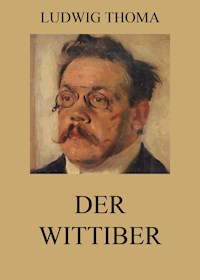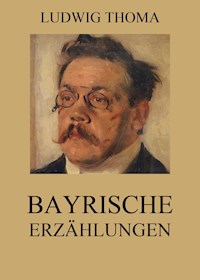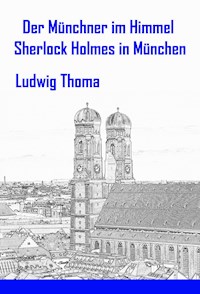Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In 'Nachbarsleute: Kleinstadtgeschichten' von Ludwig Thoma taucht der Leser ein in die Welt der bayerischen Kleinstadt, in der scheinbar gewöhnliche Nachbarn und ihre Geschichten im Fokus stehen. Thoma's literarischer Stil zeichnet sich durch eine lebendige und humorvolle Darstellung des Alltags aus, die von einem tiefen Verständnis für menschliche Natur und soziale Dynamiken geprägt ist. Das Buch, das zuerst 1909 veröffentlicht wurde, reflektiert die damalige Gesellschaft und bietet einen einzigartigen Einblick in die Mentalität der bayerischen Kleinstadt zu jener Zeit. Thoma's genaue Beobachtungen und pointierten Dialoge machen 'Nachbarsleute' zu einem zeitlosen Meisterwerk der deutschen Literaturgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachbarsleute: Kleinstadtgeschichten
Inhaltsverzeichnis
Auf dem Bahnsteig
»Es wird Herbst!« sagte Major Burkhardt und blickte den Studienlehrer fest an mit seinen furchtlosen Soldatenaugen.
Er sagte es mit Betonung, als suchte er in seinem Begleiter bestimmte Vorstellungen zu erwecken.
»Ja – – ja«, seufzte Professor Hasleitner, »es wird allmählich kalt.«
»Und ungemütlich. Kalt und ungemütlich.«
Der Major wies auf die Kastanien vor dem Dornsteiner Bahnhofe, deren gelbe Blätter sich fröstelnd zusammenkrümmten.
»Um fünf Uhr wird es Nacht. Ein schlecht geheiztes Zimmer. Eine qualmende Lampe. Die Zugeherin bringt lauwarmes Essen aus dem Gasthof. Stellt es unfreundlich auf den Tisch. Das ist Ihr Leben.«
Hasleitner hatte ins Weite geblickt, zu dem Walde hinüber, an dessen Fichten der Nebel lange Fetzen zurückließ.
Der soldatisch bestimmte Ton des pensionierten Majors weckte ihn auf.
»Wie?« fragte er.
»Ich sage, Sie müssen heiraten.«
Der alte Soldat deutete auf die tiefer gelegene Stadt, deren Häuser behaglich aneinandergerückt waren.
»Das ist das Glück!« sagte er. »Eine Frau am Herde, fleißig, um unser Wohl besorgt und stattlich.«
Er beschrieb mit der Rechten eine nach rückwärts ausbauchende runde Linie.
»Und stattlich!« wiederholte er.
Hasleitner sah, wie es weiß und grau und dick und dünn aus vielen Kaminen rauchte, und er schien die Gemütlichkeit des Anblickes zu verstehen.
In seine Augen trat ein freundlicher Schimmer, und man konnte glauben, daß er an Herdfeuer dachte, oder an die runde, sich nach rückwärts ausbauchende Linie.
Überhaupt, er war ein träumerischer Mensch.
Sorglos im Äußeren, den Hemdkragen nicht immer blendend weiß, die Krawatte verschoben, den Bart naß von der letzten Suppe, aber in den Augen Herzensgüte, im ganzen Wesen eine Verträumtheit, die immer wieder zum Nasenbohren führte.
Kein Mann, der Backfische begeistern konnte, aber einer, der älteren Töchtern hundert Dinge zeigte, die man in lieber Häuslichkeit flicken, stopfen und bürsten mochte.
Und doch – dieser Mann, geschaffen, von den Ärmeln einer bürgerlichen Schlafjacke umfangen zu werden, war durch eine seltsame Laune des Schicksals mit einer verdorbenen Phantasie belastet, also daß seine Gedanken an das weibliche Geschlecht sich stets mit Vorstellungen von Eisbärenfellen verbanden, von Eisbärenfellen, auf denen dünne, lasterhafte Beine in schwarzen Seidenstrümpfen ruhten. Noch dazu lehrte er die Wissenschaft der Geographie und stieß auf der Landkarte immer wieder auf Orte, wo seine Sinne knisternde Seide und herrlich verstöpselte Parfüms vermuten durften.
Paris – Wien – Budapest –
Ein Gefühl, das mit seiner heimlichen Sehnsucht zusammenhing, trieb ihn täglich zum Bahnhofe, wo Punkt fünf Uhr der große Schnellzug hielt, der glücklichere Menschen von einer Großstadt in die andere führte.
Hier hatte nun der quieszierte Major den Träumer angesprochen, und ein freundlicher Zufall fügte es, daß beide, als sie auf dem Bahnsteige kehrtmachten, der Gattin des Offiziers gegenüberstanden, wie auch der Tochter Elise.
In merkwürdig schnellem Gedankengange brachte der Professor das vorausgegangene Gespräch von Stattlichkeit in Zusammenhang mit der Erscheinung Elisens, und vielleicht ohne daß er es wollte, drang seine unlautere Phantasie dem älteren Mädchen durch Mantel und Rock und begann, sich Dinge auszumalen.
Freilich nicht langgestreckte, seidenumhüllte Beine, aber Rundlichkeiten, mit denen sich die Vorstellung von Wärme und Innigkeit verbindet.
Die Tochter des Majors fühlte den sengenden Blick des Philologen, und als eine reife Blume, die sie war, öffnete sie willig ihre Blätter den wärmenden Strahlen. Dieses heimliche, unbewußte Suchen und dieses bewußte Entgegenkommen spann Fäden zwischen den beiden, welche das erfahrene Mädchen bald genug aufzuspulen beschloß, und es schickte sich alsbald mit einem lieblichen Lächeln dazu an.
Freilich war dieser Professor kein Gegenstand für brennende Wünsche und verzehrende Glut, indessen wohl ein Objekt, das sich mit baumwollenen Ärmeln sanft umfangen ließ, nachdem es vorher sorgfältig gereinigt war.
Keine berauschend süße Frucht, sondern ein säuerlicher, deutscher Hausapfel, der aber, im Kachelofen gebraten, einigen Wohlgeschmack bieten konnte.
Und das Mädchen schickte sich alsbald an, den heimlichen Faden zu ergreifen, als mit dumpfem Brausen der Schnellzug in die Station einfuhr.
Die riesige Lokomotive schnaufte, als wäre sie in der langen, stürmischen Fahrt außer Atem gekommen, und die langen, schönen Wagen standen da, als ruhten sie kurze Augenblicke, um weiterzujagen in die weite Welt.
Mit einem Male hatte Hasleitner alle Gedanken an runde Mädchenreize vergessen; sie versanken vor ihm, er sah sie nicht mehr.
Dort im ersten Coupé schob eine schmale Hand den Vorhang zurück, und ein Paar müde Augen blickten entsetzt auf die Philister, hier prallte ein entzückender Kopf entrüstet zurück.
Es war die große Welt, die eine Minute lang Dornsteiner Luft einzog und Pariser Odeurs zurückgab.
Und da stand es auf weißen Tafeln und war darum kein phantastisches Märchen: Paris – Avricourt – Wien –
Ja… Ja… diese nämlichen Wagen waren gestern noch in Paris gewesen!
Jene fabelhaften Damen, von denen man sich erzählt, daß sie gierig und unerbittlich Jagd machen auf gutgebaute Männer, waren an ihnen vorbeigewandelt, hatten süße Blicke in sie hineingeworfen, und von ihrem Dufte hing etwas an Türen und Fenstern und verwirrte den Sinn eines deutschen Jugendbildners.
Wußte man, ob nicht eine solche Tigerin da drinnen auf schwellenden Polstern saß und einen breitbrüstigen Germanen mit ihren Blicken verschlang?
Odette, Suzette – Germaine – ah!
Hier steht ein Gymnasiallehrer von gänzlich unverdorbener Jugend, und der für schlanke Waden und schwarze Strümpfe die heftigsten Empfindungen angestaut hat.
Warum seufzt ihr erleichtert auf, da sich nun der Zug in Bewegung setzt?
Ihr saht erstaunt auf die Kostüme, die im Dornsteiner Atelier für modes und confection kreiert waren, ihr saht Spitzbäuche und gepreßte Busen, faltenreiche Hosen und geschmierte Stiefel, aber ihr saht nicht in das Herz des blonden Professors und wißt nicht, wie er so ganz der Eure ist!
Fort!
Die Lokomotive pfeift jubelnd aus der Station hinaus, als freute auch sie sich, diesem Nest entronnen zu sein…
Diesem Himmelherrgott…
»Warum so träumerisch?« lispelte Elise und blickte schelmisch auf den Professor, der dem Zuge nachstarrte und in der Nase bohrte.
Da traf sie ein Blick, so leer, so fremd und so feindselig…, daß sie unter dem flanellenen Höschen eine Gänsehaut überlief.
– – Der Faden war zerrissen – –
Das Begräbnis
Am Dienstag, den 3. Januar, verstarb der Realitätenbesitzer Josef Seilinger eines plötzlichen Todes.
Er war wie alltäglich beim Sternbräu zum Abendschoppen eingekehrt, trank mit sichtlichem Behagen seine drei Maß Bier und sprach sich mit gewohnter Lebhaftigkeit über die Schlechtigkeit der preußischen Zustände aus.
Um sieben Uhr verließ er die Gaststube und begab sich in die Küche, um sich von der Frau Wirtin zu verabschieden. Er wechselte einige Scherzworte mit ihr und sagte noch: »Jetzt pfüat Eahna Gott, Sie Schneckerl, Sie liab’s«, da fiel er plötzlich streckterlängs zu Boden und war maustot.
Nun lag er den zweiten Tag aufgebahrt im Prunkzimmer seiner Wohnung.
In dem frostigen, unfreundlichen Raume nahm die tiefverschleierte Witwe die Beileidsbezeugungen entgegen. Es war ein stetes Kommen und Gehen.
Die ehrsamen Bürger traten schweigend mit ihren Frauen an die Bahre.
Sie legten alle gleichmäßig die Stirne in ernste Falten, verzogen die Mundwinkel und sahen lange und ausdruckslos noch einmal in das breite Gesicht des Verblichenen.
Die Frauen drückten schluchzend die Taschentücher an ihre nassen Augen und zählten im geheimen die Kranzspenden.
Nach einer anständig bemessenen Pause traten die Besucher zu den Leidtragenden und sprachen Worte des Trostes.
»Wer hätt’ dös glaubt, Frau Seilinger? So a g’sunder Mann! Vor drei Tag hab i’n no über’n Marktplatz geh seh’gen und zu mein Mann g’sagt – gel Schorschel? – schau hi, hab i g’sagt, da geht der Herr Seilinger. Und jetzt – – a so a Mann…!«
»– – Ja, ja, der Seppl! I hätt’s a net gmoant, daß eahm so schnell derwischt, Frau Seilinger. Am letzten Sunntag san ma no so zünfti beinand g’wen, und heint liegt er do… Ja, ja, das menschliche Leben!«
»Trösten S’ Eahna, Frau Seilinger! Gunnen S’ eahm sei Ruah. Eahm is wohl! Wer woaß, was eahm alles derspart blieben is, und wia bald daß uns selber außi tragen mit di Füaß voro.«
Und wenn die trauernde Witwe zustimmend mit dem Kopfe nickte, rühmte die Frau noch die Schönheit und Zahl der Kränze.
»De vielen, vielen Kränz’ und de schönen Blumen, Frau Seilinger! Es ist doch auch a gewisser Trost, wenn ma siecht, wia oan de Leut in Ehren halten! So was muaß noch gar net dag’wesen sein.«
Dann blickten die Besucher der Witwe noch einmal tieftraurig in die Augen und machten anderen Platz.
Draußen bemerkte die Frau flüsternd: »Hast a’s g’sehg’n, Schorschl? Mit dera Trauer is a net weit her. Grad drucka hat s’ müassen, daß s’ a paar Thräna außerbracht hat. Und den Aufwand! An glatten Kaschmirrock mit Schürzendraperie und Krepp de schin-Ausputz, a g’schweifte Schoßtaille mit an Latzteil, und am Rand matte Holzperlen. Statt a Schneppenhauben hat s’an Kapothuat mit an schwarzen Bleamelbukett, und den Schloar!«
»Na! Na! I woaß net, daß de Leut koa rechts G’fühl nimma ham. Da guat Seilinger wenn s’ sehg’n tat, wia s’ dasteht, nacha drahet er si um.«
Im Treppenhause war die Leichenfrau mit den Zurüstungen für die Einsegnung beschäftigt; sie zündete die Kerzen an, stellte das Weihwasser zurecht und wies die Ankommenden in das Trauerzimmer.
Ihre Miene war dem Ernste ihres Berufes angemessen, und nur flüsternd führte sie die Unterhaltung mit diesem und jenem Trauergaste.
»Geln’s, der Herr Seilinger? Aba schö liegt er drin, koa bissel entstellt! So sanft! Grad als wenn er schlafen tat. So a g’sunder Mann und so plötzli schterben! I sag Eahna, was der Herr für a G’wicht g’habt hat, des is net zum glauben! Der muaß im Leben alleweil seine guaten dritthalbe Zentner g’wogen ham. I hab zerscht gmoant, i kunnt’n alloa daheben beim Anziagn, aber da is koa Drodenka net g’wen. Erscht wia mir die Binder Cenzl g’holfen hat, is ganga. Cenzl, hab i g’sagt, paß auf, sag i, daß ma’n schö hinleg’n, hab i g’sagt…« Die Leichenfrau wurde unterbrochen durch das Herannahen der Geistlichkeit, welche die Zeremonie begann.
Eintönig hallten die tiefen Stimmen der singenden Priester durch den kalten Gang, und süßlicher Weihrauchduft füllte das Haus.
Vor demselben hatten sich nunmehr alle versammelt, welche dem Toten das letzte Geleit geben wollten.
Alle Vereine, denen Josef Seilinger angehört hatte, waren vertreten. Die Liedertafel, die Schützengesellschaft, der Tarockklub, die Freiwillige Feuerwehr, der Veteranenverein und der Velozipedklub.
Zum Zeichen der Trauer waren die Fahnen umflort wie die Schärpen der Fahnenjunker.
Mit finsterem Ernste blickten die Männer unter den hohen Zylindern hervor; ihnen gegenüber, durch die Straße getrennt, stand die schwarzgekleidete Schar der Frauen.
Die Blicke aller waren auf das Tor gerichtet, aus dem jetzt schwankend unter der Last des Sarges die Leichenträger schritten, gefolgt von der Geistlichkeit und den Hinterbliebenen.
Die Fahnenträger schlossen sich an, dann die Trauergesellschaft in hergebrachter Ordnung.
In langer, krummer Linie schlich der schwarze Zug durch die schneebedeckten Straßen; an den Fenstern lugten hinter den Vorhängen die alten Leute und Kinder heraus; die kleinen Häusler und Taglöhner standen vor ihren Hütten und entblößtem ehrfürchtig die Häupter zum letztenmal vor dem dicken, reichen Josef Seilinger.
Die Bürger aber kürzten sich den Weg mit Gesprächen über das traurige Ereignis.
»Ja, schnell hat’s ‘n g’rissen. Wer hätt’ dös glaubt? Woaßt as no, Franzl, wia ma vorig’s Jahr in Hausham beim Bierletzt g’wen san? I und da Reitmoar und du und da Seilinger? Wia ma z’letzt allsam so b’suffa g’wen san, daß ins s’Bier bei die Augen außa grunna is?«
»Freili woaß i’s no. Wia nacha da Seilinger aufg’standen is und hat mit da Faust in Tisch einig’haut. Herrgottsakra, hat a g’schriean, trink ma no a Maß, ös Fretter ös miserablige! I trink Enk allsamt untern Tisch eini. Und g’rad schnackerlfidel is er g’wen.«
»Ja, da hätt aa koa Mensch net denkt, daß er so bald ei’liefert. Man hat eahm nix okennt.«
»No, no, woaßt, Franzl, dös viele Saufen ko net guat sei. Er hat scho a bisl gar z’naß g’fuattert.«
»Dös is wahr. Du, wo geh’ ma denn danach hi?«
»I moa halt zum Stembräu. Spiel ma an Tarock, da Weißlinger tuat aa mit. Gell Schorschl?«
»Ja, is ma grod recht… Bst! Bst!«
Man war vor dem offenen Grabe angelangt. Als unter den üblichen Zeremonien der Sarg versenkt war, entblößte der Pfarrer das Haupt und sprach:
»Andächtige Trauerversammlung! Wir stehen vor dem offenen Grabe des tugendsamen Josef Seilinger, bürgerlichen Realitätenbesitzers dahier. Er ist geboren am 10. Oktober 1854, als der Sohn des Realitätenbesitzers Josef Seilinger und dessen Ehefrau Brigitta, und starb am 3. Januar 1899. Sein Leben war vergleichbar einem Strome, der ruhig dahinfließet. In seiner Jugend besuchte er drei Lateinklassen mit großem Erfolge, wie durch das Zeugnis seiner Lehrer bestätigt wird. Alsdann zog er sich in sein elterliches Haus zurück und verblieb daselbst bis zu seinem Lebensende.
Im Jahre 1879 vermählte er sich mit Fräulein Marie Hitzinger, Brauereibesitzerstochter von hier, welche heute als trauernde Witwe in das Grab blicket. Der glücklichen Ehe entsprossen drei Kinder.
So, geliebte Christen, ist seine Laufbahn ein Beispiel und eine Lehre für alle. Er war aber auch ein ordnungsliebender Bürger und ein gläubiger Katholik. Er war nie ein Zweifler, und der neue Geist, welcher jetzt so böse in der Welt umhergeht, hat ihn nicht beschädiget.
Darum dürfen wir hoffen, daß er trotz seines schnellen Endes die Seligkeit erworben habe. Amen!«
Hier wollte der Gesangverein einfallen mit dem Liede: ›Seht, wie sie so sanft ruhen.‹ Aber nach den ersten Tönen brachen die Sänger ab; eine auffallende Bewegung ging durch die Reihen, und nach einer drückenden Pause trat der Vorstand an das Grab und erklärte, daß der Gesang infolge Unwohlseins einiger Mitglieder nicht stattfinden könne.
Damit war auch die Feierlichkeit zu Ende. Die Trauergäste entfernten sich rasch und besprachen mißbilligend das letzte Vorkommnis.
»Da sieht ma’s wieda, unsa Liadertafel. Bal ma sei Ruah haben möcht im Wirtshaus, nacha plärren s’ in oan Trumm, oan faden G’sang nach dem andern. Bal ma s’aba braucht, ham S’ koa Stimm’. I möcht bloß wissen, was da dahinter steckt.«
Die Neugierde wurde bald befriedigt, denn der Vorstand erzählte beim Sternbräu jedem, daß der erste Bassist, der Schreinermeister Bergmann, sich geweigert habe, zu singen.
»Und wissen S’, warum, meine Herren? Weil d’Frau Seilinger an Sarg net bei eahm hat macha lassen. I hab bitt und bettelt, daß er uns de Blamasch net atoa soll. Nix hat’s g’holfen. ›Fallt ma gar net ein‹, sagt er, ›braucha de Protzen mein Sarg net, braucha’s mei Stimm’ aa net.‹ Was sagen S’ da dazu, meine Herren?«
»Ja no!«
Junker Hans
Eine Kleinstadtgeschichte
Wie es gekommen war, ob Herr Pfaffinger höflich oder in barschem Tone das Schließen der Türe verlangt, ob Herr Tresser nach dieser Aufforderung erst recht die Türe aufgerissen, ob Herr Pfaffinger in rüder Weise sie dann ins Schloß geworfen hatte und hierauf von Herrn Tresser als ungebildeter Lümmel bezeichnet wurde, während Herr Pfaffinger diesen, Herrn Tresser nämlich, mit dem Worte Lauskerl schon vorher betitelt hatte, läßt sich aus den erregten Schilderungen der angesehenen Bürger Dornsteins nicht unwiderleglich feststellen, – Tatsache ist, daß Herr Tresser Herrn Pfaffinger einerseits an der Gurgel packte, während Herr Pfaffinger andererseits diesem, dem Herrn Tresser nämlich, eine derart schallende Ohrfeige versetzte, daß der Schlag sogar in den hintersten Sitzreihen des Höllbräusaales vernommen wurde.
Von vielen Zeugen des Vorfalles wird erzählt, daß die Tochter des Herrn Magistratsrates Trinkl, Fräulein Fanny Trinkl, über Zugluft geklagt habe, was den neben ihr sitzenden Brauereivolontär Pfaffinger veranlaßte, aufzuspringen und die Saaltüre zu schließen, worauf Herr Rechtspraktikant Tresser dieselbe sogleich wieder öffnete, sei es nun, weil er und einige mitanwesende Beamte es zu heiß fanden, sei es, weil er über die eigenmächtige Handlung des Herrn Pfaffinger entrüstet war, was aber wiederum diesem, Herrn Pfaffinger, als eine Beleidigung seiner Dame erscheinen mußte, so daß er sich zu einem Schimpfworte hinreißen ließ, wobei freilich nicht bestimmt behauptet werden kann, daß nicht etwa Herr Tresser schon vorher den Ausdruck ungebildeter Lümmel gebraucht hatte, kurz und gut, was hier auch übereinstimmend oder verschieden berichtet wird, – Tatsache ist, daß Herr Pfaffinger von Herrn Tresser an der Gurgel gefaßt wurde, und daß dann Herr Tresser eine dermaßen starke Ohrfeige erhielt, daß seine linke Wange anschwoll.
Mir war und ist es nur darum zu tun, eine vollkommen wahrheitsgetreue Schilderung des Herganges zu geben, wobei ich keineswegs, wie Herr Magistratsrat Trinkl, das Verhalten des Herrn Pfaffinger oder, wie Herr Sekretär Hundertkäs, das Benehmen des Herrn Tresser als absolut berechtigt hinstelle, sondern ich möchte ausschließlich die Tatsache klarstellen, daß Herr Tresser einerseits Herrn Pfaffinger körperlich anfiel, während Herr Pfaffinger andererseits diesem eine wuchtige Maulschelle applizierte.
Das Geschehnis läßt sich weder leugnen noch beschönigen, noch auf irgendeine Weise aus der Welt schaffen, und es ist weiter nichts zu erörtern als die Frage, welche Folgen die Mißhandlung eines den besseren Kreisen angehörigen Mannes haben konnte.
In der Tat wurde der Vorfall auch von den bürgerlichen Elementen nach Verlassen des Höllbräusaales lebhaft erörtert, und Bäckermeister Schwarz bewies vielleicht die größte Heftigkeit der Gesinnung.
»Also mir… net… also mir bal oana so was saget… net… also ung’hobelter Lackel oder so was… net… also i… mei Liaba… i den bei de Ohrwaschel nehma und beuteln… hast doch’ g’hört… und nacha oani links und oani rechts abahau’n… vastehst… und nacha no a paar… also mir bal oana kam! Was? sag i… an ung’hobelter Lackel bin i… moanst du vielleicht, weil di dei Vata studieren hat lass’n… derfst du an Bürgersmann, der wo seine Steuern zahlt… net… und wo seine Familli rechtschaff’n ernährt… schimpf’n… sag i… Wer is ung’hobelt? sag i… vielleicht net a Beamta, der sie a so aufführt? Was bin i? A Lackel bin i? Hab Eahna i scho amal an Lackel abgeb’n? Han? Du Herrgottsakrament! sag i. Da hast a paar! sag i…«
»Plärr do net a so!« rief Magistratsrat Trinkl… »Bleib’n ja d’Leut steh’ und schaug’n…«
»Ja no… muß ma si so was hoaß‘n lass’n«?
»Zu dir hat er nix g’sagt!«
»Dös is sei Glück, mei Liaba… mir bal er so was saget! Also den schlaget i sei Batterie scho a so her, daß er alle Engel pfeif’n hörat… Ung’hobelter Lackel möcht er an Bürgersmann hoaß‘n… so a Schreiberg’sell, so a notiger, der wo si net amal was G’scheits z’fress’n kaff’n ko… Dir gib i scho an Lackel… also bloß sag’n braucht er’s zu mir… nix als wia sag’n… sag’ i«
»Mir g’fallt de G’schicht garnet… dös… dös… ich woaß net… da derleb’n mir no was!« sagte der Gold-und Silberarbeiter Elfinger und machte ein bekümmertes Gesicht… »De G’schicht is no net firti…«
»Was is net firti?« fragte Trinkl.
»Ja… dös mit dera Schell’n….
»Dös is allerdings firti. Der hat sei Fotz’n, und gar is…«
»Wer’n ma’s sehen, ob die Sache so einfach verläuft, also gewissermaßen im Sande«, erwiderte Elfinger, der nicht ungerne hochdeutsch sprach.
»Was will er denn mit a Klag?« höhnte Magistratsrat Trinkl.
»Bal er z’erscht ‘s Maul aufreißt, net, und ganz ordinär werd’… und nacha auf’s G’richt laff’n! Na, mei Liaba!«
»G’richt laufen!«
»Ja… da werd halt ‘s G’richt sag’n, Herr Rechtspraktikant, werd’s sag’n, bald Sie eine würkliche Bildung besitzen, dürfen Sie nicht anfangen und die Leute aufreizen, und bald Sie aber die Leute aufreizen, müssen Sie Ihnen halt diese Behandlung gefallen lassen. A so red’t ‘s G’richt! Vastand’n?«
»Ich rede ja überhaupts nicht vom Gericht«, sagte Elfinger etwas ungeduldig.
»Net?«
»Nein… durchaus nicht. Das weiß man doch, daß diese Herren… also… die wo auf der Universität studiert haben… eine Ohrfeige durchaus nicht hinnehmen dürfen wie unsereiner…«
»Geh! Hör’ auf!«
»Nein! Das lest man doch in der Zeitung, daß für solchene Herren eine Ohrfeige sozusagen eine tödliche Beleidigung ist, und auch bald sie nicht wollen, müssen sie doch, indem es ein Ehrenstandpunkt ist…«
»Geh! Hör’ auf!«
»Na, frag’ halt Leut’, die ‘s wissen! Ob eine Ohrfeige nicht mit Blut abgewaschen werden muß, und bald der Betreffende auch vielleicht nicht will…«
»Jetzt muaß i scho sag’n… Elfinger… red’ net gar so saudumm daher!«
»Ich rede durchaus nicht saudumm daher… und überhaupts möchte ich mir das verbitten… net wahr…«
»Kam er da mit’n Bluat o’wasch’n… und solche Sprüch!«
»Weil es wahr ist! Jawohl! Wenn einer natürlich seiner Lebtag in Dornstein hockt als Lebzelter, weiß er nicht, wie solche Vorkommnisse sich auswachsen…«
»O mei! Da balst net gehst!…«
»Ich war dritthalb Jahr in Erlangen, mein Lieber, wo sich eine Universität befindlich ist, und bald du das nicht woißt, kannst es ja nachles’n im Sulzbacher Kalender…«
»I huast dir auf dei Universität!«
»Das ist die Sprache der Ungebildeten… das kann ich dir sagen…«
»Han?«
»Jawohl! Da muß man einmal in der Welt herumgekommen sein, dann schaut man die Sache etwas anders an. Ich hab viel erlebt in dieser Beziehung, und bald ein Student dem anderen eine Ohrfeigen gibt, diese Fälle kenn’ ich, und da entscheidet dann das Ehrengericht, ob dieser Betreffende nicht mit der Pistole in der Hand Rechenschaft verlangen muß…«
»Herrgottsakrament, jetzt sag’ i s’ nomal, a so a spinnata Tropf is ma do aa no net fürkemma…«
»Da spinnt niemand!«
»Net z’ weni, sag’ i…«
»Nein! Durchaus nicht! Das ist der Standpunkt der Satisfaktion, wennst d’ scho amal was g’hört hast von dem!…«
»Da müaßt da Schorschl…?«
»Jawohl!!«
»Da müaßt da Pfaffinger Schorschl si vo an so an notinga Hanswurscht’n nauf schiaßn lass’n?«
»Jawohl!! Das heißt, in dieser Beziehung weiß ja der Betreffende nicht, ob ihn das Schicksal trifft, und äh…«
»Da Pfaffinger Schorschl, der in a paar Jahr de Brauerei von sein Vata kriagt mit achtavierz’g Wirt… und…«
»Was hat denn das damit zu tun…«
»Und dös schöne Sach in Matzing drauß‘n… langa koane vierhundert Tagwerk…«
»… Also…«
»Und a Stuck an achtz’g Küah im Stall… der soll si…? Geh! Wia no a Mensch so daher red’n ko!«
»Wenn du oan net red’n laßt und all’s besser woaßt, na brauch ja i net red’n«, schrie Elfinger, den der Zorn wieder ins Altbayrische brachte.
»Für dös Red’n kriagst d’ nix«, erwiderte der Herr Magistratsrat Trinkl mit gleichfalls erhobener Stimme. »Kam er do mit sein Student’nschmarr’n daher! A Duwäl! Ah! Ah! da kunnt’st scho Grean Baamwirt wer’n!«
»Wenn er an Ehr im Leib hat… vastehst!«
»An Ehr! Woaßt, was da Pfaffinger Schorschl hat? An Diridari hat a! Maxi hat a! Und auf dei Ehr is…«
»Mit dir ko ma net streit’n; dös woaß ma scho! Weil du a Hammi bist!«
»I?«
»Ja du! Für dös bist du bekannt in ganz Dornstoa!«
»Ah! Der is guat! Was bist na du?«
»Is scho recht!«
»Was bist na du? A spinnata Deifi bist d’. Mit’n Bluat o’wasch’n kam er daher! Wasch da du ‘s Hirn mit Salmiak, dös werd g’scheiter sei!«
»Sie sind ein ordinärer Mensch, Herr Trinkl! Ich verkehre nicht mehr mit Ihnen…«
»Bleib’ halt weg, spinnata Deifl! Spinnata!«
Herr Elfinger hatte sich mit raschen Schritten entfernt und war schon in der Dunkelheit entschwunden, da schrie ihm Herr Trinkl noch durch die hohlen Hände nach: »Druck di, du Hanswurscht, mit dein Duwäl!«
Und zum Bäckermeister Schwarz sich noch immer erregt wendend, fragte er: »Hast d’ scho amal so was Dumm’s g’hört? Der bracht’s außa, als wenn da Pfaffinger Schorschl so a Karmenadlstudent waar!«
»I hab’n net recht vastand’n«, sagte Herr Schwarz. »Moant er, daß de mit’n Sabl da so aufanand trischak’n müaßt’n?«
»Oder schiaß‘n, vastehst? Mit da Pistol’n! Der Pfaffinger Schorschl werd si von so an Hungerleider aufi schiaß‘n lass’n. Dös kost da denk’n!«
»Als der oanzige Sohn vom Danglbräu in Matzing!« rief Bäckermeister Schwarz voll Hohn aus, denn auch er hatte sogleich die ganze Lächerlichkeit dieses Gedankens erfaßt.
»Also mir sollt oana mit so a’ra Duwälforderung kemma!« setzte er hinzu. »Grad kemma sollt oana! Was? sag i… fordern möcht’n Sie mi? Auf was denn, sag i… und an Schiaßa fürag’langa hintern Bachofa und den am Kopf aufi hau’n mit da Pretsch’n… vastehst… daß er drei Tag lang auf alli vieri umanandkriachat… fordern möcht er mi… so waar’s recht! Fordern! An Bürger aa no koan Ruah lass’n mit dena Duwälg’schicht’n! I tat an Nudelwalgla nehma und den aba scho so umanandlass’n… da hast dei Duwäl! sag i… und hau eahm oani über sein Gipskopf umi, daß er grad staubet… da… sag i… und da… hast d’ no oani…«
»Herrgott! Gib do acht! Haut er mir an Huat aba!« schrie Trinkl.
»Muaßt scho entschuldinga… aba da kunnt’st scho belzi wer’n… net… bal oan so was unterkimmt… Fordern möcht oan der Schreiberg’sell…«
Und man hörte noch lange ihre erregten Stimmen, da sie den Stadtplatz mehrmals hinauf und wieder herunter gingen.
»Sie san aber einer!« lispelte Fräulein Fanny Trinkl, als sie in Gesellschaft des Herrn Pfaffinger den Höllbräusaal verließ.
Der stattliche Brauereivolontär warf sich in die Brust und sagte mit geheucheltem Gleichmute: »Da gibt’s bei mir nix!«
»Ich bin so derschrocken, wie Sie auf einmal aufg’sprungen sind. Jessas Maria! hab ich mir denkt, es werd doch kein Unglück geb’n, daß er Ihnen was tut…«
»Der – mir?«
»Man weiß halt oft nicht…«
Herr Pfaffinger schob den Hut verwegen aus der Stirne.
»Solchene derfen drei daherkemma, nacha fürcht’ i s’ aa no net.«
Das üppige Mädchen sah bewundernd zu dem Ritter auf, der sich kraftvoll in den Hüften wiegte und mit den Fingern schnalzte, gleichsam um zu beweisen, wieviel ihm an einer ganzen Schar von Gegnern läge.
Fannys rehbraune Augen trafen sich mit seinen etwas hervorquellenden wasserblauen und senkten sich sofort, indessen sie wiederum rief: »Nein, Sie sind aber einer!«
Offenbar hegte Herr Pfaffinger die gleiche günstige Meinung von sich; denn sein ganzes Gebaren verriet, daß er mit der Bewunderung seiner Persönlichkeit beschäftigt war.
»Ich hätt’ mir gar nicht denkt, daß Sie so heftig sein können…«, sagte Fräulein Fanny.
»Ja, da kenn i nix.«
»Wie Sie den Stuhl z’ruckg’stössen haben, und auf und hin…«
»Da gibt’s koana Würschtel!…«
»Und wie Sie ihm eine hing’haut haben, daß‘s ihn gleich draht hat!«
Wieder gingen sie eine Weile schweigend nebeneinander, und indessen Herr Pfaffinger beim Schein einer Straßenlaterne respektvoll seine große Hand betrachtete, huschten Fannys Blicke wieder beifällig über ihn hin. Schön war er nicht –
Ein gewissermaßen viereckiger Kopf auf einem kurzen Halse; eine stumpfe Nase, dicke Lippen, die sich nicht ganz schlossen, so daß man die unregelmäßigen Zähne sah, der Teint von jener biersäuerlichen Blässe, wie sie Schenkkellnern und Bräuburschen eigen ist… All das ließ den Pfaffinger Schorschl nicht gerade als verführerisch erscheinen, und doch besaß er Reize, die ein altbayrisches Mädchen, wenn auch noch so flüchtig, wohl bemerken konnte.
Derbe Rundungen und Breiten und Grobschlächtigkeiten, die vielverheißend waren.
»Eigentlich san S’ wegen meiner in die G’schicht nein kommen, weil ich mich beschwert hab’, daß die Tür offen war, und mich hat’s nachher schon g’reut…«
»Da braucht Ihnen nix reu’n, Fräulein Fannerl…«
»Aber do, wenn S’ jetzt solchene Unannehmlichkeiten hamm…«
»Dös is mir ganz egal…« Schorschl sagte wirklich egal… »Bald ich amal bei einer Dame sitz… nacha muß ich auch für die Dame eintreten…« Ein zärtlicher Blick traf ihn, und seine wasserblauen Augen streiften wohlgefällig über den sehr stattlichen Busen des Mädchens und blieben daran haften.