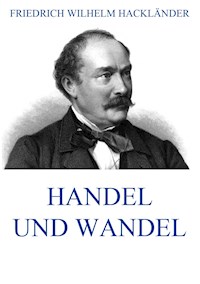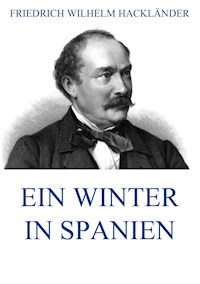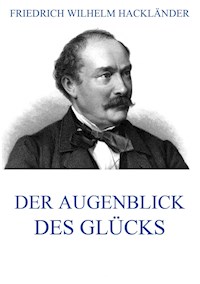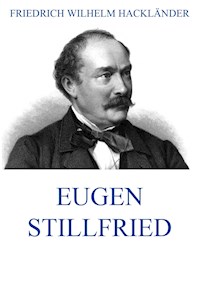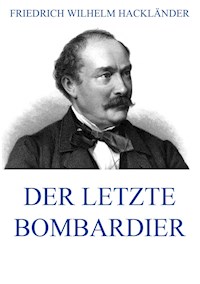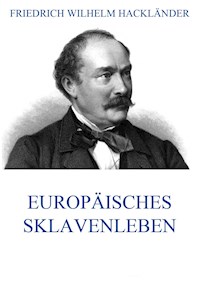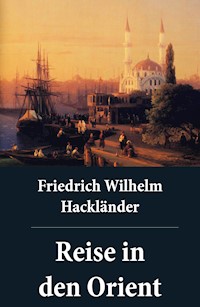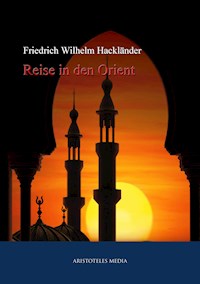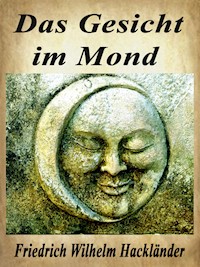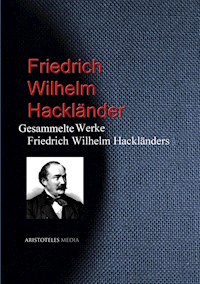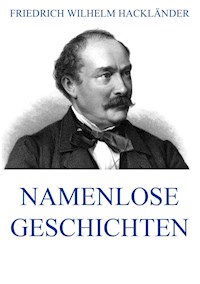
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den "Namenlosen Geschichten" zeigt Hackländer anhand der kleinen Maria das Schicksal der Frauen auf, die sich um das Öl für die Beleuchtung der Stadt kümmern müssen. Bereits in Armut lebend treibt sie die Umstellung auf die moderne Gasbeleuchtung immer weiter in ein Leben am Rande des Existenzminimums.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Namenlose Geschichten
Friedrich Wilhelm Hackländer
Inhalt:
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Namenlose Geschichten
Erstes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Zweites Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Drittes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Viertes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Fünftes Kapitel. Ein Bürgerball und seine Folgen.
Sechstes Kapitel. Ein Bürgerball und seine Folgen.
Siebentes Kapitel. Aus dem Marstall.
Achtes Kapitel. Aus dem Marstall.
Neuntes Kapitel. Vor dem Hofball.
Zehntes Kapitel. Aus dem Marstall.
Eilftes Kapitel. Ein Hofball und seine Folgen.
Zwölftes Kapitel. Aus dem Kutscherzimmer.
Dreizehntes Kapitel. Ein Hofball und seine Folgen.
Vierzehntes Kapitel. Elstergasse Numero vierundvierzig.
Fünfzehntes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Sechzehntes Kapitel. Ein Bürgerball und seine Folgen.
Siebenzehntes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Achtzehntes Kapitel. Im Hoftheater.
Neunzehntes Kapitel. Ein erstes Debut.
Zwanzigstes Kapitel. Thauwetter und Frühlings-Anfang.
Einundzwanzigstes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Anna.
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Ein Bürgerball und seine Folgen.
Vierundzwanzigstes Kapitel. Ein neuer Tänzer.
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Die Flucht.
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Das Ende des Traumes.
Siebenundzwanzigstes Kapitel. Aus dem Marstall.
Achtundzwanzigstes Kapitel. Aus dem Marstall.
Neunundzwanzigstes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Dreißigstes Kapitel. Das Ende des Traumes.
Einunddreißigstes Kapitel. Ein Hofball und seine Folgen.
Zweiunddreißigstes Kapitel. Alfred's Erzählung.
Dreiunddreißigstes Kapitel. Ein Hofball und seine Folgen.
Vierunddreißigstes Kapitel. Elstergasse Numero Vierundvierzig.
Fünfunddreißigstes Kapitel. Im Hoftheater.
Sechsunddreißigstes Kapitel. Ein Bürgerball und seine Folgen.
Siebenunddreißigstes Kapitel. Aus dem Marstall.
Achtunddreißigstes Kapitel. Eine Hochzeit ohne Geläute.
Namenlose Geschichten, F. W. Hackländer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849626808
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Wilhelm Hackländer – Biografie und Bibliografie
Roman- und Lustspieldichter, geb. 1. Nov. 1816 in Burtscheid bei Aachen, gest. 6. Juli 1877 in seiner Villa Leoni am Starnberger See, widmete sich, früh verwaist, 1830 dem Kaufmannsstand, trat nach zwei Jahren bei der preußischen Artillerie ein, kehrte aber, da ihm der Mangel an Vorkenntnissen die Aussicht auf Avancement verschloß, zum Handelsstand zurück. Das Glück lächelte ihm indes erst, als er sein frisches Erzählertalent mit »Vier Könige« und »Bilder aus dem Soldatenleben« (Stuttg. 1841) geltend zu machen begann. Die auf eignen Erlebnissen beruhende Wahrheit und der liebenswürdige Humor dieses Büchleins, dem später die weitern Skizzen »Das Soldatenleben im Frieden« (Stuttg. 1844, 9. Aufl. 1883) folgten, erregten allgemeine Aufmerksamkeit und verschafften H. insbes. die Zuneigung des Barons v. Taubenheim, der ihn zum Begleiter auf seiner Reise in den Orient (1840–41) wählte. Deren literarische Früchte waren: »Daguerreotypen« (Stuttg. 1842, 2 Bde.; 2. Aufl. als »Reise in dem Orient«, 1846) und der »Pilgerzug nach Mekka« (das. 1847, 3. Aufl. 1881), eine Sammlung orientalischer Märchen und Sagen. Durch den Grafen Neipperg dem König von Württemberg empfohlen, arbeitete H. einige Zeit auf der Hofkammer in Stuttgart und wurde im Herbst 1843 zum Sekretär des Kronprinzen ernannt, den er auf Reisen und 1846 auch zu seiner Vermählung nach Petersburg begleitete. Im Winter 1849 aus dieser Stellung entlassen, begab er sich nach Italien, wo er im Hauptquartier Radetzkys dem Feldzug in Piemont beiwohnte, war darauf im Hauptquartier des damaligen Prinzen von Preußen (spätern Kaisers Wilhelm I.) Zeuge der Okkupation von Baden und nahm dann in Stuttgart seine schriftstellerische Tätigkeit wieder auf. 1859 wurde er vom König Wilhelm von Württemberg zum Direktor der königlichen Bauten und Gärten ernannt, begab sich noch in demselben Jahr, bei Ausbruch des italienischen Krieges, auf Einladung des Kaisers Franz Joseph in das österreichische Hauptquartier nach Italien, wo er bis nach der Schlacht bei Solferino blieb, und wurde 1861 für sich und seine Nachkommen in den österreichischen Ritterstand erhoben. Beim Regierungsantritt des Königs Karl (1865) plötzlich seines Amtes enthoben, lebte er seitdem abwechselnd in Stuttgart und in seiner Villa Leoni am Starnberger See. Die literarische Tätigkeit hatte H. während seiner verschiedenen amtlichen Obliegenheiten und Reisen eifrig fortgesetzt; aus der Teilnahme am piemontesischen Feldzug Radetzkys und der Belagerung von Rastatt im Sommer 1849 erwuchsen die »Bilder aus dem Soldatenleben im Krieg« (Stuttg. 1849–50, 2 Bde.); den »Wachtstubenabenteuern« (das. 1845, 3 Bde.; 6. Aufl. 1879), den »Humoristischen Erzählungen« (das. 1847, 5. Aufl. 1883) und »Bildern aus dem Leben« (das. 1850, 5. Aufl. 1883) folgten größere humoristische Romane: »Handel und Wandel« (Berl. 1850, 2 Bde.; 3. Aufl., Stuttg. 1869), voll ergötzlicher Reminiszenzen aus seiner kaufmännischen Lehrzeit, »Namenlose Geschichten« (das. 1851, 3 Bde.) und »Eugen Stillfried« (das. 1852, 3 Bde.). Hackländers Lustspiel »Der geheime Agent«, bei der von Laube 1850 ausgeschriebenen Konkurrenz mit einem Preis gekrönt (3. Aufl., Stuttg. 1856), wurde auf allen deutschen Bühnen mit Erfolg ausgeführt, auch mehrfach übersetzt. Weniger Glück machten: »Magnetische Kuren« und die Possen: »Schuldig« (1851), »Zur Ruhe setzen« (1857) und »Der verlorne Sohn« (1865). Geteilten Beifall fand sein Roman »Europäisches Sklavenleben« (Stuttg. 1854, 4 Bde.; 4. Aufl. 1876). Mit den »Soldatengeschichten« (das. 1854, 4 Bde.) begann eine gewisse Vielproduktion, in der Wiederholungen unvermeidlich waren, und die zuletzt in manieristische Flüchtigkeit auslief. Wir nennen noch: »Ein Winter in Spanien« (Stuttg. 1855, 2 Bde.), das Resultat einer 1853 nach Spanien unternommenen Reise; »Erlebtes. Kleinere [595] Erzählungen« (das. 1856, 2 Bde.); »Der neue Don Quixote« (das. 1858, 5 Bde.); »Krieg und Frieden« (das. 1859, 2 Bde.); »Der Tannhäuser« (das. 1860, 2 Bde.); »Tag und Nacht« (2, Aufl., das. 1861, 2 Bde.); »Der Wechsel des Lebens« (das. 1861, 3 Bde.); »Tagebuchblätter« (das. 1861, 2 Bde.); »Fürst und Kavalier« (das. 1865); »Künstlerroman« (das. 1866); »Neue Geschichten« (das. 1867); »Hinter blauen Brillen«, Novellen (Wien 1869); »Der letzte Bombardier«, Roman (Stuttg. 1870, 4 Bde.); »Geschichten im Zickzack« (das. 1871, 4 Bde.); »Sorgenlose Stunden in heitern Geschichten« (das. 1871, 2 Bde.); »Der Sturmvogel«, Seeroman (das. 1872, 4 Bde.); »Nullen«, Roman (das. 1873, 3 Bde.); »Verbotene Früchte« (das. 1878, 2 Bde.); »Das Ende der Gräfin Patatzky« (das. 1877); »Reisenovellen« (das. 1877); »Residenzgeschichten« (das. 1877); »Letzte Novellen«, mit seinen ersten literarischen Versuchen (das. 1879) etc. Eine Gesamtausgabe seiner Werke erschien Stuttgart 1855 bis 1874, 60 Bde. (neuer Abdruck 1876); eine Auswahl in 20 Bänden 1881, seitdem auch in illustrierten Ausgaben. Auf journalistischem Gebiet begründete H. 1855 mit Edm. Höfer die »Hausblätter« und 1859 mit Edm. Zoller die illustrierte Wochenschrift »Über Land und Meer«. H. zeigte sich in seinen literarischen Produktionen als eine gesunde und frisch genießende Natur von großer Welt- und Menschenkenntnis, soweit es sich um die Beobachtung der äußerlichen Weltzustände und der äußerlichen Charaktere handelt. Unter seinen größern Romanen zeichnen sich besonders die »Namenlosen Geschichten« und »Eugen Stillfried« durch die Frische aller Farben, die seltene Lebendigkeit der Erzählung vorteilhaft aus. Der Humor Hackländers ist vorwiegend harmlos und gutmütig; nur in einzelnen Romanen, wie im »Europäischen Sklavenleben«, spitzt er sich tendenziös zu. Aus seinem Nachlaß erschien eine interessante Selbstbiographie: »Der Roman meines Lebens« (Stuttg. 1878, 2 Bde.). Vgl. H. Morning, Erinnerungen an Friedr. Wilh. H. (Stuttg. 1878).
Namenlose Geschichten
Erstes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Es mag wohl manchem unserer Leser ergehen wie uns, daß er sich nämlich beim Anblick alter, zumal verfallener Gebäude und bei Spaziergängen auf wüsten Plätzen, die früher von einiger Bedeutung waren, unwillkürlich aber gern der Vorzeit erinnert, welche jene alten halbverfallenen Gelände bevölkerte und in glänzenden Gewändern voll Lust und Freude über die jetzt so öden Plätze dahinschritt. In unserer Umgebung, und wohnten wir auch in der kleinsten Stadt, ist so Manches, das durch sein Aussehen fremdartig in unser Leben hereinblickt. Sind es nicht alte Schlösser, welche Kunst und Fleiß der Vorfahren mit riesenhaften, reichverzierten Thorwegen, mit Statuen und Sculpturen aller Art geschmückt, so ist es ein einsamer Marktbrunnen mit Röhren in Gestalt fabelhafter Unthiere, aus denen das Wasser sprudelt, oder eine alte Rittergestalt, die sonderbar lächelnd auf die neue Generation herabblickt, welche sie umgibt und nicht selten ebenso verwundert hinaufschaut. Die alten Häuser rings um den Brunnen sind dieselben geblieben, und an hohen Giebeln hängen in den willkührlichsten Gestalten allerlei Dachrinnen-Thiere, die so häßlich, wie sie der Künstler geschaffen, nie existiren konnten; die Kirchthurm-Uhr hat denselben bekannten Klang, wie vor vielen hundert Jahren, nur ist sie vor Alter etwas heiser geworden; die Thüren da unten öffnen sich auf dieselbe Art wie früher, und die Bewohner der Häuser kommen nach wie vor aus denselben heraus, aber der alte Ritter da oben auf dem Brunnen sieht mit jedem Jahrzehnd das Aeußere dieser Menschen wechseln. Und wie hat sich dasselbe gar geändert seit der Zeit, wo er von seinem Piedestal herabsteigend, ohne viel Aufsehen zu erregen, unter ihnen hatte herwandeln können!
Es ist aber nichts so geeignet, dergleichen Phantasien Raum zu geben, wie die Zeit der stillen Mitternacht, wo die Straßen leer, die Häuser geschlossen sind; nichts ist dann hörbar, als das Rauschen der Brunnen, und diese rieselten damals gerade so wie heute, in derselben Gestalt, mit demselben Ton.
An das Portal eines alten Hauses gelehnt und an dem großen, mit Eisen beschlagenen Thor desselben lauschend, ist man leicht versucht, zu glauben, drinnen erhebe sich das alte, lustige Leben und versage die neue nüchterne Zeit mit ihren frostigen, poesielosen Gestalten. Dumpf wirbeln die Pauken, der Baß reißt gellend den Takt in das wirre Tongemälde einer lustigen Tanzmusik, Gläser klirren, und der Thorweg ist mit Dienern aller Art angefüllt, welche Fackeln tragen, um ihre Herrschaft nach Hause zu begleiten. Jetzt öffnen sich geräuschlos die Flügel des großen Thors, und die Treppe herab wimmelt der glänzende Zug der Gäste, die das gastliche Haus verlassen; Fackelglanz und Kerzenschimmer erhellen die gewölbten Vorhallen und schimmern auf Gold- und Silberstickerei, auf buntem Sammet und wallenden Federn. Der Hausherr steht oben an der Treppe, die Hand der Gemahlin ruht in der seinigen, und Beide winken den Gästen recht wehmüthig zum Abschied bis zur nächsten Mitternacht. Der Page, der vor ihnen steht, hält den kleinen Bologneser empor, der mit hinabschlüpfen wollte. Endlich hat sich das Haus entleert, Herr und Herrin auf der Treppe werden immer bleicher, immer unbestimmter und verschwinden endlich in dem Dampf der Fackeln und Kerzen; die gespenstigen Gäste ziehen in die Nacht hinaus mit unhörbarem Tritt, und obgleich die Damen von den Cavalieren aufs Beste unterhalten werden, hört man weder sprechen noch lachen: dunstig und nebelig schweben sie dahin und zerfließen vor dem nachschauenden Blick, ehe sie ihm verschwinden.
So hat jeder Platz auf der Erde, jedes Haus, das wir bewohnen, seine mannigfachen Geschichten, die sich dem Auge des tiefer Schauenden bald anmuthig bald grauenhaft enthüllen.
Vor Allem aber wollen wir in diesem Sinne einen Platz ins Auge fassen, auf welchem unsere einfache Geschichte beginnt. Nicht als ob derselbe große welthistorische Momente gesehen hätte, oder als ob auf demselben viel Ungeheures geschehen sei – nein, im Gegentheil, was hier geschah und wie sich dieser Platz im Laufe der Jahre änderte, mag auch an vielen andern Orten ebenso geschehen sein; nur erinnern wir uns nicht, daß schon Jemand desselben anderswo mit einigen beschreibenden Worten erwähnt hätte.
Wie alle deutschen Städte in vergangenen Tagen, so hatte auch die Residenzstadt, von der wir eben sprechen, in alten, mittelalterlichen Zeiten Wall und Mauer, breite Gräben und Zugbrücken. Viele Schutzmittel gegen äußere Feinde zwängten die Stadt wie in einen eisernen Gürtel zusammen und gestatteten lange nicht, daß sich Leben und Treiben, Handel und Verkehr über diese Schranken hinaus ergoß. Als aber die Zeiten etwas milder wurden, oder die Stadt als fester Punkt ihre Bedeutung verlor, oder als das immer mehr sich regende Leben gewaltsam übersprudelte und vor den Mauern Häuser erstehen ließ, die hohnlachend über die abendliche Straßensperre zu den alten Thoren hereinsahen, da begannen diese allmählig zu verfallen, zuerst die Mauern, dann die Thorbogen, dann die festen Thürme, und was sich nicht von selbst demüthigte und aus Altersschwäche und Lebensüberdruß verfiel, dem half die Menschenhand nach und riß die alten Werke ebenso emsig nieder, wie sie dieselben früher aufgebaut; die Gräben füllten sich mit Schutt und Steinen, darüber wuchs Unkraut und Strauchwerk, Gras und Blumen, und diese verwesten wieder und wurden zu Staub und guter Erde, woraus wieder Neues erwuchs; und das ging so fort, bis sich die tiefen Gräben langsam auffüllten; und da auf dem guten, feuchten Grunde hier Bäume trefflich heranwuchsen, so gab es unter ihren überhangenden Zweigen bald schattige, angenehme Spaziergänge.
Nur einer dieser Gräben widerstand hartnäckig jedem Versuche ihn zu entfernen. Nachdem auf fast allen Seiten der Stadt die Gräben verschwunden und einige der alten Thürme und Thorbogen, mit dichtem Epheu bewachsen, nur noch als eine Merkwürdigkeit fast mitten in der Stadt stehen geblieben waren, hatte sich einzig und allein auf der Stelle, von der wir sprechen, der Graben in seiner ganzen Tiefe und Breite erhalten. Nicht als ob die Stadt hier in ihrem Wachsthum zurückgeblieben sei, – im Gegentheil, sie war hier ausgedehnter als irgendwo, und den alten Stadtgraben faßten auf beiden Seiten lange Reihen neuer Häuser ein.
Der erste Grund zu diesem hartnäckigen Festhalten an seinem längst nicht mehr zeitgemäßen Dasein war wohl, daß der alte Stadtgraben hier nicht so breit und tief war, wie anderswo, und man wohl glauben mochte, wenn erst die tieferen Stellen zugeschüttet seien, werde das Bischen hier von selbst nachfolgen. Zweitens hielt ihn als eine Art Kirchhof das Volk heilig; denn an dieser Stelle war bei den vielen Belagerungen, welche die Stadt ausgehalten, Sturm und Vertheidigung beständig am heftigsten gewesen, manch ein Bürger und Bürgerskind schlief da, niedergestreckt auf dem Felde der Ehre, den ewigen Schlaf. Mochte es nun die Rücksicht sein, um die Gefallenen hier zu ehren und ihrer Ruhestatt eine gewisse Weihe zu geben – genug, man erbaute an dem Stadtgraben mit den Steinen der Mauer ein Kloster, und fromme Kapuziner machten ihn zu ihrem Garten und pflanzten da in stiller Bescheidenheit ihren Kohl. Auch versäumten sie nicht, wo bei dem Aufgraben des Grundes Lanzenspitzen, Schwerterklingen, Pickelhauben und Menschenknochen in größerer Anzahl zum Vorschein kamen, ein Kreuz zu errichten, um, indem sie auf diese Art die Gefallenen ehrten, ihren Garten selbst gegen die Angriffe der Stadtbehörde sicher zu stellen.
So lag der Klostergarten lange Zeit in einem stillen Grunde mitten in der Stadt, rings herum hatten die Mönche tüchtige Mauern aufgeführt, um die Blicke der Neugierigen abzuhalten, sie hatten Bäume gepflanzt, Wasser hergeleitet und lebten da unten fromm und gottgefällig.
Da aber in dieser Welt nichts von Dauer ist, so hörte auch das Kloster an einem schönen Tage auf, ein Kloster zu sein, die Mönche verschwanden, die kleine Thür, die aus dem Gebäude in den Stadtgraben führte, wurde zugemauert, der Garten verwilderte, die Wasser hörten auf zu laufen, und die Bubenschaar belustigte sich lange Zeit damit, die Mauern abzubrechen und langsam in den Graben hinabrollen zu lassen; denn der Magistrat war noch nicht mit sich darüber einig, was mit dem alten Stadtgraben zu beginnen sei. Endlich beschloß man, denselben aufzufüllen, und that von Rechts wegen, was die Knaben der Stadt unbefugter Weise angefangen: die Mauern wurden hinabgeworfen, der Stadtgraben an beiden Seiten geöffnet und zum Durchgang in zwei Straßen gebraucht, die bis jetzt keine Verbindung hatten. Das Kapuziner-Kloster vermiethete man an eine Menge ärmerer Familien, von denen eine gute Anzahl in dem großen weitläufigen Gebäude Platz fand; des Gartens bemächtigten sich die Kinder der Stadt zu einem außerordentlich gut gelegenen Spielplatze, und hier geschah alles das, was die Jugend in ihrem lebensfrohen Uebermuth nur auszuführen pflegt. Bald wurde der Angriff und die Vertheidigung der Stadt dargestellt, und die junge Generation kämpfte mit hölzernen Schwertern und eben solchen Spießen tapfer und heldenmäßig auf derselben Stelle, wo ihre Vorfahren vor Alter das Gleiche gethan. Die Kinder äfften den Lauf der Zeit vollkommen nach, und als wegen allzuviel zerschlagener Nasen und blauer Augen, nicht zu gedenken der zerrissenen Hosen und Jacken, das Kampfspiel verboten wurde, so beschloß die ganze Versammlung, das Klosterleben wieder erstehen zu lassen, und alsbald tönten in dem Stadtgraben geistliche Gesänge, der weibliche Theil der Schule wurde streng abgesondert, und feierlichen Schrittes zogen die Buben in Procession unter dem Steingerölle dahin. Diese harmlosen Spiele aber sollten ein blutiges Ende nehmen; nicht als ob eines der Kinder einmal bedeutenden Schaden genommen hätte, sondern der Magistrat beschloß in seiner Weisheit, den alten Stadtgraben zur Richtstätte umzuwandeln, und hier wurde nun eine Reihe von Jahren geköpft und gestäubt und alle möglichen Strafen ausgeführt, die das Gericht für gut fand, den Verbrechern aufzulegen, ohne daß die Menschheit durch die vielen Beispiele im Geringsten gebessert worden wäre. Doch war der Platz von da an geflohen und gemieden, und man erzählte sich unter der Hand an langen Winterabenden von schrecklichen und unerhörten Spukgestalten, welche in dem alten Stadtgraben sichtbar wurden und die umher Wohnenden ängstigten. Bald wollte man die alten, längst vermoderten Kämpfer der Stadt gesehen haben, wie sie den letzten Geköpften voll Abscheu, daß das unreine Blut sich mit dem ihrigen vermische, über die Mauer entfernt hätten; bald habe sich, so sagte man, zur Nachtzeit die kleine vermauerte Thür des Klosters geöffnet, und die Mönche seien paarweise erschienen mit feierlichem Schritt und haben mit traurigem Gesang den Graben durchschritten, wehklagend, daß die heilige Stelle entweiht sei. Obgleich nun, wie es bei allen Gespenstergeschichten geht, nie Einer behauptete, er habe dies und das mit seinen eigenen Augen gesehen, so wurde doch, namentlich in der Dunkelheit, der alte Stadtgraben von Niemand gerne besucht, und man machte lieber einen großen Umweg, wenn man von einer Straße, welche in gerader Linie durch den Stadtgraben verbunden wurde, in die andere wollte. Die Bubenschaar hatte sich längst einen anderen Spielplatz ausgesucht und ließ dem Unkraut und Strauchwerk freien Spielraum, welches sich behaglich ausdehnte und diesen Platz mitten in der Stadt höchst unangenehm für das Auge machte.
Endlich wurde dieser Anblick den Vätern der Stadt unerträglich, auch war man des Platzes hier sehr benöthigt, und so faßte man die großartige Idee, den alten Graben theilweise zu überwölben, anderntheils zu pflastern und den benachbarten Hauseigenthümern unentgeldlich kleine Stücke zu Hofraum und Garten abzutreten.
Dieser Durchgang, finster und unheimlich, wie er war, gehörte nicht zu den angenehmen Theilen der Stadt und war doch den mittleren und ärmeren Volksklassen, die hier herum und namentlich in dem alten Kloster wohnten, von großem Nutzen. Da hatten Obstverkäuferinnen, vor dem Regen geschützt, ihre Waaren aufgestellt, da befanden sich kleine ambulante Bücher- und Bilderläden, und, wenn es draußen gar zu sehr stürmte und schneite, trieb auch wohl eine Knabenschaar ihre lärmenden Spiele hier und freute sich an dem dumpfen Klang, mit dem ihre dünnen Kinderstimmen von dem Gewölbe wiederhallten.
Der Eingang ins Kloster war in demselben frei gelassen worden und befand sich an der Seite in einem kleinen melancholischen Hofe, hier ragten die von Alter geschwärzten Mauern unendlich in die Höhe, und neue viereckige Fenster wechselten ab mit den alten gothischen des ehemaligen Klosters; ein einsamer Streifen Epheu schlang sich dort hinauf, und wenn er auch wenig Sonnenlicht genoß, so hatte er desto mehr Feuchtigkeit, denn die alten, seltsam geformten Dachrinnen mündeten alle in den kleinen Hof, und wenn es regnete, spie es eine wahre Sündfluth von Wasser herab. Jedes der verschiedenen Fenster hier war anders verziert: an diesem flatterte Wäsche an dünnen Seilen, an jenem waren Blumenbretter angebracht, und Geranien und Kapuziner fristeten hier in dem dunklen Winkel ein kümmerliches Dasein; auf dem Boden dieses Hofes standen Fässer von allen erdenklichen Formen, um das kostbare Regenwasser aufzufangen, und wenn man dazwischen die großen Kehrichthaufen sah, so konnte man sich kopfschüttelnd fragen, warum die gestrenge Polizei nicht kräftigst einschritt. Doch wußte jeder, der genauer bekannt war, daß es unter den ordentlichen Familien, die hier wohnten, auch viel excentrische Gemüther gab, die es der Polizei schwer machten, sich allzu vorsorglich in ihre innern Angelegenheiten zu mischen.
Dieser Durchgang nun, sowie die umliegenden Gebäude hießen:
»Unter dem Stadtgraben.«
Zweites Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Wenn der alte Stadtgraben schon am hellen Tage bei Sonnenschein ein unheimlicher und trübseliger Aufenthalt war, so konnte man ihn wirklich trostlos nennen, wenn man ihn an einem Abende betrat, wie an demjenigen, an welchem unsere namenlose Geschichte beginnt.
Es war ein unfreundlicher, trüber Novembertag; dichte Nebel, welche die Erde einhüllten, hatten Vor- und Nachmittags kräftig mit einander gerungen, bald waren sie aufgestiegen und bedeckten die Höhen rings um die Stadt mit schweren, grauen Kuppen; bald sanken sie auf den Erdboden nieder und hüllten dort Alles so dicht ein, daß man, auf der Straße gehend, nicht auf drei Schritte deutlich bemerkte, ob einem ein Mensch, ein Pferd oder ein Wagen begegnete; dazu war es naßkalt, das Pflaster feucht und schlüpfrig, und man mußte fest auftreten, um nicht auszugleiten. Was der Nebel schon am Morgen hätte thun sollen, nämlich vollständig auf die Erde herab kommen, das that er erst am Abend, indem er sich in einen feinen, scharfen Regen auflöste, der mit einigem Schnee vermischt, den Dahinwandelnden vom Wind unangenehm in das Gesicht geweht wurde. Dabei befanden sich die Straßen der Stadt theilweise in großer Zerstörung; man war im Begriff, die alten Straßenlaternen zu pensioniren und die Residenzstadt mit Gas zu erleuchten; deßhalb war das Pflaster in einer Breite von vier Fuß und dabei oft ganze Straßenlängen ausgehoben und ein tiefer Graben gemacht, um den Gasrohren im Schooße der Erde ein bequemes Lager bereiten zu können. Wo diese Röhren bereits lagen, da war der Graben wieder zugeworfen, und wenn auch der harmlos Vorüberwandelnde, der zufällig auf die lose Erde trat, tief einsank, wenn auch Eilwagen und Omnibus, die mit zwei Räder hineingeriethen, dem Umschlagen nur mit genauer Noth entgingen, so waren das kleine Uebelstände, die in Anbetracht der allgemeinen Nützlichkeit der Sache wohl zu ertragen waren. Wo aber die Röhren noch nicht gelegt waren, da gähnte der Graben in einer Tiefe von vier Fuß, und um den Darüberschreitenden zu warnen, hatte man an solchen Stellen kleine schwarze, schmutzige Laternen aufgesteckt, die, schon an sich trübselig, jetzt durch Oelmangel, Nebel und Regen in einem wahrhaft jammervollen, trübrothen Licht dämmerten und den Wanderer schon allein durch ihr melancholisches Aussehen darauf vorbereiteten, daß sich zu seinen Füßen etwas Furchtbares aufthue.
Ein solcher Graben mit einer solchen Laterne sperrte den einen Eingang des Stadtgrabens vollständig und zum großen Aerger aller Leute, die ihren Weg eigens hieher lenkten, um unter dem Gewölbe eine Zeit lang im Trockenen gehen zu können, und man hörte an dieser Stelle viele leise Flüche, sowie den halbunterdrückten Schrei weiblicher Stimmen, wenn sie an den tiefen Graben kamen und den Sprung wagten, das Lachen der Straßenjungen, die diesen unwillkürlichen Kraftanstrengungen zuschauten und sie mit einem Zungenschlag, wie auf der Rennbahn, begleiteten; dann traten Alle schallenden Schrittes in das Gewölbe, stampften mit den Füßen und schüttelten ihre Mäntel und Regenschirme, um den anhängenden Schnee zurück zu lassen, der auf diese Art in dem Gewölbe liegen blieb und dasselbe noch feuchter und unbehaglicher machte. Dazu pfiff der Wind von einer Seite, und die Straßenlaterne, die in der Mitte dieses Durchganges hieng, ächzte kläglich hin und her. In dem kleinen Seitenhofe brach sich der Luftstrom und fuhr heulend und pfeifend, da er keinen Ausweg an den steinernen Mauern fand, in die Höhe und in's Freie. Kein Thier war auf der Straße oder im Gewölbe zu sehen, und eine Katze, die eben von einem nachbarlichen Besuche kam, eilte mit rasenden Sätzen über den kleinen Hof in's Kapuzinerkloster, um sobald als möglich ihren warmen Ofenwinkel zu erreichen.
Wer hätte nach allem dem glauben sollen, daß in diesem Gewölbe trotz des Unwetters eine Gesellschaft menschlicher Wesen, auf einem Stein neben der verwitterten Klosterthür saß und ruhig und unerschüttert von Sturm und Regen auf etwas zu warten schien? Es mochten sechs bis acht Frauen aus der niederen Volksklasse sein, die dort neben einander kauerten, mit einem trübseligen Schweigen, das nur zuweilen unterbrochen wurde durch einen absichtlich sehr laut ausgestoßenen Seufzer oder durch die Bemerkung, es scheine, als wolle der ganze Himmel mit all' seinen Wassern auf die Erde herabkommen. Die Weiber waren ärmlich angezogen, sie hatten unter ihre Umschlagtücher Kopf und Arme verborgen und zitterten trotzdem vor Kälte und Nässe; eine brennende Laterne stand in der Mitte vor ihnen, beleuchtete die abgemagerten und traurigen Gesichtszüge, und zeigte zu gleicher Zeit, daß vor jedem der Weiber auf dem Boden eine ebensolche Laterne, aber unangezündet, nebst einem kleinen blechernen Gefäße stand.
Diese Frauen waren nichts mehr und nicht weniger als Dienerinnen der Stadt, und hatten die wichtige Verrichtung, täglich die Straßenlaternen mit frischem Oel zu versehen und sie anzuzünden. Das Oel wurde jeden Abend unter sie ausgetheilt, und beim Eintreten der Dämmerung fanden sie sich zu diesem Zwecke an gewissen Orten ein und verkürzten sich die Zeit, bis sie ihr Oel erhielten und an die Arbeit gehen konnten, mit allerlei Bemerkungen über ihr sauer verdientes geringes Brod, wobei sie gewöhnlich versicherten, daß das Amt einer Laternen-Anzünderin eine langsame Art von Hungertod sei. Doch hatten sich diese Ansichten der armen Weiber seit einiger Zeit bedeutend geändert, und wenn wir vorhin von unterschiedlichen Seufzern sprachen, so waren sie nicht vom schweren Amte erpreßt, sondern galten einer neuen Einrichtung, die sie mit dem Verluste ihres Erwerbs bedrohte – der Gasbeleuchtung nämlich.
Ein neuer heftiger Windstoß, der durch das Gewölbe heulte und vor der Oeffnung desselben die kleine Laterne an dem breiten Graben auslöschte, brachte die Zungen der Laternen-Anzünderinnen auf einmal in Bewegung.
»Geh' Sie doch hin, Winklere!« sagte eines der Weiber, »und zünd' Sie die Laterne wieder an; nicht wahr, Sie thut's mit Ihrem guten Gemüth? Mir war's dort finster genug, und wenn's in der Finsterniß ein paar zerbrochene Beine gäbe, welche die Gassenlicht-Herren zu bezahlen hätten, thät' mich's auch freuen.«
»Natürlich werd' ich's wieder anzünden,« entgegnete die Angeredete, indem sie gewaltig hustete und sich zugleich erhob. Es war eine kleine buckelige Person, welche die brennende Laterne vom Boden aufhob und damit dem Eingange zuschritt.
»Gebt nur Acht,« fuhr die andere Stimme fort, »die Winklere weiß schon, warum sie besorgt ist, die schleicht sich schon wieder in ein Aemtchen hinein, die wird schon wieder angestellt, und wenn sie sie auch um als Wetterhex auf das Dach setzen.«
»Habt ihr denn eigentlich eine Idee davon,« sagte eine andere Stimme, »was das mit dem Gassenlicht eigentlich sagen will, und warum wir unsern Dienst deßhalb verlieren müssen? Laternen müssen sie nun doch einmal haben, und die Laternen muß auch ein Christenmensch putzen und muß ihnen Oel geben, das liegt auf der Hand; aber ich weiß schon, wir sollen abgeschafft werden, denn die Herren vom Stadtrath werden schon andere Leute im Auge haben, welche die Laternen anzünden sollen, ja, ja, ganz andere Leute als wir, und natürlich viel jünger und verständiger.«
»Schwätz' Sie kein so dummes Zeug!« sagte die erste Stimme wieder, »das Gassenlicht ist nichts, wie so verflucht's Maschinenwerk; da bauen sie draußen ein Gassenhaus, und in dasselbe kommen große Maschinen, wie in der Spinnerei drüben am Bach, und ein großer Schornstein daneben, und das arbeitet in einer Viertelstunde alles das, wofür sich alle Laternen-Anzünderinnen Morgens und Abends zu plagen haben; ich sage euch, diese Maschine ist unser Unglück, und wo so ein Unrath anfängt zu laufen und zu wuseln, sollt man's gleich zerschlagen.«
Eine dritte Stimme erhob sich jetzt schüchtern und wollte gehört haben, das Gassenlicht bekäme kein Oel, sondern werde durch die Luft allein hervorgebracht, – eine Behauptung, über deren Unhaltbarkeit und Lächerlichkeit sämmtliche Weiber in ein gellendes Gelächter ausbrachen.
»Luft, Luft?« sagte die erste Stimme wieder; »wie man nur so dumm sein kann und so etwas glauben! Wozu legen sie denn diese dicken eisernen Röhren? Wohl damit die Luft hindurch geht? eine eiserne Röhre für die Luft! nun hör' mir einer an, so was hab' ich mein Lebtag nicht gehört. Ich will's euch sagen, was die Röhren bedeuten: Diese Röhren laufen in dem Gassenhaus alle in einem großen Kessel zusammen und dieser große Kessel ist voll Oel, und da thut man nichts, als jeden Abend den Hahnen aufmachen und läßt das Oel in die Laternen laufen, und so braucht man euch nicht mehr – verstanden?«
»Bloß die Winklere allein,« sagte eine vierte Stimme mit krächzendem Ton; »dort kommt sie zurück gehumpelt, bloß die wird beibehalten, und, wenn man sie nicht als Wetterhex brauchen kann, so darf sie an dem großen Oelhahnen sitzen und ihn langsam aufdrehen.«
»Spottet nur,« sagte die Verhöhnte und setzte die Laterne ruhig auf den Boden. »Ihr wißt Alle, daß ich ein so armes Weib bin, wie ihr, die ihre paar Groschen vom Laternenanzünden für ihr kümmerliches Leben ebenso braucht und die sonst nichts hat.«
»Und die uns das Geschäft verderbt,« sagte die erste Stimme mit bitterem Tone, »ja Winklere, Sie hätte uns doch das Geschäft verdorben, wenn's der Teufel in den nächsten Tagen nicht ganz holen würde.«
»Ich? – Und womit denn?«
»Ja Sie! Hat Sie nicht durch Ihr Scharwenzeln und durch Ihre Bittgänge herausgeschlagen, daß die nichtsnutzige Weibsperson, die Marie, die Laternen in der hohen Gasse anzünden darf, und sind wir dadurch nicht alle verschimpfirt worden, und sagt nicht seit der Zeit der Stadtsoldat Steinmann, der, beiläufig gesagt, einst in der Hölle in dem Oel braten wird, das er uns abgezwackt und dem Rathe gestohlen, – hat er nicht seit der Zeit gesagt, wir seien alle zusammen liederliche Weibsbilder?«
»Ja, ja, das hat er gesagt!« riefen mehrere Weiber; »und sobald wir entlassen sind,« setzte eine schrille Stimme hinzu, »kratze ich ihm sein scheeles Auge aus.«
»Und das ist noch nicht Alles,« sagte die erste Stimme, »jetzt liegt die Marie schon ein halbes Jahr zu Bette als Strafe für ihren sündhaften Lebenswandel, und was thut die Frau Winklere, die hochmüthige Mama von dem hochmüthigen königlichen Stallknecht? Anstatt die Gelegenheit zu benutzen, um die Weibsperson los zu werden, geht sie her und versieht die ganze Zeit den Dienst der Marie.«
»Und ist da was Böses drinn?« fragte die Winklere.
»Ei, nun seh' mir eins die Frage an!« antwortete die Andere, »was hat der Steinmann neulich gesagt? Er hat gesagt, wenn er gewußt hätte, daß eine von uns zwei Stadtviertel versehen könnte, so hätte man eigentlich nur die Hälfte der Lampen-Anzünderinnen anzustellen gebraucht, und hat hinzugesetzt, wenn nicht ohnehin Alles aufhörte, so würde man darauf hin die Hälfte von uns fortjagen.«
»Der Steinmann ist ein hartherziger, schlechter Kerl,« sagte die Winklere, die auch anfing in Zorn zu gerathen, so heftig es ihre zarte Stimme erlaubte, »und der Steinmann wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen.«
Ueber diesen Punkt waren sämmtliche Weiber vollkommen einig und Eine mit sehr schriller Stimme meinte, wenn es unter dem größten Höllenofen ein recht tiefes und glühendes Aschenloch gäbe, so wäre das ein passender Platz für den Steinmann.
Doch wie man in der Fabel nur den Wolf zu nennen braucht, damit er erscheine, so war es auch hier, und die Weiber, die im Begriff waren, noch einige besondere und recht empfindliche Strafen zu erdenken, die den Stadtsoldaten im Jenseits unfehlbar erwarten dürften, bemerkten in demselben Augenblick am Ende des Durchgangs eine lange Gestalt und den Schein einer Laterne, welche hinter dieser Gestalt hergetragen wurde, wodurch dieselbe, da man weder das Licht selbst noch den Träger sah, wie in einem rothen Feuer heranzuschweben schien. Diese Gestalt war Herr Steinmann, welcher ein großes Oelgefäß in der Hand trug, und hinter ihm drein wandelte ein kleiner Bube mit der Laterne, von welcher der oben erwähnte Schein herkam.
Bei diesem Anblick verstummten die Weiber plötzlich und flüsterten sich nur leise zu, keine solle mit dem Ungeheuer ein Wort sprechen.
Dieses Ungeheuer näherte sich nun langsamen Schrittes, hustete zuweilen, und wenn dasselbe auch nicht gerade aussah, wie man sich die Ungeheuer gewöhnlich vorstellt, so war sein Gesicht doch so seltsamer Art, daß man glauben konnte, der Herr Stadtsoldat Steinmann habe einmal bei einer nächtlichen Runde etwas ganz furchtbar Entsetzliches gesehen, wodurch seine Gesichtszüge auf eine solch' unangenehme Art verzerrt worden seien, wie sie zum Schrecken aller kleinen Kinder sich öffentlich sehen ließen; dabei war er blatternarbig und hatte nur noch ein einziges Auge, welches sehr unangenehm schielte.
Wenn er als Diener der öffentlichen Gewalt die Knabenschaar zur Ruhe bringen wollte, so brauchte er sich nur vor sie hinzustellen und sie mit seinem einzigen Auge scharf anzusehen, was vollkommen hinreichte, um die Buben in höchster Angst nach Hause zu jagen. Ja, sein Anblick erschien denselben so entsetzlich, daß sie, um sich selbst recht in Furcht und Schrecken zu jagen, zuweilen Steinmannles spielten, wobei dann der Knabe, der ihn vorzustellen die Ehre hatte, sich bemühte, durch die furchtbarsten Grimassen und Fratzen die Gesichtszüge des Stadtsoldaten nachzuahmen.
In seiner Eigenschaft als Oberaufseher der Lampenputzerinnen und Oelvertheiler hatte er sich den Ruhm erworben, daß ein Wort von ihm, ja sein Anblick hinreichte, um die armen alten Frauen zur strengsten Pflichterfüllung anzuhalten. Wie eine Katze schlich er Tag und Nacht umher, und wenn eines der Weiber zufällig ein bischen Oel in ihrem Kännchen übrig behielt und nicht alles in die Laterne goß, so konnte plötzlich in dem hellen Scheine dicht vor der Uebelthäterin das schreckliche Gesicht des Herrn Steinmann auftauchen und sie lächelnd an ihre Pflicht erinnern. Dabei maß er ihnen das Oel so knapp zu, daß die Laternen schon eine Stunde, bevor sie erlöschen durften, auffallend zu kränkeln begannen und durch ein trübes Aufflackern deutlich anzeigten, daß es ihnen an der nothwendigen Nahrung fehle. Doch konnte man dem Steinmann darüber nichts anhaben, denn das Gefäß war bis an den Rand gefüllt, und wenn er der letzten Anzünderin ihr Oel gegeben, so drehte er dasselbe um, und es rann kein Tropfen mehr heraus; böse Zungen aber behaupteten, der Steinmann habe unten in seinem Oelgefaß einen großen Schwamm, den er später zu Hause in seine eigene Lampe auspresse.
Die Oelvertheilung heute Abend begann von Seiten der Empfängerinnen mit einem melancholischen Schweigen und von Seiten des Austheilers mit einem bösartigen Blinzeln seines einzigen Auges; er bemerkte wohl, daß die Weiber beschlossen hatten, keine Unterhaltung anzuknüpfen, und es verursachte ihm deßhalb die größte Freude, durch ein einziges Wort im Stande zu sein, ihre Zungen aufs Feindseligste zu entfesseln.
Während die Weiber ihre Oelgefäße schlossen und jede ihre Laterne anzündete, zog der Stadtsoldat eine Schnupftabaksdose aus Birkenrinde hervor, nahm bedächtig eine Prise und versicherte, wie leid es ihm thäte, daß er durch die neue Gasbeleuchtung gezwungen sei, bald für immer eine so angenehme Unterhaltung, wie ihm die Oelaustheilung gewähre, verlieren zu müssen.
Die Winklere schloß mit einem stillen Seufzer ihre Laterne, die übrigen Weiber rafften sich entschlossen von ihrem Steinsitze auf, um davon zu gehen.
»Von morgen an,« sagte der Stadtsoldat sehr bedächtig und langsam, indem er eine zweite Prise nahm, »braucht nur die Hälfte hieher zu kommen, um Oel zu fassen!« Und bei diesen Worten verzerrte sich sein Gesicht zu einem scheußlichen Lachen, als er bemerkte, wie auf diese Neuigkeit hin die Weiber plötzlich Halt machten und ihn ängstlich und erwartungsvoll ansahen.
»Ja, ja, von morgen an nur noch die Hälfte,« fuhr er fort und klappte den Deckel auf seine Dose; »wir haben die Gasbeleuchtungs-Gesellschaft unabläßig angetrieben, und obgleich sie erst im nächsten Monat anfangen wollte, so werden doch schon, Dank unsern Bemühungen, in dem dritten, sechsten und achten Stadtviertel die Gaslaternen morgen Abend angezündet werden können; die betreffenden Weiber sind deßhalb von heute an schon entlassen.«
Wie der Steinmann vorausgesehen hatte, so brach auf diese Ankündigung hin ein wahrer Strom von Worten, Klagen, ja Schmähungen los; manche Weiber setzten ihre Laternen hin, fuhren mit dem Schurzzipfel an die Augen und meinten, es sei gar nicht möglich, daß man ihnen so plötzlich und über Nacht ihr bisschen Brod nehmen könne. Es war in dem engen Durchgang ein Klagen und Lamentiren, daß es einen Stein hätte erbarmen können; aber je mehr die armen Weiber wehklagten und weinten, um so inniger freute sich Herr Steinmann; auch schien es ihm durchaus nicht wehe zu thun, wenn mitunter sehr harte Aeußerungen gegen seine eigene Person fielen, ja er nahm ganz ruhig und lächelnd eine neue Prise, als der Jammer der Weiber in offene Rebellion auszubrechen drohte, indem die Hartnäckigsten erklärten, wenn man sie so schonungslos fortjage, so würden sie auch heute schon keinen Dienst mehr thun, und der Teufel möge die Stadt beleuchten wie er wolle, und ihnen sei es gleich, wenn dies sogar durch eine große Feuersbrunst geschehe.
Der Stadtsoldat stand, wie gesagt, in diesem Lärmen ruhig und lächelnd da, als wenn ihn das alles durchaus nichts anginge, und nur wenn eines der Weiber in ihrer Aufregung etwas zu nahe auf ihn zutrat, wandte er sich um und scheuchte sie mit einer furchtbaren Grimasse weit zurück; ihn schien dieses Geschrei außerordentlich zu amusiren, und anstatt, daß er sich Mühe gab, den Sturm zu beschwichtigen, vermehrte er ihn vielmehr noch durch seine Bemerkungen.
»Dankt Gott,« sagte er lachend, »daß der scheußliche Hundedienst ein Ende hat! Habt ihr nicht allesammt oft bedauert, daß ihr euch je zum Geschäft des Lampenanzündens hergegeben, was? he? Habt ihr nicht immer euch verschworen und euch selbst Esel genannt, daß ihr je dieses Geschäft übernommen? Jetzt seid ihr's ja los, dankt eurem Heiland auf den Knieen dafür, dankt dem Steinmann, – jetzt macht, daß ihr fortkommt, oder ...«
Das einzige Auge des Stadtsoldaten begann vor innerer Lust und Bosheit zu funkeln, und er streckte den gebieterischen Arm nach dem Eingange aus.
Dies war das gewöhnliche Ende von dergleichen Scenen gewesen, und es hatten sich die Weiber darauf stillschweigend entfernt; heute aber, wo das lange Befürchtete so plötzlich über sie hereingebrochen war, wo die armen, durchnäßten und frierenden Weiber den harten Winter vor der Thür sahen, folgten sie nicht dem gebieterischen Wink ihres ewigen Plagegeistes, sondern ihre Thränen begannen reichlicher zu fließen und ihre Klagen übertönten das Geheul des Windes und den niederplätschernden Regen in dem engen Hofe nebenan.
Leute, die durch das Gewölbe eilten, blieben einen Augenblick erstaunt stehen und gingen dann rasch fort, als sie den Steinmann gewahrten. Dieser schnupfte heftig und wollte ebenfalls den Schauplatz seiner Thaten verlassen, als eine große starke Frau, gefolgt von zwei Dienstmädchen, die auf ihren Köpfen große Körbe mit Wäsche trugen, in das Gewölbe trat und erstaunt bei den heulenden Weibern stehen blieb.
Der Leser aber soll im nächsten Kapitel erfahren, wer diese Frau war und was sich weiter begeben.
Drittes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Die Frau, welche bei dem großen Jammer der Lampenanzünderinnen plötzlich erschien und vor denselben ihren festen, aber eiligen Schritt anhielt, war die ehrsame Wittwe eines königlichen Hofkutschers, der in seinen besten Jahren das Zeitliche gesegnet und die Frau mit drei kleinen Kindern zurückgelassen hatte.
Da die Besoldung des Kutschers von jeher nicht groß zu nennen war, auch derselbe bei dem stundenlangen Sitzen auf dem Bock, wenn er bei Bällen, Concerten und dergleichen in bitterkalter Nacht aus seine Herrschaft zu warten hatte, von dieser kleinen Besoldung ein Erkleckliches verwenden mußte, um sich Behufs innerer Erwärmung etwas Geistiges anzuschaffen, so kann man sich leicht einbilden, daß der Frau von den Ueberbleibseln des Gehaltes nicht viel zu gute kam, weßhalb sie ein einträgliches Geschäft, das sie von ihrer Mutter überkommen, sorgsam beibehielt und möglichst ausdehnte. Dieses Geschäft bestand in dem Besorgen der Wäsche für die Gesandtschaften und andere große Häuser der Stadt.
Frau Welscher hatte ihren Mann, den Hofkutscher, eigentlich nur zum Staat geheirathet, und es ließ sich auch in den ersten Jahren ganz gut an, wenn die junge hübsche Frau mit dem stattlichen Manne in glänzender Livree Arm in Arm dahin wandelte.
Sie hatten drei Kinder miteinander, als der Mann starb, und der Frau blieb von ihm nichts übrig, als das Andenken an manchen guten und manchen bösen Tag, die sie mitsammen verlebt, sowie die Kundschaft einiger Hofdamen, die der selige Kutscher Welscher beständig gefahren und in welch' angestrengtem Dienst er sich, so behaupteten nämlich seine Kameraden, den frühen Tod geholt; denn so eine Hofdame läßt nicht mit sich spassen und spaßt auch nicht mit ihrem Kutscher und ihren Pferden, und wenn Nachts alle Geschöpfe zur Ruhe gegangen sind, wenn sogar Wachposten und Nachtwächter einnicken, so hört man gewiß noch eine verspätete Equipage auf dem Pflaster rasseln – einen Hofdamenwagen.
Frau Welscher hatte sich bei ihrem Geschäft und durch den Umgang mit vornehmen Leuten oder doch mit deren Kammerdienern und Kammerjungfern einen gewissen Grad von Bildung angeeignet, die sonst Leute ihres Ranges nicht besitzen; hierdurch, sowie durch einen außerordentlich rechtlichen und ehrsamen Lebenswandel hatte sich die Frau nicht nur in dem Hause, wo sie wohnte, sondern im ganzen Stadtviertel, wo dieses Haus lag, ein größeres Ansehen erworben, als selbst der Polizei-Commissär besaß. Sie wohnte in dem alten Kapuzinerkloster und war bei häufig vorkommenden Streitigkeiten der Nachbarschaft eine vollkommen competente richterliche Behörde, und wer bei einem Streit von ihr Unrecht bekam, der mochte sein Urtheil in aller Geduld hinnehmen, denn eine Appellation dagegen würde ihm die ganze Nachbarschaft für ein Majestätsverbrechen ausgelegt haben.
Dieses Ansehen nun, in welchem die Waschfrau stand, äußerte sich auch bei ihrem Erscheinen sogleich auf die heulenden Lampenanzünderinnen, ja sogar auf den hartherzigen Steinmann. Die Weiber hörten auf zu weinen und eine beeilte sich auf die Frage der Frau Welscher nach dem Spectakel die schreckliche Ursache desselben anzugehen und hinzuzusetzen, auf welch' boshafte und scheußliche Weise der Stadtsoldat ihnen ihre Entlassung mitgetheilt.
Die Waschfrau stemmte den Arm in die Seite, und die beiden Dienstmädchen hinter ihr thaten das Gleiche, es gehörte ihr ganzes Ansehen dazu, die keifenden und lärmenden Weiber zu vermögen, sich ruhig zu verhalten, nachdem sie, wie eine Schaar Gänse durcheinander schreiend, ihre Anklage alle zusammen bekräftigt hatten.
Jetzt aber schwiegen sie mit Einemmal und hoben ihre Laternen in die Höhe, um aus den Gesichtszügen der Frau Welscher zu erfahren, ob sie aus denselben eine Hoffnung schöpfen könnten; natürlicher Weise war dem nicht so, die Waschfrau schüttelte den Kopf und sagte: »Seht, ihr Weiber, da ist nichts zu machen, der Stadtrath ist in seinem Recht; er hat euch angenommen, um die Straßenlaternen anzuzünden und jetzt, da keine mehr anzuzünden sind, wenigstens nicht in der Art wie früher, entläßt er euch und hat sein vollkommenes Recht dazu.«
Ein tiefer Seufzer war die Antwort auf diese Entscheidung, und die Weiber waren von diesem Augenblick an so hoffnungslos, als hätte der oberste Gerichtshof des Landes diesen Ausspruch gethan.
»Ihr könnt nichts thun,« fuhr die Frau fort, »als euch an die Gnade des Rathes wenden, um irgend ein anderes Aemtchen zu erhalten; leider habt ihr keine Aussicht, mit diesem Gesuch von eurem Aufseher, – diesem Menschen da, – unterstützt zu werden; doch Gott ist barmherzig, und wenn ich einer von euch mit meinem besonderen Rathe dienen kann, so wißt ihr alle, wo ich wohne. Ihr aber,« wandte sie sich zum Stadtsoldaten, »solltet Euch in Eure Seele hineinschämen, diese armen Weiber, die mit dem erbärmlichen Lohne oft noch Mann und Kinder ernähren mußten, zu verhöhnen und ihren Abschied sauer zu machen.«
»Vor wem soll ich mich schämen?« grinste der Steinmann, »vor Euch vielleicht?«
»Ja, und vor der ganzen Stadt, die Euch kennt,« sagte die Frau, und die beiden Dienstmädchen setzten laut genug hinzu: »der widerwärtige, häßliche Kerl!«
Der Stadtsoldat wollte alles Ernstes böse werden, doch war er klug genug, sich zu besinnen, daß er in einem Viertel sei, dem nicht zu trauen, und daß es nur ein Wort von der Frau, die vor ihm stand, bedürfe, um ihm den nächsten Besuch unter dem Stadtgraben sehr unangenehm zu machen; auch standen die beiden handfesten Mädchen der Waschfrau so herausfordernd da, ja, sie faßten schon an ihren schweren Körben, um sie auf den Boden zu setzen, was ganz wie eine Vorbereitung zum Kampfe aussah, wie ein: »Macht Euch fertig!« – um bei dem geringsten beleidigenden Worte, das er gegen ihre Frau und Meisterin ausstoßen würde, über ihn herfallen zu können, daß er es für besser hielt, unter verschiedenartigen Drohungen für die Zukunft mit seiner Laterne den Heimweg anzutreten.
Auch die Weiber verabschiedeten sich von der Frau Welscher und gingen still seufzend ihres Weges. Anfänglich wankten die Laternen auf Einem Punkte durch das Gewölbe bis zum Ausgange, die ärmlichen Schuhe schlurften auf dem Pflaster, die Oelmaße klapperten, hie und da hustete Eine schwer auf, und als die Weiber von dem noch heftig strömenden Regen auf's Neue durchnäßt wurden, sagten sie einander wehmüthig gute Nacht und gingen nach allen Richtungen auseinander.
Noch lange sah man die kleinen rothen Lichter in den Straßen umher irren, hörte die schweren Seile der Straßenlaternen niederrasseln und sah manch' blasses, eingefallenes Gesicht, wie es sich bemühte, den halb durchnäßten Docht in dem gläsernen Gehäuse anzuzünden.
Droben aber, in den Fenstern der Häuser, wurden ebenfalls Lichter angezündet, und manch' frohes Kindergesicht drückte in dem behaglichen, warmen Zimmer die Nase platt an das angelaufene Fenster und konnte nicht begreifen, was die Frau an ihrer Laterne so lange zu schaffen habe; der Vater aber, der hinzu trat, sagte: »Nun, das hört glücklicher Weise auf, die ganze Stadt wird sich freuen über das Gaslicht, das wir jetzt bekommen.«
Unterdessen ging die Frau Welscher ihrer Wohnung zu und hatte ein Gespräch angeknüpft mit der Winklere, die nebenher hinkte, um an dem alten Kapuzinerkloster eine Laterne anzuzünden.
»Wie geht's Eurer Kranken?« sagte die Waschfrau, »Ihr könnt morgen eine warme Suppe für sie holen, – was macht die Marie?«
»Ach, Ihr wißt ja noch nicht, – – Gott, das hab ich vergessen,« entgegnete die Winklere und setzte Oelmaß und Laterne auf den Boden, »Gott hab' sie selig, die unglückliche Person! Sie ist heute Mittag gestorben, ich glaube an Entkräftung, denn mit ihrer Schwindsucht hätte sie's noch ein paar Monate ausgehalten; ich hätt' es aber auch gewiß nicht früher sagen dürfen, denn wenn der Steinmann erfahren hätte, daß sie schon heute Mittag gestorben sei, so hätte er mir unbedingt den Lohn für den letzten Tag abgezogen.«
»Die arme Person!« sagte die Frau Welscher weich. »Und wo ist das Kind?«
»Ja, das Kind, das hab' ich bei ihr lassen müssen; ich hab's bei seiner armen Mutter eingeschlossen.«
»Bei der Todten?« fragte erschreckt die Waschfrau.
»Ich konnt's nicht anders machen,« entgegnete die Winklere, »es klammerte sich an das Bett fest und wollte seine Mutter durchaus nicht verlassen; hätt' ich es mit Gewalt hinweggenommen, so hätte das Gezeter und Geschrei des kleinen Mädchens die Nachbarn aufmerksam gemacht.«
»Aber was wollt Ihr heute Nacht machen?« fragte die Frau; »wo soll das Kind bleiben?«
»Ich will es in Gottes Namen in mein Stübchen nehmen und morgen sehen, ob sich mitleidige Seelen finden, die etwas für das Kind thun wollen.«
»Und von dem Vater hat man nichts gehört?« fragte die Waschfrau, »hat er sie so elend zu Grunde gehen lassen, die arme Marie?«
»Ach, daß sich Gott erbarme,« entgegnete die Winklere, »was denkt so ein Herr weiter an ein armes bürgerliches Mädchen, wenn er sie in's Unglück gebracht! Von sich hören lassen? ja, abgereist ist er und hat sie nicht wieder gesehen, und was hat er ihr zurückgelassen? ein paar seidene Kleider, einen goldenen Ring und so etwas Flitterkram.«
»Ich mochte die Marie immer leiden,« sagte betrübt Frau Welscher, »es war ein gutes Geschöpf, eine fleißige Näherin, aber immer etwas leichtsinnig.«
»Ob sie ein gutes Geschöpf war!« sagte die Winklere, und Thränen rollten über ihre Wangen. »Wie hat sie ihr Mädchen, das arme Kind, gepflegt! und sie hat es recht gut erzogen und immer aufgeputzt, wie eine Puppe; ach, daran hat sie sich die Schwindsucht an den Hals und zu todt genäht, Gott hab' sie selig! Und als sie nun endlich auf dem Bett lag und nicht mehr ausgehen konnte und auch am Ende nicht mehr im Bette nähen, und der Armendoctor kam, wie hat sie es da getrieben? Obgleich ihr der Tod in den Augen saß, hat sie ihn nie um ihren Zustand gefragt, sondern nur gesagt: »Das Kind darf doch auch davon nehmen? das arme Kind ist so schwach.« Und denken Sie nur, als er einmal Wein mitgebracht, da mußte die Kleine den Wein trinken, und die arme Creatur sagte, es stärke sie so viel mehr, wenn sie sehe, wie das Kind wieder zu Kräften komme, als wenn sie den Wein selbst trinke; ja, Frau Welscher,« schloß die Winklere ihre Rede und trocknete ihre Augen mit dem Halstuche: »es ist viel Elend in der Welt!«
Die Waschfrau, deren Augen ebenfalls feucht wurden, schien über etwas ernstlich nachzudenken; sie ließ die beiden Mägde in das Haus hinauf gehen und ließ sie droben sagen, sie werde in einer halben Stunde nach Hause kommen; dann besann sie sich noch einen Augenblick und sagte darauf zur Winklere: »Komm' Sie, Frau, wir wollen zu dem armen Kinde gehen, ich will es heute Nacht zu mir nehmen, und morgen wollen wir sehen, was weiter zu machen ist.«
Die arme Lampenanzünderin, welche über diesen Entschluß höchlich erfreut war, versicherte wiederholt, Gottes Segen werde solch' einem edlen Werke nicht fehlen, und so gingen die beiden Frauen dahin durch den Stadtgraben bis an's Ende der andern Straße, wo sie vor einem kleinen, unscheinbaren und höchst ärmlich aussehenden Hause stehen blieben; die Winklere deutete mit dem Finger auf ein Fenster im untern Stock, das gänzlich finster da lag und so niedrig am Boden, daß man daraus abnehmen konnte, das Zimmer, zu welchem dieses Fenster gehöre, müsse mehrere Fuß unter dem Boden liegen; das erste Stockwerk dieses Hauses war, wie es bei alten Gebäuden oft der Fall ist, über das untere hinausgebaut, und dann kam eine zweite, dritte und vierte Etage, und in allen brannte Licht, sogar in dem einzigen Giebelfenster, zu welchem die schneidenden Töne einer Violine in die Nacht hinausseufzten. – – Nur unten war's finster! –
Vor diesem Hause befand sich eine Straßenlaterne, und die Winklere öffnete den kleinen Kasten und ließ sie herab, dann zündete sie das Licht in derselben an, mehr zu sich selber, als zu der Waschfrau sprechend: »Ach, diese Laterne habe ich immer am liebsten angesteckt, ein Licht konnten wir bei aller Sparsamkeit für die arme Person da drinnen nicht herausschlagen, und nun wußt' ich wohl, wie sehr sie sich in ihrem dunklen Zimmer freute, wenn sie mich endlich kommen hörte, sie und ihr Kind, und wenn sie in einem leichten Schlummer lag, dann wachte sie gern auf bei dem Rasseln der alten Laterne und versicherte, es sei ihr ordentlich, als erwärme sich die Stube, wenn die Lichtstrahlen hineinfielen. Sie fielen gerade auf ihr Bett, und wenn Sie durch das Fenster schauen wollten, Frau Welscher, so könnten Sie die arme, todte Person in ihrem Bette liegen sehen.– –Gott! das kleine Kind, es hat mich erkennt, hören Sie, wie es mir ein Zeichen gibt!«
Und die Waschfrau, der es schauderte, durch das Fenster zu sehen, hörte wirklich, wie von innen an die Thür leise geklopft wurde – drei leichte, dumpfe Schläge.
Rasch fuhr die Winklere in die Tasche, holte einen Schlüssel heraus und öffnete die Hausthür, welche zugleich den Eingang zum Zimmer bildete. Es war hier früher einmal ein Laden gewesen, aber die Specereiwaaren verdarben, weil das Gewölbe zu feucht war.
Klopfenden Herzens traten die beiden Weiber in das Gemach, und ein kleines Mädchen von vier bis fünf Jahren lief eilig auf die Winklere zu und verbarg ihr Gesicht in den Falten ihres Rockes. »Ach Frau, ach Frau,« sagte das kleine Wesen, »laßt mich nicht mehr allein, die Mutter lacht nicht und spricht nicht mit mir, freilich ist sie todt, habt Ihr gesagt, und der Kummer habe sie todt gemacht, aber ich habe ihr ja nichts gethan, und mit mir könnte sie doch wohl sprechen.«
»Sei ruhig, mein Kind,« sagte die Winklere; »das kommt Alles wieder.« Und sie trat mit gefalteten Händen und schweigend vor das Bett der todten Mutter.
Die Waschfrau hatte sich vor demselben auf ein Knie niedergelassen und betete leise und innig; das Kind kauerte sich neben sie hin und legte die kalte starre Hand auf seinen Kopf, um die Mutter zu vermögen, ihr durch die dichten Locken zu fahren, was sie in früheren besseren Tagen so oft gethan.
Aermlich war das Gemach über alle Beschreibung, sowie das Bett, in welchem die Todte lag; ein Stuhl mit einigem elendem Weißzeug und eine Kiste in der Ecke, keine Truhe, die etwas Werthvolles verschloß, sondern eine einfache Kiste aus weißen Brettern, mit Heu ausgefüllt, welches mit einem alten Weiberrock bedeckt war, – dort hatte das Kind geschlafen.
Die Todte lag auf ihrem Bette ausgestreckt, eine Hand auf dem Herzen, die andere hing an der Seite herab; ihr Gesicht war, wie es bei Brustkranken gewöhnlich der Fall ist, eingefallen und wachsbleich, doch hatte der Tod dasselbe nicht verzerrt; es war das Antlitz eines jungen Weibes von einigen zwanzig Jahren, dem man ansah, daß es einstens schön gewesen war. Durch das gewölbte Fenster drang der Schein der Straßenlaterne, und da dieselbe vom Winde hin und her bewegt wurde, so warf das flackernde, zitternde Licht seine beweglichen Strahlen über das Antlitz der Gestorbenen, daß man hätte glauben können, sie zucke bisweilen mit den Lippen.
Nachdem die beiden Weiber eine Zeitlang still gebetet, erhob sich die Frau Welscher und zog das ärmliche Leintuch über das Angesicht der Verstorbenen. Die Winklere nahm den alten Weiberrock aus dem Kasten in der Ecke und heftete ihn mit einigen Stecknadeln vor das Fenster des Zimmers; sie sagte, es sei ihr schauerlich, wenn das Licht der Laterne die ganze Nacht durch auf das Gesicht der armen Marie falle, und sie könne sich nicht des Gedankens erwehren, als werde sie davon aufgeweckt und schaue um sich, verwundert, daß sie gestorben sei; auch setzte sie mit leiser Stimme hinzu: »Ich wohne hier neben dran, und wenn ich heute Nacht vorbeiginge, so müßte ich durch das Fenster hineinsehen und würde immer glauben, sie lebe doch noch.«
Als dieses geschehen war, zog sie eine Putzschachtel unter dem Bette hervor und nahm daraus einige alte seidene Tücher, welche sie dem kleinen Mädchen um den Kopf und um den Hals wand, zog ihm ein Paar Handschuhe an und schob ihm ein zusammengedrehtes Hemdchen unter den Arm. Damit war der An- und Auszug für das Kind besorgt, die Frau Welscher nahm es bei der Hand, und alle drei verließen das Zimmer. Nachdem die Thür geschlossen war, beteten sie noch ein Vaterunser, und die Waschfrau sagte: »Komm' Sie morgen früh, um nach dem Kinde zu sehen. Winklere,« – und alsdann ging sie ihrem Hause zu.
Viertes Kapitel. Unter dem Stadtgraben.
Das Haus, in welchem die Frau Welscher wohnte, das ehemalige Kapuzinerkloster, war von außen durch die dasselbe umgebenden Häusermassen der benachbarten engen Straßen und des Stadtgrabens kaum sichtbar; es hatte sich, des Unschönen seines Aeußern bewußt, bereitwillig versteckt und war zufrieden, daß blos sein einziger allenfalls schöner Theil, – es war ein riesenhafter, treppenförmiger Hausgiebel, – über die andern Dächer hinwegblickte und daß eine alte rostige Wetterfahne mit stattlichem Kreuze heute noch, wie schon vor ein paar hundert Jahren, von den umliegenden Höfen deutlich gesehen wurde. Auch im Innern war das Kloster zur Zeit seines Bestehens in der damaligen Umgebung wenig interessant gewesen; heute aber, wenn man durch die Straße kam, wo all' die neuen Häuser standen, mit viereckigen Fenstern und eben solchen Thüren, geraden Treppen und hellen Gängen, konnte man sich eines gewissen Eindrucks nicht erwehren, wenn man in das ehemalige Kloster trat.
Der Eingang war in dem erwähnten kleinen Hofe, und an der massiven Thüre sah man deutlich das verstümmelte Wappen des gräflichen Geschlechts, unter dessen Protectorate das Kloster erbaut ward; hinter dieser Thür, die Tag und Nacht offen stand, gähnte ein langer finsterer Gang dem Eintretenden entgegen, und es dauerte eine Zeit lang, ehe in die Finsterniß einiges Licht kam, und zwar, wenn es draußen nicht gar zu dunkel war, durch eine kleine viereckige Oeffnung, die ins Freie gieng; dann bemerkte man, wenn sich das Auge etwas an die Dunkelheit gewöhnte, im Hintergrunde des Ganges von oben herab eine dürftige Helle, welche bei längerem Hinstarren die Formen einer alten Wendeltreppe erkennen ließ. Diese Helle kam aus dem ersten Stock, wo sich eine kleine Weinwirthschaft befand, welche recht sinnig das Refectorium des Klosters zu ihrem Gastzimmer gemacht.
Von den untern Räumen des Hauses war nichts bewohnbar, und in diesem feuchten, dunklen Gewölbe wurden Fässer aufbewahrt und allerlei Geräth, das den Miethsleuten des Klosters im Wege stand.
Die Wendeltreppe war von Stein und die einzige bequeme Einrichtung im Hause; gehörig breit und solid, wie sie war, konnten die Leute des Hauses die schwersten Lasten bequem auf ihr transportiren. Für die Kinder dieser Hausbewohner war sie nebenbei eine Quelle beständigen Vergnügens und ein Gegenstand stillen aber angenehmen Grauens; auf ihrem breiten Geländer rutschten die Knaben von oben hinunter, und auf den ungeheuren Ruheplätzen trieben die Mädchen ihre harmlosen Spiele. Vom zartesten Lebensalter an bis zu der Zeit, wo man die Schule verläßt, tummelten sich die Kinder, die in dem Kloster wohnten, auf der Treppe herum, und auf dem alten Steinwerk jauchzte und lachte es den ganzen Tag, rumorten und krabbelten eine Menge kleiner Geschöpfe beständig auf und nieder. Diese Treppe war ihre Gouvernante, ihre Amme, ihre Kleinkinderbewahr-Anstalt, und das dauerte den ganzen Tag, bis der Schatten des Abends begann zuerst den Fuß der Treppe und den untern Gang in tiefe Dunkelheit zu hüllen, und nun das erste Stockwerk, wo schon größere Fenster waren, und alsdann das zweite und zuletzt das dritte, wo ein großer Bogen im Dache die Treppe so lange erleuchtete, als überhaupt das Licht in der Natur noch nicht vollständig verschwunden war. Die, Kinder folgten allabendlich dem verschwindenden Licht, und dann hörten die lärmenden Spiele der Buben auf, sie kauerten zu den Mädchen hin auf den großen Ruheplätzen, zuerst auf dem ersten Stocke und dann auf dem zweiten, und wenn ihnen die unerbittliche, finstere Nacht überall geheimnißvoll und düster folgte, so saßen sie zuletzt noch an dem großen Dachbodenfenster und schauten in die goldene Abendluft und ließen ihre Gesichtchen bestrahlen von der letzten Gluth der untergehenden Sonne. In solchen Momenten stockte die lustige Unterhaltung der Kleinen, und aus dem dunkeln Treppenhause schienen schwarze Schatten emporzusteigen und mischten sich in die kindlich-frohen Gespräche; alsdann fröstelte es sogar den kecksten unter den Buben, die Kinder jedes Stockwerks drängten sich eng zusammen und suchten hastig, den Beherztesten an der Spitze, ihre Stuben auf, und bald war die Treppe leer und lag einsam und ausgestorben da.
Es ging nämlich die Sage, es sei in dem alten Kloster zur Nachtzeit nicht geheuer, und die verstorbenen Kapuziner wandelten oft gespensterartig darin herum; namentlich wäre, so hieß es, der Bruder Pförtner ein unruhiger Gesell und erscheine allabendlich auf der Erde, um sich schmerzlich zu überzeugen, daß die Thür, die er so sorgfältig verschlossen, allnächtlich offen stehen bliebe. Der Bruder Pförtner, dessen Ebenbild aus Holz geschnitzt mit einem großen Schlüsselbund am Gürtel unten an der Treppe stand, war übrigens ein harmloses Gespenst und hatte nie Jemanden etwas zu Leide gethan; viele Bewohner des Hauses erzählten gern und bereitwillig, daß ein Bruder, ein Onkel, eine Tante, ein Vetter den Kapuziner deutlich wandeln gesehen. Einer sogar behauptete, er habe ihn selbst husten gehört, und ein Schuster im dritten Stock, der von seinen stillen Wirthshausfreuden schon zu jeder Stunde der Nacht nach Hause gekommen war, sagte aus: Den Kapuziner habe er eigentlich nicht gesehen, wohl aber sei er im Stande, tausend Eide zu schwören, daß in einer Nacht die Statue an der Treppe verschwunden gewesen sei; er habe mit den Händen auf den leeren Fleck gefühlt, und am andern Morgen sei sie wieder unten gestanden, wie immer.
Tiefe Stille lag heute Abend in den untern Räumen des alten Hauses, sogar in der Schenkstube befanden sich des schlechten Wetters wegen nur zwei Gäste, welche vor dem helllodernden Feuer saßen, dessen Schein es war, welcher durch eine Oeffnung in der Thür die Treppe etwas Weniges beleuchtete; von hier aber ging sie finster in den zweiten Stock und lag da schmutzig und unreinlich mit Gemüse-Abfällen und Strohhalmen bedeckt; die Kalkwand, an der man sich hinauffühlen mußte, war glänzend und unangenehm schlüpfrig; im zweiten Stock waren die Bewohner alle in ihren Zimmern, darum hier Alles finster, und es kostete einige Mühe, in den dritten Stock hinauf zu tappen, wo die Frau Welscher wohnte.
Man muß nicht glauben, daß diese würdige Frau so hoch hinaufgezogen wäre, um wohlfeiler in der Miethe zu sitzen, sie hatte vielmehr die großen Räume und Bodenkammern, die zum Trocknen ihrer Wäsche unerläßlich waren, ins Auge gefaßt, sowie eine feuerfeste, gewölbte Küche, die ihr sehr zu Statten kam. Aus dieser Küche nun brach, so oft sich die Thür öffnete und so oft die hin- und herlaufenden Dienstmädchen die großen Ofenthüren aufstießen, ein gewaltiger Feuerschein auf den Gang hinaus und beleuchtete die schwarzen Wände und das Geländer der Treppe blutroth.
Die Wäsche der Frau Welscher war an dem heutigen Tage in