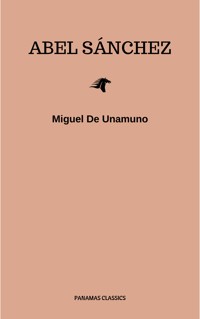17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Endlich die Neuauflage dieses Klassikers der Weltliteratur! Miguel de Unamuno zieht alle Register des Figurenspiels mit seinem unglücklichen Helden Augusto Pérez. Der eines Tages nach alter Gewohnheit auf die Straße tritt und sich sofort und unsterblich verliebt. In Eugenia, eine Klavierlehrerin wider Willen, die wiederum den nichtsnutzigen Neffen der Portiersfrau ihres Hauses liebt. Augusto macht die Erfahrung, daß man, wenn man liebt, die Liebe überall findet, so auch bei seiner Wäscherin Rosario. In seiner Verwirrung spricht er mit allen und jedem über seine Probleme, und sein Autor leistet ihm tatkräftige Hilfe: Dadurch gelingt es ihm, den vom Balkon gestürzten Vogelkäfig (samt Inhalt) der Tante seiner Angebeteten zu fangen, als er scheinbar zufällig, aber in Wirklichkeit vom Marionettenfaden seines Autors gezogen, an ihrem Haus vorbeikommt. Er verschafft sich damit ein bejubeltes Entrée in die Familie. Nach vielen äußerst komischen Verwicklungen und langen Gesprächen, an deren Ende Augustos Hochzeitspläne krachend gescheitert sind, wendet sich der Verzweifelte an Miguel de Unamuno, seinen Autor. Dieser versucht ihm klarzumachen, daß es mit seiner Selbständigkeit nicht allzuweit her ist, doch will Augusto nichts davon hören. Schließlich bleibt ihm als Gesprächspartner nur noch sein kleiner Hund Orpheus, der zuletzt gar die Grabrede auf ihn halten muß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Printausgabe: © Weidle Verlag 2022
Nebel erschien in dieser Form zuerst 1988 im Verlag Peter Selinka, Ravensburg, das spanische Original, Niebla, 1914 und revidiert 1935. Die Übersetzung von Otto Buek erschien zuerst 1927. Wir danken Susanne Marshall für die Genehmigung, das Nachwort von Wilhelm Muster nachdrucken zu dürfen. Ganz besonderer Dank gebührt Guenter ›Guenny‹ Rodewald.
In memoriam Oliver Selinka.
Durchsicht: Stefan Weidle
Kollationierung: Katharina Huhn
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: September 2022
ISBN 978-3-95988-221-7
Über das Buch
Miguel de Unamuno zieht alle Register des Figurenspiels mit seinem unglücklichen Helden Augusto Pérez. Der eines Tages nach alter Gewohnheit auf die Straße tritt und sich sofort und unsterblich verliebt. In Eugenia, eine Klavierlehrerin wider Willen, die wiederum den nichtsnutzigen Neffen der Portiersfrau ihres Hauses liebt. Augusto macht die Erfahrung, daß man, wenn man liebt, die Liebe überall findet, so auch bei seiner Wäscherin Rosario.
In seiner Verwirrung spricht er mit allen und jedem über seine Probleme, und sein Autor leistet ihm tatkräftige Hilfe: Dadurch gelingt es ihm, den vom Balkon gestürzten Vogelkäfig (samt Inhalt) der Tante seiner Angebeteten zu fangen, als er scheinbar zufällig, aber in Wirklichkeit vom Marionettenfaden seines Autors gezogen, an ihrem Haus vorbeikommt. Er verschafft sich damit ein bejubeltes Entrée in die Familie.
Nach vielen äußerst komischen Verwicklungen und langen Gesprächen, an deren Ende Augustos Hochzeitspläne krachend gescheitert sind, wendet sich der Verzweifelte an Miguel de Unamuno, seinen Autor. Dieser versucht ihm klarzumachen, daß es mit seiner Selbständigkeit nicht allzuweit her ist, doch will Augusto nichts davon hören. Schließlich bleibt ihm als Gesprächspartner nur noch sein kleiner Hund Orpheus, der zuletzt gar die Grabrede auf ihn halten muß.
Über den Autor
Miguel de Unamuno (1864 – 1936) stammt aus Bilbao. Er studierte Philologie in Madrid und erhielt 1891 eine Professur für Altgriechisch in Salamanca. Wegen seiner Angriffe gegen die Diktatur von Primo de Rivera wurde er 1923 auf die Insel Fuerteventura verbannt, von wo er nach Paris floh. Erst 1930 kehrte er nach Salamanca zurück. Niebla entstand 1914, 1935 erschien eine revidierte Fassung mit neuem Vorwort.
Miguel de Unamuno
Nebel
Roman
Übersetzung von Otto Buek, revidiert nach der dritten Ausgabe des Originals von Roberto de Hollanda und Stefan Weidle.
Vorwort zur dritten Ausgabe oder Die Geschichte von Nebel
Deutsch von Roberto de Hollanda und Stefan Weidle
Die erste Ausgabe dieses meines Werkes – ist es nur mein Werk? – erschien 1914 in der Biblioteca »Renacimiento«, die später Betrug und Betrügern zum Opfer fiel. Scheinbar gibt es eine zweite aus dem Jahre 1928, doch von dieser besitze ich nur bibliographische Kenntnis. Ich habe sie nicht gesehen, was nicht verwunderlich ist, denn damals war die Diktatur an der Macht und ich, der sie nicht anerkennen wollte, in der Verbannung, in Hendaye. Als man mich 1914 von meinem ersten Rektorat an der Universität von Salamanca vertrieb, genauer gesagt, mich aus dem Käfig entließ, fing für mich mit dem Ausbruch des Krieges der Nationen, der auch unser Spanien erschütterte, wenngleich dieses sich nicht daran beteiligte, ein neues Leben an.
Der Krieg teilte uns Spanier in Deutschenfreunde und Deutschenfeinde – Anhänger der Alliierten, wenn man so will. Die Einteilung entsprach allerdings eher unseren Temperamenten als den Anlässen des Krieges. Bei dieser Gelegenheit wurde der Kurs unserer späteren Geschichte, bis zur sogenannten Revolution von 1931, dem Selbstmord der bourbonischen Monarchie, vorgezeichnet. Damals fühlte ich mich vom Nebel unseres Spaniens, unseres Europas und sogar des menschlichen Universums umfangen. Jetzt, im Jahre 1935, da ich die Möglichkeit habe, Nebel erneut aufzulegen, habe ich es revidiert und beim Durchlesen in meinem Innern wiedererschaffen, wiedererlebt. Die Vergangenheit lebt von neuem auf; die Erinnerungen kehren ins Leben zurück und erschaffen sich noch einmal. Es ist ein neues Werk für mich, wie sicherlich auch für jene Leser, die es gelesen haben und nochmals lesen werden. Sollen sie mich dabei wiederlesen. Einen Augenblick dachte ich daran, es umzuschreiben, zu erneuern; doch dann wäre es ein anderes Buch. Ein anderes? Vor einundzwanzig Jahren – damals war ich fünfzig – erschien mir mein Augusto Pérez im Traum, als ich glaubte, ich hätte ihn sterben lassen, und reuevoll erwog, ihn wiederzuerwecken, und er fragte mich, ob ich es für möglich hielte, Don Quijote auferstehen zu lassen, und als ich antwortete: »Unmöglich!«, erwiderte er: »Nun, wir anderen Geschöpfe der Phantasie sind in derselben Lage.« Darauf ich: »Und wenn ich dich noch einmal träume?« Er: »Man träumt denselben Traum nicht zweimal. Der, den Sie dann träumen werden und von dem Sie meinen, er sei ich, wird ein anderer sein.« Ein anderer? Wie mich dieser andere verfolgt hat und noch verfolgt! Man braucht nur an meine Tragödie Der Andere zu denken. Und was die Möglichkeit anbelangt, Don Quijote wiederauferstehen zu lassen, so glaube ich, denjenigen von Cervantes wiedererweckt zu haben, und ich glaube, daß jeder, der über ihn nachdenkt und ihm zuhört, ihn zu neuem Leben erweckt. Die Gelehrten und Cervantisten selbstverständlich nicht. Sie erwecken den Helden, wie die Christen, indem sie Paulus von Tarsus folgen, Christus erwecken. So zumindest ist die Geschichte, das heißt die Legende. Eine andere Auferstehung gibt es nicht.
Ein Geschöpf der Phantasie? Ein Geschöpf der Wirklichkeit? Die Wirklichkeit der Phantasie ist die Phantasie der Wirklichkeit. Als ich eines Tages meinen Sohn Pepe, der damals fast noch ein Kind war, dabei überraschte, wie er ein Männchen malte und bei sich sagte: »Ich bin aus Fleisch, ich bin aus Fleisch, nicht gemalt!« und diese Worte auf das Männchen schrieb, da erlebte ich meine Kindheit und erschuf mich von neuem, und fast erschrak ich. Es war eine geistige Vision. Und vor kurzem fragte mich mein Enkel Miguelín, ob der Kater Felix – der der Kindermärchen – aus Fleisch sei. Er wollte sagen: lebendig. Und als ich ihm erklären wollte, das sei Märchen, Traum oder Lüge, erwiderte er: »Aber doch ein Traum aus Fleisch?« Hier haben wir eine ganze Metaphysik. Oder ein Metahistorie.
Ich dachte auch daran, die Biographie meines Augusto Pérez weiterzuführen, sein Leben in der anderen Welt, in einem anderen Leben zu schildern. Doch die andere Welt und das andere Leben finden sich in dieser Welt und in diesem Leben. Es gibt die Biographie und die universelle Geschichte einer bestimmten Persönlichkeit, sei sie nur historisch oder literarisch oder fiktiv. Einen Augenblick dachte ich daran, meinen Augusto eine Autobiographie schreiben zu lassen, durch die er mich berichtigen und erzählen könnte, wie er sich selbst geträumt hat. Ich würde den Bericht auf zwei verschiedene Arten beenden – vielleicht in zwei Spalten, und der Leser könnte wählen. Doch der Leser erträgt so etwas nicht, er duldet nicht, daß man ihn aus seinem Traum reißt und in den Traum von einem Traum versetzt, in das schreckliche Bewußtsein des Bewußtseins, dieses qualvolle Problem. Er will sich die Illusionen der Realität nicht nehmen lassen. Es heißt, ein Prediger vom Lande habe, als er vom Leid unseres Herrn berichtete und hörte, wie die bäuerlichen Betschwestern darüber in bittere Tränen ausbrachen, gesagt: »Weinet nicht, denn dies ereignete sich vor mehr als neunzehn Jahrhunderten, und vielleicht ist es auch nicht so geschehen, wie ich es euch erzähle …« In anderen Fällen aber sollte man den Zuhörern sagen: »Vielleicht war es wirklich so …«
Ich habe von einem an der Archäologie interessierten Architekten gehört, der eine Basilika aus dem zehnten Jahrhundert niederreißen und nicht restaurieren, sondern neu bauen wollte, so wie sie hätte gebaut werden sollen, nicht wie sie gebaut worden war. Nach einem Bauplan aus jener Zeit, den er angeblich gefunden hatte, dem Bauplan des Architekten des zehnten Jahrhunderts. Bauplan? Er wußte nicht, daß die Basiliken sich selbst erbaut, sich über die Baupläne hinweggesetzt und die Hände der Erbauer geführt haben. Auch für einen Roman, ein Epos oder ein Drama entwirft man einen Plan; doch später beherrschen der Roman, das Epos oder das Drama den, der sich für ihren Autor hält. Oder die handelnden Figuren, seine angeblichen Geschöpfe, drängen sich ihm auf. Wie zuerst Luzifer und Satan, dann Adam und Eva dem Jehova. Und das ist wirklich eine Nivola oder Epödie oder Trigödie! So hat sich mir mein Augusto Pérez aufgedrängt. Und als mein Werk erschien, hat unter seinen Kritikern Alejandro Plana, mein guter katalanischer Freund, diese Trigödie erkannt. Die anderen hielten sich aus geistiger Trägheit an meine diabolische Erfindung der Nivola.
Der Einfall, es Nivola zu nennen – ein Einfall, der genaugenommen nicht von mir stammt, wie ich im Text berichte –, war ein weiterer harmloser Trick, um die Neugier der Kritiker zu wecken. Ein Roman wie jeder andere soll es sein. Und wer sagt, daß die Zeit des Romans vorbei ist? Oder die des Epos? Solange die vergangenen Romane leben, wird auch der Roman leben und wieder zum Leben erweckt werden. Man muß Geschichte wiederträumen.
Bevor ich anfing, Augusto Pérez und seine Nivola zu träumen, hatte ich den Karlistenkrieg wiedergeträumt, dessen Zeuge ich in meiner Kindheit teilweise gewesen war, und Frieden im Krieg geschrieben, einen historischen Roman oder besser eine romanhafte Historie, um den akademischen Regeln des Genres zu entsprechen. Was man eben Realismus nennt. Was ich mit zehn Jahren erlebt hatte, erlebte ich mit dreißig, beim Schreiben dieses Romans, noch einmal. Und ich erlebe es wieder bei dem, was heute geschieht. Was heute vergeht und was bleibt. Später träumte ich Liebe und Pädagogik – das 1902 erschien –, eine andere qualvolle Tragödie. Qualvoll zumindest für mich. Ich wollte mich beim Schreiben dieser Qual entledigen, indem ich sie auf den Leser übertrug. In Nebel tauchte jener tragikomische, nebulöse und nivoleske Don Avito Carrascal wieder auf, der Augusto erzählte, man lerne zu leben nur, indem man lebt. Und zu träumen, indem man träumt. Es folgte 1905 Das Leben von Don Quijote und Sancho, erläutert und besprochen nach Miguel de Cervantes Saavedra. Aber nicht so, sondern wiedergeträumt, wiedererlebt und neu erschaffen. Daß mein Don Quijote und Sancho nicht die des Cervantes seien, wen interessiert das? Die Don Quijotes und Sanchos, die in der Ewigkeit leben – die innerhalb der Zeit liegt, nicht außerhalb; die ganze Ewigkeit in der ganzen Zeit und in jedem einzelnen ihrer Augenblicke –, sie gehören nicht nur Cervantes oder mir oder einem Träumer, der sie träumt, sondern werden von jedem einzelnen zu neuem Leben erweckt. Ich meinerseits glaube, daß Don Quijote mir jene intimsten Geheimnisse offenbart hat, die er Cervantes nicht zeigte, vor allem was seine Liebe zu Aldonza Lorenzo angeht. 1913, noch vor Nebel, erschienen die Erzählungen, die ich unter einem ihrer Titel, nämlich Der Spiegel des Todes, zusammenfaßte. Nach Nebel erschien dann 1917 Abel Sánchez: Geschichte einer Leidenschaft, die schmerzhafteste Erfahrung, die ich je machte, als ich mein Skalpell in das bösartige gemeinsame Geschwür unseres spanischen Volkes senkte. 1921 veröffentlichte ich meinen Roman Tante Tula, der in letzter Zeit – dank der Übersetzungen ins Deutsche, Holländische und Schwedische – in den Freudianischen Kreisen Mitteleuropas Aufnahme und Resonanz gefunden hat. 1927 erschien in Buenos Aires mein autobiographischer Roman Wie man einen Roman schreibt, was dazu führte, daß mein guter Freund und hervorragender Kritiker, Eduardo Gómez de Baquero, »Andrenio«, scharfsinnig wie er war, in eine ähnliche Falle wie die der Nivola tappte und kundtat, er habe erwartet, daß ich erklärte, wie man einen Roman schreibt. Schließlich erschien 1933 San Manuel Bueno, ein Märtyrer, und drei weitere Erzählungen. Alles im Verlauf desselben nebulösen Traums.
Einigen meiner Werke ist es – ohne mein Zutun – gelungen, in, soweit mir bekannt ist, fünfzehn verschiedene Sprachen übersetzt zu werden: in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Holländisch, Schwedisch, Dänisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Jugoslawisch, Griechisch und Lettisch; von allen diesen aber hat es Niebla zu den meisten Übersetzungen gebracht. 1921, sieben Jahre nach seinem Erscheinen, fing es mit Italienisch an: Nebbia, romanzo, übersetzt von Gilberto Beccari und mit einem Vorwort von Ezio Levi versehen; 1922 folgte Ungarisch, Köd (Budapest), übersetzt von Gárady Viktor; 1926 Französisch, Brouillard (Collection de la Revue Européenne), von Noémi Larthe; 1927 Deutsch, Nebel, ein phantastischer Roman (München), von Otto Buek; 1928 Schwedisch, Dimma, von Allan Vougt, Englisch, Mist, a tragicomic novel (New York), von Warner Fite, und Polnisch, Migła (Warschau), von Dr. Edward Boyé; 1929 Rumänisch, Negura (Bukarest), von L. Sebastián und Jugoslawisch: Magla (Zagreb), von Bogdan Raditsa; schließlich 1935 Lettisch: Migla (Riga), von Konstantin Raudive. Insgesamt zehn Übersetzungen, zwei mehr als meine Drei beispielhafte Novellen und ein Prolog, wozu auch Ein ganzer Mann gehört, erreicht haben.
Woher rührt diese Vorliebe? Warum hat dieses Buch, das von dem deutschen Übersetzer Otto Buek »phantastischer Roman« und dem Nordamerikaner Warner Fite »tragikomischer Roman« getauft wurde, in fremdsprachigen Ländern mehr Anklang als andere meiner Werke gefunden? Eben wegen seiner Phantasie und Tragikomik. Ich täuschte mich nicht, als ich von Anfang an vermutete – und es auch sagte –, daß dieses Werk, das ich Nivola nannte, mein am weitesten verbreitetes sein würde. Nicht Tragisches Lebensgefühl – sechs Übersetzungen –, denn dieses erfordert gewisse philosophische und theologische Kenntnisse, die nicht so geläufig sind, wie man zu glauben pflegt; daher war ich von seinem Erfolg in Spanien überrascht. Auch nicht mein Leben von Don Quijote und Sancho – drei Übersetzungen –, denn der Quijote von Cervantes ist außerhalb Spaniens (und sogar in unserem Land selbst) nicht so bekannt, wie die Literaten vermuten – und noch weniger populär. Und ich wage zu behaupten, daß Werke wie das meine dazu beitragen könnten, ihn mehr und besser bekannt zu machen. Kein anderes hatte so viel Erfolg. Wegen seines nationalen Charakters? Mein Frieden im Krieg ist nur ins Deutsche und Tschechische übersetzt worden. Es muß die Phantasie und Tragikomik von Nebel sein, die am eindringlichsten den einzelnen Menschen anspricht, den Menschen schlechthin, der über und unter allen Klassen, Kasten und sozialen Stellungen steht, arm oder reich ist, Plebejer oder Aristokrat, Proletarier oder Bourgeois. Und dies wissen die Geschichtsschreiber der Kultur, die man gebildet nennt.
Ich nehme an, der größte Teil dieses Prologs – Metalogs –, den manch einer selbstkritisch nennen würde, verdanke ich jenem in seinem Nebel versunkenen Don Antolín Sánchez Paparrigópulos – er verdient das Don –, von dem im dreiundzwanzigsten Kapitel die Rede ist, auch wenn es mir nicht gelungen ist, dabei die strenge Technik des unvergeßlichen und tiefgründigen Forschers anzuwenden. Ach, wenn ich es nur fertigbrächte, seinem Vorsatz folgend, die Geschichte derer in Angriff zu nehmen, die, obwohl sie zu schreiben gedachten, nicht dazu kamen! Dieses Charakters, dieser Art sind unsere besten Leser, unsere Mitarbeiter und Mitautoren – besser Mitschöpfer –, die beim Lesen einer Geschichte wie dieser – einer Nivola, wenn man so will –, denken: »Das habe ich doch früher schon gedacht! Ja, diese Person habe ich gekannt! Mir ist doch dasselbe eingefallen!« Wie anders als die Gefangenen einer erdrückenden Plattheit, die sich nur um das, was sie Wahrscheinlichkeit nennen, sorgen! Oder diejenigen, die meinen, in wachem Zustand zu leben, und nicht wissen, daß nur derjenige wirklich wach ist, der das Bewußtsein hat, zu träumen, wie nur derjenige klug ist, der um seinen Wahnsinn weiß. Und »wer nicht andere verwirrt, verwirrt sich selbst«, wie Víktor Goti, mein Verwandter, zu Augusto Pérez sagte.
Diese meine Welt von Pedro Antonio und Josefa Ignacia, von Don Avito Carrascal und Marina, von Augusto Pérez, Eugenia Domingo und Rosarito, von Alejandro Gómez, dem »ganzen Mann«, und Julio, von Joaquín Monegro, Abel Sánchez und Elena, von Tante Tula, ihrer Schwester, ihrem Schwager und ihren Neffen und Nichten, von San Manuel Bueno und Angela Carballino – einem Engel – und von Don Sandalio und Emeterio Alfonso und Celedonio Ibáñez und von Ricardo und Liduvina, diese ganze Welt ist für mich wirklicher als die von Cánovas und Sagasta, von Alfons XIII, von Prima de Rivera, von Galdós, Pereda, Menéndez y Pelayo und all denen, die ich zu ihren Lebzeiten kennenlernte oder noch kenne; mit einigen habe ich verkehrt oder tue es heute noch. In jener Welt jedoch werde ich mich, wenn überhaupt, eher verwirklichen als in dieser.
Und unterhalb dieser beiden Welten gibt es noch eine Welt, die die anderen stützt, eine wesentliche, ewige Welt, in der ich mich selber und diejenigen träume, die Fleisch von meinem Geist und Geist von meinem Fleisch waren, eine Welt des Bewußtseins ohne Raum und Zeit, in der, wie die Welle im Meer, das Bewußtsein meines Körpers seine Wohnung hat. Als ich mich weigerte, meinen Augusto Pérez zu begnadigen, sagte dieser: »Sie wollen mich also kein Ich sein lassen, mir nicht erlauben, aus dem Nebel herauszutreten und zu leben, leben, mich nicht hören, fühlen, tasten, leiden lassen? Ich soll nicht sein? Sie wollen also nicht? Ich soll also sterben, als Phantasiewesen sterben? Nun denn gut, mein Herr und Schöpfer, Don Miguel. Auch Sie werden sterben, auch Sie … Sie werden in das Nichts zurücksinken, aus dem Sie hervorgegangen sind! Gott wird aufhören, von Ihnen zu träumen. Ja, Sie werden sterben, jawohl, sterben, auch wenn Sie sich noch so sehr dagegen sträuben. Sie werden sterben, Sie und alle die, die meine Geschichte lesen werden: alle, alle, alle. Nicht einer wird verschont bleiben! Phantasiewesen – ihr alle – Phantasiewesen – wie ich! Ihr alle, alle, alle werdet sterben.« Das sagte er mir, und seit über zwanzig Jahren vernehme ich das wie beim biblischen Jehova kaum hörbare und furchterregende Säuseln dieser prophetischen und apokalyptischen Worte! Denn nicht nur ich komme dem Tod immer näher, sondern die Meinen sind mir gestorben, jene, die mich besser erschufen und träumten. Tropfen um Tropfen hat sich die Seele aus meinem Körper verflüchtigt – und manchmal gar in Strömen. Arme Narren, die da glauben, ich sorgte mich um meine eigene persönliche Unsterblichkeit! Arme Leute! Nein, ich sorge mich um die Unsterblichkeit all derer, die ich geträumt habe und noch träume, all derer, die mich träumen und die ich träume. Denn die Unsterblichkeit ist wie der Traum entweder allen gemeinsam, oder sie ist nicht. Ich kann mich an niemanden erinnern, den ich wirklich gekannt habe – jemanden wirklich zu kennen heißt, ihn zu lieben, auch wenn man glaubt, ihn zu hassen – und der dahingegangen wäre, ohne mir Alleingebliebenem zu sagen: »Was bist du jetzt? Was ist jetzt mit deinem Bewußtsein? Was bin ich jetzt darin? Was ist mit dem, was war?« Das ist der Nebel, das ist die Nivola, das ist die Legende, das ewige Leben … Und das ist das Wort der Schöpfung, des Traumes.
Es gibt eine strahlende Vision von Leopardi, dem tragischen Träumer des Lebensüberdrusses, den Gesang des wilden Hahns, eines riesigen Hahns, der einem aramäischen Bibeltext entstammt, der die ewige Offenbarung verkündet und die Sterblichen zum Aufwachen ruft. Diese Vision endet so: »Die Zeit wird kommen, da dieses Universum und die Natur erschöpft sein werden. Und wie von den größten Reichen der Menschen und den erstaunlichsten Begebenheiten in ihnen, die in anderen Epochen hochberühmt waren, heute weder Zeichen noch Ruhm zurückgeblieben sind, ebenso wird von der ganzen Welt, den endlosen Wechselfällen und Katastrophen der geschaffenen Dinge nicht einmal eine Spur bleiben, sondern nacktes Schweigen und unergründliche Stille werden den weiten Raum erfüllen. So wird dieses bewundernswerte und schreckliche Geheimnis der universellen Existenz, bevor es verkündet oder verstanden worden wäre, sich auslöschen und vergehen.«
Doch nein, der Gesang des wilden Hahns und mit ihm das Säuseln Jehovas wird bleiben; und bleiben wird das Wort, das der Anfang war und das letzte sein wird, der Hauch des geistigen Lautes, der die Nebel verfestigt. Augusto Pérez verkündet allen, uns allen, die ich waren und sind, allen, die wir den Traum Gottes bilden – oder besser den Traum seines Wortes –, daß wir sterblich sind. Sie sterben mir dahin im materiellen Fleisch, doch nicht im Fleisch des Traums, im Fleisch des Bewußtseins. Daher sage ich euch, Lesern meines Nebel, Träumern meines Augusto Pérez und seiner Welt, dies ist der Nebel, dies ist die Nivola, dies ist die Legende, dies die Geschichte, das ewige Leben.
Salamanca, Februar 1935
Miguel de Unamuno
Vorwort
Da Don Miguel de Unamuno darauf besteht, daß ich diesem Buche, in dem die traurige Geschichte meines guten Freundes Augusto Pérez und seines geheimnisvollen Todes erzählt wird, eine Vorrede vorausschicken solle, kann ich mich dieser Aufforderung nicht entziehen, denn der Wunsch Herrn Unamunos ist mir Befehl. Ohne daß ich bei jenem äußersten hamletschen Skeptizismus meines armen Freundes Pérez angelangt wäre, der schließlich sogar an seiner eigenen Existenz zu zweifeln begann, bin ich doch fest davon überzeugt, daß ich nicht im Besitz jenes freien Willens bin, von dem die Psychologen sprechen, obwohl ich gleichzeitig den tröstlichen Glauben hege, daß auch Don Miguel dieses freien Willens ermangelt.
Es wird vielleicht manchem unserer Leser seltsam erscheinen, daß ich, ein in der spanischen Literatur noch völlig unbekannter Autor, eine Vorrede zu dem Buche Don Miguels schreiben soll, dessen Name doch bereits einen angesehenen Platz in unserem Schrifttum behauptet; ist es doch vielmehr Brauch und Sitte, daß gerade die bekanntesten Schriftsteller Vorreden zu den Büchern der weniger bekannten Autoren schreiben und diese den Lesern vorstellen. Allein Don Miguel und ich haben uns bereits hierüber geeinigt, daß wir diesen verderblichen Brauch umstürzen und das Verhältnis umkehren wollen und daß in diesem Fall der unbekannte Autor dem Leser den bekannten vorstellen solle. Werden doch Bücher vor allem wegen des Textes und nicht wegen der Vorrede gekauft, und daher ist es nur natürlich, daß ein junger Anfänger, der wie ich den Wunsch hat, bekannt zu werden, statt einen Veteranen der Literatur zu bitten, er solle zu seiner, des Anfängers, Einführung eine Vorrede zu einem seiner Werke schreiben, ihn vielmehr um die Erlaubnis bittet, das Vorwort zu einem Werk des berühmten Schriftstellers verfassen zu dürfen. Und das ist zugleich die Lösung eines der Probleme, die der ewige Prozeß zwischen den Jungen und den Alten immer wieder aufwirft.
Außerdem gibt es auch noch mancherlei enge Beziehungen, die mich mit Don Miguel de Unamuno verknüpfen. Abgesehen davon, daß dieser Herr in dem vorliegenden Werke – sei es nun eine Novelle oder eine Nivola (denn es steht fest, daß diese Idee von der »Nivola« meine eigenste Erfindung ist!) – eine ganze Reihe von Unterhaltungen zwischen mir und dem unglücklichen Augusto Pérez sowie Aussprüche, die ich ihm gegenüber getan habe, zum besten gibt, und daß er darin auch die Geschichte von meinem spätgeborenen Sohn Victorcito erzählt, scheint es auch, daß ich, wenngleich nur entfernt, mit Don Miguel verwandt bin, denn mein Familienname ist dem eines seiner Vorfahren gleich, wie dies mein Freund Antolín S. Paparrigópulos, dieser in der gelehrten Welt höchst bekannte Mann, auf Grund seiner tiefgründigen genealogischen Untersuchungen festgestellt hat.
Ich kann nicht voraussehen, was für eine Aufnahme diese Nivola bei dem Publikum und bei den Lesern Don Miguels finden wird und ob sie auf deren Beifall oder Ablehnung wird rechnen können. Seit längerer Zeit schon verfolge ich mit der größten Aufmerksamkeit den Kampf, den Don Miguel gegen die Naivität des Publikums führt, und ich bin wirklich erstaunt über ihre Tiefe und Arglosigkeit. Gewisse Artikel, die Don Miguel im »Mundo Grafico« und in anderen, ähnlichen Zeitschriften veröffentlichte, hatten zur Folge, daß er eine Reihe von Briefen und Ausschnitte aus Provinzzeitungen zugesandt erhielt, die den ganzen Schatz an unschuldiger Treuherzigkeit und taubenhafter Einfalt widerspiegeln, der sich noch in unserem Volk erhalten hat. Einmal wird darin auch an jenen Satz Unamunos erinnert, daß Herr Cervantes (Don Miguel) nicht ganz ohne Talent gewesen sei, und man ist höchst empört über diesen Mangel an Ehrfurcht. Andere sind wieder gerührt über Don Miguels melancholische Betrachtungen, zu denen ihm der Blätterfall im Herbst Anlaß gibt, oder sie begeistern sich für seinen Ruf: Krieg dem Kriege!, den ihm der Schmerz darüber entrang, daß die Menschen sterben, obwohl sie niemand tötet. Oder sie zitieren jene Handvoll ganz unparadoxer Wahrheiten, die er in allen möglichen Cafés, Zirkeln und an Stammtischen gesammelt hat, woselbst sie sich herumtrieben und durch das ewige Von-Hand-zu-Hand-Gehen, Betasten und Befühlen bereits in Fäulnis überzugehen begannen, den üblen Geruch dieses ordinären Milieus um sich verbreitend; denn die, die sie zitierten, hatten sie als ihr eigenstes Eigentum erkannt. Es gab auch sanfte, unschuldsvolle Tauben ohne ein Tröpfchen Arglist, die sich darüber empörten, daß dieser Logomach Don Miguel das Wort Cultur zuweilen mit einem großen K schreibt, und nachdem er sich eine große Geschicklichkeit in der Erfindung unterhaltender Späße zugeschrieben, sich für unfähig erklärt, Kalauer und Wortspiele zu machen; denn bekanntlich laufen für dies naive Publikum Talent oder Genie, sowie Unterhaltung und Zerstreuung auf Kalauer und Wortspiele hinaus.
Es ist noch gut, daß dieses naive Publikum eine andere Teufelei Don Miguels übersehen zu haben scheint, den oft die Laune ankommt, sich einen Scherz zu leisten, indem er zum Beispiel einen Artikel schreibt, dabei aufs Geratewohl einzelne Worte unterstreicht, und dann die Blätter durcheinandermischt, damit er später selbst nicht mehr feststellen kann, welche Worte das waren. Als er mir dies einmal erzählte, fragte ich ihn, warum er so etwas täte, worauf er mir antwortete: »Was weiß ich … weil ich meinen Spaß daran habe. Um eine Pirouette zu machen. Und überdies, weil mich die unterstrichenen und in Kursivschrift gedruckten Worte ärgern und mir die Laune verderben. Das heißt doch den Leser beleidigen, ihn für dumm erklären, da man zu ihm zu sprechen scheint: paß auf, Mann, paß auf, hier liegt eine besondere Absicht vor! Und daher habe ich einem Autor empfohlen, er solle alle seine Artikel durchweg in Kursivschrift schreiben, damit das Publikum daraus ersehe, daß sie alle – vom ersten bis zum letzten Wort – wohldurchdacht und beabsichtigt wären. Das ist nichts anderes als eine Gestik der Schriftzüge, der Versuch, durch die Gebärde ausdrücken zu wollen, was nicht durch den Akzent und den Tonfall ausgedrückt werden kann. Sieh dir nur die Zeitungen der äußersten Rechten an, Freund Víctor, jener Partei, die man Integralismus nennt, und du wirst bemerken, welchen Mißbrauch sie mit der Kursivschrift, den Kapitälchen, den Großbuchstaben, den Ausrufungszeichen sowie allen typographischen Hilfsmitteln treiben. Pantomime, Pantomime – nichts als Pantomime! So primitiv sind ihre Ausdrucksmittel, oder richtiger, so gut verstehen sie die naive Einfalt ihrer Leser! Und mit dieser Einfalt muß einmal aufgeräumt werden.«
Zuweilen auch habe ich Don Miguel behaupten hören, daß das, was man hier Humor – den echten nämlich – nennt, in Spanien nie recht Wurzel geschlagen habe und daß er dort in absehbarer Zeit schwerlich Wurzeln schlagen könne. Die Leute, die sich hier Humoristen nennen, sind, nach der Ansicht Don Miguels, entweder Satiriker oder Ironiker, wenn sie nicht gar einfache Spaßmacher sind. Einen Taboada z. B. einen Humoristen nennen heißt Mißbrauch mit diesem Wort treiben. Auch gibt es nichts weniger Humorvolles als die bittere, aber deutliche und durchsichtige Satire eines Quevedo, aus der man sofort die Predigt heraushört. »Wir haben nur einen Humoristen gehabt«, sagte mir einmal Don Miguel, »das ist Cervantes, und wenn dieser wiederauferstünde, wie würde er da wohl über die lachen, die sich darüber empörten, daß ich einmal erklärt habe, er wäre nicht ohne Geist und Talent gewesen; vor allem aber, wie würde er über jene naiven Leute lachen, die einige von seinen feinsten Späßen ernst genommen haben. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß er den Scherz sehr ernst nahm und daß er den Stil der Ritterbücher nachgeahmt und karikiert hat. Die bekannte Stelle: ›Kaum war der rotwangige Phöbus‹ usw., die gewisse naive Cervantisten uns als Muster eines guten Stils hinstellen, ist sicherlich nichts anderes als eine geistreiche Parodie auf den literarischen Barockstil. Gar nicht davon zu reden, daß diese Leute es für einen besonders geistvollen Zug halten, daß Cervantes ein Kapitel mit den Worten beginnt: ›Es war wohl die der Morgendämmerung‹, da das vorhergehende Kapitel mit dem Worte ›Stunde‹ (Hora) schließt. Unser Publikum ist natürlich, wie jedes wenig gebildete Publikum, sehr mißtrauisch, ebenso wie unser ganzes Volk. Keiner wünscht, daß man seinen Spaß mit ihm treibe, ihn hänsele, düpiere oder lächerlich mache, und wenn man mit ihm spricht, dann will er wissen, woran er sich halten soll, ob es im Scherz oder im Ernst geschieht. Ich möchte bezweifeln, daß es ein anderes Volk gibt, das sich so aus der Fassung bringen läßt, wenn man Scherz und Ernst miteinander mischt, und wer von uns kann es ertragen, nicht zu wissen, ob eine Sache ernst gemeint ist oder nicht? Es ist äußerst schwierig für einen mißtrauischen Spanier des Mittelstandes, zu begreifen, daß eine Sache ernst und scherzhaft zugleich gemeint, Wahrheit und doch Spaß sein kann – und zwar beides in derselben Hinsicht.«
Don Miguel hat eine gewisse Vorliebe für tragische Scherze, und er hat mir mehr als einmal gesagt, daß er nicht sterben möchte, ohne eine tragische Komödie oder eine komische Tragödie geschrieben zu haben, aber keine, in der das Komische und das Tragische nur miteinander gemischt oder bloß nebeneinandergestellt sind, sondern eine solche, in der sie verschmolzen und ineinander verschlungen sind. Als ich ihn darauf hinwies, daß das ja nichts anderes als zügelloseste Romantik sei, entgegnete er mir: »Das leugne ich gewiß nicht, aber damit, daß man ein Ding mit irgendeinem Namen bezeichnet, ist noch nichts erreicht. Obwohl ich bereits mehr als zwanzig Jahre Vorlesungen über die antiken Klassiker halte, will es mir nicht in den Kopf, daß der Klassizismus einen Gegensatz zur Romantik bildet. Man sagt, es sei eine Eigentümlichkeit des Griechentums: zu unterscheiden, zu trennen, zu definieren. Nun denn, meine Eigentümlichkeit ist es, die Dinge in ihrer Unbestimmtheit zu belassen, miteinander zu vermischen und vermengen.«
Der eigentliche Grund hierfür ist nichts anderes als eine Lebensanschauung oder besser ein Lebensgefühl, das ich nicht als pessimistisch zu bezeichnen wage, weil ich weiß, daß dieses Wort Don Miguel mißfällt. Er hat die fixe Idee, daß, wenn seine Seele nicht unsterblich ist und wenn die Seelen der anderen Menschen sowie die aller Dinge gleichfalls nicht in demselben Sinne unsterblich sind, wie dies die naiven, katholisch gläubigen Menschen des Mittelalters annahmen, überhaupt nichts einen Wert hat und daß es dann nichts gäbe, was die Mühe einer besonderen Anstrengung lohnte. Hieraus sei auch die Lehre Leopardis vom Lebensüberdruß entsprungen, nachdem die große Täuschung von ihm gewichen war: ch’io eterno mi credea – sich für unsterblich zu halten. Daraus erklärt es sich auch, daß die drei Lieblingsautoren Don Miguels Sénancour, Quental und Leopardi sind. Allein dieser strenge und bittere Humor, der alle Dinge durcheinandermischt, verletzt nicht nur unsere mißtrauischen Landsleute, die, sobald ihnen einer was sagt, sofort wissen wollen, was sie davon halten sollen, er beunruhigt auch viele ernstlich. Man will wohl lachen, aber nur der guten Verdauung wegen, um seine Sorgen loszuwerden, und nicht, um das wieder von sich zu geben, was man unvernünftigerweise verschlungen hat und womit man sich den Magen verderben kann, noch weniger aber, um wirklich mit seinen Sorgen fertig zu werden. Don Miguel hat es sich in den Kopf gesetzt, daß, wenn man die Leute zum Lachen bringen wolle, dies nicht deswegen geschehen müsse, um mit Hilfe von Zwerchfellerschütterungen ihre Verdauung zu fördern, sondern nur dazu, damit sie das wieder von sich geben, was sie verschlungen haben; denn der Sinn des Lebens und des Weltalls erschließt sich uns mit weit höherer Klarheit, wenn unser Magen leer ist, als wenn er mit allerhand Leckerbissen und schwerverdaulichen Speisen überladen ist. Und er will nichts hören von dieser Ironie ohne Galle, noch von dem sogenannten feinen diskreten Humor, denn er sagt, da, wo die Galle fehle, gäbe es auch keine Ironie, und er behauptet, daß die Diskretion stets mit dem Humor, oder, wie er sich auszudrücken liebt, mit dem »Unhumor« im Streite läge.
Dies alles legt ihm eine recht unangenehme und undankbare Aufgabe auf, von der er sagt, sie sei nur eine Art Massage der Einfalt des Publikums, die den Zweck habe, festzustellen, ob der Gesamtgeist unseres Volkes allmählich etwas beweglicher werde und sich etwas verfeinere. Don Miguel gerät ganz außer sich, wenn jemand ihm sagt, daß unser Volk, besonders aber seine südlichen Stämme, geistreich seien. »Ein Volk, das sich seine Erholung und Zerstreuung bei Stierkämpfen sucht und Abwechslung und Genuß an solchen primitiven Schaukünsten findet, ist, was seine Mentalität anbetrifft, gerichtet«, sagt er. Und es gibt, wie er hinzufügt, keine primitivere und stumpfere Mentalität als die eines Stierkampfenthusiasten. Kommen Sie mal einem Menschen, der noch soeben über den Degenstich eines Vicente Pastor in Begeisterung geraten konnte, mit mehr oder minder humoristischen Paradoxen! Und Don Miguel verabscheut dies komische Genre der Stierkampf-Chronisten, dieser Priester der Wortspiele und all der groben, minderwertigen Erzeugnisse eines ordinären Geistes.
Wenn man noch das Spiel mit metaphysischen Begriffen hinzunimmt, in dem Don Miguel sich gefällt, so wird man verstehen, daß es viele Menschen gibt, die seine Bücher ärgerlich beiseitelegen und ihn nicht lesen mögen, die einen, weil solche Dinge ihnen Kopfschmerzen bereiten, die anderen, weil sie der Meinung sind, daß sancta sancte tractanda sunt, das heißt, daß heilige Dinge mit Würde behandelt werden müssen, und die daher erklären, daß diese Begriffe nicht zum Anlaß für Scherze und geistreiche Spiele genommen werden dürfen. Don Miguel entgegnet hierauf, er verstünde nicht, warum die geistigen Söhne solcher Menschen, die sich über die heiligsten Dinge, das heißt über die tröstlichsten Lehren des Glaubens und über die Hoffnungen ihrer Brüder lustig machten, die Forderung aufstellen dürfen, gewisse Dinge müßten durchaus ernst behandelt werden. Wenn es Menschen gab, die über Gott spotteten, warum sollen wir uns nicht auch über die Vernunft, über die Wissenschaft, ja sogar über die Wahrheit lustig machen? Und wenn man uns unsere teuerste innerste Lebenshoffnung raubt, warum sollten wir da nicht alles durcheinandermengen, um uns die Zeit zu vertreiben, uns die Ewigkeit aus dem Sinn zu schlagen und uns so zu rächen?
Es kann auch leicht sein, daß jemand kommen und sagen wird, es gäbe in diesem Buch schlüpfrige oder, wenn man will, sogar pornographische Stellen. Don Miguel hat jedoch schon vorgesorgt und mich in dieser Nivola einiges hierüber sagen lassen. Und er würde aufs heftigste gegen einen solchen Vorwurf protestieren und erklären, daß die Härten und Schroffheiten, die in diesem Buch vorkommen mögen, weder die Begierden des sündigen Fleisches reizen sollen noch einen andern Zweck haben, als für die Phantasie den Ausgangspunkt und Anlaß zu anderen Betrachtungen und Überlegungen zu bilden.
Sein Abscheu gegen jede Art von Pornographie ist allen denen, die ihn kennen, nur allzu bekannt. Nicht nur aus den landläufigen moralischen Gründen verwirft er sie, sondern vor allem, weil er der Meinung ist, daß die Wollust am meisten geeignet ist, unseren Intellekt zu verderben. Die pornographischen oder auch bloß erotischen Schriftsteller erscheinen ihm als die unintelligentesten, als die, die am wenigsten Geist haben oder, kurz gesagt, als die dümmsten. Ich habe Don Miguel sagen hören, daß von den drei klassischen Lastern: die Leidenschaft für die Weiber, das Spiel und der Wein, die beiden ersten den Geist mehr schädigten als das dritte, und es steht doch fest, daß Don Miguel nichts anderes als Wasser trinkt. »Mit einem Betrunkenen kann man wenigstens noch reden«, sagte er mir einmal, »ja, ein solcher kann mitunter sogar ganz vernünftige Dinge sagen, aber wer kann eine Unterhaltung mit einem Spieler oder einem Schürzenjäger ertragen? Es gibt nichts Ordinäreres und Minderwertigeres, es sei denn vielleicht das Gerede eines Stierkampfenthusiasten, dieser Gipfel und Inbegriff der Stupidität.«
Andererseits aber wundere ich mich wiederum keineswegs über die Verbindung des erotischen Elements mit dem metaphysischen, denn ich glaube zu wissen, daß unsere Völker, wie ihre literarischen Denkmäler dies beweisen, zuerst Krieger und Priester waren, um erst später Erotiker und Metaphysiker zu werden. Der Frauenkult fiel zusammen mit dem Kult des manierierten Ausdrucks. Während der geistigen Morgendämmerung unserer Völker, d. h. während des Mittelalters, wurde die noch gänzlich barbarische Gesellschaft der Menschen von mächtigen religiösen, ja von mystischen und kriegerischen Gefühlen beherrscht; der Schwertknauf war ein Kreuz – die Frau dagegen behauptete nur einen geringen und sekundären Platz in ihrer Einbildungskraft, und die eigentlichen philosophischen Ideen schlummerten, in ein theologisches Gewand gehüllt, in den Klosterzellen. Das erotische und das metaphysische Element kommen gleichzeitig zur Entwicklung. Die Religion ist kriegerisch, und die Metaphysik ist erotisch oder sinnlich.
Es ist die Religiosität, die den Menschen kriegerisch oder kampflustig macht, oder es ist die Kampflust, die ihn zur Religion führt. Andererseits ist es der metaphysische Instinkt, die Neugier auf alles, was uns nichts angeht – die Ursünde also –, die den Menschen sinnlich und begehrlich macht; oder richtiger: Es ist die Sinnlichkeit, die – wie Eva – den metaphysischen Instinkt und damit den Wunsch in uns weckt, von der Erkenntnis des Guten und Bösen zu kosten. Und so kommt es zur Mystik, zu einer Metaphysik der Religion, die aus der sinnlichen Begierde, der Kampflust entspringt.
Das war es, was jene Kurtisane aus Athen, von der uns Xenophon erzählt, sehr wohl verstanden hat. In dem von diesem mitgeteilten Gespräch zwischen ihr und Sokrates macht sie dem Philosophen, begeistert von seiner Art der Wahrheitserforschung oder richtiger von seiner Art, bei der Entdeckung der Wahrheit den Geburtshelfer zu spielen, den Vorschlag, er solle die Stelle des Kupplers bei ihr vertreten und ihr helfen, sich Liebhaber zu erjagen. (Synthérates, also Jagdgenosse, lautet der Text nach Don Miguel, der ja Professor der griechischen Sprache ist und dem ich diese höchst aufschlußreiche Notiz verdanke.) Aus dieser ganzen, äußerst interessanten Unterhaltung zwischen der Kurtisane Theodata und Sokrates, dem Geburtshelfer unter den Philosophen, erkennt man mit größter Deutlichkeit, welche Verwandtschaft zwischen diesen beiden Berufen besteht und wie die Philosophie zu ihrem größten Teil und in ihrem besten Sinne Kuppelei ist.
Und wenn dies alles doch nicht so wäre, wie ich sage, wird niemand abstreiten können, daß es geistreich ist, und das genügt.
Ich kann freilich nicht verheimlichen, daß mein geliebter Lehrer, Don Fulgencio Entrambosmares de Aquilón, über den uns Don Miguel in seiner Novelle oder Nivola »Liebe und Pädagogik« so ausführlich berichtet hat, nicht mit dieser meiner Unterscheidung zwischen Religion und Kriegsgeist einerseits und Philosophie und Erotik andererseits einverstanden sein wird. Ich nehme an, der berühmte Autor der Ars magna combinatoria würde folgende Möglichkeiten unterscheiden: eine kriegerische Religion und eine erotische Religion, eine kriegerische Metaphysik und eine erotische Metaphysik, eine religiöse Erotik und eine metaphysische Erotik, einen metaphysischen Kriegsgeist und einen religiösen Kriegsgeist, und andererseits wiederum eine metaphysische Religion und eine religiöse Metaphysik, eine kriegerische Erotik und einen erotischen Kriegsgeist, wozu dann noch die religiöse Religion und die metaphysische Metaphysik hinzukämen, was zusammen sechzehn binäre Kombinationen ergibt, wobei noch gar nichts von den dreifachen Kombinationen dieser Gattung gesagt wäre, also z. B. von einer metaphysisch-erotischen Religion oder einer kriegerisch-religiösen Metaphysik. Aber ich besitze weder das unerschöpfliche kombinatorische Genie Don Fulgencios noch den heftigen Drang zur Vermengung der Dinge und die Abneigung gegen alle Definitionen, die Don Miguel eigen sind.
Ich hätte noch vielerlei über den unerwarteten Ausgang dieser Geschichte und über die Version zu sagen, die Don Miguel in ihr vom Tode meines unglücklichen Freundes Augusto gibt, eine Version, die ich für falsch halte, aber darüber kann ich hier in diesem einleitenden Prolog nicht reden. Immerhin muß ich zur Entlastung meines Gewissens eine Feststellung machen, d. h. meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, daß Augusto Pérez nur seinen eigenen Vorsatz, sich das Leben zu nehmen, von dem er mir bei unserer letzten Begegnung Mitteilung machte, ausgeführt und sich wirklich und tatsächlich selbst getötet hat, und nicht bloß in der Idee und der Absicht nach. Ich bin überzeugt, glaubwürdige Beweise zu besitzen, die meine Meinung stützen, Beweise, die so gut und so zahlreich sind, daß diese Auffassung keine bloße Meinung mehr, sondern wirkliche Erkenntnis ist.
Und hiermit will ich meine Vorrede beschließen.
Víctor Goti
Nach-Vorwort
Gern würde ich hier etwas näher auf einige der Bemerkungen meines Vorwortschreibers Víctor Goti eingehen, aber da mir das Geheimnis seiner Existenz – der Existenz Gotis – bekannt ist, ziehe ich es vor, ihm die ganze Verantwortung für das, was er in diesem Vorwort sagt, zu überlassen. Da ich es überdies war, der ihn gebeten hat, eine Einführung in mein Werk zu schreiben, und da ich mich im voraus oder a priori dazu verpflichtet habe, es ganz so und in der Fassung, wie er es mir einhändigen würde, zu akzeptieren, kann ich es natürlich weder zurückweisen noch mich darauf einlassen, nachträglich oder a posteriori Korrekturen und Richtigstellungen darin vorzunehmen. Eine ganz andere Frage ist es jedoch, ob ich ihm gewisse Werturteile, die er in diesem Vorwort fällt, durchgehen lassen darf, ohne meine eigene Meinung zu ihnen zu äußern.
Ich weiß nicht, wie weit es zulässig ist, von vertraulichen Mitteilungen und von Herzensergüssen, die dem Busen eines uns durch innigste Freundschaft verbundenen Menschen anvertraut wurden, Gebrauch zu machen und Meinungen oder Werturteile der Öffentlichkeit zu übergeben, die nur für den bestimmt waren, dem sie mitgeteilt wurden. Goti aber hat in seinem Vorwort die Indiskretion begangen, dem Publikum Ansichten von mir preiszugeben, die ich nie der Öffentlichkeit zu unterbreiten beabsichtigte. Jedenfalls hatte ich nie den Wunsch, daß sie so, das heißt in der schroffen Form und Fassung, wie ich sie in Privatgesprächen geäußert haben mag, bekannt würden.
Was übrigens seine Behauptung anbetrifft, daß der unglückliche Augusto … warum soll er übrigens »unglücklich« gewesen sein?; aber nehmen wir an, er sei es in der Tat gewesen. Gotis Behauptung also, der »unglückliche« oder was er immer gewesen sein mag – der »unglückliche« Augusto Pérez habe sich selbst getötet und sei nicht in der Weise gestorben, wie ich dies hier, das heißt auf Grund meines allerfreisten Entschlusses und meiner souveränen Entscheidung, erzähle, kann mir nur ein Lächeln abnötigen. Denn es gibt tatsächlich Ansichten, die nicht mehr als ein Lächeln verdienen. Überdies aber möchte ich meinem Freund Goti, dem Autor dieses Vorworts, empfehlen, bei der Darlegung meiner Absichten mit der größten Behutsamkeit vorzugehen, denn wenn er mich langweilt, könnte ich es ebenso mit ihm machen, wie ich es mit seinem Freunde Pérez gemacht habe, das heißt, ich könnte ihn sterben lassen oder ihn, wie die Ärzte es zu tun pflegen, töten – die ja, wie meine Leser wohl wissen, stets vor dem Dilemma stehen: entweder den Kranken sterben zu lassen, weil sie fürchten, ihn zu töten, oder ihn zu töten, aus Furcht, daß er ihnen unter den Händen sterben könnte. Und so wäre ich fähig, Goti zu töten, wenn ich sehe, daß er sterben könnte, oder ihn sterben zu lassen, wenn mich die Furcht befiele, daß ich ihn töten müßte.
Doch ich will dieses Nach-Vorwort nicht noch länger ausdehnen, da es vollkommen ausreichend ist, um meinen Freund Víctor Goti vor die oben erwähnte Alternative zu stellen, dem ich im übrigen meinen herzlichen Dank für seine Arbeit ausspreche.
Miguel de Unamuno
I
Augusto trat aus der Tür seines Hauses, streckte den rechten Arm aus, spreizte die Hand, die Innenfläche nach unten gewandt, und verharrte dann, den Blick zum Himmel gerichtet, einen Augenblick in dieser statuenhaften und vornehmen Haltung. Nicht, als ob er so von der ihn umgebenden Welt Besitz ergreifen wollte: er wollte ganz einfach feststellen, ob es regnete. Er runzelte die Stirn, als er die Kühle des langsam niederrieselnden Sprühregens auf dem Handrücken spürte. Und es war weniger der feine Regen, der ihn störte, als vielmehr der ärgerliche Umstand, daß er seinen Regenschirm öffnen mußte – so schlank, so elegant, so geschickt war dieser in sein Futteral gerollt. Ein geschlossener Regenschirm ist nämlich ebenso elegant, wie ein offener häßlich ist.
›Es ist ein Unglück, sich der Gegenstände bedienen und sie gebrauchen zu müssen‹, dachte Augusto. ›Der Gebrauch ruiniert sie, ja, er zerstört sogar ihre ganze Schönheit. Die vornehmste Funktion der Gegenstände ist doch, betrachtet zu werden. Wie schön ist eine Orange, bevor man sie ißt. All das wird sich einmal im Himmel ändern, wenn unsere ganze Beschäftigung sich darauf beschränken oder vielmehr dahin erweitern wird, Gott zu betrachten und alle Dinge in ihm. Hier, in diesem traurigen Leben, besteht unsere Hauptsorge darin, uns Gottes zu bedienen; wir maßen uns an, ihn wie einen Regenschirm zu öffnen, damit er uns gegen alle Übel beschütze.‹
Nach diesem Monolog bückte er sich, um seine Hose hochzukrempeln. Endlich öffnete er seinen Regenschirm, blieb einen Moment unentschlossen stehen und überlegte: ›Was nun? Wohin soll ich jetzt gehen? Soll ich mich nach rechts oder lieber nach links wenden?‹ Denn Augusto befand sich nicht auf einer Reise, sondern auf einem Spaziergang durch das Leben. ›Ich werde abwarten, bis ein Hund vorbeikommt‹, dachte er, ›und ich werde die Richtung einschlagen, die er nimmt.‹
In diesem Augenblick ging zwar kein Hund, aber eine anmutige Dame über die Straße, und wie magnetisiert und ohne es zu merken, folgte Augusto ihren Blicken.
Er folgte ihr eine Straße entlang … dann eine zweite, dann abermals eine.