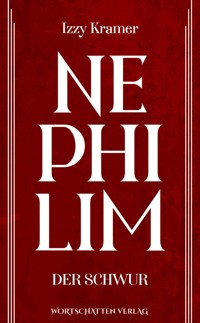
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wortschatten Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nephilim
- Sprache: Deutsch
Kaum mehr als zehn Meter entfernt tanzt eine junge Frau im milchigen Schein einer Straßenlaterne. Ihr weißblondes Haar funkelt im Licht. Sein überraschter Blick gleitet über ihr Gesicht, ihren schmalen Leib; und ihre Stimme, die eine sanfte Melodie in einer fremden Sprache singt, fesselt seine Sinne. Etwas so Schönes hat er noch nie gesehen. Sie nennen ihn »Goliath« und »Leviathan«, doch eigentlich hat er keinen Namen. Übergroß, mit weißen Augen und ebenso weißen Haaren, ist er stets ein Außenseiter, der sich mit zwielichtigen Jobs über Wasser hält. An die ständige Einsamkeit ist er seit dem Tod seiner Ziehmutter Sophia längst gewöhnt. Auf der Jagd nach ihrem Mörder durchkämmt er Londons Straßen, nur begleitet von dem letzten Geschenk, das er von ihr erhalten hat. Längst ist er überzeugt, versagt zu haben und sie niemals rächen zu können, bis er eines Nachts eine geheimnisvolle junge Frau trifft, die Sophia verblüffend ähnelt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Izzy Kramer
Ne
phi
lim
Der schwur
IMPRESSUM
1. Auflage 2022
© Wortschatten Verlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Wortschatten Verlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
0049 (0)241 87343422
www.wortschatten.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druckerei und Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Lektorat:
Kim Colling
Umschlaggestaltung:
Dietrich Betcher
Druckbuch:
ISBN-10: 3-96964-024-5
ISBN-13: 978-3-96964-024-1
E-Book:
ISBN-10: 3-96964-025-3
ISBN-13: 978-3-96964-025-8
To my little sister who never stops dreaming.
Prolog.
Der Mann mit dem langen weißen Haar, das bereits von Geheimratsecken durchbrochen wird, lacht lautlos. Er schüttelt den Kopf, wobei das Blut seiner zahlreichen Wunden sich wie feiner Sprühnebel über die kaltgrauen Kacheln des düsteren, zugigen Kerkers legt. Er blickt seinen Peinigern entschlossen in die weißen Augen.
»Ihr irrt euch«, bekräftigt er und rüttelt an den Fesseln, die bereits tief in sein Fleisch schneiden und ihn in seiner letzten Lebensstunde mit dem Holzstuhl eins werden lassen. »Meine Frau und das Kind, sie beide kamen bei der Geburt ums Leben. Ich habe keinen Sohn!«
»Blödsinn!«, donnert einer der Anführer und schlägt dem Gefangenen erneut brutal ins Gesicht, wobei seine Unterlippe endgültig nachgibt und sich entzweit. »Wir wissen, dass du lügst! Wo ist das Kind? Und was hast du mit der Scherbe gemacht? Spuck’s aus, oder …«
Seine sehnigen Arme richten die Spitze eines glänzenden Säbels auf den Hals des Mannes, der ihm weiterhin mit stoischer Miene trotzt. Lediglich eine dünne Schweißperle auf seiner Stirn zeugt von den langen Qualen, die er hat ertragen müssen.
»Die Worlid werden niemals siegen«, keucht er zur Antwort, »die Steinscherbe habe ich längst zerstört – die Prophezeiung endet mit mir!«
Und mit einem letzten Aufbegehren stemmt er sich mitsamt dem Stuhl vom Boden hoch und stößt seine Kehle in die Klinge.
SIBSI
Eins.
London, 2020, ein grauer Abend.
»Levi.«
Vor meiner Tür wispert es. Die Stimme wirkt eilig, getrieben. Fingernägel kratzen von außen über das splitternde Holz. Ich sitze in meiner Fünfzehn-Quadratmeter-Kellerwohnung mit separatem Eingang am Essenstisch und lege das Messer beiseite.
»Levi!« Es klopft, noch vorsichtig, fast flüsternd, an meine Tür.
Ich schiebe den Stuhl lautlos zurück, stehe auf und lösche das Licht.
»Leviathan, verdammt, mach auf!« Die Stimme drängt, jetzt am Rande der Hysterie, und die Holztür vibriert unter den Faustschlägen meines ungebetenen Besuchers.
»Hallo, Ahmid«, raunt eine weitere Person von der anderen Seite.
»Leviathan, bitte, um Himmels willen!«, fleht Ahmid mich an, noch immer der überheblichen Hoffnung verfallen, dass ich ihm das Leben retten würde.
Doch ich höre nicht hin.
Ich habe keinen Namen.
London, 17. Dezember 1903. Regen, Nacht.
Auf den Stufen der neu eröffneten Westminster Cathedral liegt ein Bündel, im Vorübergehen abgeworfen. Einige Meter weiter entfernt sich ein Schatten eiligen Schrittes in der Dunkelheit. Er legt die Hand an die Hutkrempe, nicht nur, um sich vor dem Regen zu verbergen, und blickt kein letztes Mal zurück. Er sagt nicht Lebewohl. Zu schwer wiegt der Schmerz, seinen Sohn, sein einziges Kind, in dieser Welt zurücklassen zu müssen.
Das Neugeborene selbst kommt gar nicht dazu, sich bemerkbar zu machen, denn die Kirchentür wird bereits zur vereinbarten Uhrzeit geöffnet. Eine junge blonde Nonne, vielleicht achtzehn Jahre alt, steckt vorsichtig den Kopf durch den Türspalt. Sie beachtet das quengelnde Findelkind zu ihren Füßen gar nicht, sondern späht angestrengt nach rechts und links. Der Regen peitscht ihr ins Gesicht. Sie wartet, rührt sich nicht. Erst als die Luft sicher rein ist, hebt sie den Korb mit dem Jungen darin auf und trägt ihn hinein. In einem Spiegel fängt sich die Inschrift der Kathedrale: Domine Jesu Rex et Redemptor per Sanguinem tuum salva nos. Herr Jesus, König und Erlöser, heile uns durch dein Blut.
London, 2020, in meiner alten Bleibe.
Zwei schallgedämpfte Schüsse stellen die Ordnung vor meiner Wohnungstür wieder her. Ich lasse das Licht noch eine weitere halbe Stunde ausgeschaltet, um sicherzugehen, dass die Mörder weg sind. Im Dunkeln packe ich langsam meine wenigen Habseligkeiten zusammen (ein Kissen, Kleidung, eine kunstvoll gefertigte Holzschatulle aus Mooreiche), räume das Essen vom Tisch (Brot und Wein) und lege den Schlüssel gut sichtbar auf den Tisch. Das sollte als Kündigung ausreichen. Als ich vorsichtig den Kopf durch den Türspalt stecke, ist die dunkle Straße vor meinem Unterschlupf wie leergefegt. Einzig der schwache Schein einer Straßenlaterne erinnert an das Verbrechen, das vor wenigen Minuten hier in London, Westminster, nur Zentimeter von mir entfernt stattgefunden hat. Gleichgültig steige ich über den Leichnam meines – jetzt ehemaligen – Kollegen Ahmid hinweg, dessen rostfarbenes Blut sich tropfenweise mit dem Regen vermischt und in einer Ablaufrinne versickert. Ein Hauch von Schwefel und Verzweiflung liegt in der Luft. Die Tür klickt hinter mir ins Schloss. Für mich ist es mal wieder Zeit, mir eine neue Unterkunft zu suchen. Zu überleben. Meine Lebensaufgabe zu erfüllen, selbst, wenn sie mir von Tag zu Tag sinnloser vorkommt.
Ich ziehe die Kapuze meiner schwarzen Jacke tiefer ins Gesicht und werfe einen flüchtigen Blick auf mein Smartphone (neuestes Samsung-Modell in mattschwarz, WhatsApp vom Boss zur Kommunikation auf allen Geräten seiner Handlanger vorinstalliert, was für ein Schwachsinn). Und zehn unbeantwortete Anrufe von Ahmid, der nun mit offenen Augen vor meiner Tür liegt. Hat sich beim letzten Job ein paar Kilogramm Koks eingesteckt, diese »gewinnbringend angelegt« und ist aufgeflogen. Unser Boss versteht bei sowas keinen Spaß.
Um 1:30 Uhr erreiche ich die Victoria Station und steige die Treppen zur U-Bahn hinab. Stechender Uringeruch weht mir um die Nase, miese Graffiti von selbsternannten Virtuosen begleiten mich in die modernen Katakomben Englands. Ich spüre die zerknitterte Oyster-Card in meiner Hosentasche, die morgen leider abläuft.
An den Gleisen lungern um diese Zeit nur noch ein paar Hungerkünstler herum, Zigaretten in ihren eingerissenen Mündern, abgegriffene Gitarren umgeschnallt, rot unterlaufene Augen von zu wenig Schlaf und zu viel Alkohol. Einer wischt sich die laufende Nase an seinem zerschlissenen blauen Pullover ab. Sie zählen die Cents in ihren Hüten. Vielleicht reicht es für einen Kanten Brot oder eine Flasche Schnaps, wenn sie zusammenlegen.
Kurz ziehe ich in Erwägung, die Jungs um eine Zigarette zu bitten, doch verwerfe den Gedanken wieder.
Die Wahl ihrer Zigarettenmarke ist ironisch. Gauloises, Liberté toujours.
In ausreichender Distanz warte ich auf die einfahrende Bahn.
London, 1903, kurz nach dem Fund des
Findelkindes, im Büro der Direktorin des
örtlichen Waisenhauses.
»Sie sind weiß, Sophia!«, schreit die sonst so nüchterne Leiterin der Foundling Orphanage London, Fiona Hallifax, beim Anblick der Augen des Findelkindes aus der Westminster Cathedral hysterisch auf und presst den Rücken gegen die kühle Wand hinter ihr, als hoffe sie, von dieser verschluckt zu werden. Mrs Hallifax führt ihr Waisenhaus mit strenger Hand, Überraschungen wie diese ist sie wirklich nicht gewohnt. Und mit einigem Stolz kann sie von sich behaupten, in der ganzen Stadt dafür bekannt zu sein, immer alles und jeden in ihrem Dunstkreis unter Kontrolle zu haben. Umso schlimmer für sie, wenn sie selbst die Kontrolle verliert, als eines ihrer jüngsten Mitglieder, Sophia Raymond, ihr ein weiteres Waisenkind auf den Schreibtisch stellt und um Unterschlupf für dieses bittet. Denn das hier ist kein Kind wie jedes andere.
»Weiß! Wir können diesen Jungen nicht behalten. Das ist entschieden zu ungewöhnlich!«
»Und was soll aus ihm werden, wenn wir ihn dort draußen lassen?«, versucht die junge Nonne das kleine Bündel in ihren Armen zu verteidigen. »Immerhin hat man ihn einfach so abgestellt. Ohne Grußformel, ohne Erklärung, mitten im Regen.« Sie sitzt scheinbar geknickt in Mrs Hallifax’ Büro an dem großen Schreibtisch aus dunkler Eiche, während die Heimleiterin gegenüber es noch immer nicht wagt, sich zu rühren. Lediglich ihr wacher Blick und ihre gespannten Glieder verraten das ihr peinliche Adrenalin, das durch ihren Körper schießt.
»Sophia, es geht nicht. Es …« Hallifax korrigiert sich. »Er … ist … vielleicht krank … Das könnten wir nie und nimmer bezahlen.«
Sophia schaut den seltsamen Findling an, und ihre Augen werden Wasser. Sie kann nicht aufgeben, sie hat es versprochen, und eine ungeheure Schuld lastet schon jetzt auf ihren viel zu schmalen Schultern.
»Ich denke, er ist nur blind«, versucht sie, die aufgebrachte Leiterin zu beruhigen.
»Das denke ich nicht«, murmelt Hallifax abwesend und mustert den Knaben skeptisch, der gezielt nach einer Strähne von Sophias hellem Haar greift.
»Ich werde für ihn aufkommen, Mylady. Jede Woche.«
Hallifax schreckt aus ihren Gedanken.
»Hast du den Verstand verloren, Mädchen? Du hast doch kaum genug zu essen für dich selbst.«
»Das ist mir gleich«, entgegnet Sophia starrsinnig und ihre demütige Fassade bröckelt dahin wie alter Kuchen auf einem Teller.
Hallifax durchschaut ihr Spiel nicht, denn wenn sie ehrlich ist, hatte sie für die fleißige Ordensschwester schon immer einen weichen Fleck in ihrem Herzen.
»Also gut«, erwidert sie daher achselzuckend, während sie sich zögerlich von der schützenden Wand entfernt, »fünf Pfund die Woche, für den Anfang. Und ich übernehme keine Verantwortung dafür, wie die Erzieher und anderen Heimkinder auf diese … Laune der Natur reagieren. Er wird alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das lässt sich kaum verhindern … Und sollte sich herausstellen, dass er gefährlich ist, dann endet unsere Vereinbarung.«
Sophia nickt erleichtert und Mrs Hallifax verschränkt die Hände hinter dem Rücken, tritt näher an den Weidenkorb auf ihrem Tisch heran und nimmt den Knaben argwöhnisch in den Blick.
»Weiße Augenfarbe, also wirklich …«
London, 2020, an der Victoria Station um
1:42 Uhr.
Ein paar uniformierte Mitarbeiter der British Transport Police beäugen mich skeptisch und flüstern, als ich mich deutlich bücken muss, um in die U-Bahn zu steigen. Immerhin bin ich zwei Meter dreißig groß, darauf sind Türen in der Regel nicht vorbereitet. Um weniger aufzufallen, nehme ich im hinteren Bereich des Personenzuges Platz, der bis auf eine leicht alkoholisierte Frau mittleren Alters in bunt aufschreienden Hippie-Klamotten leer ist.
Kopfhörer, Spotify, steinerner Gesichtsausdruck. Bis zum Tower von London sind es zum Glück nur 23 Minuten Fahrt, die ich der Öffentlichkeit so schamlos ausgeliefert verbringen muss. Ich sehe betont aus dem Fenster, vergrabe mich wie üblich unter meiner Kapuze und ignoriere nicht ohne Anstrengung die vehementen Mundbewegungen der Frau zwei Sitzreihen vor mir, die wild gestikuliert und versucht, mich in ein Gespräch über mein eigenartiges Äußeres zu verwickeln. Die Musik drehe ich lauter, bis sie mir in den Ohren klingelt. Nach kurzer Zeit verliert das Blumenkind das Interesse, hickst zweimal und schläft ein, mit dem Kopf gegen die kühle Glasscheibe gepresst.
Nach einer sonst ereignislosen Fahrt nimmt der Regen kräftig zu und ich bewege mich schleppend Richtung Tower, da ich kaum etwas um mich herum erkennen kann. Meine nachlässig geschnürten Stiefel klatschen durch die tiefen Pfützen auf dem Pflaster. Die Themse neben mir ruht in seelenlosem Nebel, ein paar Vögel schwingen sich kreischend in die Luft. Ich wünschte, die Tower-Raben würden mir heute Gesellschaft leisten, so wie sie es früher getan haben, doch mittlerweile werden sie nachts eingesperrt. Ich lasse mich daher allein auf einer Bank in der Nähe der Tower Bridge nieder und ziehe sechs Scheiben Brot, eine Flasche Wasser und zwanzig Scheiben Salami aus dem Rucksack, die ich mit niemandem teilen kann. Für mich ist es allerdings ohnehin ein karger Nachtimbiss. Wasser perlt an meiner Lederjacke ab und fängt sich auf meiner Jeans, was ich nicht weiter beachte, denn ich bin es gewohnt, bei Wind und Wetter herumzuirren.
Unvermittelt höre ich schnelle Schritte hinter mir, denen eine heisere Stimme folgt.
»Geld«, verlangt der Fremde, »Handy!« Kein Mann vieler Worte.
Ich wende ihm weiterhin den Rücken zu und beiße entspannt in mein belegtes Brot.
Der Kleinkriminelle, auf dessen Liste primär schreckhafte Touristen stehen, wird ungeduldig.
»Handy!«, wiederholt er aufgewühlt und sieht sich nervös um. Ich spüre, wie er von hinten kaltes Metall an meine Halsschlagader presst.
»Du störst beim Essen«, antworte ich mit stoischer Gelassenheit.
»Dein Geld! You crazy?«, schreit der nun sichtlich verwirrte Dieb mich in gebrochenem Englisch an, und der Rest geschieht in Sekunden. Als ich mich in voller Leibeshöhe vor ihm aufbaue und das Licht der Straßenlaterne hinter mir verdecke, begreift der Dieb die Grenzen seiner Existenz. Als er meinen gereizten Gesichtsausdruck wahrnimmt, beginnt das Messer in seiner Hand zu zittern. Und als ich ihm mit kaum mehr als einem Fingerschnipsen krachend die Nase breche, schreit er auf, hält sich die Hand vor das blutende Gesicht und rennt jaulend in Richtung London Bridge davon. Regel Nummer eins: Niemand stört mich beim Essen.
London, 1913, zehn Jahre nach dem Fund des Kindes in der Foundling Orphanage.
Wie immer um 12:00 Uhr sitzen die Kinder der Foundling Orphanage zu Tisch. Der große Speisesaal beschränkt sich auf das Nötigste: Mehrere lange Tische aus dunkelbraunem Holz, Baumkante, von der man sich schnell einen Splitter einfängt, wenn man mit der Hand darüberstreicht. Etwa hundert Schemel für die Heimbewohner, derer sind es aktuell insgesamt dreihundertzweiundvierzig. Natürlich passen nicht alle auf einmal an die Tische, weswegen in Etappen gegessen wird. Die erste Etappe kommt um zwölf, die zweite um eins und die dritte um zwei Uhr. Eingeteilt werden die Kinder nach Lebensalter in gemischten Gruppen. Die jüngsten Kinder (bis zehn Jahre) essen um zwölf, die Elf- bis Fünfzehnjährigen um eins und die ältesten um zwei. Quäkende Babys und Kleinkinder werden separat betreut.
Die deckenhohen Fenster sorgten früher wohl einmal für einen lichtdurchfluteten Speiseraum, doch mittlerweile sind sie so verdreckt und blind, dass zu jeder Tageszeit brennende Kerzen auf den Esstischen nötig sind.
Das dürftige Gedeck besteht aus einem rostigen Löffel pro Person, Essen holt man sich direkt in der Küche. Dort wird genau bemessen, wie viel jeder bekommt. Da der Knabe mit den weißen Augen sehr schnell wächst und Sophia seinen Unterhalt bezahlt, erhält er schon jetzt die Portion für die großen Kinder, doch trotzdem plagt ihn stetiger Hunger, denn seine Energiebedürfnisse sind weitaus höher als die der anderen. Und so sitzt er Punkt zwölf am Tisch und beugt sich begierig über seinen Teller, obwohl die billige Suppe darin völlig verwässert ist.
»Zwei ganze Kellen Linsensuppe«, flüstert der Knabe nahezu ehrfürchtig vor sich hin. Er schnüffelt gierig und taucht gebannt den Löffel in die Brühe, in der vielleicht zwanzig Linsen schwimmen, als er jäh unterbrochen wird.
»Dreck wie du braucht nichts zu fressen«, lacht der sieben Jahre ältere Luther, der soeben den Speisesaal betreten hat, und schlägt den dampfenden Teller Linsensuppe vor der Nase des Jungen mit einer abfälligen Handbewegung zu Boden. Das Essen verteilt sich auf dem schmutzigen Parkett, bunte Spritzer von Karotte, Kartoffel und Petersilie in braunem Matsch. Die anderen Waisenkinder schrecken auf, das Geschirr klirrt. Der Speisesaal in der Foundling Orphanage leert sich immer schnell, wenn Ärger in der Luft liegt. Außerdem ist Sonntag, und sonntags sind alle Aufseherinnen für zwei bis drei Stunden in der Kapelle der Kathedrale, wo sie sich zum Gottesdienst treffen und im Anschluss den Schichtdienst für die kommende Woche im Heim aufeinander abstimmen.
Die Gruppe der fünf Teenager, die sich nun drohend um den weißhaarigen Knaben schart, ist berühmt-berüchtigt. Natürlich haben sie um 12:00 Uhr noch nichts im Speisesaal zu suchen, doch das ist ihnen gleich. Sie kommen, um sich ihre Opfer auszusuchen. Das beliebteste davon ist der Junge, der einst unter ominösen Umständen auf den Stufen der Kirche gefunden wurde und den hier alle »Goliath den Riesen« rufen, denn für sein Alter ist er viel zu groß, zu stark, zu schnell und insgesamt zu sonderbar für ihren Geschmack. Doch während die meisten anderen Kinder ihm aus dem Weg gehen, besuchen Luther und seine Gang ihn mindestens wöchentlich, um ihn zu schlagen und so das Unbehagen, das sie bei seinem Anblick empfinden, auszumerzen. Ein Unbehagen, das mit jedem Jahr, das der Junge altert, stärker wird.
Der Knabe beurteilt wachen Geistes seine Fluchtmöglichkeiten. Aus dem Augenwinkel sieht er Jonah, mit dem er sich ein Zimmer teilt, seinen Löffel beiseite werfen und eilig aus dem Raum stürzen. Seine kurzen Schritte verhallen auf dem Korridor, der in Richtung Schlafsäle führt.
Sie sind allein.
»Ja, Dreck bist du, ganz genau«, stimmt Luthers Freund Paine mit ein. »Dreck mit weißen Augen, abartig!« Er schlägt mit der flachen Hand neben dem Jungen auf den Holztisch, der entsetzt von seinem Schemel springt, denn er weiß, was folgt. Sein Versuch, sich an zwei der Jungen vorbeizudrängen, schlägt jedoch fehl.
»Wo willst du denn hin? Wir haben doch immer so viel Spaß zusammen.« Der Größte, Roy, packt ihn am Kragen seiner notdürftig geflickten Jacke und hält ihn zurück. Er stößt Goliath von sich, der wie ein Käfer auf dem Rücken landet, und schon treten die anderen Jungen nach ihm, zwei packen seine Schultern und fixieren ihn am Boden. Der Knabe selbst schweigt verbissen. Er hat gelernt, dass Hilferufe sinnlos sind, denn das Timing der Bande ist immer perfekt. Und selbst wenn es das nicht wäre, so hätte er von den Aufseherinnen keine Hilfe zu erwarten. Auch sie gehen ihm aus dem Weg, halten ihn für ein Monster.
Sophia sagt, sie alle hätten Angst vor ihm, doch es fühlt sich wirklich nicht so an. Ein weiterer Tritt landet in seiner Rippengegend, es knackt vernehmlich und er beißt die Zähne zusammen. Nur nicht schreien. Das spornt sie an. Der siebzehnjährige Anführer, Luther, zieht eine spitze, stumpfe Messerklinge aus der Hosentasche und hält sie in die Flamme einer Kerze, die er von der Tafel nimmt.
»Wollen doch mal sehen«, raunt er, »ob wir dir die Augenfarbe nicht wegbrennen können.« Er beugt sich bedrohlich über den Zehnjährigen, der zappelnd versucht, sich aus dem Griff seiner Peiniger zu befreien, und sie müssen ihn zu viert am Boden halten.
»Kleiner Bastard«, ruft einer und spuckt ihm ins Gesicht, »halt still!«
Die heiße Klinge nähert sich seinem rechten Auge und er strampelt entsetzt, während die Jungen lachen und johlen. »Mach sie ihm schwarz!«, jubelt einer. »Das wäre zumindest besser als vorher!«
Der scheue Knabe presst die Augen fest zu und die Klinge verbrennt sein Augenlid.
»Halt ihm die Augen auf«, kommandiert Luther. Diesmal würde ihm das abartige Geschöpf nicht entkommen. Schon zu lange hasst Luther diese weißen Augen, hat Albträume davon, dass sie ihn im Dunkeln verfolgen wie todbringende Leuchtwürmer. Und jeder hier hört auf sein Kommando.
Weitere Hände greifen in das brennende Gesicht des Jungen und er wirft den Kopf hin und her, um sie abzuwehren. Todesangst breitet sich in seinem kleinen dürren Körper aus, aber noch etwas anderes ist da, ganz plötzlich, das pulsierend durch seine Venen schießt, wie gleißendes Licht.
Der Junge reißt die Augen auf und nimmt die Umwelt auf einmal wie in Zeitlupe wahr. Seine Sinne schärfen sich und er registriert seine Umgebung. Luther kniet über ihm, die Klinge in der linken Hand, die rechte stützt er auf dem Boden ab. Seine Oberlippe zittert leicht. Nervosität? Zu den Füßen des Jungen hocken Pete und Mason, gegenüber Roy und Paine, die Mühe haben, ihn festzuhalten. Ihr Lachen klingt fern und hohl. Auf Paines Stirn bildet sich eine Schweißperle und verklebt sein aschblondes Haar. Auf dem Boden hinter Luther liegt die Kerze, die allmählich ausbrennt und dabei tröpfchenweise weißes Wachs auf dem Parkettboden verliert. Der Junge konzentriert sich. Er kann hören, wie die Flügel einer Fliege vibrieren, die am Fenster sitzt und sich putzt. Die Holzbalken an der Decke weisen viele feine Risse auf. Er kann meterweit in den dunklen Korridor zu seiner Rechten sehen und plant mit neu gewonnener Entschlossenheit seine Flucht.
Eine Veränderung, die Luther nicht kommen sieht, denn als der Junge sich mit Wucht aufrichtet, lässt er erschrocken von ihm ab. Ungeahnte Kraft verlässt Goliaths kindlichen Körper, er schüttelt die fünf Jugendlichen ab wie lästige Ameisen und greift nach der Klinge in Luthers Hand. Dieser kann nur noch einen herzzerreißenden Schrei ausstoßen. Knackend entreißt Goliath seinem Peiniger das Messer mitsamt seinem linken Daumen und schleudert beide gegen die Fenster des Speisesaals auf der gegenüberliegenden Seite. Rote Schlieren bilden sich auf dem gräulichen Glas. Die Jungen springen schreiend auf und rennen davon, Luther starrt den kleinen Jungen schreckerfüllt an und hält sich weinend die blutende Hand. Schwankend stolpert dann auch er aus dem Saal.
Es kehrt Ruhe ein. Vorsichtig steht der Knabe auf und klopft sich langsam den Staub von der braunen Hose ab. Auf dem Tisch stehen noch zwei Teller Linsensuppe, die andere Waisenkinder fast unberührt stehen gelassen haben. Er rückt einen Stuhl heran, nimmt einen Löffel vom Boden und taucht ihn in die noch lauwarme Suppe vor sich, während er sein Hemd anhebt, um sich die gebrochene Rippe anzusehen. Sie ist bereits – wie alle Verletzungen, die der wunderliche Knabe in seinem kurzen Leben bereits davongetragen hat – so gut wie verheilt. Auch die Blutergüsse gehen zurück.
»Vier Kellen Linsensuppe«, murmelt der Knabe zufrieden und lässt sich die Suppe schmecken. Seine weißen Augen funkeln dabei.
London, 2020, auf einer Parkbank an der Themse.
»He … he, Mann! Du kannst hier nicht pennen! Los, beweg dich, na komm schon!«
Fuck! Nach dem Essen bin ich offenbar auf der Parkbank eingeschlafen, den Kopf auf den Rucksack gepresst, Beine in unbequemer Position auf der zu schmalen Unterlage. Einer der Londoner Ordnungshüter reißt mich im Morgengrauen aus einem traumlosen Schlaf, meine nassen Haare kleben im Gesicht, offenbar hat der Regen in der Nacht noch eins draufgelegt. Knurrend hieve ich meine schweren Glieder vom Sitz, schüttele die durchnässten Klamotten ab wie ein zottiger Büffel.
»Mh«, murmele ich, »war nicht beabsichtigt. Schönen Tag noch, Officer.«
»Jaja. Natürlich.« Und als er mich längst außer Hörweite wähnt, fügt er hinzu: »Immer diese Penner …«
Die ersten Sonnenstrahlen wärmen mein von der Nachtruhe zerfurchtes Gesicht, das ich skeptisch mit Hilfe meiner Handykamera prüfe. Die weißen Haare sind feucht, aber die teuren Kontaktlinsen, die meine weiße Augenfarbe verbergen, sitzen noch perfekt. Gut so. Keine Lust auf dumme Fragen vor dem dringend nötigen Frühstück, mein Magen knurrt so laut, dass Passanten sich bereits irritiert nach mir umdrehen.
Da weht mir ein Hauch von Leben um den Kopf. Moment, sind das etwa frische Brötchen? Mit meiner Bluthund-Nase nehme ich die Witterung auf. Immer geradeaus, dann rechts am Tower vorbei in Richtung der London Docks.
Da ist es auch schon: Ein unscheinbares kleines Café, das direkt am Wasser liegt, die Glastür einladend angelehnt. Im Hintergrund fällt eine bunt bemalte Backsteinwand auf, die ein wenig an einen schlechten Picasso erinnert, doch sie ist nicht ohne Charme.
In dem Café schlägt mir der Duft warmer Brötchen kräftiger entgegen, ebenso wie ein nicht entwirrbares Stimmenknäuel und das Mahlen einer Kaffeemaschine. Ich nehme an einem Hochtisch in der Nähe der Auslage Platz und sehe mich um. Eine junge Kellnerin, um die zwanzig, rotblond mit Zöpfen, betrachtet mich mit großem Interesse: Meine hohen Wangenknochen, die perfekte Symmetrie meines blassen Gesichts, die lange Strähne perlweißen Haars, das unter der klatschnassen Kapuze hervorlugt, weiße Augenbrauen und falsche, dunkelbraune Augen.
»Sie sehen aus, als wären Sie hergeschwommen«, lacht sie und kommt näher. »Ihre Hose klebt ja förmlich …« Sie starrt unverhohlen in meinen Schritt. »Kann ich Ihnen etwas bringen? Kaffee? Handtuch?« Ihre Augen funkeln amüsiert.
Wie beiläufig dreht sie den kleinen Elefantenanhänger an der Silberkette in ihrem üppigen Dekolletee in der Hand und leckt sich einmal über die vollen Lippen. Mir wird flau im Magen.
»Schwarzer Kaffee … und zehn belegte Brötchen mit Ei und Schinken, bitte«, würge ich hervor, ohne sie anzuschauen.
»Zehn? Erwarten Sie noch jemanden?« Sie zieht eine Schnute, glaubt wohl, gleich meine Frau und unsere drei Kinder antreffen zu müssen.
»Nein«, erwidere ich knapp. »Ich frühstücke allein.« Und um ihr darauffolgendes einladendes Lächeln und die Frage, warum jemand wie ich denn allein unterwegs sei, zu ersticken, füge ich hinzu: »Völlig allein.«
Die Kellnerin hebt eine Augenbraue, aber versteht den Wink. Vermutlich spuckt sie in meinen Kaffee, ehe sie ihn bringt. Aber immer noch besser als ihre Gegenwart. Ich kann ihren Geruch nicht ertragen. Frauen riechen nach schlechtem Parfum, Schweiß, Blut in ihren Lippenstiften.Als sie mir ein paar Minuten später kommentarlos die Brötchen hinwirft, ziehe ich die nasse Kapuze wieder tiefer ins Gesicht und sehe zu, dass ich zu Kräften komme.
London, 1913, ein Tag nach dem Vorfall im Speisesaal.
»Was hast du getan?« Sophia fasst ihren Schützling am Kinn, dreht seinen Kopf und betrachtet skeptisch die kaum sichtbare Narbe auf dem Oberlid. »Was hast du nur getan, Junge?«
Der Knabe vor ihr zuckt desinteressiert die Achseln und schweigt. Denn insgeheim ist er froh über den Zwischenfall. Schließlich hat Mrs Hallifax außerplanmäßig seine geliebte Sophia herbestellt, als Luther ihr tränenüberströmt erzählte, dass er ihm einen Daumen abgerissen habe. Einen Daumen, man stelle sich das vor!
»Du hast keinen Kratzer, und ein Junge behauptet, dass ihm ein gewisser Zehnjähriger die Hand verletzt hat. Er kann froh sein, wenn er nicht an einer Blutvergiftung stirbt, den Finger hat er auf ewig verloren!«
Ach nein, wie schade, denkt der Junge und blickt Sophia emotionslos an, fast meint sie, er lache sich dabei ins Fäustchen.
»Wieso hast du das nur getan?« Sophia schüttelt den Kopf, erinnert sie sich doch an die Worte der Heimleiterin Hallifax von vor zehn Jahren:
»Wenn sich herausstellt, dass der Junge gefährlich ist, endet unsere Vereinbarung.«
»Ich weiß nicht, wie ich Mrs Hallifax nach diesem Vorfall beruhigen soll. Immerhin …« Sophia nestelt unbehaglich an ihrem Kragen und sieht ihm in die schimmernden Augen. »Immerhin … bist du auch so schon auffällig genug! Ich fürchte, sie werden dich nicht länger hierbehalten wollen. Aber ich tue mein Bestes. Und ich hoffe … ich hoffe inständig, du hast dem Jungen nicht ohne Grund weh getan. Denn sollte es so sein, wäre ich schwer enttäuscht und käme dich nicht mehr besuchen. Nie mehr.«
Die Nonne weiß, dass es nicht zu seinem besten wäre, würde sie ihrer Drohung nachkommen. Aber ein Waisenhaus am Rande der Stadt, dem niemand Beachtung schenkt, ist und bleibt das perfekte Versteck für diesen Knaben. Stirnrunzelnd wird ihr klar, dass er nun langsam anfangen wird, seine in ihm schlummernden Kräfte zu entdecken, und sie fürchtet sich davor. Beruhigend ist dabei nur das Wissen, dass er es ohne ihre Hilfe allein nicht weit schaffen wird – und für eine Erklärung ist es noch viel zu früh. Zu ihrer Freude schnappt die Falle zu, ihre Drohung bleibt nicht ohne Wirkung.
Der Knabe springt jäh auf und fällt Sophia entsetzt um den Hals.
»Nein!«, ruft er jämmerlich und plappert unentwegt weiter: »Ich schwöre es! Ich weiß nicht, was passiert ist! Die haben angefangen, mich am Boden festgehalten, mir ein Messer ins Gesicht gedrückt, meine Augen wollten sie verbrennen und auf einmal wurde mir ganz anders, und dann …«
»Shhht.« Sophia drückt ihn schmunzelnd an sich und er atmet tief ein. Sie riecht nach Sandelholz und Kirsche. Ganz im Gegensatz zu Mrs Hallifax, die den Jungen nicht mal dann berühren dürfte, wenn sein Leben davon abhinge, genau wie alle anderen Frauen und Mädchen, die ihm begegnen. Wenn man es genau nimmt, gibt es auf der ganzen Welt nur eine Person, die der Junge riechen kann – und auch nur eine, die ihm mit Freundlichkeit begegnet. Kein Wunder also, dass er die Nonne auf ein Podest stellt, das unumstößlich ist.
»Shhht, Junge. Ich glaube dir. Aber vergiss bei deinen Handlungen eines nicht: Wir haben immer eine Wahl.« Sophia küsst ihn auf die Stirn, dann wischt sie sich eine Strähne ihres weißblonden Haares aus dem Gesicht, wendet sich ab und verlässt ohne ein weiteres Wort seine Schlafkammer.
London, 2020, nahe der Bäckerei.
Die Turmuhr schlägt neun, als ich die Bäckerei verlasse. Langsam klart der graue Himmel weiter auf, aber es bleibt kühl. Ich brauche dringend eine Dusche und vor allem frische, trockene Kleidung. In meinem Rucksack trage ich nur das Nötigste, und die Oyster-Card von gestern ist auch fast nicht mehr zu gebrauchen. Aber wo soll ich überhaupt hin? Zurück kann ich nicht. Mittlerweile wird die Polizei sicherlich am Tatort sein, Ahmids fast noch frische Überreste untersuchen, vermutlich wird sie sich auch in meiner alten Bleibe umsehen. Immerhin hat der Tote Holzsplitter meiner Tür unter den Fingernägeln. Finden werden die Polizisten in der Wohnung nichts, das darauf hinweist, dass dort jemand gelebt hat. Ich bin ein Nomade, ohne festen Wohnsitz, ohne Familie, ohne Freunde. Ich habe keinen echten Pass, wechsele die Identität für die Ordnungshüter alle paar Monate, mein wahres Geburtsdatum und mein Geburtsname sind sowieso unbekannt – und außerdem liegt der Beginn meiner Existenz entschieden zu lange zurück für normale Menschen.
Warum das so ist? Ganz einfach: Die Gesellschaft akzeptiert mich nicht und ich nage an dem Wenigen, was sie mir hinwirft. Meine Fähigkeiten zehren von meiner Lebensessenz. Ich kann nicht mit Menschen leben und auch nicht ohne sie; denn ich brauche ein Dach über dem Kopf und Nahrung. Eine Menge … Nahrung. Doch da ich aufgrund meiner unübersehbaren Andersartigkeit keinen normalen Job bekomme, erledige ich normalerweise die Drecksarbeit für alle Arten gesellschaftlichen Abschaums: Kriminelle, Drogendealer, Zuhälter. Und aktuell eben für die Londoner Mafia. Mir ist gleich, was diese Kriminellen tun oder von mir verlangen, solange es mir ein Bett und Essen einbringt. Und wenn ich versehentlich einen von ihnen zerquetsche, so ist es kein großer Verlust.
»Levi!« Eine mir nur allzu bekannte Stimme unterbricht meinen trüben Bewusstseinsstrom.
Na großartig, der Typ hat mir gerade noch gefehlt.
»Leviathan!«
Fuck!
»Ich habe dich schon gesucht!« Garth, ein hochrangigeres Mitglied des Londoner Mafiarings »Retribution«, kommt näher und klopft mir überschwänglich auf den Rücken, als seien wir alte Saufkumpane.
»Du warst gestern so schnell weg, dass ich dich fast nicht gefunden hätte! Aber dann hat mir jemand von einem übergroßen Penner mit weißen Haaren erzählt, der die Nacht auf einer Bank nahe der Tower Bridge verbracht hat … na, und da war die Sache klar! Du weißt ja … der Boss hat offene Augen und Ohren in der ganzen Stadt …« Garth lacht sein zahnloses Lächeln.
Ich knurre durch zusammengebissene Zähne.
»Mh.«
»Jetzt sei nicht sauer, Levi … nach dem kleinen Fauxpas mit Ahmid gestern Nacht dachten wir, du hättest die Stadt verlassen. Oder gar gezwitschert. Aber heute Morgen hat einer unserer Leute den Leichnam weggeräumt und ein wenig für Ordnung gesorgt. Die Polizei hat also keine Ahnung – und du bist noch hier.«
»Spar dir den Atem. Ich arbeite nicht weiter für Leute, die andere vor meiner Haustüre erschießen.«
»Tz, tz, tz … Levi …« Garth schüttelt lächelnd den fast kahlen Schädel, und sein schwarzes dünnes Zöpfchen flattert dabei im Wind. »Ganz so einfach ist die Sache nicht. Der Boss braucht dich noch, denn …« Sein ranziger Atem kommt meinem Gesicht zu nahe und ich spüre, wie meine Fäuste sich ballen. »… immerhin ist Ahmid gestorben, als er Zuflucht bei dir suchte. Sieht leider ganz so aus, als hättet ihr gemeinsame Sache gemacht …« Wie beiläufig reinigt er sich die gelben Fingernägel. »Und wenn du es dir mit dem Boss nicht komplett verscherzen willst, solltest du dir anhören, was ich zu sagen habe. Außerdem …« Er fischt einen Laib Brot und eine komplette Salami aus seiner Tasche und wirft sie mir zu. »Sowas wie das hier kannst du doch immer gebrauchen. Vielleicht stopft dir das das Maul.«
»Wirklich zu gütig, Garth. Aber ich brauche auch trockene Kleidung. Und ich kann nicht weiter auf der Parkbank schlafen, ist nicht gern gesehen.« Die Salami riecht unwiderstehlich. Dabei habe ich gerade erst gegessen.
»Kein Problem. Für die nächsten zehn Jobs springt sogar noch mehr für dich raus.«
»Zehn?« Mir fällt fast die Wurst aus der Hand. Der will mich wohl verarschen!
»Ja, ganz recht. Und fall mir nicht dauernd ins Wort …«, zischt er. »Also: Zehn Jobs. Für dich? Ein Klacks. Und du übernachtest in unserem Hotel im Hyde Park, First Class, für drei Monate. So lange hast du Zeit, für den Boss Geld bei zehn seiner Schuldner einzutreiben, denn Ahmids Alleingang hat uns einiges gekostet und das will ausgeglichen sein. Ahmids Koksmoneten sehen wir nie wieder. Der Kerl war längst blank, als wir ihn gefunden haben.«
Allmählich verliere ich das Interesse an seinem Gerede. Zehn Schuldner. Zwölf Wochen. Das ist eine ganze Menge, selbst für mich.
»Und noch etwas, Levi: Der Boss wird nichts anderes als Wiedergutmachung akzeptieren, also versau es nicht. Ist das klar?« Amüsant, wie der hässliche Wichtel mit hocherhobenem Zeigefinger vor mir her tanzt, als hätte er auch nur den Hauch einer Chance, wenn er es tatsächlich mit mir aufnähme.
»Glasklar«, raunze ich ihn an.
Mafiaaussteiger sind in London selten, denn es tummeln sich hier tausende Bandenmitglieder. Selbst ich kann nicht alle auf einmal erledigen, und welcher Idiot beißt schon die Hand, die ihn füttert?
»Wie lautet die erste Adresse?«, frage ich also mit gerunzelter Stirn und stopfe das geschenkte Futter in meinen Rucksack. Bis heute Abend wird es reichen, also kann ich direkt mit dem ersten Schuldner beginnen.
Den Drill kenne ich, Jobs wie diese erledige ich häufig.
»Du wirkst einschüchternd, das gefällt mir«, hat der Boss bei meinem … nennen wir es Vorstellungsgespräch zu mir gesagt, und mehr brauchte es damals nicht, um ein Mitglied der hiesigen Mafia zu werden.
SIBSI
Zwei.
London 2020, Job Eins.
Als ich in der Chester Street ankomme, senkt sich die Nacht langsam wieder über die Stadt. Heute ist nicht viel los. Ich stecke die Hände in die Taschen und laufe die Straße entlang. Links parken einige Pkw, schwarz und grau, die Fenster in den meisten Wohnungen sind hell erleuchtet. Hier nicht aufzufallen, wird nicht einfach sein. Ein Pärchen schlendert mir Hand in Hand entgegen, an ihrem Finger blitzt ein brandneuer Diamantring, frisch verlobt. Der junge Mann zieht klimpernd den Hausschlüssel aus der Tasche und bemerkt nicht, dass seine Freundin sich zu mir dreht, die Augen schließt und meinen Duft einsaugt, wobei die Zeit für sie einen kurzen Moment stehenbleibt. Ich spüre ihren bohrenden Blick noch in meinem Rücken und höre ihren schnellen Atem, als ich bereits in eine Querstraße abbiege.
Mein erster »Klient« wohnt in der Nähe der Irischen Botschaft. Sein Name ist Jon Mellow. Ich trage sein hässliches biometrisches Passbild in der Tasche.
Im Halbdunkel stapfe ich voran, wie immer mit schwarzer Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Immerhin ist die Jacke wieder trocken.
Ah, das letzte Haus auf der rechten Seite, die Wohnung mit den Vorhängen. Da versteckt er sich also, der Anfänger, denke ich spöttisch. Richtig untertauchen will gelernt sein. Natürlich hat er das Licht gelöscht, aber nicht bedacht, dass nur ein einziges Klingelschild leer ist. Umso genauer weiß ich, wo ich läuten muss. Doch als ich im Begriff bin, den Finger auf die Klingel zu legen, höre ich verhaltene Schritte hinter mir. Ich halte inne und greife langsam nach der schallgedämpften neun Millimeter Beretta in meinem Hosenbund.
»Verzeihen Sie«, spricht mich eine zarte weibliche Stimme an.
Rasch drehe ich mich herum – und rolle zornig mit den Augen. Ein paar Schritte von mir entfernt steht die junge Dame von vorhin und dreht verlegen ihren Verlobungsring hin und her. Vorsichtig wagt sie einen Schritt auf mich zu.
»Hi! Wir … ähm … sind uns heute auf der Straße begegnet!«
»Das ist keine zehn Minuten her«, antworte ich barsch.
»Oh, du erinnerst dich also an mich!« Ein weiterer hoffnungsvoller Schritt in meine Richtung. »Das ist schön. Ja, also …« Sie nestelt an ihrem Ärmel.
Die Frau kommt gefährlich nahe. Dieser Geruch …
»Ich bin extra nochmal losgelaufen, um dich zu finden. Ich wollte fragen … naja, hast du vielleicht Lust, was trinken zu gehen oder so?«
Eine unvorhergesehene Komplikation. Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, wie jemand in der vermeintlich verlassenen Wohnung über mir den Vorhang leicht beiseiteschiebt.
»Nein«, sage ich abwesend, ohne den Vorhang aus den Augen zu lassen. »Geh zu deinem Verlobten zurück. Ich habe zu tun …« Erschrocken fährt ihre Hand zum Mund und sie betrachtet ihren Ring. Wie aus einer Trance erwachend weicht sie zurück, kann sich aber noch nicht dazu aufraffen, mich in Ruhe zu lassen.
»Ich … aber… nein, mein Verlobter ist doch Zuhause, er weiß ja gar nicht, dass ich nochmal zurückgekommen …«
»VERSCHWINDE!«, höre ich mich sie plötzlich anbellen und richte die geladene Waffe auf sie. Das Mädchen erschrickt fürchterlich, stolpert rückwärts über ihre eigenen Stöckelschuhe und rennt davon.
In einer der Wohnungen öffnet sich das Fenster zur Straße bei diesem Tumult. Verdammt. Es bleibt mir keine Zeit mehr für Klingelspiele. Mit einem leichten Knarren drücke ich eilig die schwere Eingangstür ein und stehle mich in den dunklen Vorflur. Neben den Briefkästen drücke ich mich an die Wand und warte.
»Keiner da«, höre ich die Stimme am Fenster sagen. »Komisch … ich könnte schwören, da hätte einer geschrien.«
»Waren vielleicht Passanten, Schatz«, gibt eine Frauenstimme zu bedenken. »Komm, mach das Fenster zu, mir wird kalt.«
Mein Glück, dass Schatz so brav auf seine Frau hört. Ich warte noch fünf Minuten, dann bahne ich mir so leise wie möglich den Weg zu Mellows Wohnung im zweiten Stock.
Nach dem ungeplanten Theater vor dem Haus brauche ich mich ihm nicht mehr vorzustellen. Ich werde bereits erwartet. Durch die geschlossene Wohnungstür vernehme ich deutlich Mellows pulsierenden Herzschlag und das leise Klackern einer Pistole auf der rechten Seite. Da er sicherlich kein Geld in Schalldämpfer investiert hat, muss ich ihn entwaffnen, ehe er den Abzug drückt. Nur kein Lärm. Ich ziehe ein vorbereitetes Geschirrtuch aus der Jackentasche und wickele es grob um meine Hand. Dann drücke ich nahezu geräuschlos die Wohnungstür ein und gebe ihr einen kräftigen Tritt. Die Tür fliegt auf und Mellow kommt von rechts, wie ich es mir gedacht hatte. Zügig schlage ich ihm mit der eingewickelten Hand zweimal ins Gesicht, und er ist kurz desorientiert. Das genügt, um ihm die Waffe abzunehmen und ihm das Geschirrtuch ins Maul zu stopfen. Ich halte den 1,75 m kleinen Kerl am ausgestreckten Arm in die Luft und schließe mit dem anderen behutsam die Tür hinter mir. Seine Waffe stecke ich ein. Er zappelt und ringt nach Atem, ich lasse von ihm ab.
»Du schuldest der ›Retribution‹ Geld, Jon«, sage ich knapp. »Ich habe nicht viel Zeit. 10.000 Pfund, und du bist mich los.«
Mellow murmelt irgendetwas Unverständliches.
»Ach so … ’Tschuldigung. Aber wehe, du schreist.« Ich ziehe das Geschirrtuch aus seinem Mund und halte meine Waffe auf ihn gerichtet.
»Du wolltest etwas sagen?«
»Ich hab die Kohle nicht mehr, Mann!« Er wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Seine Augenpartie ziert ein kräftiges Veilchen. »Deswegen verstecke ich mich hier – verstehst du!«
Ich kratze mit dem Fingernagel am Abzug. Typen wie Jon langweilen mich.
»Können wir die Stelle, an der du mir schwörst, total pleite zu sein, bis ich dich halbtot prügele, nicht einfach überspringen? Ich weiß, dass das Geld hier sein muss. Du wurdest wochenlang beobachtet.«
»Ich hab es nicht, Mann!«
In Ordnung, wie üblich funktioniert das hier nur auf die harte Tour. Ich schalte das Licht ein und sehe mich genauer um. Mellows Wohnung hat maximal zwanzig Quadratmeter und besteht aus nur zwei Räumen plus Bad. Durchsuchen ließe sich also jeder Winkel, aber das dauert zu lange. Ich lasse ihn in der Ecke sitzen und richte weiterhin die Waffe auf ihn, während ich mich auf die Gerüche im Raum konzentriere. Da ist natürlich der besonders prominente Geruch von Jons Angstschweiß, und der Mülleimer riecht säuerlich nach alten Lebensmitteln … ein paar Apfelkerne, Käse und Spaghetti … Ich schnuppere.
»Du hast eine Katze, die hier markiert«, erwähne ich beiläufig, »und das Geld ist irgendwo im Nebenraum. Ich gehe nachsehen, wie viel.«
Mellows Adamsapfel tanzt auf und ab. Der Schweißgeruch intensiviert sich.
»Was redest du für einen Schwachsinn, Mann? Ich hab die Kohle längst ausgegeben!«
Mir reicht es. Ich packe ihn fest am Kragen und zerre ihn ins Bad nebenan. Schnüffele wieder.
»Toilettenkasten«, sage ich, »aufmachen!«
»Du bist ja wohl völlig …«
Ich schlage ihm ins Gesicht, seine Unterlippe platzt auf.
»Aufmachen!«, kommandiere ich und stoße ihn von mir her. Doch Mellow hat Mumm, das muss man ihm lassen. Mit erhobenen Händen bewegt er sich Richtung Toilette, doch statt den Kasten zu öffnen, greift er hinter ihn und zieht eine weitere Waffe hervor. Er drückt ab, ehe ich ihn stoppen kann. Die Kugel trifft meine Schulter, zerfetzt dabei meine Jacke. Ein glatter Durchschuss. Ich ziehe die Jacke aus, reibe mir die schmerzende Stelle und wische das Blut an meiner Jeans ab.
»Autsch! Du machst mich allmählich wirklich sauer, Jon. Die Jacke war teuer.«
Mellow sieht mit weit aufgerissenen Augen dabei zu, wie die blutende Wunde sich langsam wieder schließt, während ich auf ihn zutrete.
»W-w-was bist du nur, Mann?!«
Ich lächele boshaft und trete auf ihn zu, bereit wie ein Panther vor dem Absprung auf seine Beute.
»Ich bin dein persönlicher Albtraum.«
Eine Stunde später werfe ich Garth im Hyde Park Hotel den Sack mit 10.000 Pfund vor die Füße.
»Hier. Klient Eins hat bezahlt. Fehlen noch neun.«
»Deine Jacke ist ruiniert, Leviathan«, stellt Garth nüchtern fest, leckt die Fingerspitzen an und zählt das Geld nach. »Womit hat er sonst noch bezahlt?«
»Nur mit ein paar gebrochenen Gliedmaßen und Kopfschmerzen, wenn er wieder aufwacht.«
»Er ist also noch am Leben. Das ist großzügig von dir.«
»Mh«, brumme ich und zucke die Achseln. Ich töte nicht gern. Garth reicht mir den Zimmerschlüssel, Nummer 337, 3. Stock.
»Deine Wertsachen kannst du im Safe auf dem Zimmer unterbringen. Frühstück gibt es um 7:00 Uhr, das Abendessen geht bis 22:00 Uhr. Du kannst dir also noch den Wanst vollschlagen. Es ist erst halb.«
»Und Mittagessen?«
»12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, aber außerhalb des Buffets. Die Räume sind außerdem mit Minibar und Kaffeemaschine ausgestattet. Und wir haben einen Spa-Bereich im Keller. Whirlpool, Massage, Blocksauna, Fitnessraum, offen von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Wonach dir der Sinn steht. Klient Zwei wartet dann direkt morgen um 23:00 Uhr am Hafen auf deine Ankunft. Genieße also deine 24 Stunden Freizeit.«
Klient Zwei »wartet« auf mich. Manchmal nicht unwitzig, dieser Garth.
Ich muss nur einmal laufen, um meine Sachen nach oben zu bringen. Die Tür sieht etwas ramponiert aus und zwei alte Einschusslöcher zieren die Wand, aber das sollte in einer Mafia-Absteige nicht überraschen. Normale Gäste kommen hier nicht rein. Und wenn man ein wenig am Griff rüttelt, gewährt der Raum mir folgsam Einlass.
Die Zimmer im Hotel sind zweistöckig. In der ersten Etage geht es rechts hinter der Eingangstür ins Duschbad, links steht ein halbwegs geräumiger Einbauschrank mit Spiegel. Inmitten des Raumes ein Sofa mit rotem Bezug und Holzlehne sowie ein Sessel mit kleinem Brandloch: Zigarre, eindeutig. Die Kaffeemaschine und Minibar befinden sich praktischerweise gegenüber auf einer Kommode mit vielen Schubladen. Gewöhnungsbedürftig finde ich allerdings den schwarz-gelben Teppichboden, der etwas von moderner Kunst an sich hat, ich bekomme davon bestenfalls Kopfschmerzen.
Eine schmale Holztreppe führt in die zweite Etage mit großer Fensterfront und breitem Boxspringbett. Auf dem strahlend weißen Kopfkissen liegt eine winzige Tüte Gummibärchen, die das Öffnen nicht lohnt. Über dem Bett hängen zwei große Bilder, die Beschreibung darunter verrät, dass es sich um einen lokalen Künstler handelt.




























