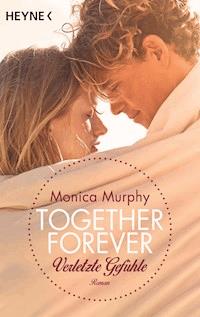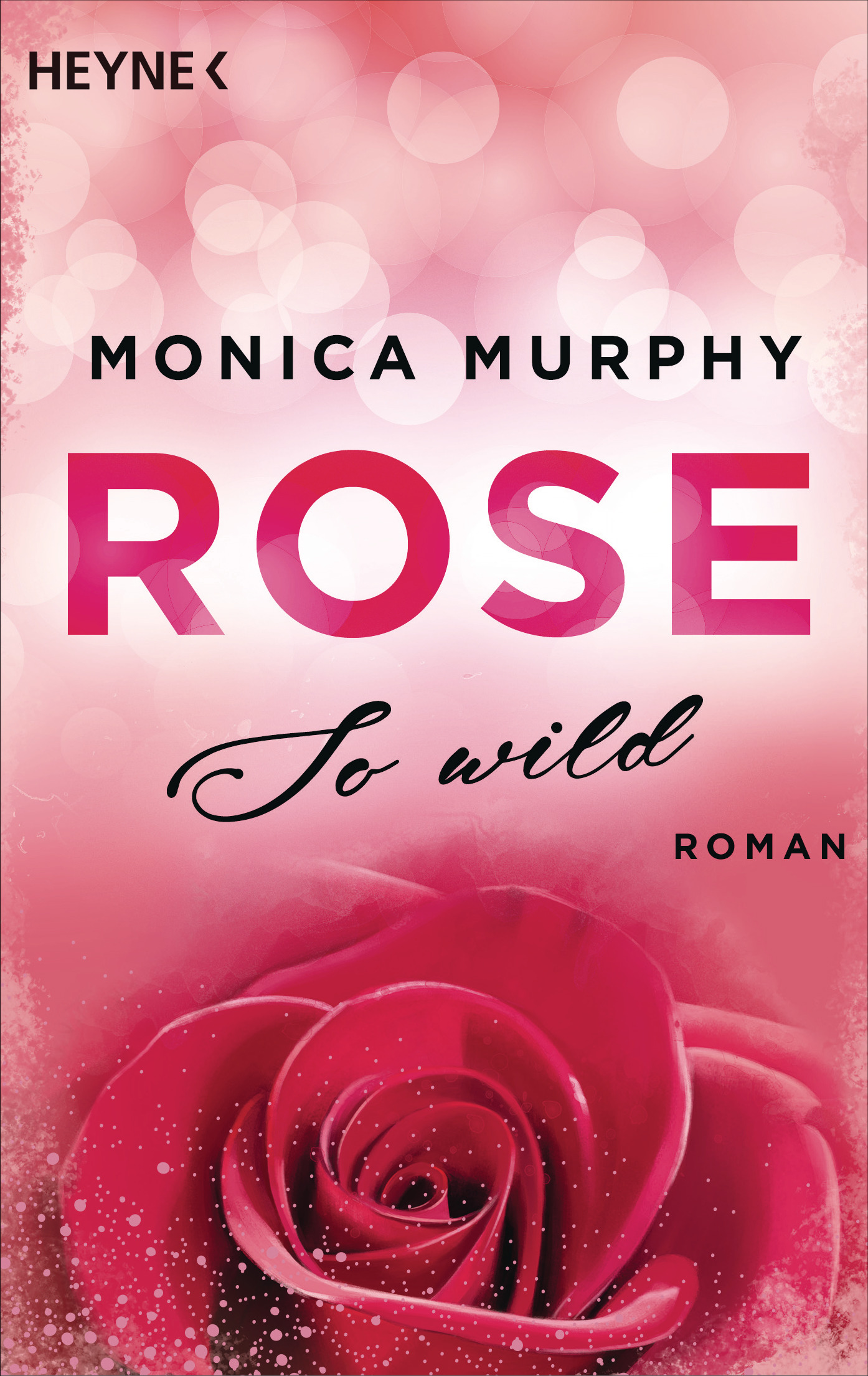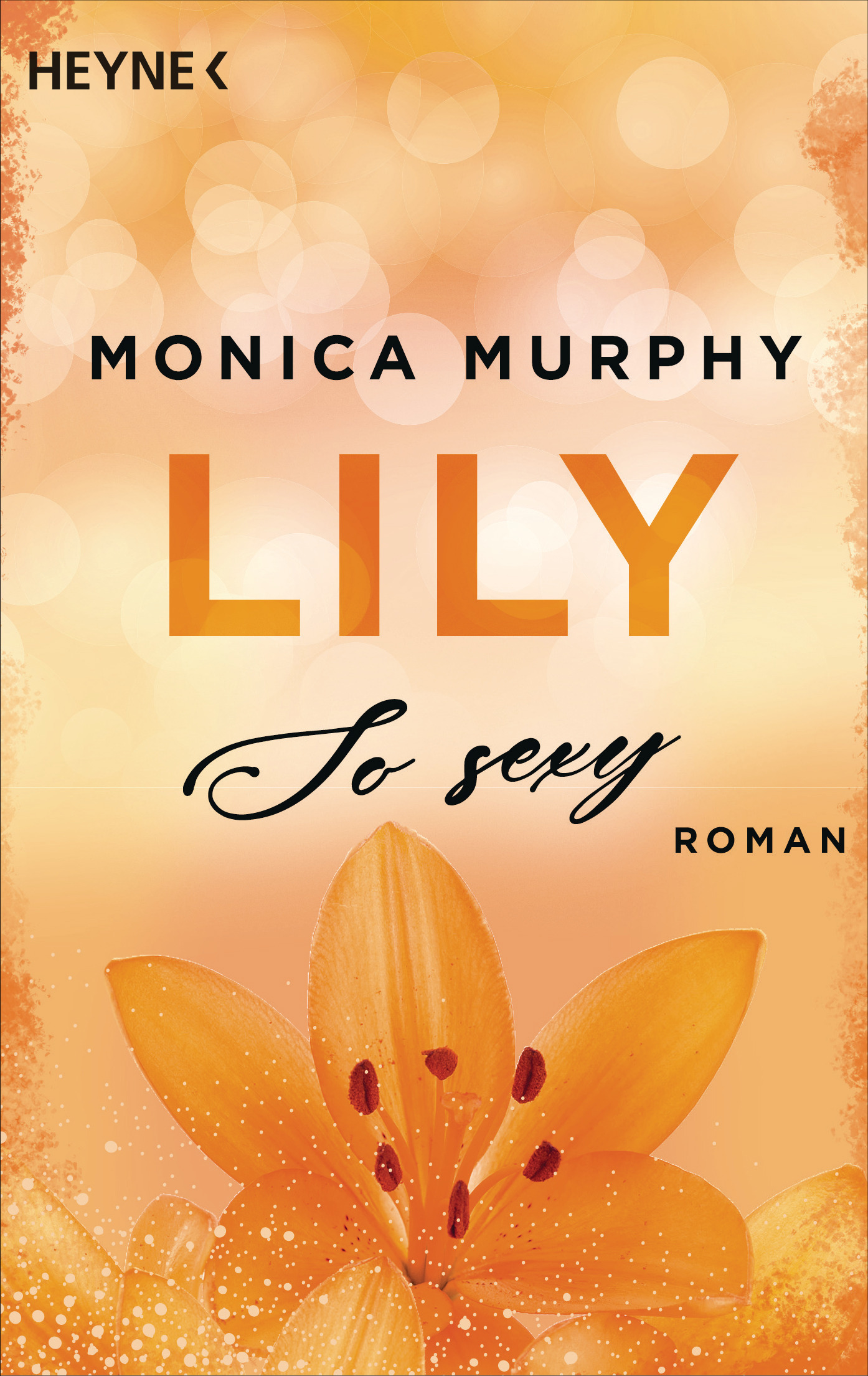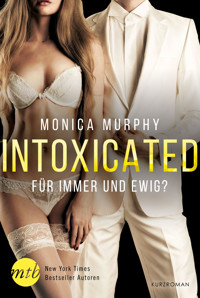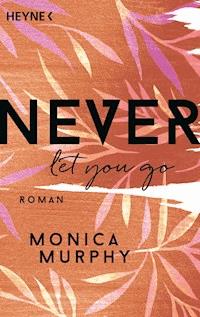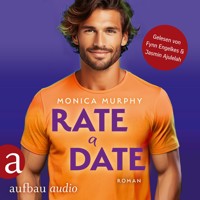8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Never-Serie
- Sprache: Deutsch
Ich habe mein Leben für sie riskiert, darf mich aber nicht zu erkennen geben ...
Vor langer Zeit, als ich fünfzehn und eine komplett andere Person war, habe ich einem Mädchen das Leben gerettet. Ich habe nur ein paar Stunden mit ihr verbracht, aber irgendwie entstand eine Verbindung – und seitdem war ich nicht mehr derselbe. Niemand versteht, was wir durchgemacht haben. Niemand weiß, was es bedeutet, wir zu sein. Wir haben überlebt, aber ich fühle mich nicht, als ob ich richtig leben würde – bis jetzt. Acht Jahre später habe ich sie gefunden. Ich will, dass sie zu mir gehört. Aber sie wird mich für immer hassen, wenn sie herausfindet, wer ich wirklich bin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Schon verrückt, wie acht Jahre in einem Moment verschwinden können. Ein Blick auf Katie Watts, und ich bin wieder ein Fünfzehnjähriger, der alles riskiert hat, um ein verängstigtes Mädchen zu retten. Jetzt ist sie erwachsen, wunderschön und erzählt der Welt ihre Geschichte. Eine Geschichte, in der ich auf mehr Arten vorkomme, als ihr euch vorstellen könnt. Sie nannte mich immer ihren Schutzengel. Irgendwie kommen wir uns wieder näher. Wir werden Freunde … aber ich will mehr. Ich genieße jeden Moment mit ihr. Immer mit der Angst, dass sie bald herausfinden wird, wer ich wirklich bin.
»Eine wunderschöne Version von einem gebrochenen Herzen … die Art von Herzschmerz, bei der du immer weiterblätterst, den Atem anhältst und Tränen zurückhalten musst.« Black Heart Reviews
Der Autor
Die New-York-Times-, USA-Today- und internationale Bestseller-Autorin Monica Murphy stammt aus Kalifornien. Sie lebt dort im Hügelvorland unterhalb Yosemites, zusammen mit ihrem Ehemann und den drei Kindern. Sie ist ein absoluter Workaholic und liebt ihren Beruf. Wenn sie nicht gerade an ihren Texten arbeitet, liest sie oder verreist mit ihrer Familie.
Lieferbare Titel
Total verliebt Zweite Chancen Verletzte Gefühle Unendliche Liebe Violet – So hot Rose – So wild Lily – So sexy Jade & Shep Lucy & Gabriel Alexandria & Tristan
MONICA MURPHY
NEVER
loved before
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Barbara Ostrop
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Zitat
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist dir seine Treue.
Psalm 91,4
Katherine
Gegenwart
Unter den gleißend hellen Scheinwerfern ist es heiß, und ich spüre, wie sich kleine Schweißperlen an meinem Haaransatz bilden. Ich vermeide es jedoch, mein Gesicht zu berühren. Sonst verwische ich noch das Make-up, das mir jemand eine halbe Stunde lang sorgfältig aufgetragen hat. Stattdessen senke ich den Kopf und ringe die Hände, und so fällt mir auf, wie verschwitzt sie sich anfühlen, obwohl meine Finger eiskalt sind. Ein Gegensatz, der gut zu meinen Gefühlen passt.
Nervös bin ich. Aufgeregt. Voller Angst. Was soll das alles? Was ich hier tue, ergibt keinen Sinn, und schon gar nicht in den Augen meiner Familie.
Ich will mich einer Kamera stellen. Ich bin bereit, meine Geschichte zu erzählen.
Endlich.
Die Reporterin kenne ich bereits aus dem Fernsehen, seit ich denken kann. Sie ist berühmt. Ihren Namen hat jeder schon einmal gehört. Sie ist hübsch, im Stil der meisten ihrer Kolleginnen. Dunkelblond, perfekt frisiert, strahlend blaue, mit viel Make-up hervorgehobene Augen. Ihre Wangen sind mit einem Hauch Rouge betont, und ihre Lippen haben ein sanftes Beerenrot. Sie ist tüchtig und weiß genau, was sie will. Das erkenne ich daran, wie sehr sie im Raum dominiert und wie prompt die Angestellten des Senders ihre Anweisungen befolgen. Sie ist stark. Selbstbewusst. Und makellos.
Was mir nur in Erinnerung ruft, dass ich das definitiv nicht bin. Meine Fehler verhöhnen mich und machen mir klar, dass ich alles andere als vollkommen bin. Früher einmal fand ich mich tatsächlich nahezu vollkommen – damals war ich jung und naiv und hielt mich für unverletzlich. Aber Perfektion ist schwer zu erreichen. Und wenn man sie einmal vollständig aus den Augen verloren hat, ist es sehr schwer, sie zurückzuerlangen.
Wenn nicht unmöglich.
»Sind Sie so weit, Katherine?« Die Stimme der Reporterin ist sanft, und als ich aufsehe, begegne ich ihrem mitfühlenden Blick. Gedemütigt setze ich mich aufrechter hin und kontrolliere mein Mienenspiel. Ich brauche kein Mitleid. Nachdem ich mich so lange innerlich leer gefühlt habe und kein bisschen Mut aufbringen konnte, um … um mich der Vergangenheit zu stellen – oder auch nur einem Fitzelchen davon –, verspüre ich nun genug Kraft, und das darf ich nicht vergessen.
Es mussten erst acht Jahre vergehen und mein Vater tot sein, aber jetzt mache ich es.
»Ich bin bereit«, bestätige ich mit einem energischen Nicken. Dann höre ich, wie ein Stück abseits Mom Brenna etwas zuflüstert, sehe allerdings bewusst nicht hin, damit ich keinen Rückzieher machen kann. Sie sind mitgekommen, weil ich ihnen gesagt habe, dass ich ihre Unterstützung brauche, doch nun frage ich mich, ob das nicht ein Fehler war. Ich will Mom nicht schluchzen hören, während ich um Worte ringe. Ich möchte nicht, dass die beiden mit entsetzter Miene und weinend zuhören, wie ich all meine schmerzhaften, hässlichen Geheimnisse preisgebe.
Alle haben genug Tränen über diese Tragödie vergossen, die mein Leben ist. Ich sollte feiern, dass ich nicht tot bin, statt mich im Dunkeln zu verstecken. So lange durfte ich über all das nicht reden, und jetzt fühle ich mich beinahe … befreit. Ja, trotz der schrecklichen Dinge, die ich enthüllen werde, bin ich erleichtert. Fühle mich befreit. Gleich nach meiner Heimkehr hat Dad damals verlangt, über das Geschehene Stillschweigen zu bewahren. Insbesondere von mir. Er war überwältigt von der Scham, dass er versagt hatte, als seine Tochter Hilfe brauchte.
Das habe ich ihn einmal bei einem Streit sagen hören, in den Mom und er kurz nach meiner Rückkunft geraten waren. Sie dachten, dass ich friedlich in meinem Kinderzimmer läge und schliefe, aber ihr Geschrei weckte mich auf. Nicht, dass ich damals viel geschlafen hätte. Selbst heute habe ich damit noch Probleme. Doch ich kann mich an diesen Abend erinnern, als wäre es gestern gewesen, so sehr habe ich es im Gedächtnis behalten. Die Verzweiflung in Dads Stimme war das, was mich aus dem Bett holte. Das und die Tatsache, dass ständig mein Name fiel, und zwar lauter und immer lauter.
Ich schlüpfte aus dem Bett und schlich mich mit heftig pochendem Herzen durch den Flur. Dort drückte ich mich an die Wand und lauschte, unfähig, mich abzuwenden, als ich begriff, dass sie nicht einfach nur über mich redeten – sie stritten sich meinetwegen.
»Du kannst sie nicht für den Rest ihres Lebens einsperren«, sagte Mom. »Ich weiß, dass ich früher eine Glucke war, aber ich glaube … nein, ich weiß, dass du es jetzt übertreibst.«
»Ich habe versagt, Liz. Ich habe unser kleines Mädchen nicht beschützt, und daran kann ich nichts mehr ändern.«
Doch er hätte es ändern können, wenn er mich einfach akzeptiert hätte. Wenn er mich einfach mal in den Arm genommen hätte, so wie er meine ältere Schwester Brenna in den Arm nahm. Ohne darüber nachzudenken und voll Wärme und Zuneigung. Wenn seine Augen nicht immer so voll Scham und Demütigung gewesen wären, sobald er mich ansah, als wäre ich ein unerwünschtes Kind, das widerlich besudelt zu ihnen nach Hause zurückgekehrt war. Statt Daddys großem Mädchen war ich plötzlich die Tochter, die er nicht mehr anfassen wollte. Und zu diesem Wandel war es nur innerhalb weniger Tage gekommen.
Damals hat mich das sehr verletzt. Und das tut es immer noch. Dabei ist mein Vater schon seit einem halben Jahr tot.
»Wir können den Rekorder jederzeit anhalten, wenn Sie beim Erzählen eine Pause brauchen, um sich wieder zu sammeln«, beruhigt mich die Reporterin mit der glatten tröstenden Stimme eines Profis, und ich nicke, obwohl ich mir sage, das das nicht nötig sein würde.
Ich muss die Geschichte bis zum Ende erzählen, und zwar ohne Unterbrechung. Ich muss meine Seele ein für alle Mal davon reinigen.
Vor allem aber muss ich für klare Verhältnisse sorgen.
Es hat unzählige Berichte über das gegeben, was mir zugestoßen ist. Zahllose einstündige Dokumentarberichte, die sich meinem Fall widmeten. Zwei Fernsehfilme und unzählige True-Crime-Serien. Als man mich vor acht Jahren fand, prangte mein Gesicht auf dem Cover des People Magazine. In einem schlabberigen grauen T-Shirt, zwei Nummern zu groß, das eine Polizistin mir gegeben hatte, und einer dazu passenden Hose, starre ich mit tränennassen Augen in die Kamera, während man mich aus dem Revier führt. Damals brachte man mich zur Untersuchung ins Krankenhaus.
Bei dieser grässlichen Erinnerung läuft mir ein Schauder den Rücken hinunter.
Ich habe die Zeitschrift aufgehoben, tief unten in einer Schachtel. Aber ich habe sie noch. Meinen sogenannten Anspruch auf Ruhm. Warum ich sie nicht weggeworfen habe, weiß ich nicht. Eine angenehme Erinnerung hält sie schließlich nicht fest.
Doch es ist meine Erinnerung. Mein Leben. Ich kann es nicht ändern, wie sehr sich das auch jeder, der mich liebt, wünschen würde.
Das People Magazine hat mich wieder um einen Termin gebeten, insbesondere jetzt, da sie von dem Interview hier erfahren haben. Sie wollen mein Gesicht noch einmal aufs Cover setzen, allerdings habe ich nicht zugestimmt. Und das werde ich wohl auch nicht. Verlage haben mich aufgefordert, ein Buch über meine Erlebnisse zu schreiben, doch das werde ich wohl ebenfalls unterlassen. Nur dieses eine Mal, jetzt, will ich meine Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Für das Interview ist eine Stunde Sendezeit angesetzt, aber man hat mir bereits versichert, dass ich auch zwei Stunden bekomme, sollte ich mehr brauchen.
Diese Woche ist wohl nicht viel los, doch ich widerspreche nicht. Das Angebot, zwei Stunden zur Verfügung zu haben, werde ich wohl annehmen. Ich habe viel zu sagen. Und nun ist meine Zeit gekommen. Mein Moment.
Danach werde ich nie wieder öffentlich über Aaron William Monroe sprechen.
Katie
Damals
Als wir das Hotel verließen, brach die Sonne durch letzte davonziehende frühmorgendliche Nebelfetzen. Wir gingen zu Fuß, und unterwegs liebkosten ihre intensiven Strahlen meine Arme und wärmten mein Haar und mein Gesicht. Jetzt bereute ich es, dass ich das leuchtend rote Rettungsschwimmer-Sweatshirt angezogen hatte, das Mom mir gestern Abend in einer Geschenkeboutique gekauft hatte. Ich hatte mit großen Augen und flehend zusammengelegten Händen darum gebettelt. Sie hatte nur widerstrebend nachgegeben und ständig über den hohen Preis gemeckert.
Ich fand das auffällige Sweatshirt natürlich wunderschön, aber es war zu dick und würde total blöd aussehen, falls ich es um die Taille bände.
Los wurde ich es nun jedenfalls nicht mehr.
Der Himmel war so unglaublich blau, dass es beinahe unnatürlich wirkte, als wäre er gemalt. Der Wind war kühl und trug den Geruch des Meeres heran. In der Luft lag die Feuchtigkeit des Pazifiks und seiner Dunstschleier, und ich spürte, wie die Hitze der Sonne dadurch milder wurde. Eine reine, durch nichts gedämpfte Freude durchströmte mich, und ich konnte mich nicht erinnern, jemals so aufgeregt gewesen zu sein.
Nie wieder würde ich solch eine unschuldige Erregung empfinden.
Als wir endlich ankamen, wimmelte es auf dem Gelände von Menschen, dabei hatten die Fahrgeschäfte gerade erst geöffnet. Ich legte sofort los und bettelte Mom und Dad an, uns allein losziehen zu lassen. Ich zog alle Register.
»Brenna darf immer mit ihren Freundinnen los!« Der quengelnde Tonfall war dick aufgetragen. Ich argumentierte, ich sei alt genug, um allein zurechtzukommen, doch ich klang wie ein Kleinkind.
»Natürlich. Ich bin ja auch fünfzehn und kein Quälgeist so wie du«, bemerkte meine Schwester von oben herab und warf ihrer besten Freundin Emily einen Blick zu. Gleich darauf platzten beide vor Lachen. Manchmal hätte ich Brenna erwürgen können. Und Emily mochte ich eigentlich auch nicht besonders. Die beiden hackten ständig auf mir herum, und dann fühlte ich mich dumm.
Meine beste Freundin Sarah warf meiner Schwester dieselbe Art von Blick zu wie ich. Das hatte uns wirklich gerade noch gefehlt, dass Brenna uns mit ihren Kommentaren alles kaputt machte. Wo wir es uns doch so sehr wünschten.
Nämlich uns nur zu zweit im Freizeitpark herumzutreiben, statt brav im Schlepptau von Mom und Dad hinterherzutrotten. Sarah und ich wurden beide im nächsten Monat dreizehn, mit nur sechs Tagen Abstand, und wir wollten einfach nur mal für ein paar Stunden ohne Aufsicht sein.
»Sarah hat doch ihr Handy«, bettelte ich weiter und sah Daddy flehentlich an. Ich erhaschte ein Flackern von Verunsicherung in seiner Miene, ein erstes Zweifeln, und so versuchte ich sofort, ihn um den kleinen Finger zu wickeln. »Wir melden uns auch jede Stunde bei euch, Ehrenwort.«
»Ich weiß nicht recht …«
Ein kurzer Blick auf meine Mutter zeigte mir, dass sie gar nicht begeistert von der Idee war. Aber Mom war nicht diejenige, die ich überzeugen musste.
Es ging um Daddy.
»Bitte. Wir können uns auch alle zwei Stunden treffen, wenn ihr wollt. Mittags zum Beispiel, zum Essen. Es ist erst zehn. Wir können uns doch um zwölf Uhr dort drüben verabreden.« Ich deutete auf eine Restaurantzeile in der Nähe. »Bitte, bitte, bitte.«
»Wir benehmen uns auch total gut«, fügte Sarah feierlich mit ernster Miene hinzu. Mit so ernster Miene, dass ich fast losgeprustet hätte.
Doch ich riss mich zusammen. Ich würde das hier auf keinen Fall vermasseln. Wir waren schon so dicht dran.
»Aber ihr redet auf keinen Fall mit Fremden«, sagte Daddy und zeigte auf uns beide. Ich merkte, dass er gleich einwilligen würde. Er hatte so ein weiches Herz. »Und ihr bleibt hier auf dem Boardwalk und geht nirgendwo anders hin, nicht einmal zum Strand.«
Mein Herz hämmerte vor Aufregung. Ich wusste, dass wir ihn beinahe herumgekriegt hatten.
»Also wirklich, Jim.« Mom klang ungläubig, aber ich beachtete sie nicht. Das hatte ich in den vergangenen Monaten perfektioniert. Wir verstanden uns in letzter Zeit nicht sonderlich gut. Sie wollte mir ständig Vorschriften machen, was ich tun und lassen sollte. Das hatte ich satt. Ich wollte unabhängig meinen eigenen Weg gehen und nicht in ihrem Kielwasser schwimmen. Was wusste sie schon über mein Leben? Seit ihrer Jugend hatte sich alles so sehr verändert, da hatte sie garantiert nicht die geringste Ahnung.
»Ach, komm schon, Liz. Das schafft sie doch«, beschwichtigte Daddy sie, bevor er mir sein strahlendes Lächeln schenkte. »Wir müssen sie nun einmal irgendwann loslassen, oder?«
Mom seufzte, und ich hörte die Erschöpfung, die darin lag. Sie war in letzter Zeit gestresst gewesen, was auch immer der Grund dafür war. Wir waren doch im Urlaub, warum entspannte sie sich dann nicht einfach mal? »Ruf mich auf jeden Fall um halb elf an und sag mir, wo ihr seid.«
Um halb elf? Das war ja in nicht einmal einer halben Stunde. Das zum Thema Kontrollzwang. »Okay«, willigte ich ein und gab mich ganz gelassen, aber innerlich hätte ich am liebsten einen Freudentanz aufgeführt. So wie Sarah neben mir von einem Bein aufs andere hüpfte, empfand sie es offensichtlich genauso.
Wir waren wirklich total im Takt, Sarah und ich. Wir rannten los, ehe meine Eltern ihre Meinung ändern konnten.
»Redet nicht mit Fremden!«, schrie Daddy uns nach, und das brachte uns zum Kichern.
»Es sei denn, sie sind süß«, murmelte Sarah, und dann lachte sie richtig los.
Ich sagte nichts. Meine beste Freundin war seit dem Ende des Schuljahrs wild auf Jungs, und sie wollte unbedingt einen Freund. So schnell wie möglich.
Und ich? Mir waren Jungs egal. Keiner meiner Mitschüler interessierte mich. Die meisten kannte ich seit der Vorschule, und einige hatte ich sogar schon im Kindergarten kennengelernt. Fast alle nervten. Und der Gedanke, einen von ihnen zu küssen?
Einfach nur eklig.
»Aber wir werden jetzt nicht den ganzen Tag lang nur Jungs zuwinken und mit ihnen flirten«, sagte ich, weil ich … weil ich das einfach nicht wollte. Nicht heute. Das war unser Tag. Unsere Chance, ganz wir selbst zu sein und in jedem Fahrgeschäft mitzufahren, das uns Spaß machte. Zu essen, was wir nur wollten. Zu machen, was wir wollten. Wir hatten die neongrünen Armbänder, mit denen wir alle Fahrgeschäfte so lange durchprobieren durften, wie wir es aushielten, und wir waren startklar.
Ich wollte meine Zeit nicht verplempern und mit Zehntklässlern flirten, die uns auslachen würden, wenn sie wüssten, dass wir erst zwölf waren. Ich sah wirklich genau wie zwölf aus, aber Sarah nicht.
Sie sah älter aus.
»Sei doch keine solche Spaßbremse.« Sarah war klüger gewesen als ich. Sie trug kein Sweatshirt, sondern nur ein T-Shirt, und als sie es nun auszog, kam ein pinkfarbenes Bikinioberteil zum Vorschein. Sie hatte Brüste, während bei mir alles noch ziemlich flach war, aber ich war nicht neidisch. Zumindest nicht richtig.
»Das bin ich nicht. Nur … heute hab ich nichts mit Jungs am Hut. Ich will Spaß haben.« Ich lächelte sie an, und sie lächelte zurück.
»Na klar, und das werden wir auch. Mit Jungs hat man Spaß. Das hast du nur noch nicht herausgefunden.« Sie rollte ihr T-Shirt zusammen und stopfte es in ihre Handtasche. »Und jetzt fahren wir Riesenrad.«
Ich runzelte die Stirn. Wie langweilig. »Ehrlich?«
»Wir fangen ganz harmlos an.« Ihr spitzbübisches Lächeln wurde breiter. »Und heben uns das Coolste bis zum Schluss auf.« Sie deutete auf die riesige weiße Achterbahn, die vor uns aufragte. In diesem Augenblick schoss ein Zug vorbei. Die Passagiere kreischten, die Arme in die Luft geworfen und die Haare vom Fahrtwind gepeitscht.
Mein Herz schlug schneller, als ich sie sah. Ich konnte es gar nicht abwarten.
Katherine
Gegenwart
»Und was ist dann geschehen?«
Die Stimme der Reporterin reißt mich aus meinen Gedanken. Ich hatte mich in ihnen verloren, denn diese bestimmte Szene hatte ich mir schon ewig nicht mehr in Erinnerung gerufen. Alle konzentrieren sich immer auf die schlimmen Ereignisse, mich selbst eingeschlossen. Was er mir angetan hat. Wie lange er mich gefangen gehalten hat. Wo er mich eingesperrt hat. Wie er mich ankettete, als wäre ich ein Hund, und mir die Augen verband, sodass ich nichts mehr sehen konnte. Und wie ich so außer mir geriet vor Angst, als er mir das Tuch zum ersten Mal abnahm, dass ich mir in die Hose machte. Ich erkannte an seinem entschlossenen Gesichtsausdruck, was er mit mir vorhatte.
Aber ich wusste es nicht wirklich, weil ich von Sex kaum mehr Ahnung hatte, als man aus Jugendbüchern erfährt. Ich hatte darin einige sehr brave Bettszenen gelesen und außerdem die ätzenden Filme geschaut, die sie einem in der Schule über die erste Regelblutung und Hormone und so zeigen.
»Ich hatte an diesem Vormittag viel Spaß«, erzähle ich mit schwerer Zunge, denn das hatte ich tatsächlich, und die Erinnerung hat etwas Bittersüßes. Sarah und ich lachten und alberten herum, was mich eigentlich fröhlicher stimmen sollte. Aber es tut schrecklich weh, mich an die schönen Momente dieses Tages zu erinnern. Sie werden vollständig von den unangenehmen überlagert. »Wir haben uns mit meinen Eltern mittags zum Essen getroffen, genau wie versprochen. Ich hatte ein Hotdog im Teigmantel.«
Die Einzelheiten habe ich noch immer in meinem Gedächtnis, ein bisschen verschwommen zwar, doch je mehr ich davon erzähle, desto deutlicher zeichnen sie sich ab. Ich erinnere mich an die Möwen, die über den Tischen Sturzflüge probten, während wir aßen. Und wie mir ein Stückchen meines Hotdogs auf den Boden fiel und so ein weißgrauer Vogel herunterschoss und es mir wegschnappte, bevor ich mich auch nur danach bücken konnte.
Nicht, dass ich es noch gegessen hätte, aber trotzdem.
Die Reporterin lächelt – um mir die Befangenheit zu nehmen, denke ich. »Es war ein schöner Tag mit Ihrer Familie und Ihrer besten Freundin.«
»Ja.« Ich nicke und denke an Sarah. An die Entfremdung zwischen uns, die nach meiner Heimkehr einsetzte. Dass sie sich danach in meiner Nähe unbehaglich fühlte. Das hat sie mir einmal gesagt, und wir haben beide geweint und nicht verstanden, warum es nicht wieder so werden konnte wie früher, als wir noch beste Freundinnen waren. Es platzte aus ihr heraus, und sie biss sich auf die Unterlippe, kaum dass sie es ausgesprochen hatte. Am liebsten hätte sie die Worte wohl wieder heruntergeschluckt.
Aber das ging nicht. Es war zu spät. Sie habe Schuldgefühle, sagte sie. Sie habe mich nicht beschützt. Das kam mir wie völliger Schwachsinn vor, doch ich diskutierte nicht mit ihr.
Als wir in die Highschool kamen, waren wir wie Fremde. Sie schaute mich nicht einmal an, wenn wir zwischen zwei Kursen im Korridor aneinander vorbeigingen, und es gab Gerüchte, dass sie Gemeinheiten über mich verbreitete. Ich weiß nicht, ob das stimmte.
Als ich von der Schule abging, sah ich sie nie wieder.
»Reden Sie noch manchmal mit Sarah?«, fragt mich die Reporterin, als könnte sie meine Gedanken lesen. Ich habe von der unglaublichen Intuition dieser Frau gehört und sollte vor ihr auf der Hut sein. Sie weiß, wie sie ihren Interviewpartnern Informationen entlocken kann, bevor diese es überhaupt richtig merken.
»Nein.« Ich schüttele den Kopf und ärgere mich, dass das Wort so rau herauskommt. Der Verlust von Sarahs Freundschaft war das Zweitschlimmste, womit ich nach allem, was passiert war, fertigwerden musste. Fast so schlimm wie der Verlust der Zuneigung meines Vaters. Mom und ich kamen uns dagegen näher. Überraschenderweise wurde Brenna meine beste Freundin und engste Vertraute. Was sie noch immer ist.
Aber das liegt auch daran, dass ich sonst keine Freundinnen habe. Ich lasse niemanden Neuen an mich heran.
Und meine alten Freunde haben mich im Stich gelassen. Oder ich sie.
Ich weiß nicht recht, was zuerst kam.
»Vielleicht waren Sarahs Schuldgefühle nach allem, was passiert ist, zu groß. Glauben Sie, dass sie sich für Ihr Verschwinden verantwortlich fühlte?«
»Nein. Keine Ahnung.« Ich klinge abwehrend, wie ich die Worte herausstoße. Jung. Ich hatte mir geschworen, cool und gefasst zu bleiben, und die Reporterin – sie heißt Lisa – hat mir versprochen, mir keine unangenehmen Fragen zu stellen. Sie würde sich mit den Informationen begnügen, die ich ihr von mir aus mitteile.
Aber bestimmt hat sie geglaubt, unangenehm wäre mir all das, was mit Aaron William Monroe zu tun hat. Und nicht die Frage nach der Freundin, die ich vor langer Zeit verloren habe.
Lisa sieht mich eindringlich an und versucht, mein Gehirn auseinanderzunehmen. Ich verrammele es jedoch von allen Seiten und presse die Lippen zusammen, damit mir nur ja kein ungewolltes Wort entschlüpft. Ich habe im Laufe der Jahre alle möglichen Verteidigungsstrategien entwickelt, und das ist eine von ihnen.
»Erzählen Sie mir, was nach dem Mittagessen vorgefallen ist«, sagt Lisa.
Ich hole tief Luft und überlege mit angehaltenem Atem, womit ich anfangen soll.
Denn ab hier wird es hart.
Ethan
Gegenwart
Zum ersten Mal seit Jahren höre ich, wie jemand anders ihren Namen sagt, woraufhin ich aufschrecke.
Ich drehe mich nach dem Fernseher um, der an der Wand meines schmalen Wohnzimmers hängt, und fasse blinzelnd den Bildschirm ins Auge. Da ich die Brille nicht aufhabe, taste ich hastig nach ihr, finde sie vor mir auf der Küchentheke und setze sie auf.
Jetzt sehe ich alles klar, und vor Überraschung kriege ich den Mund nicht mehr zu.
Diese Woche in News in Current mit Lisa Swanson: Katherine Watts, die ihrem Entführer vor acht Jahren entkam, spricht zum ersten Mal über ihre Tortur.
Wie vom Blitz getroffen, starre ich hin, als Katherine auf meinem Bildschirm erscheint. Ihr Haar ist ein wenig dunkler, hat aber immer noch einen goldfarbenen Blondton. Sie sieht älter aus – natürlich, verdammt noch mal, es ist ja auch acht Jahre her, genau wie die Ansagerin gesagt hat, und in dieser Zeit haben wir uns alle verändert.
Enorm.
»Ich hatte an diesem Vormittag viel Spaß«, erzählt sie, und ihre sanfte helle Stimme erfüllt den Raum. In meinem Kopf dreht sich alles, und mir wird schwindelig. Sie klingt genauso wie damals, aber doch älter. Anders.
Viel Spaß. Ja, natürlich hatte sie an dem Vormittag Spaß. Der Boardwalk ist super, wenn man zwölf ist. Ich fand es da auch cool. Und mag ihn immer noch.
Meine Erinnerungen daran sind allerdings auch nicht durch eine Zeit des Schreckens getrübt wie ihre.
»Anfangs war er so nett«, fährt sie fort, und als sie den Kopf senkt und sich auf die Lippen beißt, erstirbt ihre Stimme. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Anscheinend hat sie sich in den vergangenen acht Jahren doch nicht so sehr verändert, oder zumindest sind die verräterischen Zeichen dieselben geblieben.
Sie fühlt sich unsicher. Zögert.
Das Blut rauscht mir im Kopf, als ich sie so sehe und höre, dem Klang ihrer vertrauten und zugleich veränderten Stimme lausche. Sie klingt sehr gefasst, und ihre Worte sind ganz klar. Gut sieht sie außerdem noch aus. Sie ist hübsch mit ihrem langen blonden Haar, den großen blauen Augen, dem rosigen Mund …
Ich schließe ganz kurz die Augen und schlucke kräftig. Alle Erinnerungen ziehen tosend wie die Flammen eines Waldbrandes eine nach der anderen über mich hinweg, und ich halte mich am Küchentresen fest. Diese Erinnerungen will ich nicht. Ich habe sie aus meinem Kopf verbannt, habe vor Jahren mit diesen Dämonen gekämpft und sie besiegt. Sie gehören zu einem traurigen Kapitel meines Lebens, noch so einem Teil meiner Geschichte, den ich nach Kräften verdränge.
Doch als ich Katie jetzt sehe und höre, erwacht mein altes Ich und öffnet sich so weit und klaffend, dass es mir das Herz bricht.
»Scheinbar harmlos?«, fragt Lisa in diesem sachlichen Tonfall, bei dem sich mir alle Nackenhaare sträuben. Mit dieser Stimme hat sie sich mehr als einmal an mich gewandt. Als ich noch ein Kind war, völlig verängstigt, und nicht wusste, was ich sagen sollte. Ich hasse Lisa Swanson.
Ein neues Bild füllt den Fernseher aus. Katherine damals, als sie gefunden wurde. Mit verweinten Augen schaut sie direkt in die Kamera, sie wirkt völlig verzweifelt. Sie trägt einen schlabberigen Trainingsanzug, und ihr Haar ist hinten zottelig zusammengebunden. Links und rechts von ihr stehen zwei Polizisten, darunter eine Frau, die sie ins Krankenhaus bringen.
Katie. Wenn ich sie so sehe, bricht alles wieder in mir auf. Eine Erinnerung nach der anderen überfällt mich, ein Versprechen nach dem anderen. Mir zittern die Knie, weswegen ich mich am Tresen festhalte.
Du darfst keine Angst haben, Katie. Du musst tapfer sein. Du musst mitkommen.
Was, wenn er uns findet? Was macht er dann mit uns?
Er wird dir nichts tun. Das lasse ich nicht zu.
Versprochen?
Versprochen.
»Hat er jemals versucht, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen?«
Jetzt ist wieder Lisa auf dem Bildschirm zu sehen. Sie hat die Augenbrauen zusammengezogen und den Kopf schief gelegt, als würde sie sich angestrengt konzentrieren. Als läge ihr Katherine am Herzen.
Ich schnaube verächtlich und schüttele den Kopf. Ja, natürlich ist das alles wichtig für sie. Nämlich die Zuschauerquote, das Geld und das nächste große Interview, das sie an Land ziehen kann.
Ich kann es nicht fassen, dass Katherine mit ihr redet.
Katie.
Meine Katie.
Es ist so lange her, seit ich sie so genannt habe, dass es fremd in meinen Ohren klingt. Für eine ganz kurze Zeit habe ich mich ihrer angenommen und war verantwortlich für ihre Sicherheit. Sie nannte mich ihren Schutzengel, und obwohl ich es abwehrte, freute ich mich insgeheim über das Kompliment. Es machte mich glücklich, dass sie mich für einen guten Menschen hielt. Mich schätzte.
Ohne zu zögern, habe ich damals das getan, was richtig war. Das musste ich. Ich konnte nicht zulassen, dass sie seine Gefangene blieb. Er hätte …
Ich mag mir gar nicht vorstellen, was er ihr angetan hätte.
Ich war nicht nur ihr Schutzengel, sie nannte mich auch ihren Helden. Das sagte sie zu mir, als wir schon fast bei der Polizeiwache waren. Noch immer habe ich ihre Stimme deutlich im Kopf.
Du hast mich vor ihm gerettet. Du bist mein Held. Als hätte der Himmel mir einen Schutzengel geschickt.
Ich glaubte nicht an Gott, aber in diesem Moment hätte ich das gern getan. Unheimlich gern.
»Kontakt zu mir? Nein«, antwortet Katherine energisch und schüttelt den Kopf. »Nie.«
»Wirklich?« Lisa zieht die Augenbrauen hoch. Als Nächstes sieht man das Foto eines Briefes. Ich erkenne die Handschrift, und meine Finger klammern sich so fest um die Kante des Tresens, dass es sich anfühlt, als würden gleich meine Hände in Stücke brechen.
Schnitt. Jetzt sieht man Katherine mit geöffneten Lippen und geweiteten Pupillen. Was immer Lisa ihr gezeigt hat, kann nichts Gutes sein.
Ich weiß es.
Und dann ist sein Gesicht da. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit eigensinnig vorgerecktem Kinn. Den Mund hat er zu einem Strich zusammengepresst, und seine Augen sind ausdruckslos. Seine Miene ist kalt, das Haar kahl rasiert, und bestimmt hat er ein riesiges Tattoo seitlich am Hals. Ja, natürlich.
Schließlich sitzt er im Knast. Da musste er sich soweit irgend möglich an den Stil der Insassen anpassen, sonst hätten sie ihn mit dem Schwanz an die Decke genagelt. Einer, der Kinder missbraucht. Ein Vergewaltiger. Ein Killer.
Mein Vater.
Will
Damals
»Komm rein.«
Ich erstarrte, als ich ihn aus seinem Schlafzimmer mit drohender Stimme nach mir brüllen hörte. Er war betrunken. Mal wieder. In letzter Zeit war er ständig betrunken, und meistens beachtete er mich gar nicht, aber heute Abend war es anders.
Scheiße.
Ich schlurfte widerwillig in sein Schlafzimmer und verzog bei dem Geruch, der mir entgegenschlug, angeekelt das Gesicht. Er war schwer zu beschreiben. Moschusartig. Abgestanden. Stank nach Schweiß. Alkohol. Sex.
»Wo warst du?«, fragte er, als ich vor seinem Bett stehen blieb. Er lag darauf, hatte außer seiner schmutzigen weißen Boxershorts nichts an. Seine Haut war bleich, und seine Brustbehaarung hob sich davon dunkel ab. Er hatte sich nicht rasiert, und die zerzausten Haare standen in alle Richtungen von seinem Kopf ab.
Er sah richtiggehend durchgeknallt aus.
»In der Schule«, antwortete ich und sah an ihm vorbei. Es fiel mir schwer, ihn anzuschauen: Diese leere Hülle eines Mannes, der einmal bedeutend und wichtig gewesen war. Jedenfalls hatte er mir das erzählt.
Ich selbst hatte ihn nie so erlebt, aber was wusste ich schon? Ich war erst fünfzehn. Dumm und unwissend. Auch das hatte er mir gesagt.
»Du verdammter Lügner«, fuhr er mich an. »Sag die Wahrheit.«
»Da war ich wirklich«, beharrte ich. »In der Schule. Ich hatte Football-Training.« Ich verbrachte viel Zeit in der Schule und trieb Sport, damit ich nicht heimmusste. Damit ich ihm nicht begegnen musste. Meistens war es ihm scheißegal, wo ich gerade steckte oder was ich trieb. Ich begriff nicht, warum er sich jetzt so aufführte.
Ein Schauer überlief mich, denn ich rechnete mit dem Schlimmsten.
Er wollte etwas von mir. Und ich wusste nicht was.
»Im Sommer? Football-Training«, äffte er mich mit der hohen winselnden Stimme nach, die absichtlich so klang, als imitierte er ein Mädchen. Oder mich mit Mädchenstimme. Das Arschloch. »Du hältst dich wohl für einen tollen Hecht, wenn du Football, Basketball und den ganzen anderen Scheißsport mitmachst, den ihr habt? Bildest dir wohl ein, du mit deiner hässlichen Visage könntest ein paar Mädchen abkriegen.«
Ich presste die Lippen zusammen und erwiderte nichts. Was wusste er denn schon? Wenn ich etwas Falsches sagte, würde er mich ohrfeigen. Er sah zwar aus wie ein fauler Sack, wie er da auf seinem Bett lümmelte, aber der Kerl konnte schnell sein, wenn er wollte.
Ich musste es wissen. Ich hatte schon oft genug ohne Vorwarnung eine gefangen.
»Ich hab eine neue Freundin«, wechselte er plötzlich das Thema. »Und ich möchte, dass du sie kennenlernst.«
Nun begegnete ich schließlich doch seinem Blick, und was ich sah, gefiel mir nicht. In seinen teuflisch dunklen Augen glitzerte Belustigung, und seine Lippen waren zu einem gemeinen Lächeln verzogen. »Wann?«, fragte ich misstrauisch.
»Jetzt«, verkündete er, und genau in diesem Moment schwang die Tür des angrenzenden Badezimmers auf, und eine Frau, die nur mit schwarzer Unterwäsche bekleidet war, stolzierte heraus und blieb unmittelbar vor mir stehen, die Hände in die Hüften gestemmt.
Ich sah sie an und bemerkte die dünnen Falten um den schmalen Mund und den Blick, der genauso hart war wie der meines Dads. Ihr Haar war orangefarben und sah an den Spitzen verbrannt aus. Ihre Haut war bleich. Aschfahl.
Sie sah aus, als wäre sie tot.
»Hi.« Ihre Stimme war so rau, als hätte sie in ihrem Leben schon eine Million Zigaretten geraucht, und das traf wahrscheinlich auch zu. Sie stank nach Rauch, und diesen Geruch kannte ich, seit ich selbst heimlich mehr als ein paar Kippen täglich qualmte.
Mein einziges Laster.
»Ich bin Sammy.« Sie streckte mir die Hand hin, und ihre pinken Nägel schossen wie Dolche auf mich zu. »Und du musst Willy sein.«
Ich starrte meinen Dad aufgebracht an, so wütend über diesen verdammten Spitznamen, dass ich am liebsten geschrien hätte. »Will«, verbesserte ich sie und schüttelte ihre Hand nur so kurz, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. Was durchaus der Fall sein mochte. »Kann ich jetzt gehen?«, fragte ich meinen Dad.
»Nein.« Lächelnd klopfte er neben sich auf die Matratze. »Komm her, Cookie.«
Er nannte jede seiner Freundinnen Cookie. Ob die dumme Sammy sich darüber im Klaren war? So, wie sie mit leisem Kichern eifrig aufs Bett hüpfte, bezweifelte ich das.
»Na, magst du meine neue Cookie, Willy?«, fragte mein Dad und drückte sie an sich, was sie noch mehr zum Lachen brachte. »Ist sie nicht süß?«
Nein. Ich fand sie grässlich. Sie sah aus wie eine alte Straßenhure. Genau wie all die anderen. Wahrscheinlich war sie süchtig, nahm Crack oder Meth oder so, und mein Dad sorgte für Nachschub. Er stand ebenfalls auf Crack und Meth und diese ganze Scheiße. Manchmal. Dann wieder riss er sich zusammen und sah dann richtig gut aus. Mein Dad kam super rüber, wenn er mal duschte, sich das Haar kämmte, sich rasierte und sich anzog wie ein normaler Mensch.
Aber jetzt war es nicht so. Er war abgerutscht und in seinen dunklen inneren Sumpf gefallen. Das merkte ich genau. Ich wusste, was er von mir wollte. Ich hatte es schon früher machen müssen, als ich noch klein und schwach war und zu viel Angst hatte, um mich zu wehren.
Doch das war vorbei. Ich war stark geworden. Der ganze Sport und auch die Niederlagen auf dem Spielfeld hatten mir Kraft gegeben. Ich wurde mit ihm fertig, wenn ich wollte. Wir waren gleich groß. Hoffentlich würde ich noch ein paar Zentimeter zulegen und diesem Arschloch über den Kopf wachsen. Tja, und dann? Was würde er tun?
Ich wollte, dass er so große Angst vor mir bekam, wie ich einmal vor ihm gehabt hatte.
»Setz dich da drüben hin, Willy.« Er deutete auf den zerschlissenen blassgrünen Stuhl, der in der Ecke des Schlafzimmers stand. Angeblich hatte der einmal meiner Mutter gehört.
Das einzige Überbleibsel in unserem Haus, das bewies, dass es sie einmal gegeben hatte. Fotos waren keine da. Mein Dad hatte sie alle zerrissen und verbrannt. Er hatte sie zerstört, hatte meine Mutter und meine Erinnerungen an sie vollkommen vernichtet.
»Nenn mich nicht so«, stieß ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor, denn ich hasste diesen Spitznamen. Und nicht nur das. Dazu kam die Wut auf den Namen an sich. Seinen Namen, der auch meiner war. Er hieß Aaron William. Und ich William Aaron. Es kotzte mich an, sein Namensvetter zu sein, auch wenn die Reihenfolge vertauscht war.
Irgendwann würde ich meinen Namen ändern. Mir selbst einen Namen geben, der nur mir gehörte und niemals ihm.
»Willy«, rief Sammy und legte den Kopf zurück, als heulte sie den Mond an. Dad lachte und kippte sie nach hinten auf den Rücken. Er legte ihr die Hand auf die Titten und presste kurz den Mund auf ihren.
Dann hob er den Kopf und starrte mich an. »Setz dich auf den Stuhl.«
»Fick dich ins Knie«, antwortete ich.
»Setz. Dich. Auf. Den. Stuhl«, befahl er mit drohend gesenkter Stimme.
»Komm schon, Willy. Er will doch nur, dass du zuschaust. Er hat mir erzählt, dass du das magst«, warf Sammy ein und kicherte, als er sie in den Nippel zwickte, damit sie den Mund hielt. Aber sie hielt ihn nicht. Sie brach in ein gackerndes Hexengelächter aus, und er wälzte sich auf sie, hielt ihr den Mund mit der Hand zu und drückte sie mit seinem Gewicht nieder. Sie schrie los, die Stimme von seiner Hand gedämpft, und ich packte die Gelegenheit beim Schopf.
»Fick dich ins Knie«, wiederholte ich finster, schoss durch den schmalen Flur in mein Zimmer und schlug die Tür krachend hinter mir zu. Ich drehte den Schlüssel im Schloss und warf mich mit hämmerndem Herzen auf das schmale Bett. Das Blut rauschte so laut in meinen Ohren, dass ich nichts anderes mehr hörte.
Ich starrte den Türgriff lange Zeit an und erwartete, dass mein Dad daran rütteln würde, dass er an die Tür hämmern und mich zum Aufschließen auffordern würde. So etwas hatte er schon früher getan. Zahllose Male. Als ich noch kleiner war, packte er mich dann am Nacken, führte mich in sein Schlafzimmer und drückte mich auf den Stuhl.
Er zwang mich, ihm zuzuschauen.
Alles in meinem Inneren brannte, und ich nahm mein Kopfkissen und presste es an mich. Ich hasste meinen Vater. Und ich hasste meine Mutter, weil sie mich bei ihm zurückgelassen hatte. Warum hatte sie mich nicht mitgenommen? Tränen prickelten in meinen Augenwinkeln, doch ich blinzelte sie zurück und widerstand dem Drang zu weinen. Ich hatte genug geweint. Es wurde Zeit, dass ich härter wurde. Ich war zu alt, um noch wie ein Baby zu heulen.
Noch drei Jahre. Es blieben drei Jahre Schule, dann würde ich meinen Abschluss machen und von hier abhauen. Falls ich nicht aufs College konnte, würde ich zum Militär gehen. Zur Marine. Oder so. Egal was, nur weg. Die Welt machte mir keine Angst.
Aber ich hatte verdammte Angst davor, was aus mir werden könnte, wenn ich hierbliebe.
Ich lag lange auf dem Bett und drückte das Kissen fest an mich, der ganze Körper angespannt, die Muskeln so verkrampft, dass sie wehtaten, wenn ich versuchte, mich zu bewegen. Endlich schloss ich die Augen und überließ mich meiner Erschöpfung.
Er kam nicht an meine Tür.
Und danach befahl er mir nie wieder, ihm zuzuschauen.
Katherine
Gegenwart
Schaust Du es dir an?
Ich lese die Textnachricht meiner Schwester und lasse zögernd die Finger über den Tasten schweben. Was soll ich ihr antworten? Sollte sie sich bei mir einladen wollen, müsste ich sie abweisen. Ich möchte sie heute Abend nicht hier bei mir haben. Ich will allein sein.
Und Du?
Ich schicke die Nachricht ab und warte auf Brennas Antwort. Ich verstecke mich aus Angst vor der Reaktion der Medien. Wenn heute Abend das Interview gesendet wird, könnte das mein Leben auf den Kopf stellen. Dann wäre es wieder wie damals, als alle hinter uns her waren und wir sie abwimmeln mussten und jedes Gespräch verweigerten.
In den Jahren seither hat es unzählige Theorien gegeben, was mit mir los gewesen sei. Ich sei von zu Hause abgehauen. Ich hätte es so haben wollen. Ich hätte bei ihm sein wollen. Ich hätte seine Sexsklavin sein wollen. Ich hätte unbedingt meinen strengen Eltern entkommen wollen. Ich hätte mein Leben zu Hause gehasst. Ich sei ein widerspenstiges frühreifes Mädchen gewesen, das seinen Spaß haben wollte. Ich sei eine verdammte Schlampe, die alles verdient habe, was mir zugestoßen sei. Ich sei eine dreckige Fotze, die gern Schwänze lutsche.
Jede einzelne dieser schrecklichen Lügen ist über mich erzählt und im Netz verbreitet worden. Ganze Videos auf YouTube sind meinen angeblichen Lügen gewidmet. Ich habe mir einmal eines angeschaut und musste mich gleich danach übergeben. Ich erinnere mich bis heute, was in dem Video gesagt wurde.
Sie ist eine Verführerin. Eine Schlampe. Sie hat ihn mit ihrer provokativen Kleidung verleitet. Sie hat nach ihrer Rettung den Mund gehalten, weil sie selbst schuld ist. Sie hatte Geheimnisse zu verbergen. Sie war drogensüchtig. Eine Schlampe. Die Freundin seines Sohns, und er und sein Vater haben sie miteinander geteilt.
Weil ich überlebt habe, hat man mir aus irgendeinem Grund die Schuld gegeben. Ich hätte es nicht anders verdient und hätte es so haben wollen: dass ein Serienmörder mich mitten am helllichten Tag entführt und mich wie sein persönliches Spielzeug gefangen hält.
Mein Handy piept, und ich lese die Nachricht von Brenna.
Ich will es mir wirklich nicht ansehen. Als Du das Interview gegeben hast, hab ich genug gehört.
Hatte sie da nicht recht? Ich will gerade antworten, als die nächste Nachricht eingeht.
Mom hat angerufen und gefragt, ob wir uns heute Abend nicht treffen sollen. Ich hab gesagt, ich würde erst mal hören, was Du meinst.
Oje, nein danke. Ich will nicht mit Mom zusammen sein. Dann heult sie nur und versucht, mich zu trösten, und damit bin ich fertig. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Aber ich möchte es mir anschauen. Allein. Ich möchte sehen, wie sie mich porträtiert haben. Lisa hat mir hoch und heilig geschworen, dass es ein positives Bild von mir zeigen würde. Dass ich hinterher nicht schlecht dastehen würde, schließlich sei ich das Opfer.
Ich verbesserte sie, ich sei kein Opfer. Ich sei eine Überlebende. Das ist ein großer Unterschied.
Ein Riesenunterschied.
Ich möchte die Sendung hier schauen. Sag Mom Danke, aber ich möchte sie allein sehen.
Ich schicke die Nachricht ab, bevor ich es mir noch einmal anders überlegen kann, und warte auf eine Antwort.
Meine Eltern sind nie umgezogen. Mom lebt noch immer in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und Brenna ist auch nicht weit weg. Sie hat eine Wohnung mit ihrem Freund Mike. Sie unterrichtet die dritte Klasse derselben Grundschule, die wir als Kinder besucht haben. Das haut mich immer noch um – meine ungeduldige, kratzbürstige ältere Schwester unterrichtet Tag für Tag mit Begeisterung eine Rasselbande Achtjähriger.
Ich selbst bin ganz bewusst umgezogen. Ich lebe nun eine Stunde südlich von meinem Elternhaus in einer sehr kleinen Stadt unweit des Orts, an dem ich entführt wurde. Also im Mittelpunkt des Schreckens, und ich weiß selbst nicht, warum mich das beruhigt, aber ich hinterfrage meine Motive nicht gern allzu genau.
In Anbetracht dessen, was derzeit los ist, bin ich in Deckung gegangen. Ich habe alle notwendigen Schritte unternommen, um unauffindbar zu sein, und so soll es auch bleiben. Es ist mir lieber so. Jetzt, wo die News in Current-Sendung ständig mit einer Serie von Fotos beworben wird, bin ich froh über diese Vorsichtsmaßnahme. Erst sieht man mich, wie ich geschockt auf einen Brief reagiere, von dessen Existenz ich nichts wusste – vielen Dank, liebe Mom. Musstest du das wirklich vor mir geheim halten? Und gleich im Anschluss an das Bild, wie mir die nackte Panik ins Gesicht geschrieben steht, kommt Aaron William Monroes Polizeifoto.
Genau diesen Moment habe ich in dem Interview am meisten gehasst. Ja, und dann noch den anderen, als ich den Jungen vehement verteidigen musste, der mich vor dem Unmenschen gerettet hat.
Den Jungen, der mich vor seinem Dad in Sicherheit brachte.
Mein Handy erschreckt mich mit seinem Klingeln, und ich lasse es beinahe fallen. Ein Blick auf das Display zeigt mir, dass es Mom ist.
Na super.
»Liebling, bist du dir sicher, dass du heute Abend allein sein möchtest?« Sie klingt besorgt. Das höre ich, ja ich fühle die Emotionen geradezu in ihrer Stimme. »Was, wenn du dich furchtbar aufregen musst? Ich finde, du solltest das nicht allein durchstehen müssen. Wir wollen bei dir sein.« Mit wir meint sie sich selbst und Brenna.
»Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Mom, aber ich möchte nicht zu dir fahren.« Ich klinge steif. Hölzern. So wie früher immer mit Dad.
»Wie wär’s, wenn Brenna und ich zu dir kommen?«, schlägt sie vor.
»Bitte, Mom.« Ich schließe mit einem Seufzer die Augen und ringe um Geduld. Ich möchte nicht böse werden. Sie meint es gut. »Ich möchte dabei lieber allein sein. Ehrenwort: Wenn ich traurig werde oder Angst kriege oder was auch immer, ruf ich dich an.«
»Okay.« Sie stößt langsam und erschöpft den Atem aus. »Okay. Ich möchte nur … ich möchte für dich da sein.«
»Das warst du doch immer.«
»Dein Vater …« Ihre Stimme verliert sich, und sie seufzt. Sie vermisst ihn. Und Brenna vermisst ihn auch. Beide sind noch sehr verletzlich und reden nicht viel über ihn, weil sein Tod noch so frisch ist.
Für mich fühlt es sich anders an. Ich habe ihn schon vor langer, langer Zeit verloren.
Ich erwidere nichts und warte ab, dass sie fortfährt.
»Vielleicht hat er nicht so reagiert, wie wir es uns gewünscht hätten, aber du musst wissen, dass er dich genauso geliebt hat wie immer. Bevor es passiert ist und auch danach«, sagt sie.
Sie verteidigt ihn, und das verstehe ich, doch sie lügt. Möglich, dass er mich geliebt hat, allerdings nicht so wie vorher. Für ihn war ich danach besudelt. Nicht mehr sein kleines Mädchen. Sondern eine Frau in einem Mädchenkörper.
Ich bin beinahe dreizehn …
Ich denke daran, wie alt mir das damals vorkam. Bald – so ging es mir zu dieser Zeit durch den Kopf – würde ich die magische Brücke zwischen zwölf und dreizehn überqueren und mich in eine Frau mit Kurven verwandeln, die dann ihre Periode hätte und vielleicht sogar … irgendwann einmal … einen Freund.
Aber so ist es nicht gekommen. Danach habe ich mir jedes Gramm Fett von den Knochen gehungert, weil ich glaubte, ich sei kein Essen mehr wert. Des Lebens nicht mehr wert. Ich habe nicht einmal mehr fünfzig Kilo gewogen und meine Regelblutung erst mit sechzehn bekommen. Einen Freund hatte ich nie. Ich bin nicht zur Highschool-Abschlussfeier gegangen und war auch niemals auf einem Schulball. Für mich gab es keine Football-Spiele, keine Partys, kein Übernachten bei Freundinnen, nichts dergleichen. Das alles machte mir Angst. Jungs machten mir Angst. Und schlimmer noch: Männer erschreckten mich zu Tode. Insbesondere Lehrer. Die schauten mich immer an. Prüfend. Ich spürte, wie ihre Blicke über mich wanderten, als krabbelten winzige Ameisen meine Beine hinauf, über die Hüften und den Bauch und rund um die Brüste.
Ich fange an zu weinen, bevor ich mich zusammenreißen kann.
»Ähm, danke für deinen Anruf, Mom, aber ich muss jetzt los.« Ich lasse sie nicht mehr zu Wort kommen, sondern beende das Gespräch. Ganz vorsichtig lege ich mein Handy neben mich auf die Couch und lasse den Tränen freien Lauf.
Nichts ist in Ordnung mit mir. Ich dachte, ich wäre okay, aber so ist es nicht. Ich dachte, ich müsste nur meine Geschichte erzählen und sie ein für alle Mal loswerden, dann könnte ich einen Schlussstrich ziehen. Dann würde ich mich endlich gereinigt fühlen. Nachdem ich mich in den letzten acht Jahren meines Lebens wie eine dreckige, schmierige Schlampe gefühlt habe – danke, liebes Internet, für diese Gedanken –, wäre ich endlich sauber gewaschen und wieder heil und unschuldig.
Aber so ist es nicht. Ich wurde auf brutalste Weise vergewaltigt.
Geistig.
Und emotional.
So schwer, dass der körperliche Missbrauch gar keine Rolle mehr spielt.
Ethan
Gegenwart
Ich sitze voll nervöser Spannung auf meiner Couch und warte auf News in Current. Die Sendung fängt um einundzwanzig Uhr an und läuft bis dreiundzwanzig Uhr. Zwei Stunden vor mir zu haben, die von Katie und mir handeln, fühlt sich schlecht an und macht mir Schuldgefühle, aber ich bin auch aufgeregt. Und beunruhigt.
Sie müssen mich erwähnen. Ich bin ein integraler Bestandteil dieser Geschichte – ihrer Geschichte. Werden sie mich schlecht dastehen lassen? Bestimmt. Ich hasse Lisa Swanson, und sie mag mich auch nicht besonders.
Ich hatte mit allen Mitteln versucht, mir Katie Watts aus dem Kopf zu schlagen, und mir seit Jahren nicht mehr gestattet, an sie zu denken. Das durfte ich nicht. Aber nun, da sie wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist, belegt sie mich völlig mit Beschlag. Stundenlang habe ich auf meinem Laptop nach Informationen gesucht, wo sie sich aufhält, was sie macht und was für ein Mensch sie geworden ist.
Leider konnte ich nicht viel herausfinden. Sie lebt zurückgezogen. Das überrascht mich nicht. Ihren Namen hat sie nicht geändert, abgesehen davon, dass sie jetzt nicht mehr den Kosenamen verwendet, sondern das offiziellere Katherine. Einen Highschool-Abschluss hat sie nicht gemacht, zumindest ist nichts davon zu finden. Ihre Schwester ist Lehrerin. Brenna Watts besitzt eine Facebook-Seite und hat ihre Privatsphäre nicht geschützt, sodass jeder alles sehen kann. Diese Seite habe ich wie ein Stalker nach Fotos von Katie abgesucht, nach irgendeiner Erwähnung oder einem Link auf ihr eigenes Profil.
Aber ein Profil für Katie gibt es nicht. Und sie wird auf der Seite ihrer Schwester auch nicht oft erwähnt. Vor einem Jahr hat Brenna allerdings ein Foto der Einstandsparty in ihrer neuen Wohnung gepostet. Sie und ihr dämlich aussehender Freund Mike feierten, dass sie zusammenzogen. Es ist ein Gruppenfoto: Ein Haufen Leute in einem überfüllten Wohnzimmer prosten mit ihren Gläsern der Kamera zu. Wer immer das Foto aufgenommen hat, muss dabei auf einem Stuhl oder Hocker oder so gestanden haben, das merkt man am Blickwinkel.
Dort entdeckte ich Katie im Gedränge, ohne ein Glas in der Hand, aber mit einem Lächeln im Gesicht. Ihr Haar war auf dem Kopf zu einem unordentlichen Knoten zusammengefasst, und dünne Haarsträhnen rankten sich zu ihren Wangen hinunter. Ihr Blick war direkt. Wie sah sie aus?
Schön.
Verloren.
Traurig.
Einsam.
Gebrochen.
Ich betrachtete das Foto lange. Dann klickte ich es als Stalker, der ich bin, mit der rechten Maustaste an und speicherte es auf meiner Festplatte. Wie würde sie reagieren, sollte ich sie kontaktieren? Würde sie sich dann freuen? Oder mich hassen? Würde sie mich für ein Arschloch halten oder noch immer für ihren Helden? Ihren Schutzengel?
Du hast mich vor ihm gerettet. Du bist mein Held.
Ich habe ihre Worte nach wie vor im Ohr. Nach all der Zeit. Und ich werde sie auch nie vergessen. Sie lassen mein Herz bluten und bohren sich in meine Seele, als wäre Katie nie daraus fort gewesen.
Und das war sie auch nicht.
Ich schaue auf den Fernseher und bemerke, dass die vorangegangene Sendung nun zu Ende ist. Lisa Swanson füllt den Bildschirm aus und hat mit ihrem gespielt aufrichtigen Blick eine Miene aufgesetzt, die ich das Nachrichtenschlampengesicht nenne. Ich stelle lauter, bis ihre Stimme mein Wohnzimmer ausfüllt, meinen Kopf und meine Gedanken kapert und ich ihr am liebsten sagen würde, sie soll die Klappe halten.
Aber ich schalte nicht aus.
Denn obwohl ich das nur zähneknirschend zugebe, möchte ich die Sendung unbedingt sehen.
Katie
Damals
Die Briefe trafen regelmäßig jede zweite Woche ein, meistens donnerstags oder freitags. Nach der Schule holte immer ich die Post rein, und das hatte ich ihm gesagt. Vorher hatten wir E-Mails ausgetauscht, aber das kam mir so nüchtern und unpersönlich vor. Ich hatte ihn gebeten, mir stattdessen auf Papier zu schreiben, und er war einverstanden gewesen.
Ich mochte seine Handschrift, die kühnen Striche auf dem Papier und die verschmierte Tinte, die mir in Erinnerung rief, dass er Linkshänder war und beim Schreiben mit der Hand über die Worte streifte. Das zerknitterte Blatt sagte mir, dass er es aus einem Schulheft gerissen hatte. Und die albernen Kommentare am Rand erinnerten mich daran, dass er noch jung war.
Wir waren beide noch jung, auch wenn wir uns meistens nicht so fühlten. Wir hatten so schnell erwachsen werden müssen. Das war wohl auch der Grund, aus dem wir uns noch immer zueinander hingezogen fühlten. Seelenverwandte, die unter demselben Mann gelitten hatten und so.
Ich öffnete den Briefkasten, schnappte mir den Inhalt, nahm den an mich adressierten Brief heraus und schob ihn in die Tasche meines Pullis. Im Haus legte ich die restliche Post auf die Küchentheke und gab meiner Mutter, die mir aus dem Wohnzimmer eine Begrüßung zurief, eine gemurmelte Antwort.
Erst später, wenn wir im Esszimmer am Tisch saßen und sie nach Kräften versuchte, Leben in die höfliche Konversation zu bringen, die meine Familie inzwischen betrieb, fragte sie mich nach meinem Tag aus. Das Abendessen bei Familie Watts war so schwer zu ertragen, dass es beinahe wehtat.
Ich fand es grässlich. Und Brenna auch.
Ich zog meine Kinderzimmertür geräuschvoll hinter mir zu, schloss ab, warf mich aufs Bett und griff nach dem Brief in meiner Tasche. Mit zitternden Fingern zog ich ihn heraus, voll Spannung auf das, was darin stehen mochte. Es könnte etwas Gutes sein. Oder etwas Schlechtes. Irgendwann würde es vielleicht keine solchen Briefe mehr geben, und darauf hatte ich mich, so gut ich konnte, vorbereitet. Seit beinahe einem Jahr korrespondierten wir nun miteinander. Er war so ziemlich der einzige Mensch, mit dem ich wirklich reden wollte. In der Schule hatte ich keine Freunde, nicht mehr.
Ich entfaltete den Brief und kaute auf meiner Unterlippe herum, während ich den Inhalt verschlang.
Katie,
Du fragst immer wieder, wie es für mich in der Jugend-WGläuft, als würdest Du Dir Sorgen machen oder so. Ich bin dieser Frage bisher ausgewichen, jetzt kann ich mich allerdings nicht mehr zurückhalten. Ich finde es hier furchtbar. Die anderen Jungs sind Arschlöcher. Sie beklauen mich, und letzte Woche habe ich mich mit einem von ihnen geprügelt. Ich habe ihn fertiggemacht, aber ein blaues Auge dafür kassiert und Arrest bekommen, weil ich angeblich mit der Prügelei angefangen hätte. Dabei war sie zunächst mal gar nicht meine Schuld. Und die fünfzig Dollar, die er mir geklaut hat, habe ich trotzdem nicht zurückbekommen.
Bei dem Tempo komme ich nicht vorwärts, schaffe ich es niemals irgendwohin.
Hab ich Dir erzählt, dass ich das Football-Spielen aufgegeben habe? Ich musste den ganzen Nachmittagssport sein lassen, sonst hätte ich niemals einen Job gefunden. Ich hab jetzt sogar zwei, einen offiziellen und dann noch einen, wo ich schwarz bezahlt werde. Beide sind Mist, doch wenigstens verdiene ich ein bisschen Geld. Ich muss allerdings ein neues Versteck dafür finden. Vielleicht könnte ich ja ein Konto eröffnen, keine Ahnung. Dafür brauche ich wohl die Unterschrift eines Erwachsenen, was für ein Scheiß. Ich darf arbeiten und Geld verdienen, aber kein Sparkonto eröffnen?
Na ja, genug gejammert. Wie geht es Dir? Wie läuft es in der Schule? Hast Du den Geschichtstest bestanden? Bestimmt. Du hast viel gelernt und machst Dir immer Sorgen wegen deiner Noten. Wie behandelt Dich Dein Dad? In Deinem letzten Brief hast du geschrieben, Brenna wäre besonders nett zu Dir. Ist das immer noch so?
Ich wünschte, ich könnte mich mit Dir treffen. Mit Dir reden. Die Verhandlung wurde schon wieder auf einen späteren Termin verschoben. Ich weiß, dass Du nicht über ihn reden möchtest, aber ich habe das Gefühl, die einzige Gelegenheit für mich, Dich überhaupt noch einmal zu sehen, ist die Verhandlung, und das widert mich einfach nur an, Katie.
Doch ich weiß, dass Du Dich nicht mit mir treffen kannst. Ich weiß, dass Deine Eltern Dich nicht mehr aus den Augen lassen, und das ist auch richtig so. Sie müssen Dich im Blick behalten, damit Dir auf keinen Fall etwas zustößt.
Wenn ich nicht da sein kann, sind eben sie die zweitbeste Lösung.
Ich muss zur Arbeit, tut mir also leid, dass der Brief so kurz ist. Aber Du musst wissen, wie sehr Du mir fehlst.
Will
Ich las den Brief noch einmal, voll Schmerz über das, was er durchmachen musste. Er war so arm dran. Er arbeitete hart, und wozu? Damit jemand ihm das Geld stahl? War das etwa gerecht?
Doch das Leben war total unfair. Das wusste ich. Und Will ebenfalls. Wir waren die Einzigen, die das so recht begriffen.
Die Einzigen, die einander wirklich verstanden.
Katherine
Gegenwart
Als ich vorhin das Interview geschaut und all die alten Fotos von mir gesehen habe, Bilder vom Tatort, von der Gerichtsverhandlung … sind alle Erinnerungen zurückgekehrt. Eine nach der anderen sind sie über mich hergefallen, nachdem ich sie so viele Jahre lang ganz tief in meinem Gedächtnis verbannt hatte. Ein überwältigender Ansturm. Und das Ergebnis waren schließlich fürchterliche Kopfschmerzen.
Ich habe viele Geschichten gehört, wie das Gehirn Menschen beschützt, die ein traumatisches Erlebnis hatten, indem es die Erinnerung löscht. In der Grundschule wurde eine Klassenkameradin von einem Auto angefahren, flog fünfzehn Meter durch die Luft und erinnerte sich …
… an nichts. An absolut gar nichts.
Wie sehr ich mir wünsche, mein Gehirn hätte mich vor den traumatischen Tagen beschützt, die ich durchmachen musste, indem es diese schrecklichen Erinnerungen abblockte, aber bei mir war es nicht so. Ich mag diese Erinnerungen nach Kräften verdrängt haben, doch sie sind immer da. Sie lauern auf mich. Sie warten nur darauf, zurückzukehren und mich heimzusuchen.
Heute Abend habe ich zum ersten Mal seit … einer Ewigkeit an ihn gedacht. Und mit ihm meine ich nicht das böse Monster, den schrecklichen Mann.
Ich denke an den anderen. Den Sohn. William.
Will.
Während des Interviews brachte Lisa das Gespräch auf ihn und fragte, ob ich nach allem, was passiert sei, je Kontakt mit ihm gehabt habe.
Ich log.
Aber er hatte mir als Erster geschrieben, gleich nach meiner Rückkehr zu meiner Familie. Ein Brief in einer kaum lesbaren steilen Handschrift, schnell hingeschmierte Zeilen auf liniertem Papier. Schmerzerfüllte Worte, der Wunsch, dass es mir wieder besser gehen möge, die Hoffnung, dass ich mich erholt habe, und eine Entschuldigung.
Eine lange, von Herzen kommende Entschuldigung, für die er nicht den geringsten Grund hatte. Er war gut zu mir gewesen. Er hatte mich gerettet. Außerdem lag seinem Brief noch ein Geschenk bei – ein Armband, an dem ein Schutzengel hing.
Ich trug dieses Schmuckstück monatelang, es war der einzige Gegenstand, der mir ein Gefühl der Sicherheit vermittelte und mir half weiterzumachen. Anfangs schrieben wir uns wöchentlich, dann ein, zwei Mal im Monat. Gelegentlich schickten wir uns E-Mails, und als ich endlich ein eigenes Handy bekam, auch SMS. Aber irgendwann brach er den Kontakt zu mir ab.
Ich hatte das Armband, Wills Geschenk, seit Jahren nicht mehr getragen und bewahrte es in einer alten Schmuckdose auf. Doch am Abend, nachdem ich das Interview gesehen hatte, kramte ich es hervor, legte es an und ließ die Finger immer wieder über den Anhänger gleiten, damit er mir Kraft gab. Damit er mir Mut machte.
Lisa warf mir einen skeptischen Blick zu, als ich ihre Frage über Will verneinte, aber ich blieb dabei. Ich zuckte mit keiner Wimper. Nach einem langen Moment des Schweigens erklärte sie, sie selbst wisse auch nichts über ihn. Sie könne nur vermuten, dass er seinen Namen geändert und eine andere Identität angenommen habe. Dass er nun ein neues Leben führe.
Hoffentlich war das wirklich so. Die Alternative wollte ich mir gar nicht erst ausmalen. Was, wenn er sich genau wie sein Vater dem Verbrechen zugewandt hatte? Was, wenn er die Schuldgefühle nicht abschütteln konnte, der Sohn dieses furchtbaren Mannes zu sein? Was, wenn … was, wenn er sich das Leben genommen hatte? Ich selbst hatte im Laufe der Jahre durchaus diese Versuchung verspürt. Gerade auch als ich noch jünger war und nicht wusste, wie ich mit allem fertigwerden sollte, gingen mir ständig Selbstmordgedanken durch den Kopf.
Aber ich machte weiter. Hielt durch. Und fand wieder zu mir selbst. Und Will? Hatte er es ebenfalls geschafft und einfach weitergemacht?
Während der Sendung streifte Lisa ihn nur ganz am Rande. Ein paar Anmerkungen hier und da – dabei hatte er mehr verdient. Er ist der einzige Grund, aus dem ich noch lebe. Der Teil des Interviews, in dem wir über ihn sprachen, wurde in der Sendung stark gekürzt. Warum mich das so traurig machte, weiß ich nicht.
Will war nicht mein Feind. Er hat mir geholfen. Ich gebe nichts auf die vielen Artikel und Berichte, in denen unterstellt wird, er sei an den bösen Taten seines Vaters beteiligt gewesen. Immer wieder wurde er bei den Verhören gefragt, warum er mich nicht früher zur Polizeiwache gebracht habe. Auch mich hat man andauernd zu Wills Rolle gelöchert.
Hat er dich belästigt?
Nein.
Hat er dich gezwungen, ihn zu berühren?
Nein.
Hatte er Sex mit dir?
Nein.
Hat er dich zu etwas genötigt? Ist er gewalttätig geworden?
Nein und nochmals nein.
Die Polizisten wirkten nie richtig zufrieden mit meinen Antworten.
War ihnen nicht klar, dass er einfach nur ein Kind war, so wie ich? Ich war beinahe dreizehn, als es passierte. Er war damals fünfzehn. Fast schon ein Erwachsener, hatte einer der Cops während meiner Erstbefragung in sich hineingemurmelt. Wir haben schon Mörder ins Gefängnis gesteckt, die jünger waren.
Was sie ihm unterstellten, stimmte nicht. Er war mein Held.
Mein Schutzengel.
Meine Antwort auf seinen Brief und sein Geschenk war eine Karte mit meinem innigen Dank in mädchenhafter Schrift. Ich schickte ihm ebenfalls ein kleines Geschenk. Mehr war nicht möglich, denn ich war noch ein Kind und wusste, dass meine Eltern außer sich sein würden, wenn sie herausfänden, dass ich mit dem Sohn meines Entführers korrespondierte. Für sie spielte es keine Rolle, dass er mich gerettet hatte. In ihren Augen war Will der Feind.