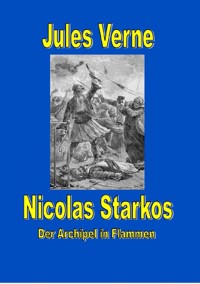
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1827 kämpfen die Griechen verzweifelt gegen die Willkürherrschaft der Türken, und ihr Freiheitskampf wird von vielen Europäern, den 'Philhellenen', unterstützt. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund spielt der Roman um Nicolas Starkos, Seeräuber und Sklavenhändler, den selbst seine Mutter, eine glühende Kämpferin für ein freies Griechenland, nicht von seinem Treiben abhalten kann. Dann kommt es zur schicksalhaften Begegnung mit der schönen Hadjine Elizundo, die allerdings den französischen Offizier Henry d'Albaret liebt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Verne
Nicolas Starkos – Pirat des Archipels
Der Archipel in Flammen
Jules Verne
Nicolas Starkos –
Pirat des Archipels
Der Archipel in Flammen
Durchgesehen und herausgegeben von Thomas Ostwald
Edition Corsar
D. u. Th. Ostwald, Braunschweig
Texte: © 2025 Copyright by Thomas Ostwald nach der Ausgabe des Hartleben-Verlages 1887 und der von mir betreuten Taschenbuchausgabe im Pawlak-Verlag 1984 durchgesehen und korrigiert
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by Thomas Ostwald
Edition Corsar
Dagmar u. Thomas Ostwald
Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
Erstes Kapitel
Ein Schiff in Sicht
Am 28. Oktober 1827 gegen fünf Uhr abends bemühte sich ein kleines levantinisches Fahrzeug, noch vor Einbruch der Nacht den Hafen von Vitolo, am Eingang des Golfs von Coron, zu erreichen.
Dieser Hafen, das Oetylos Homer's, liegt an einer der tiefen Einbuchtungen, welche aus dem Ionischen und Aegäischen Meere das Platanenblatt ausschneiden, mit dem man das südliche Griechenland so trefflich verglichen hat Dieses Blatt nimmt der alte Peloponnes, das Messene der Griechen unserer Tage, ein. Die erste dieser Ausbuchtungen bildet im Westen der Golf von Coron, der sich zwischen Messene und Laconia öffnet. Die zweite, der Golf von Marathon, der die Küste des ernsten Laconia tief einschneidet. Die dritte, der Golf von Nauplia, dessen Gewässer Laconia und Argolis scheiden.
Zu dem ersten der drei Golfe gehört der Hafen von Vitolo. An der Ostküste, im Hintergrunde einer unregelmäßigen Bai liegend, reicht er bis an die letzten Ausläufer des Taygetos heran, dessen Bergkämme das Skelet des Hinterlandes bilden. Die Sicherheit seines Ankergrundes, der bequeme Verlauf der Einfahrtsstraßen und die ihn umgebenden Höhen machen ihn zu einem der festen Zufluchtshäfen dieser von allen Winden der südlichen Meere unausgesetzt gepeitschten Küste.
Das Fahrzeug, welches bei ziemlich frischer Nordnordwestbrise sehr dicht am Winde segelte, konnte von den Hafendämmen Vitylos nicht erkannt werden, da dasselbe noch eine Entfernung von sechs bis sieben Meilen von demselben trennte. Da das Wetter aber ausgezeichnet klar war, hob sich doch der Rand seiner oberen Segel deutlich von dem leuchtenden Hintergrunde des äußersten Horizonts ab.
Was aber von unten nicht sichtbar war, konnte doch von oben, das heißt von dem Gipfel der Höhenzüge, gesehen werden, welche das Dorf umgrenzen. Vitolo ist in Gestalt eines Amphitheaters auf abschüssigen Felsen erbaut, welche die alte Akropolis von Kelapha verteidigt. Darüber erheben sich noch einige alte, zerfallene Türme von jüngerem Ursprung als jene merkwürdigen Überreste eines Tempels der Seraphis, dessen Säulen und Kapitale von ionischer Ordnung noch heute die Kirche von Vitolo zieren. Neben jenen Thermen stehen auch noch zwei oder drei kleine, wenig besuchte Kapellen, in welchen fromme Mönche den Kirchendienst versehen.
Es ist hier von Wichtigkeit, auf die Bezeichnung »den Kirchendienst versehen« und selbst auf die Qualifikation eines Mönches, welche diese Geistlichen der messenischen Küste sich zulegen, zu achten Einer derselben, der soeben seine Kapelle verließ, wird sogleich dem Leser näher vor Augen treten.
Zu jener Zeit war die Religion in Griechenland noch ein eigentümliches Gemisch von heidnischen Sagen und christlichen Glaubenssätzen. Viele Gläubige betrachteten die Gottheiten des Altertums noch gewissermaßen als Heilige der neuen Religion. In der Tat, wie das Henry Belle schildert, vermengen sie die Halbgötter mit den Heiligen, die Kobolde der bezaubernden Täler mit den Engeln des Paradieses und rufen ebenso die Sirenen und Furien an, wie sie noch Brotopfer darbringen. Diese Umstände haben gewisse merkwürdige Gebräuche eingeführt, welche andere zum Lachen reizen, während die Geistlichkeit große Mühe hat, dieses wenig orthodoxe Chaos zu entwirren. Während des ersten Viertels dieses Jahrhunderts – es ist einige fünfzig Jahre her und die Zeit, mit welcher unsere Erzählung beginnt – war der Klerus der griechischen Halbinsel noch unwissender, und die sorglos dahinlebenden, naiven, zutraulichen Mönche, »gute Kinder«, schienen sehr wenig geeignet, die von Natur abergläubische Bevölkerung auf rechte Wege zu leiten.
Und wenn diese niederen Kirchendiener nur allein unwissend gewesen wären. In gewissen Gegenden Griechenlands aber, vorzüglich in den wilden Distrikten von Magne, scheuten die armen Teufel, von Natur und aus Noth schon Bettler und gierig auf die paar Drachmen, welche mitleidige Reisende ihnen zuwarfen, ohne alle Beschäftigung, außer etwa der, den Gläubigen das gefälschte Bildnis eines Heiligen zum Kusse darzureichen oder eine ewige Lampe in irgend einer Grotte zu unterhalten, dazu verstimmt über den geringen Ertrag ihrer Pfründen, der Beerdigungen und der Taufen, nicht davor zurück, die Auflauerer – und was für Auflauerer – im Solde der Bewohner des Küstengebietes zu spielen.
Die Seeleute von Vitolo, welche am Hafen umher lungerten wie die Lazzaronis, welche gleich mehrere Stunden Ruhe brauchen, um sich von der Arbeit während einiger Minuten zu erholen, erhoben sich doch rasch, als sie einen ihrer Mönche, die Arme heftig bewegend, schnellen Schrittes nach dem Dorfe hinabsteigen sahen.
Es war das ein Mann von fünfzig bis fünfundfünfzig Jahren, der nicht nur dick, sondern fett war von jenem Fette, das der Müßiggang erzeugt, und dessen schlaue Physiognomie nur sehr mittelmäßiges Vertrauen einzuflößen vermochte.
»Was gibt es denn, Vater, was ist denn los?,« fragte einer der Seeleute, der ihm entgegenging.
Der Vityliner sprach mit so näselndem Tone, dass man Nason hätte für einen Vorfahren der Hellenen halten können, und dazu jene maniatische Mundart, in der sich das Türkische mit dem Italienischen mischte, als rühre dasselbe aus der Zeit des Turmbaus von Babel her.
»Haben die Soldaten Ibrahim's etwa die Höhen des Taygetos besetzt?«, fragte ein anderer Seemann mit sehr sorgloser Geste, welche eben nicht viel Patriotismus verriet.
»Wenn's nicht gar Franzosen sind, mit denen wir es zu tun haben«, erwiderte der erste Sprecher.
»Na, die sind einander wert!«, bemerkte ein Dritter.
Diese Äußerung bewies, dass der Kampf, welcher damals gerade am heftigsten wütete, die Bewohner des untersten Peloponnes nur sehr wenig berührte, sehr verschieden von den Maniaten des Nordens, welche sich im Unabhängigkeitskriege so rühmlich hervortaten.
Der dicke Geistliche vermochte aber weder dem Einen, noch dem Anderen Antwort zu geben.
Er war von dem Herabklettern über die steilen Abhänge noch ganz außer Atem. Seine asthmatische Brust keuchte. Er wollte sprechen, konnte es aber nicht. Einer seiner Ahnen im alten Hellas, der Soldat von Marathon, hatte doch wenigstens, noch ehe er starb, den Sieg des Miltiades verkünden können. Doch es handelte sich hier weder um Miltiades, noch um den Kampf der Athener gegen die Perser. Es waren kaum Griechen, diese verwilderten Bewohner der untersten Spitze von Magne.
»So sprich doch, Vater, sprich doch!« rief ein alter Seemann, Namens Gozzo, der sich ungeduldiger als die Anderen gebärdete, als hätte er schon erraten, was der Mönch verkünden wollte.
Endlich hatte dieser sich wieder etwas beruhigt. Da streckte er die Hand nach dem Horizonte aus und rief:
»Ein Schiff in Sicht!« Auf diese Meldung hin sprangen die Tagediebe alle auf, klatschten in die Hände und stürmten nach einem Felsen, der den Hafen überragte. Von hier aus konnten sie das Meer in weitem Umkreise sehen.
Ein Fremdling hätte glauben können, dass diese Bewegung nur hervorgebracht würde durch das Interesse, welches jedes von der See herkommende Fahrzeug naturgemäß Seeleuten einflößen muss, denen so etwas ja besonders angeht. Das wäre aber eine falsche Annahme gewesen oder war es vielmehr; wenn dies ein Interesse dieser Leute aufzustacheln vermochte, war das doch ein solches ganz spezieller Art.
In der Tat ist Magne, jetzt wo wir diese Erzählung niederschreiben – nicht zur Zeit, als die darin geschilderten Vorfälle sich ereigneten – noch immer ein von Griechenland halb abgesonderter Landstrich, ein unabhängiges Königreich, geschaffen durch den Beschluss der europäischen Großmächte, welche 1829 den Vertrag von Adrianopel unterzeichneten. Die Maniaten, oder mindestens diejenigen derselben, welche auf den verlängerten Landausläufern zwischen den Golfen wohnen, sind noch halbe Barbaren geblieben, welche sich mehr um ihre persönliche Freiheit, als um die des Landes bekümmern. Diese äußerste Zunge des unteren Moreas ist von jeher auch kaum zur Botmäßigkeit zu bringen gewesen. Weder die türkischen Janitscharen, noch die griechischen Gendarmen haben sie zu bezwingen vermocht. Streitsüchtig und rachbegierig, oft in Familienzwistigkeiten verwickelt, welche nur durch Blut ausgetragen werden können. Räuber von Geburt und doch gastfreundlich, Mörder, wenn der Raub einen Mord bedingt, nennen sich deshalb die rohen Bergvölker nicht weniger die direkten Nachkommen der Spartaner; aber eingeschlossen in die Verzweigungen des Taygetos, in dem man zu Tausenden jene kleinen Befestigungen oder »Pyrgos«, welche kaum zu erklimmen sind, findet, spielen sie gar zu gern die zweifelhafte Rolle jener Wegelagerer des Mittelalters, die ihre Feudalrechte mit Dolch und Pistole übten.
Wenn die Maniaten zur Stunde auch noch halb wild sind, so mag man sich vorstellen, was dieselben vor nun fünfzig Jahren sein mochten. Ehe die Kreuzfahrten der Dampfschiffe ihren Raubzügen zur See ein Ziel setzten, traten sie während des ersten Viertels dieses Jahrhunderts als die verwegensten Seeräuber auf, welche die Handelsfahrzeuge in allen Stapelplätzen des Morgenlandes nur zu fürchten hatten.
Gerade der Hafen von Vitolo erschien durch seine Lage am Ende des Peloponnes, am Eingang zweier Meere, durch die Nähe der den Seeräubern wohlbekannten Insel Cerigotto, höchst geeignet, sich allen Übeltätern zu öffnen, welche den Archipel und die benachbarten Gegenden des Mittelmeeres unsicher machten. Der Zentralpunkt der Bewohnerschaft dieses Teils von Magne hieß speziell das Land von Kakovonni, und die Kakovonnioten, welche zu beiden Seiten der Landspitze siedelten, welche mit dem Cap Matapan ausläuft, hatten es bequem, ihre Untaten auszuführen. Auf dem Meere überfielen sie die Schiffe; an das Land lockten sie dieselben durch falsche Signale. Überall plünderten und verbrannten sie dieselben. Ob deren Besatzung nun eine türkische, maltesische, ägyptische oder selbst eine griechische war, das kümmerte sie nicht; sie wurde ohne Erbarmen niedergemetzelt oder nach den Barbareskenstaaten in die Sklaverei verkauft. Gab es einmal eine Zeit lang nichts zu tun, und wurden die Küstenfahrer in der Bucht von Cerigo oder dem Cap Gallo seltener, so stiegen öffentliche Gebete auf zu dem Gott der Stürme, damit dieser sich herabließe, ein Schiff von großem Tonnengehalt und mit reicher Ladung in ihre Hand zu geben. Die Mönche schlugen es auch nicht ab, diese Gebete zum Nutzen ihrer Gläubigen zu zelebrieren.
Jetzt hatte es seit mehreren Wochen nichts zu plündern gegeben. Kein Schiff war an der Küste von Magne angelaufen. Deshalb verursachte es einen wirklichen Ausbruch der Freude, als der Mönch jene von asthmatischem Keuchen unterbrochenen Worte ausgerufen hatte:
»Ein Schiff in Sicht!«
Sofort erschallten die dumpfen Schläge des Simanders, einer Art Glocke aus Holz mit eisernem Klöppel, welche in den Provinzen in Gebrauch ist, wo die Türken die Verwendung von metallenen Glocken nicht zuließen. Die klanglosen Schläge genügten jedoch, die habgierige Bevölkerung zusammenzurufen, Männer, Frauen, Kinder, herrenlose furchtbare Hunde, alle begierig zu plündern und wenn nötig zu morden.
Inzwischen verhandelten die auf dem Felsen vereinigten Vityliner mit großer Lebhaftigkeit. Welcher Art Fahrzeug war es, das der Mönch ihnen anmeldete? Mit der nordnordwestlichen Brise, die beim Einbruch der Nacht noch auffrischte, glitt das Schiff mit Backbordhalsen schnell dahin. Es schien möglich, dass es beim Lavieren das Cap Matapan ziemlich streifte. Seinem Kurse nach schien es aus der Gegend von Kreta zu kommen. Schon begann sein Rumpf sich zu zeigen über dem weißen Kielwasser, das es hinter sich ließ; seine Segel alle bildeten jedoch für das Auge eine unkenntliche Masse Es war also schwierig zu sagen, welcher Klasse das Fahrzeug angehören möge, was auch die verschiedensten, von einer Minute zur andern sich widersprechenden Äußerungen veranlasste.
»Es ist eine Schebeke, erklärte einer der Seeleute, ich sehe ihre viereckigen Segel am Fockmast!
»Nein, erwiderte ein anderer, es ist eine Pinke! Man sieht ja den erhöhten Achter und starkgekrümmten Vordersteven!«
»Schebeke oder Pinke! Wer könnte dieselben auf eine solche Entfernung unterscheiden?«
»Sollte es nicht vielmehr eine Polake mit viereckigen Segeln sein«, bemerkte ein anderer Seemann, der aus den halbgeschlossenen Händen sich eine Art Fernrohr gemacht hatte.
»Gott helfe uns!«, antwortete der alte Gozzo.»Polake, Schebeke oder Pinke, jedenfalls sind's drei Maste, und drei Maste sind allemal besser als zwei, wenn sich's darum handelt, hier bei uns mit einer tüchtigen Ladung Wein aus Candia oder mit Stoffen aus Smyrna zu landen!«
Nach dieser weisen Bemerkung blickten Alle mit noch größerer Aufmerksamkeit hinaus.
Das Schiff näherte sich und schien allmählich zu wachsen; weil es aber so dicht am Winde fuhr, konnte man es nicht von der Seite sehen. Es wäre also schwierig gewesen, zu sagen, ob es zwei oder drei Maste führte, das heißt, ob sein Tonnengehalt ein größerer oder ein geringerer sein werde.
»O, das Unglück verfolgt uns und der Teufel hat sein Spiel!«, rief Gozzo, indem er noch einen Fluch hinzusetzte, mit dem er alle Sätze zu verstärken pflegte. »Das Ding ist weiter nichts als eine Feluke...«
»Oder gar nur eine Speronare!«, rief der Mönch, nicht weniger enttäuscht als seine Zuhörer.
Dass diese beiden Bemerkungen mit nicht sehr wohlwollenden Rufen aufgenommen wurden, braucht wohl kaum versichert zu werden. Aber welcher Art das Fahrzeug auch war, so konnte man doch schon beurteilen, dass es höchstens hundert bis hundertfünfzig Tonnen messen konnte. Freilich kam es ja nicht auf die Menge der Ladung an, wenn diese sonst eine wertvolle war. Man trifft einfache Feluken oder selbst Speronaren, welche eine Fracht an kostbaren Weinen, feinen Ölen oder teuren Geweben führen. In solchen Fällen verlohnt es sich schon der Mühe, sie zu plündern, denn sie geben oft reiche Beute für geringe Mühe. Zu verzweifeln war also noch nicht. Dazu entdeckten die älteren Leute der Bande, dass das Schiff ein gewisses elegantes Äußere hatte, welches, langjähriger Erfahrung nach, immerhin zu seinen Gunsten sprach.
Schon begann die Sonne hinter dem Horizont im Westen des ionischen Meeres zu verschwinden; die Oktoberdämmerung musste jedoch noch eine Stunde lang hinreichendes Licht verbreiten, um das Schiff vor Einbruch völliger Dunkelheit zu erkennen Nachdem dasselbe das Cap Matapan umsegelt, wendete es sich um zwei Viertel, um besser in den Golf einlaufen zu können, und zeigte sich damit den Beobachtern in bequemer Stellung. Gleich nachdem dies geschehen, entfuhr auch schon den Lippen des alten Gozzo das Wort »Sacoleve«!
»Eine Sacoleve!«, wiederholten seine Genossen, welche ihrem Unmute durch rohe Flüche Luft machten.
Über den Gegenstand wurde indessen nicht weiter gesprochen, weil Zweifel über denselben nicht obwalten konnten. Das Fahrzeug, welches dem Golf von Coron zusteuerte, war sicherlich eine Sacoleve. Übrigens taten die Leute aus Vitolo sehr unrecht, gleich über Unglück zu schreien. Es ist gar nicht selten, dass man gerade auf diesen Sacoleven sehr kostbare Ladungen antrifft.
Man bezeichnet mit diesem Namen übrigens ein levantinisches Fahrzeug von mittlerem Tonnengehalt, dessen Verdeck einen gedrückten Bogen bildet, indem es sich nach hinten zu ein wenig erhebt. Auf seinen schlanken Masten trägt es mannigfaches Segelwerk. Der stark nach vorn geneigte, in der Mitte stehende Großmast hat gewöhnlich ein lateinisches Segel, ein Not-, ein Mars- und ein Topsegel. Zwei Klüversegel vorn, zwei sehr spitzige an den beiden Hintermasten vervollständigen seine Takelage, die ihm einen auffallenden Anblick verleiht. Die lebhaften Farben des Rumpfes, die Ausbiegung des Vorderstevens, die Verschiedenheit der Maste, die phantastische Gestalt seiner Segel selbst stempeln es zu einem der merkwürdigsten Muster jener schlanken Fahrzeuge, welche man zu Hunderten in den engen Wasserstraßen des Archipels manövrieren sieht. Es gewährte einen wirklich schönen Anblick, das leichte Fahrzeug sich bäumen und mit der Welle wieder aufrichten zu sehen, wenn es sich mit weißem Schaum bekränzte oder mühelos fast hüpfte, gleich einem ungeheuren Vogel, dessen Flügel das Meer streiften und dessen Gefieder in den letzten Strahlen der Abendsonne schimmerte.
Obwohl die Brise auffrischte und der Himmel sich allmählich mit »Wasserhosen« bedeckte – ein Name, den die Levantiner gewissen Wolken ihres Himmels zulegen – verminderte die Sacoleve ihre Segelfläche doch nicht im Mindesten. Sie hatte sogar das Topsegel beibehalten, welches ein minder kühner Seemann gewiss schon hätte reffen lassen.
Offenbar lag es in der Absicht des Kapitäns, an's Land zu gehen und nicht etwa die Nacht auf dem schon ziemlich bewegten Meere, welches noch mehr aufgeregt zu werden drohte, zuzubringen.
Wenn die Seeleute von Vitolo nun nicht mehr in Zweifel sein konnten, dass die Sacoleve in einen Hafen einlief, so fragten sie sich doch, ob sie gerade in ihrem Hafen anlegen würde.
»Ah«, rief einer von ihnen, »man möchte sagen, dass sie sich immer nur am Winde zu halten, aber nicht einzulaufen suchte.«
»Da soll sie der Teufel in's Schlepptau nehmen!«, versetzte ein anderer. »Sollte sie wirklich nur laviren und wieder auf die hohe See gehen?«
»Steuert sie überhaupt auf Coron zu?«
»Oder vielleicht auf Kalamata?«
Beide Voraussetzungen hatten etwa gleichviel für sich. Coron ist ein von Handelsfahrzeugen der Levante stark besuchter Hafen der maniatischen Küste, wo ein bedeutender Ausfuhrhandel von Öl aus dem südlichen Griechenland stattfindet. Dasselbe gilt für Kalamata am Grunde des Golfes, dessen Bazare mit Manufakturwaren, Stoffen oder Geschirren gefüllt sind, welche von Westeuropa hier eingeführt werden. Es war also möglich, dass die Sacoleve nach einem dieser zwei Häfen bestimmt war, ein Umstand, der die raub- und plünderungslüsternen Vityliner sehr enttäuschte.
Während sie so mit ziemlich interessierter Aufmerksamkeit beobachtet wurde, glitt die Sacoleve rasch vorwärts. Bald befand sie sich auf der Höhe von Vitolo. Jetzt musste ihr Schicksal sich entscheiden. Wenn sie noch weiter auf den Hintergrund des Golfes zuhielt, mussten Gozzo und seine Spießgesellen jede Hoffnung, sich ihrer zu bemächtigen, aufgeben. Selbst wenn sie sich in ihre schnellsten Boote warfen, hatten sie keine Aussicht jene einzuholen, um so viel war sie ihnen durch das ungeheure Segelwerk, welches sie trug, an Geschwindigkeit überlegen.
»Sie kommt hierher!«
Diese drei Worte rief der alte Steuermann, dessen Arm mit niedergebogener Hand sich gleich einem Enterhaken nach dem kleinen Schiffe zu ausstreckte.
Gozzo täuschte sich nicht. Das Steuerruder wurde in den Wind gelegt und die Sacoleve richtete sich jetzt auf Vitolo. Gleichzeitig wurden das Topsegel und ein Focksegel eingezogen und andere Segel wenigstens halb gerefft. Auf diese Weise von einem Teil des auf ihr lastenden Winddrucks befreit, gehorchte sie nun leichter der Hand des Steuermanns.
Jetzt dunkelte es allmählich mehr. Die Sacoleve hatte gerade nur noch Zeit, in die Einfahrt von Vitolo einzulaufen. Hier liegen unter dem Wasser Felsen verstreut, welche wegen der Gefahr, daran vollständig zu scheitern, sorgsam vermieden werden müssen. Trotzdem stieg keine Lotsenflagge am Großmast des kleinen Fahrzeugs auf. Der Kapitän musste also mit dem ziemlich gefährlichen Fahrwasser selbst genügend vertraut sein, weil er sich, ohne Beistand zu verlangen, in dasselbe wagte. Vielleicht misstraute er auch – und zwar ganz mit Recht – dem beliebten Verfahren der Vityliner, welche wohl nicht davor zurückgeschreckt wären, ihn irgendwo hier auf den Grund laufen zu lassen, wo schon so sehr viel Fahrzeuge auf diese Weise verloren gegangen waren.
Bisher erhellte übrigens noch kein Leuchtturm die Küste dieses Teiles von Magne. Ein einfaches Hafenlicht diente dazu, den Eingang in den engen Kanal zu bezeichnen.
Inzwischen näherte sich die Sacoleve. Bald befand sie sich nur noch eine halbe Meile von Vitolo. Sie musste gleich landen. Man merkte, dass eine erfahrene Hand sie führte.
Auch das war nicht dazu angetan, die Ungläubigen zu befriedigen; sie hatten ja weit mehr Interesse daran, das Fahrzeug auf irgend einem Felsen stranden zu sehen; dann hatten sie die Brandung gewissermaßen zum Bundesgenossen. Diese begann die Arbeit, welche sie nur zu vollenden hatten. Erst der Schiffbruch, dann die Plünderung, das war ihr gewöhnliches Verfahren. Das ersparte ihnen ja meist einen Kampf mit bewaffneter Hand, einen unmittelbaren Angriff, dem doch allemal Einige von ihnen zum Opfer fallen konnten.
Es gab in der Tat oft genug von einer mutigen Mannschaft verteidigte Fahrzeuge, welche sich nicht ungestraft überfallen ließen.
Die Genossen Gozzo's verließen also ihren Beobachtungsposten und gingen nach dem Hafen hinunter, um alle verbrecherischen Vorbereitungen zu treffen, welche bei den Strandräubern, ob die die Meere des Abend- oder des Morgenlandes unsicher machen, so ziemlich die gleichen sind.
Es erschien ja so leicht, die Sacoleve in der engen Fahrstraße des Kanals stranden zu lassen, wenn man ihr falsche Weisungen erteilte, was die zunehmende Dunkelheit noch begünstigte, die, ohne gerade schon vollkommen zu sein, doch die Führung eines Schiffes einigermaßen erschwerte
»Ans Hafenlicht!«, befahl Gozzo, dem seine Gefährten ohne Zögern zu gehorchen pflegten.
Alle verstanden den alten Seemann. Schon zwei Minuten später erlosch dieses Licht – eine einfache, am Ende des Hafendammes an einem dort stehenden Pfahl befestigte Laterne – urplötzlich.
Im nämlichen Augenblick wurde es durch ein anderes Licht ersetzt, das zuerst zwar dieselbe Stelle einnahm; doch wenn das erste auf dem Molo feststehende dem Schiffer immer die gleiche Richtung anwies, musste diesen das bewegliche andere aus der Fahrstraße verlocken und der Gefahr, auf einen Unterwasserfelsen aufzulaufen, aussetzen.
Das falsche Licht bestand aus einer Laterne, deren Schein sich von dem des Hafenlichtes nicht unterschied. Diese Laterne hatte man aber an den Hörnern einer Ziege befestigt, welche langsam am Rande der Klippe hingetrieben wurde. Sie veränderte ihren Ort also mit dem Tiere und musste infolgedessen auch die Sacoleve zu falschem Manövrieren verleiten.
Es war nicht zum ersten Male, dass die Leute in Vitolo auf diese Weise verfuhren. Nein, gewiss nicht! Und es war leider auch nur selten, dass ihnen ihre schändlichen Absichten misslangen.
Die Sacoleve lief nun in die Einfahrt ein. Nachdem auch das große Marssegel eingezogen war, trug sie nur noch die lateinischen Segel am hintersten Mast; doch mussten auch diese genügen, um bis zu dem Anlegepfosten zu gelangen.
Zum größten Erstaunen der dasselbe beobachtenden Seeleute bewegte sich das Schiff durch die Windungen des Kanals mit unglaublicher Sicherheit weiter. Um das von der Ziege getragene bewegliche Licht schien sich darauf kein Mensch zu kümmern. Selbst am hellen Tage hätte es nicht sicherer manövrieren können.
Sein Kapitän musste also unbedingt die Umgebungen von Vitolo schon wiederholt durchsegelt haben, um so bekannt zu sein, dass er selbst in finstrer Nacht wagen konnte, hier ans Land zu steuern.
Schon konnte man jetzt den kühnen Seemann wahrnehmen. Seine Gestalt hob sich noch ziemlich deutlich aus dem Schatten auf dem Vorderteil der Sacoleve ab. Er stand da, in die weiten Falten seiner Aba, einer Art wollenen Mantels, gehüllt, dessen Kapuze seinen Kopf bedeckte. Dieser Kapitän zeigte in der Tat kaum eine Ähnlichkeit mit jenen bescheidenen Küstenfahrern, welche während einer schwierigen Fahrt meist einen Rosenkranz mit großen Kugeln, wie sie in den Meeren des Archipels gebräuchlich sind, hin und her gleiten lassen. Nein, dieser hier begnügte sich, mit tiefer und ruhiger Stimme dem auf dem Hinterteil des Decks befindlichen Steuermann nur seine Anweisungen zu erteilen.
Da erlosch plötzlich die Laterne am felsigen Strand. Doch auch das störte die Sacoleve nicht, welche unbeirrt ihren Weg fortsetzte. Einen Augenblick hätte man vielleicht glauben können, dass sie bei einer Wendung einen gefährlichen Felsen anlaufen könne, der ziemlich bis zur Wasserfläche, eine Kabellänge vom eigentlichen Hafen, hinausragte und den in der Dunkelheit unmöglich Jemand sehen konnte. Eine leichte Wendung des Steuers genügte aber, die Richtung des Schiffes zu ändern, das zwar ganz nahe an diesem Risse vorüberstreifte, dasselbe aber nicht im Geringsten berührte.
Dieselbe Gewandtheit entwickelte der Steuermann, als es notwendig wurde, eine zweite Untiefe zu passieren, welche nur eine ganz beschränkte Fahrstraße im Kanal übrig ließ – eine Untiefe, auf der schon manches Schiff festgefahren war, ob dessen Lotse nun ein Komplize der Vityliner war oder nicht.
Letztere hatten nun keine Aussicht mehr, auf einen Schiffbruch zu rechnen, der ihnen die Sacoleve fast wehrlos überliefert hätte. Binnen wenigen Minuten musste diese im Hafen verankert liegen. Um sich ihrer zu bemächtigen, galt es nun Gewalt zu gebrauchen.
Das wurde denn auch nach einer kurzen Verhandlung unter den Schurken von diesen beschlossen und sollte bei der eben herrschenden und einem solchen Unternehmen besonders günstigen Dunkelheit sofort ins Werk gesetzt werden.
»In die Boote!«, rief der alte Gozzo, dessen Befehl ohne Widerspruch Geltung hatte, vorzüglich wenn es sich um eine Plünderung handelte.
Etwa dreißig kräftige Männer, von denen die einen mit Pistolen bewaffnet waren, die anderen Dolche oder Äxte schwangen, warfen sich in die am Quai befestigten Boote und ruderten, offenbar an Zahl der Besatzung der Sacoleve überlegen, auf diese zu.
Da ertönte an Bord der letzteren ein kurzes Kommando. Die Sacoleve, welche jetzt über den Kanal herausgekommen war, befand sich inmitten des Hafens. Ihre Hisstaue wurden gelöst, der Anker rasselte in den Grund, und sie lag, nach einem kurzen Stoße in Folge der Anspannung der Ankerkette, unbeweglich.
Die Boote befanden sich nur noch wenige Faden von derselben entfernt. Ohne besonderes Misstrauen zu zeigen, hatte sich doch die ganze Besatzung, wohl bekannt mit dem üblen Rufe der Bewohner von Vitolo, ausreichend bewaffnet, um gegebenen Falles zur Verteidigung bereit zu sein.
Vorläufig geschah aber nichts. Der Kapitän der Sacoleve war, nachdem das Schiff fest lag, mehrmals auf dem Deck hin und zurück gegangen, während seine Leute, ohne sich besonders um die Annäherung jener Boote zu bekümmern, ruhig fortfuhren, die Segel in Ordnung zu bringen und das Verdeck frei zu machen.
Indes hätte man doch beobachten können, dass sie diese Segel nicht einbanden, sondern sie so weit frei ließen, um sofort wieder auslaufen zu können.
Das erste Boot legte neben dem Backbord der Sacoleve an. Die anderen drängten sogleich nach. Und da die Seitenwände des Fahrzeugs nur niedrig waren, brauchten die Angreifer, welche jetzt ein wütendes Geschrei ausstießen, sich nur in die Höhe zu schwingen, um sich auf dessen Verdeck zu befinden.
Die Verwegensten derselben eilten nach dem Hinterteil. Einer derselben ergriff eine brennende Stocklaterne und hielt sie dem Kapitän vor das Gesicht.
Da ließ dieser durch eine schnelle Handbewegung die Kapuze herabsinken, so dass sein Gesicht in vollem Licht erschien.
»Eh«, sagte er, »die Leute von Vitolo erkennen nicht einmal ihren Landsmann Nicolas Starkos?«
Bei diesen Worten kreuzte der Kapitän gelassen die Arme. Kurze Zeit darauf stießen die Boote eiligst wieder ab und zogen sich nach dem Hintergrund des Hafens zurück.
Zweites Kapitel
Auge in Auge
Zehn Minuten später verließ ein leichtes Boot, eine Gig, die Sacoleve und führte nach dem Fuß des Molos ohne jede Begleitung und ohne Waffen den Mann, vor dem die Vityliner so schnell den Rückzug angetreten hatten.
Es war der Kapitän der »Karysta«, so nannte sich das kleine Fahrzeug, welches eben im Hafen vor Anker gegangen war.
Unter der dicken Seemannsmütze zeigte dieser nur mittelgroße Mann eine hohe stolze Stirn und in den grausamen Augen einen höchst entschlossenen Blick. Über seine Oberlippe lief der Klephte-Schnurrbart waagerecht nicht in Spitzen, sondern in starken Haarbüscheln aus. Seine Brust war breit, seine Glieder muskulös. In Locken fielen ihm die schwarzen Haare auf die Schultern. Wenn er fünfunddreißig Jahre überschritten hatte, konnte das nur um wenige Monate sein. Aber sein durch Sonne und Wind gebräunter Teint, die Härte seiner Züge und eine Falte auf der Stirn, die wie eine Furche vertieft erschien, in der kein guter Samen keimen konnte, ließ ihn entschieden älter erscheinen, als er in der Tat war.
Was die Kleidung angeht, die er eben trug, so bestand diese weder aus der Weste, noch dem Brustlatz oder der Fustanella des Palikaren. Der Kaftan, die Kapuze von brauner Farbe, welche wenig hervortretend gestickt war, die grünlichen Beinkleider mit den weiten Falten, welche sich in hohe Stiefeln verloren, erinnerten weit eher an die Tracht eines Seemannes aus den Barbaresken-Staaten.
Dennoch war Nicolas Starkos wirklich von Geburt ein Grieche und ein Eingeborner des Hafens von Vitolo. Hier hatte er seine ersten Jugendjahre verbracht. Als Kind und als Jüngling hatte er zwischen diesen Felsgebilden den Anblick des Meeres lieben gelernt. Auf diesen Gewässern war er, eine Beute des Windes und der Strömungen, so viel umhergefahren. Hier gab es keine Einbuchtungen, deren Wassertiefe und Landungsplätze er nicht gekannt hätte; kein Riff, keinen Grund, keinen Unterwasserfelsen, dessen Lage ihm verborgen geblieben wäre; keine Windung des Kanals, welche er selbst ohne Lotsen und ohne Kompass nicht hätte in Sicherheit befahren können. Das erklärt denn auch leicht, warum er trotz der falschen Signale seiner Landsleute die Sacoleve immer hatte mit ruhiger Hand leiten können. Daneben wusste er, wie wenig den Vitylinern Vertrauen zu schenken war. Er hatte sie schon gar zu oft in Tätigkeit gesehen. Und im Grunde missbilligte er vielleicht nicht einmal ihre räuberischen Gewohnheiten, wenigstens sobald er persönlich gesichert war, nicht davon zu leiden.
Doch wenn Nicolas Starkos seine Leute kannte, so war er nicht minder bei ihnen bekannt. Nach dem Tod seines Vaters, der unter den Tausenden von Opfern fiel, welche die Grausamkeit der Türken hinschlachtete, lechzte seine von Rache erfüllte Mutter nur nach der Stunde, wo sie sich bei der ersten Erhebung gegen das türkische Joch auflehnen konnte. Er selbst hatte Magne mit achtzehn Jahren verlassen, um zur See zu gehen, wobei er vorzüglich im Archipel umherfuhr, und sich dabei nicht allein zum vortrefflichen Seemann, sondern auch in dem Handwerk des Räubers ausbildete.
Niemand hätte wohl zu sagen vermocht, an Bord wie vieler Schiffe er seitdem gedient, welche Flibustier- oder Seeräuberführer ihn unter ihrem Befehl gehabt, unter welcher Flagge er zuerst gekämpft, wie viel Blut seine Hand schon vergossen, Blut der Feinde Griechenlands ebenso wie solches seiner Verteidiger – dasselbe, welches auch in seinen Adern rollte. Wiederholt hatte man ihn schon in verschiedenen Häfen des Busens von Coron gesehen. Manche seiner Landsleute hätten wohl verschiedene Großtaten von ihm berichten können, wenn er sich mit ihnen verbündet hatte, Handelsschiffe zu überfallen und zu vernichten, um die reiche Beute mit ihnen zu teilen. Dennoch umgab den Namen Nicolas Starkos' ein gewisses Geheimnis. Jedenfalls war er aber in den Provinzen von Magne so bekannt, dass sich alle vor seinem Namen verneigten.
Damit erklärte sich auch der Empfang, den dieser Mann bei den Bewohnern von Vitolo fand, ebenso der Umstand, dass schon seine Anwesenheit genügte, alle auf die geplante Plünderung verzichten zu lassen, sobald sie nur erkannt hatten, wer die Sacoleve befehligte.
Sobald der Kapitän der »Karysta« ein wenig hinter dem Quai den Hafen betreten hatte, bildeten die zu seinem Empfang herbeigelaufenen Männer und Frauen ehrerbietig eine Kette, um ihn hindurch zu lassen. Als er ans Land stieg, wurde kein Ausruf laut. Es schien, als ob Nicolas Starkos hier einen hinreichenden Einfluss ausübte, um Anderen schon durch sein Erscheinen Ruhe zu gebieten. Die Leute warteten, bis er sprechen würde, und wenn das – wie wahrscheinlich – nicht der Fall war, hätte sich gewiss niemand erlaubt, ein Wort an ihn zu richten.
Nachdem Nicolas Starkos seinen Matrosen der Gig befohlen, an Bord zurückzukehren, begab er sich nach dem Winkel, den der Quai im Hintergrunde des Hafens bildete. Kaum hatte er aber zwanzig Schritte in dieser Richtung getan, als er plötzlich stehen blieb. Dann wandte er sich an den alten Seemann, der ihm nachfolgte, als erwarte er von ihm noch irgendwelche Befehle.
»Gozzo«, begann er,»ich werde noch zehn kräftige Burschen brauchen, um meine Besatzung zu vervollständigen.«
»Du wirst sie haben, Nicolas Starkos,« antwortete Gozzo.
Hätte der Kapitän der »Karysta« Hundert zur Auswahl unter der seefahrenden Bevölkerung des Ortes verlangt, so würde er diese auch gefunden haben. Und diese hundert Mann würden, ohne zu forschen, wohin sie geführt würden, wozu sie bestimmt seien, für wessen Rechnung sie fahren oder kämpfen sollten, ihrem Landsmann gefolgt sein, bereit, sein Los zu teilen, da sie recht gut wussten, dass ihnen auf die eine oder die andere Weise daraus zuletzt Vorteil entspringen müsse.
»Jene zehn Mann«, fuhr der Kapitän der »Karysta« fort, »müssen binnen einer Stunde an Bord sein.«
»Sie werden da sein,« versicherte Gozzo.
Nicolas Starkos deutete ihm durch eine Handbewegung an, dass er seine Begleitung nicht weiter wünsche, ging längs des Quais, der sich an den Molo anschloss, weiter und verschwand in einer der engen, am Hafen mündenden Straßen.
Der alte Gozzo kehrte, seinem Willen gehorchend, zu den Gefährten zurück und ging sofort daran, die zehn Burschen auszuwählen, welche die Mannschaft der Sacoleve zu vermehren bestimmt waren.
Inzwischen klomm Nicolas Starkos immer höher den Abhang des steilen Ufers empor, auf dem der Flecken Vitolo erbaut ist. Hier oben hörte man weiter nichts, als das Gebell der wilden Hunde, welche den Reisenden oft nicht weniger gefährlich sind, als die Schakals und Wölfe, Hunde mit gewaltigem Gebiss und dem breiten Gesicht der Dogge, die vor keinem Stocke zurückweichen. Mit langsamem Schlage der langen Flügel flatterten noch einige Seemöwen umher, welche ihre Schlupfwinkel am Strand aufsuchten. Bald hatte Nicolas Starkos die letzten Häuser von Vitolo hinter sich gelassen. Er schlug jetzt den beschwerlichen Fußpfad ein, der um die Akropolis von Kerapha herumführt. Nachher kam er an den Ruinen einer Befestigung vorüber, welche hier zu jener Zeit von Ville-Hardouin angelegt worden war, als die Kreuzfahrer verschiedene Punkte des Peloponnes besetzt hielten, und dann umschritt er noch den Fuß einiger alter Türme, die sich noch jetzt hier auf dem Felsenufer erheben. Bei diesen blieb er stehen und wendete sich zu einem Rückblick um.
Am Horizont, jenseits des Cap Gallo, neigte sich der zunehmende Mond seinem Untergang im Ionischen Meere zu. Da und dort flammten einige Sterne durch die zerrissenen Wolken, welche der frische Abendwind über den Himmel jagte. Wenn dieser einmal nachließ, herrschte Totenstille rings um die Citadelle. Zwei oder drei kaum sichtbare kleine Fahrzeuge durchfurchten das Wasser im Golfe, näherten sich Coron oder wendeten sich Kalamata zu. Ohne die Laternen, welche an ihrer Mastspitze leuchteten, hätte man dieselben vielleicht kaum erkennen können. An anderen Punkten der Küste brannten sieben bis acht Feuer, welche sich im Meere zitternd widerspiegelten. Waren dies Lichter von Fischerfahrzeugen oder solche in Wohnungen am Strande? Das hätte man schwerlich unterscheiden können. Nicolas Starkos ließ den schon an die Dunkelheit gewohnten Blick über die ungeheure Fläche schweifen. Das Auge des Seemanns hat oft eine unbegreifliche Schärfe und gestattet ihm da noch etwas zu unterscheiden, wo andere gar nichts sehen würden. Im jetzigen Augenblick schien es aber nicht, als ob die Außenwelt den Kapitän der »Karysta«, der ja in seinem Leben so Vieles gesehen hatte, besonders interessieren könnte. Er saugte die Luft der Heimat, gleichsam den Atem des Landes, fast unbewusst ein. So stand er unbeweglich, nachsinnend mit gekreuzten Armen da und hielt auch den Kopf, von dem jetzt die Kapuze zurückgeschlagen war, still, als wär' er aus Stein gemeißelt.
So verging etwa eine Viertelstunde. Immer hatte Nicolas Starkos den Westhimmel beobachtet, den ein ferner Meereshorizont begrenzte. Dann tat er einige Schritte weiter das Felsenufer hinaus. Es war nicht Zufall, dass er so zögerte. Ihn erfüllte ein geheimer Gedanke, und wer ihn gesehen, hätte vielleicht gesagt, dass er noch zu erkennen vermeide, was er hier auf der Anhöhe hinter Vitolo eigentlich aufzusuchen gekommen war.
*
Es gibt kaum einen öderen Anblick als diese Küste vom Cap Matapan bis zum äußersten Hintergrunde des Golfs. Hier wuchsen weder Orangen-, noch Zitronenbäume, weder wilde Rosen, noch Lorbeer, kein Jasmin von Argolis, keine Feigen, keine Erd- oder Maulbeerbäume, nichts, was gewissen Gegenden von Griechenland den Anblick einer so üppigen, reichen Landschaft verleiht. Hier erhob sich keine grüne Eiche, keine Platane, kein Granatbaum, der sich vom dunkleren Hintergrunde der Zypressen und Zedern abhob. Überall nur Felsen, welche jede Erschütterung dieser vulkanischen Gebiete leicht in das Wasser des Golfes stürzen konnte. Überall herrschte auf diesem wilden Boden von Magne eine trostlose Dürre, so dass dieser nicht einmal seine dünn gesäte Bevölkerung zu ernähren vermochte. Kaum standen hier einzelne verkümmerte Pinien, welche halb abgestorben aussahen, weil man ihnen das Harz geraubt, und deren Saft versiegt war, wie die tiefen Risse der Stammrinde zeigten. Da und dort ein magerer Cactus mit scharfen Stacheln, dessen Blätter mehr kleinen, halb geschorenen Igeln glichen. Nirgends endlich fand sich, weder an den verkrüppelten Sträuchern noch auf dem Boden, der mehr aus Kieselsteinen als aus nahrhafter Erde bestand, etwas, um die Ziegen zu ernähren, welche doch mit dem ärmlichsten Futter vorlieb zu nehmen pflegen.
Nachdem er zwanzig Schritte vorwärts getan, blieb Nicolas Starkos von Neuem stehen. Dann wandte er sich nach Nordosten, dahin, wo der entfernte Gipfel des Taygetos seine Umrisse von dem minder dunklen Grunde des Himmels abhob. Ein oder zwei Sterne, welche um diese Zeit aufgingen, schienen am Rande des Horizontes, wie zwei leuchtende Punkte, auf demselben zu lagern.
Nicolas Starkos war regungslos stehen geblieben. Er erblickte jetzt ein kleines, niedriges, aus Holz erbautes Haus, das etwa fünfzig Schritte von ihm in einer Ausbuchtung des Felsgebirges verborgen lag.
Es war eine bescheidene Wohnstätte, vereinzelt über dem Flecken liegend, zu der man nur auf steilem Fußwege gelangte und welche wenige halb entlaubte Bäume, sowie eine Dornenhecke umgaben. Diese Wohnung erschien auf den ersten Blick als schon lange verödet. Die Hecke war in schlechtem Zustande, hier buschig verwachsen, dort wieder durchbrochen, und bildete so einen sehr unzureichenden Schutz; Hunde und Schakals, welche zuweilen diese Gegend durchstreiften, hatten wiederholt diesen verlassenen Winkel des maniatischen Bodens verwüstet. Grobe Kräuter und Buschwerk waren das Einzige, was die Natur hier da und dort verstreut hatte, nachdem die Hand des Menschen sich nicht mehr zur Pflege des Ortes regte.
Warum war derselbe aber so verlassen? Nun, der Besitzer dieses Fleckchens hatte schon vor langen Jahren die Augen geschlossen. Seine Witwe, Andronika Starkos, verließ später das Land, um sich jenen todesmutigen Frauen anzuschließen, welche sich im griechischen Unabhängigkeitskriege so rühmlich hervortaten. Daher kam es auch, dass der Sohn, seitdem er das Haus verlassen, niemals wieder den Fuß über die väterliche Schwelle gesetzt hatte.
Hier war Nicolas Starkos geboren und hier verliefen die ersten Jahre seiner Kindheit. Sein Vater hatte sich nach langem ehrenvollen Leben als Seemann nach dieser Freistatt zurückgezogen, vermied aber gern jede Berührung mit der Einwohnerschaft von Vitolo, deren wilde Sitten ihm ein Gräuel waren. Etwas gebildeter und mit mehr Verständnis für die Annehmlichkeiten des Lebens, hatte er sich mit Weib und Kind hier eine freundliche Existenz gegründet. So lebte er in diesem Schlupfwinkel ruhig und unbeachtet, bis er eines Tages, von aufflammendem Zorn übermannt, sich der Bedrückung seitens der türkischen Behörden widersetzte und seinen Widerstand mit dem Leben bezahlen musste. Den türkischen Agenten konnte eben niemand entgehen, nicht einmal im entferntesten Winkel der Halbinsel.





























