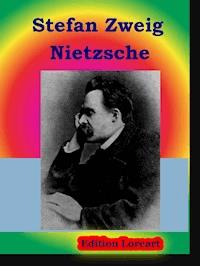
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Loreart
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein biografischer Essay über Friedrich Nietzsche. Stefan Zweig wurde am 28. November 1881 in Wien geboren. Sein episches Werk machte ihn ebenso berühmt wie seine historischen Miniaturen und die biographischen Arbeiten. Am 23. Februar 1942 schied er in Petrópolis, Brasilien, freiwillig aus dem Leben. Friedrich Wilhelm Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Lützen geboren. Nietzsche war ein klassischer Philologe, der postum als Philosoph zu Weltruhm kam. Als Nebenwerke schuf er Dichtungen und musikalische Kompositionen. Ursprünglich preußischer Staatsbürger, war er seit seiner Übersiedlung nach Basel 1869 staatenlos. Nietzsche starb am 25. August 1900 in Weimar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TITELSEITE
TRAGÖDIE OHNE GESTALTEN
DOPPELBILDNIS
APOLOGIE DER KRANKHEIT
DER DON JUAN DER ERKENNTNIS
LEIDENSCHAFT DER REDLICHKEIT
WANDLUNGEN ZU SICH SELBST
ENTDECKUNG DES SÜDENS
FLUCHT ZUR MUSIK
DIE SIEBENTE EINSAMKEIT
DER TANZ ÜBER DEM ABGRUND
DER ERZIEHER ZUR FREIHEIT
Über den Autor
IMPRESSUM
E-Books im Reese Verlag:
Hinweise und Rechtliches
Stefan Zweig
FRIEDRICH NIETZSCHE
Essay
Ich mache mir aus einem Philosophen
gerade so viel, als er imstande ist, ein
Beispiel zu geben.
Unzeitgemäße Betrachtungen
TRAGÖDIE OHNE GESTALTEN
Den größten Genuß vom Dasein einzuernten heißt: gefährlich leben.
Unzeitgemäße Betrachtungen
Die Tragödie Friedrich Nietzsches ist ein Monodram: sie stellt keine andere Gestalt auf die kurze Szene seines Lebens als ihn selbst. In allen den lawinenhaft abstürzenden Akten steht der einsam Ringende allein, niemand tritt ihm zur Seite, niemand ihm entgegen, keine Frau mildert mit weicher Gegenwart die gespannte Atmosphäre. Alle Bewegung geht einzig von ihm aus und stürzt einzig auf ihn zurück: die wenigen Figuren, die anfangs in seinem Schatten auftreten, begleiten nur mit stummen Gesten des Staunens und Erschreckens sein heroisches Unterfangen und weichen allmählich wie vor etwas Gefährlichem zurück. Kein einziger Mensch wagt sich nahe und voll in den innern Kreis dieses Geschickes, immer spricht, immer kämpft, immer leidet Nietzsche für sich allein. Er redet zu niemandem, und niemand antwortet ihm. Und was noch furchtbarer ist: niemand hört ihm zu.
Sie hat keine Menschen, keine Partner, keine Hörer, diese heroische Tragödie Friedrich Nietzsches: aber sie hat auch keinen eigentlichen Schauplatz, keine Landschaft, keine Szenerie, kein Kostüm, sie spielt gleichsam im luftleeren Raum der Idee. Basel, Naumburg, Nizza, Sorrent, Sils-Maria, Genua, diese Namen sind nicht seine wirklichen Hausungen, sondern nur leere Meilensteine längs eines mit brennenden Flügeln durchmessenen Weges, kalte Kulissen, sprachlose Farbe. In Wahrheit ist die Szenerie der Tragödie immer dieselbe: Alleinsein, Einsamkeit, jene entsetzliche wortlose, antwortlose Einsamkeit, die sein Denken wie eine undurchlässige Glasglocke um sich, über sich trägt, eine Einsamkeit ohne Blumen und Farben und Töne und Tiere und Menschen, eine Einsamkeit selbst ohne Gott, die steinern ausgestorbene Einsamkeit einer Urwelt vor oder nach aller Zeit. Aber was ihre Ode, ihre Trostlosigkeit so grauenhaft, so gräßlich und zugleich so grotesk macht, ist das Unfaßbare, daß dieser Gletscher, diese Wüste Einsamkeit geistig mitten in einem amerikanisierten Siebzig-Millionen-Lande steht, mitten in dem neuen Deutschland, das klirrt und schwirrt von Bahnen und Telegraphen, von Geschrei und Gedränge, mitten in einer sonst krankhaft neugierigen Kultur, die vierzigtausend Bücher jährlich in die Welt wirft, an hundert Universitäten täglich nach Problemen sucht, in hunderten Theatern täglich Tragödie spielt und doch nichts weiß und nichts ahnt und nichts fühlt von diesem mächtigsten Schauspiel des Geistes in ihrer eigenen Mitte, in ihrem innersten Kreis.
Denn gerade in ihren größten Augenblicken hat die Tragödie Friedrich Nietzsches in der deutschen Welt keinen Zuschauer, keinen Zuhörer, keinen Zeugen mehr. Anfangs, solange er noch als Professor vom Katheder spricht und Wagners Lichtkraft ihn sichtbar macht, bei seinen ersten Worten, weckt seine Rede noch eine kleine Aufmerksamkeit. Aber je tiefer er in sich selbst, je tiefer er in die Zeit hinabgreift, um so weniger findet er Resonanz. Einer nach dem andern von den Freunden, von den Fremden steht während seines heroischen Monologs verschüchtert auf, von den immer wilderen Verwandlungen, von den immer glühenderen Ekstasen des Einsamen erschreckt, und läßt ihn auf der Szene seines Schicksals entsetzlich allein. Allmählich wird der tragische Schauspieler unruhig, so ganz ins Leere zu sprechen, er redet immer lauter, immer schreihafter, immer gestikulativer, um sich Widerklang oder wenigstens Widerspruch zu entzünden. Er erfindet sich zu seinem Wort eine Musik, eine strömende, rauschende, dionysische Musik - aber niemand hört ihm mehr zu. Er zwingt sich zu Harlekinaden, zu einer spitzen, schrillen, gewaltsamen Heiterkeit, er läßt seine Sätze Kapriolen springen und sich in Lazzi überschlagen, nur um mit künstlichem Spaß für seinen furchtbaren Ernst Hörer heranzuködern - aber niemand rührt zum Beifall die Hand. Er erfindet sich schließlich einen Tanz, einen Tanz zwischen Schwertern, und übt verwundet, zerfetzt, blutend seine neue tödliche Kunst vor den Menschen, aber niemand ahnt den Sinn dieser schreienden Scherze und die todwunde Leidenschaft in dieser aufgespielten Leichtigkeit. Ohne Hörer und Widerhall endet vor leeren Bänken das unerhörteste Schauspiel des Geistes, das unserem stürzenden Jahrhundert geschenkt war. Niemand wendet nur lässig den Blick, wie der auf stählerner Spitze hinschwirrende Kreisel seiner Gedanken zum letztenmal herrlich aufspringt und endlich taumelnd zu Boden fällt: »tot vor Unsterblichkeit«.
Dieses Mit-sich-allein-Sein, dieses Gegen-sich-selbst-allein-Sein ist der tiefste Sinn, die einzig heilige Not der Lebenstragödie Friedrich Nietzsches: nie war so ungeheure Fülle des Geistes gegen ein so metallen undurchdringliches Schweigen gestellt. Nicht einmal die Gnade bedeutender Gegner ist ihm gegeben - so muß der stärkste Denkwille »in sich selber eingehöhlt, sich selber angrabend«, aus der eigenen tragischen Seele sich Antwort und Widerstand holen. Nicht aus der Welt, sondern in blutenden Fetzen von der eigenen Haut reißt sich der Schicksalsrasende wie Herakles sein Nessushemd, die brennende Glut, um nackt gegen die letzte Wahrheit, gegen sich selbst zu stehen. Aber welcher Frost um diese Nacktheit, welches Schweigen um diesen ungeheuersten Schrei des Geistes, welch entsetzlicher Himmel voll Wolken und Blitze über dem »Mörder Gottes«, der nun, da keine Gegner ihn finden und er keinen mehr findet, sich selber anfällt, »Selbstkenner, Selbsthenker ohne Mitleid«! Von seinem Dämon hinausgetrieben über Zeit und Welt, hinaus selbst über den äußersten Rand seines Wesens,
Geschüttelt ach von unbekannten Fiebern,
Zitternd vor spitzen eisigen Frostpfeilen,
Von dir gejagt, Gedanke!
Unnennbarer! Verhüllter! Entsetzlicher!
schaudert er manchmal mit einem ungeheuren Schreckblick zurück, da er erkennt, wie weit ihn sein Leben über alles Lebendige und alles Gewesene hinausgeschleudert hat. Aber ein so übergewaltiger Anlauf kann nicht mehr zurück: mit voller Bewußtheit erfüllt er das Schicksal, das sein geliebter Hölderlin ihm vorausgedacht, sein Empedokles-Schicksal.
Heroische Landschaft ohne Himmel, gigantisches Spiel ohne Zuschauer, Schweigen und immer gewaltsameres Schweigen um den fürchterlichsten Schrei geistiger Einsamkeit - das ist die Tragödie Friedrich Nietzsches: man müßte sie als eine der vielen sinnlosen Grausamkeiten der Natur verabscheuen, hätte er ihr nicht selbst ein ekstatisches Ja gesagt und die einzige Härte um ihrer Einzigkeit willen gewählt und geliebt. Denn freiwillig, aus gesicherter Existenz und mit klarem Sinn hat er sich dies »besondere Leben« aus dem tiefsten tragischen Instinkt gebaut und mit einer einzigen Kraft die Götter herausgefordert, in ihm »den höchsten Grad der Gefährlichkeit zu erproben, mit der ein Mensch sich lebt«. »Xαίρετε δαίμονεϛ!« »Seid gegrüßt, Dämonen!« Mit diesem heitern Ruf der Hybris beschwören einmal in studentisch froher Nacht Nietzsche und seine philologischen Freunde die Mächte: zur Geisterstunde schwenken sie vom Fenster aus den gefüllten Gläsern roten Wein in die schlafende Straße der Baseler Stadt hinab als Opfergabe an die Unsichtbaren. Es ist nur ein phantastischer Scherz, der mit tieferer Ahnung sein Spiel treibt: aber die Dämonen hören den Ruf und folgen dem, der sie gefordert, bis aus dem Spiel einer Nacht grandios die Tragödie eines Schicksals wird. Nie aber verwehrt sich Nietzsche dem ungeheuren Verlangen, von dem er sich übermächtig erfaßt und fortgeschleudert fühlt: je härter ihn der Hammer trifft, um so heller klingt der eherne Block seines Willens. Und auf diesem rotglühenden Amboß des Leidens wird härter und härter mit jedem verdoppelten Schlag die Formel geschmiedet, die seinen Geist dann ehern umpanzert, die »Formel für die Größe am Menschen, amor fati: daß man nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen, sondern es lieben«. Dieser sein inbrünstiger Liebes- gesang an die Mächte überklingt dithyrambisch den eigenen Schmerzensschrei: zu Boden geknickt, zerdrückt vom Schweigen der Welt, zerfressen von sich selber, geätzt mit allen Bitterkeiten des Leidens, hebt er niemals die Hände, das Schicksal möchte endlich von ihm lassen. Nur um mehr noch bittet er, um stärkere Not, um tiefere Einsamkeit, um volleres Leiden, um die äußerste Fülle seiner Fähigkeit; nicht in der Abwehr, einzig im Gebet hebt er die Hände, im herrlichsten Gebet des Helden: »Du Schickung meiner Seele, die ich Schicksal nenne, Du In- mir! Über-mir! Bewahre mich und spare mich einem großen Schicksal.«
Wer aber so groß zu beten weiß, der wird erhört.
DOPPELBILDNIS
Das Pathos der Attitüde gehört nicht zur Größe;
wer Attitüden überhaupt nötig hat, ist falsch ...
Vorsicht vor allen pittoresken Menschen!
Pathetisches Heroenbild. So bildet ihn die marmorne Lüge, die pittoreske Legende: ein trotzig gerecktes Heldenhaupt, hohe wölbige Stirn, zerklüftet von düstern Gedanken, niederwuchtende Welle des Haares über gespanntem, auftrotzendem Nacken. Unter den buschigen Augenbrauen blitzt Falkenblick, jeder Muskel des gewaltigen Gesichts steht straff von Willen, Gesundheit und Kraft. Der Vercingetorix-Schnurrbart männisch über herben Mund und das vorstoßende Kinn stürzend, zeigt den barbarischen Krieger, und unwillkürlich denkt man sich zu diesem muskelkräftigen Löwenhaupt eine germanische Wikingergestalt mit Siegschwert, Hifthorn und Speer. So, zum deutschen Übermenschen, zum antiken Promethiden der gefesselten Kraft gewaltsam übersteigert, lieben es unsere Bildhauer und Maler, den Einsamen im Geiste darzustellen, um ihn einer kurzgläubigen Menschheit anschaulicher zu machen, die von Schulbuch und Bühne her unfähig ist, das Tragische anders als in theatralischer Drapierung zu verstehen. Das wahrhaft Tragische aber ist niemals theatralisch und Nietzsches wahres Bildnis darum unendlich weniger pittoresk als seine Büsten und Bilder.
Bildnis des Menschen. Der dürftige Speiseraum einer Sechs-Franken-Pension in einem Alpenhotel oder am ligurischen Strand. Gleichgültige Gäste, zumeist ältere Damen im »small talk«, im kleinen Gespräch. Die Glocke hat dreimal zu Tisch gerufen. Über die Schwelle tritt mit gedrückter Schulter eine leicht gebückte unsichere Gestalt: wie aus einer Höhle heraus tappt immer der »Sechs-Siebentel-Blinde« in fremdes Gelaß. Dunkles, sauber gebürstetes Kleid, dunkel auch das Antlitz mit dem buschigen, braunen, gewellten Haar. Dunkel auch die Augen hinter der fast rundgeschliffenen dicken Krankenbrille. Leise, ja sogar schüchtern tritt er heran, eine ungemeine Lautlosigkeit um sein Wesen. Man fühlt einen Menschen, der im Schatten lebt, jenseits jeder gesprächigen Geselligkeit, der alles Laute, allen Lärm mit fast neurasthenischer Ängstlichkeit fürchtet: höflich, mit ausgesucht vornehmer Artigkeit grüßt er die Gäste, höflich, mit liebenswürdiger Gleichgültigkeit grüßen die andern den deutschen Professor zurück. Vorsichtig rückt sich der Kurzsichtige an den Tisch, vorsichtig prüft der Magenempfindliche jedes Gericht: ob der Tee nicht zu stark sei, die Speisen nicht übermäßig gewürzt, denn jeder Irrtum in der Kost reizt seine empfindlichen Gedärme, jeder Verstoß in der Nahrung wühlt die zitternden Nerven für Tage gewaltsam um. Kein Glas Wein, kein Glas Bier, kein Alkohol, kein Kaffee vor seinem Platz, keine Zigarre, keine Zigarette nach der Mahlzeit, nichts, was aufmuntert, erfrischt oder ausruhen macht: nur die kurze magere Mahlzeit und ein kleines, urbanes, untiefes Gespräch mit leiser Stimme zum gelegentlichen Nachbar (wie einer spricht, der des Redens seit Jahren entwöhnt ist und sich fürchtet, zuviel gefragt zu werden).
Und wieder hinauf in das schmale, enge, dürftige, kalt möblierte Chambre garnie, der Tisch vollgehäuft mit unzähligen Blättern, Notizen, Schriften und Korrekturen, aber keine Blume, kein Schmuck, kaum ein Buch und selten ein Brief. Rückwärts in der Ecke ein schwerer klotziger Holzkoffer, seine einzige Habe, mit den zwei Hemden und dem zweiten vertragenen Anzug. Sonst nur Bücher und Manuskripte, auf einem Tablett unzählige Flaschen und Fläschchen und Tinkturen: gegen die Kopfschmerzen, die ihn oft für Stunden sinnlos machen, gegen die Magenkrämpfe, gegen das spasmische Erbrechen, gegen die Trägheit der Eingeweide und vor allem die fürchterlichen Mittel gegen die Schlaflosigkeit, Chloral und Veronal. Ein entsetzliches Arsenal von Giften und Drogen, und doch die einzigen Helfer in dieser leeren Stille des fremden Raums, in dem er niemals anders ruht als in kurzem, künstlich erzwungenem Schlaf. In den Mantel verpackt, mit einem Wollschal umhüllt (denn der elende Ofen raucht bloß und wärmt nicht), mit frierenden Fingern, die doppelte Brille hart ans Papier gedrückt, schreibt die hastende Hand stundenlang Worte, die das trübe Auge dann kaum selbst entziffern kann. Stundenlang sitzt er so und schreibt, bis die Augen brennen und tränen: es sind die seltenen Glücksfälle seines Lebens, wenn sich irgendein Helfer seiner erbarmt und ihm seine Schreibhand borgt für eine Stunde oder zwei. Bei schönem Wetter geht der Einsame aus, immer allein, immer mit seinen Gedanken : nie ein Gruß unterwegs, nie ein Gefährte, nie eine Begegnung. Dunkles Wetter, das er haßt, Regen und Schnee, der seinen Augen wehtut, halten ihn unbarmherzig im Gefängnis seines Zimmers: nie geht er zu den andern, zu den Menschen hinab. Nur abends noch ein paar Kekse, eine Tasse dünnen Tee, und sofort wieder die lange, die unendliche Einsamkeit mit den Gedanken. Stunden und Stunden wacht er noch bei der zuckenden, qualmenden Lampe, ohne daß die Nerven, die heißgestrafften, sich lockerten zu einer sanften Müdigkeit. Dann ein Griff nach dem Chloral, nach irgendeinem Schlafmittel, und dann endlich, mit Gewalt erzwungen, der Schlaf der andern, der gedankenfreien, nicht vom Dämon gejagten Menschen.
Manchmal bleibt er tagelang im Bett. Erbrechen und Krämpfe bis zur Bewußtlosigkeit, sägende Schmerzen in den Schläfen, fast vollkommene Blindheit. Aber niemand kommt zu ihm, niemand für eine kleine Handreichung, für einen Umschlag auf die brennende Stirn, niemand, der ihm vorliest, mit ihm plaudert, mit ihm lacht.





























