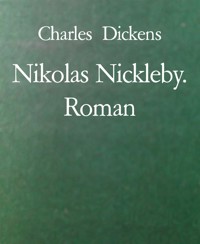
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Nikolas Nicklebys Vater stirbt, geraten er und seine Schwester Kate in die Gewalt ihres schurkischen Onkels Ralph.
Charles Dickens' dritter Fortsetzungsroman, ein Meisterwerk der Weltliteratur und sozialkritischer Gesellschaftsroman, ungekürzt, Korrektur gelesen und in neuer deutscher Rechtschreibung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nikolas Nickleby. Roman
BookRix GmbH & Co. KG81371 München1. Kapitel
Das alle übrigen einleitet
In einem entlegenen Teil der Grafschaft Devonshire lebte einst ein braver Mann namens Gottfried Nickleby, der sich ziemlich spät noch in den Kopf gesetzt hatte zu heiraten. Da er aber weder jung noch begütert war und daher nicht auf die Hand einer vermögenden Dame rechnen durfte, so verehelichte er sich lediglich aus Zuneigung mit einer alten Flamme, die ihn ihrerseits aus demselben Grunde nahm – so wie etwa zwei Leutchen, die es sich nicht leisten können, um Geld Karten zu spielen, einander hin und wieder den Gefallen erweisen, mitsammen eine Partie »umsonst« zu machen.
Die Flitterwochen waren bald vorüber, und da Mr. Nicklebys jährliches Einkommen achtzig Pfund nicht überstieg, blickte das Ehepaar sehnsüchtig in die Zukunft und verließ sich in nicht geringem Maß auf den Zufall, der ihnen aufhelfen sollte.
Es gibt, der Himmel weiß, Menschen genug auf der Welt; und sogar in London, wo Mr. Nickleby in jenen Tagen wohnte, hört man nur wenig klagen, dass die Bevölkerung zu spärlich gesäet sei. Dabei aber – du lieber Gott – kann man lange suchen, bis man einen Freund entdeckt.
Mr. Nickleby spähte und spähte, bis ihn die Lider nicht weniger schmerzten als das Herz, aber nirgends wollte sich ein solcher blicken lassen. Wenn er dann die vom Ausschauen ermüdeten Augen seinem eigenen Herde zuwandte, so zeigte sich auch dort gar wenig, wo sie hätten ausruhen können.
Als schließlich Mrs. Nickleby nach fünf Jahren ihren Gatten mit ein paar Jungen beglückte, fühlte der tiefgedrückte Mann die Notwendigkeit, für seine Familie zu sorgen, immer mehr und mehr, und er war bereits nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, sich am nächsten Quartal in eine Lebensversicherung einzukaufen und dann ganz zufällig von irgendeinem Monument oder Turm herunterzufallen, als eines Morgens ein schwarzgesiegelter Brief mit der Nachricht anlangte, Mr. Ralph Nickleby, sein Oheim, sei gestorben und habe ihm sein ganzes kleines Vermögen von ungefähr fünftausend Pfund Sterling hinterlassen.
Da der Selige bei Lebzeiten keine weitere Notiz von seinem Neffen genommen, als dass er dessen ältestem Knaben, der infolge einer verzweifelten Spekulation den Namen seines Großonkels in der Taufe erhalten hatte, einen silbernen Löffel in einem Maroquinfutteral schickte – was, da dieser nicht allzu viel damit zu essen hatte, fast wie eine Satire darauf aussah, dass das Kind nicht mit einem solchen nützlichen Artikel im Munde auf die Welt gekommen war – so wollte Mr. Gottfried Nickleby im Anfang die freudige Botschaft kaum glauben. Bei weiterer Prüfung stellte sich jedoch heraus, dass sich die Sache wirklich so verhielt.
Der wackere alte Herr hatte, wie es schien, zuerst beabsichtigt, seine ganze Habe dem allgemeinen Rettungsverein zu hinterlassen, und zu diesem Zwecke auch bereits ein Testament aufgesetzt. Aber dieser Verein hatte einige Monate vorher das Pech gehabt, das Leben eines armen Verwandten Mr. Nicklebys zu retten, dem dieser wöchentlich ein Almosen von sechs Schillingen und drei Pence auszahlte. Deshalb widerrief Mr. Ralph Nickleby in höchst gerechter Entrüstung das Vermächtnis durch ein Kodizill und setzte seinen Neffen Gottfried zum Universalerben ein, um dadurch seinen Unwillen sowohl gegen die Gesellschaft, die das Leben des armen Verwandten gerettet, als auch gegen den armen Verwandten selbst, der es sich hatte retten lassen, auszudrücken.
Mit einem Teile dieser Erbschaft kaufte Gottfried Nickleby ein kleines Landgut unweit Dawlish in Devonshire und zog sich dorthin mit seiner Gattin und seinen zwei Kindern zurück, um von dem spärlichen Ertrage des Gütchens und den Interessen des ihm noch übrig bleibenden Kapitals zu leben.
Als er nach fünfzehn Jahren, etwa fünf Jahre nach dem Tode seiner Gattin, starb, hinterließ er seinem ältesten Sohne Ralph dreitausend Pfund in barem Gelde und dem jüngeren, Nikolas, tausend Pfund und das Landgut – wenn man anders ein Stück Feld ein Landgut nennen kann, das mit Ausnahme des Hauses und des eingeheckten Grasgartens keinen größeren Umfang hatte als der Russelplatz von Covent Garden.
Die zwei Brüder waren mitsammen in einer Schule in Exeter erzogen worden und hatten, da sie gewöhnlich wöchentlich einmal einen Besuch zu Hause machten, von ihrer Mutter oft lange Erzählungen über die Leiden ihres Vaters in den Tagen seiner Armut und der Wichtigkeit ihres verblichenen Onkels in den Tagen seines Wohlstandes mit angehört – Erzählungen, die auf die beiden Knaben einen sehr verschiedenen Eindruck hervorbrachten, denn während der Jüngere, dessen Charakter schüchtern und begnügsam war, nur Winke darin sah, das Getriebe der Weh zu meiden und sein Glück in der Ruhe des Landlebens zu suchen, schöpfte Ralph, der Ältere, die zwei großen Lehren daraus, dass Reichtum die einzige Quelle von Glück und Ansehen sei und dass er zur Erwerbung desselben alle Mittel anwenden dürfe, sofern sie nicht durch das Gesetz mit Todesstrafe bedroht wären.
»Wenn meines Onkels Geld auch keinen Nutzen brachte, so lange er lebte«, folgerte Ralph weiter, »so kam es doch nach seinem Tode meinem Vater zugute, der jetzt den höchst lobenswerten Vorsatz hat, es für mich aufzusparen. Und was den alten Herrn anbelangt, so fand dieser doch auch seinen Genuss darin, sich sein Lebtag lang bewusst zu sein, dass ihn seine Familie deshalb beneide und in Ehren halte.« So kam Ralph immer bei derartigen Selbstgesprächen zu dem Schluss, dass auf der ganzen Welt nichts dem Gelde gleich komme.
Doch schon in frühen Jahren beschränkte sich der hoffnungsvolle Knabe nicht auf Theorien und rein abstrakte Spekulationen, sondern eröffnete bereits in der Schule ein kleines Wuchergeschäft, indem er zuerst Schieferstifte und Marmeln auf gute Zinsen auslieh und dann allmählich auf Kupfermünzen überging. Er quälte aber dabei seine Schuldner nicht etwa mit umständlichen und verwickelten Zinseszinsberechnungen. Sein Satz: »Zwei Pence für jeden Halfpenny«, vereinfachte das Verfahren außerordentlich.
In gleicher Weise vermied der junge Ralph Nickleby alle umständlichen und verwickelten Berechnungen der einzelnen Tage – mit denen man, wie jeder weiß, der schon damit zu tun gehabt, selbst bei dem einfachsten Zinsfüße seine liebe Not hat –, indem er als allgemeine Regel feststellte, dass Kapital nebst Interessen immer am Taschengeldtage, das heißt am Samstag zurückzuzahlen seien, wobei es sich gleich blieb, ob die Schuld am Montag oder am Freitag kontrahiert worden war. Er folgerte nämlich, und nicht mit Unrecht, dass die Zinsen eigentlich für einen Tag höher sein sollten als für fünf, da man annehmen könne, dass in ersterem Falle dem Borger aus einer besonders großen Verlegenheit geholfen werde, weil dieser sonst gewiss nicht unter solch drückenden Bedingungen Geld würde aufgenommen haben.
Nach dem Tode seines Vaters widmete sich Ralph Nickleby, der kurz zuvor in einem Londoner Handlungshaus untergebracht worden, seinem alten Hange, Geld zu erwerben, mit einer solchen Leidenschaft, dass er darüber seinen Bruder viele Jahre lang ganz und gar vergaß. Wenn auch hin und wieder ein Rückerinnern an seinen lieben alten Spielgefährten durch den Nebel, in dem er lebte, brach – denn das Geld umhüllt den Menschen mit einem Nebel, der auf die Gefühle der Jugendzeit weit zerstörender wirkt und einschläfernder als Kohlengas –, so tauchte damit doch immer zugleich der Gedanke auf, jener werde vielleicht, falls das gegenseitige Verhältnis inniger wäre, Geld von ihm borgen wollen. Daher schüttelte Mr. Ralph Nickleby dann jedes Mal die Achsel und sagte: Es ist besser so, wie es ist.
Nikolas seinerseits lebte als Junggeselle auf seinem Erbgute, bis er, der Einsamkeit müde, die Tochter eines Nachbars mit einer Mitgift von tausend Pfund zum Weibe nahm. Die gute Dame gebar ihm zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter, und als der Sohn ungefähr neunzehn Jahre und die Tochter etwa vierzehn zählte, sah sich Mr. Nickleby nach Mitteln um, sein Kapital wieder zu vergrößern, das durch den Zuwachs seiner Familie und die Kosten der Erziehung der Kinder sehr zusammengeschmolzen war.
»Spekuliere damit!«, meinte Mrs. Nickleby.
»Spekulieren, mein Schatz?«, entgegnete Mr. Nickleby bedenklich.
»Warum denn nicht?«
»Weil wir nichts mehr zu leben hätten, wenn wir es verlören«, antwortete Mr. Nickleby in seiner gewohnten bedächtigen Weise.
»Pah«, erwiderte Mrs. Nickleby.
»Man könnte es ja immerhin überlegen, meine Liebe«, meinte Mr. Nickleby.
»Nikolas ist schon ziemlich herangewachsen«, drängte die Gattin, »und es ist Zeit, dass er sich für einen Beruf entscheidet. Und was soll aus unserem Käthchen, dem armen Kind, werden, wenn wir ihr keinen Heller mitgeben können? Denk an deinen Bruder. Würde er das sein, was er ist, wenn er nicht spekuliert hätte?«
»Das ist freilich wahr«, gab Mr. Nickleby zu. »Also gut, meine Liebe. Ich werde spekulieren.«
Spekulieren ist ein Hasardspiel. Die Spieler sehen am Anfang wenig oder gar nichts von ihren Karten, und der Gewinn kann groß sein, aber ebenso auch der Verlust.
Das Glück war gegen Mr. Nickleby. Die allgemeine Spekulationswut warf sich damals gerade wie toll auf eine bestimmte Aktienunternehmung; die Seifenblase barst, vier Faiseure kauften sich Landgüter in Florenz und vierhundert arme Schlucker, darunter auch Mr. Nickleby, waren – ruiniert.
»Das Haus, in dem ich wohne«, seufzte der unglückliche Spekulant, »kann mir morgen genommen werden. Kein Stück unserer alten Möbel bleibt uns. Alles wird an Fremde versteigert werden!«
Und dieser letzte Gedanke war ihm so schmerzlich, dass er sich in sein Bett legte, augenscheinlich fest entschlossen, wenigstens dieses in keinem Falle aufzugeben.
»Kopf hoch, Sir!«, riet der Arzt.
»Sie müssen sich nicht so niederdrücken lassen, Sir«, sagte die Krankenwärterin.
»Solche Dinge kommen alle Tag vor«, meinte der Advokat.
»Und es ist eine große Sünde, sich dagegen aufzulehnen«, ermahnte der Pfarrer.
»Ein Mann, der seine Familie hat, sollte so etwas nie tun«, fügten die Nachbarn hinzu.
Mr. Nickleby aber schüttelte nur den Kopf dazu, bedeutete allen, das Zimmer zu verlassen, umarmte sein Weib und seine Kinder, drückte sie an das immer matter pochende Herz und sank dann erschöpft auf sein Kissen zurück.
Bald sah die Familie zu ihrer großen Bestürzung, dass er irre zu reden begann, denn er sprach lange von der Großmut und der Güte seines Bruders und den schönen Tagen, die sie miteinander auf der Schule zugebracht hatten.
Als der Anfall vorüber war, empfahl er sie feierlich dem Einen, der nie der Witwen und Waisen vergisst, lächelte matt, richtete das Gesicht zur Zimmerdecke empor und sagte, er glaube jetzt einschlummern zu können.
2. Kapitel
Handelt von Mr. Ralph Nickleby, seinen Geschäften und Unternehmungen. Ferner von einer großen Aktiengesellschaft, die für das ganze Land von größter Bedeutung ist
Mr. Ralph Nickleby war im eigentlichen Sinne des Wortes weder Kaufmann noch Bankier noch Sensal noch Notar. Man hätte überhaupt seinen Beruf nicht leicht bestimmen können. Nichtsdestoweniger ließ sich aus dem Umstande, dass er in einem geräumigen Hause in Golden Square wohnte mit einer Messingplatte an der Eingangstüre, die die Aufschrift »Bureau« trug, entnehmen, dass er irgendein Geschäft betrieb oder zu betreiben vorgab.
Die weitere Tatsache, dass zwischen halb zehn und fünf Uhr täglich ein Mann mit einem aschfahlen Gesicht und rostbraunem Anzug anwesend war, in einem speisekammerähnlichen Gemach am Ende des Hausflurs auf einem ungewöhnlich harten Stuhl saß – und stets eine Feder hinter dem Ohr hatte, wenn er auf den Ruf der Klingel die Haustüre öffnete, schien das zu bestätigen.
Golden Square liegt ziemlich abgelegen. Es hat seine Glanzzeit hinter sich und gehört nur mehr unter die herabgekommenen Plätze, sodass nur wenige Geschäftsleute hier ihren Aufenthaltsort wählen. Die Wohnungen werden meistens vermietet, und die ersten und zweiten Stockwerke gewöhnlich möbliert an ledige Herren abgegeben, die zugleich auch im Hause einen Kosttisch finden.
Es ist vorzugsweise der Zufluchtsort der Fremden. Sonnverbrannte Männergestalten mit großen Ringen, schweren Uhrketten und buschigem Backenbart, wie sie sich zwischen vier und fünf nachmittags unter der Säulenhalle des Opernhauses versammeln, sobald geöffnet wird, um die Logenbillets auszugeben, leben in Golden Square oder dessen Nähe.
Einige Violinisten und ein Trompeter der Opernkapelle haben hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen. In den Kosthäusern wird unaufhörlich musiziert, und die Töne der Klaviere und Harfen beleben die Abendstunden.
In Sommernächten kann man aus den offenen Fenstern Gruppen von dunklen, schnurrbärtigen Gesichtern sehen, die fürchterliche Rauchwolken von sich blasen; und der Geruch aller möglichen Sorten von Tabak durchduftet die Luft.
Dem Anscheine nach eignet sich ein derartiger Platz nicht besonders für einen Geschäftsmann, aber Mr. Ralph Nickleby wohnte bereits seit vielen Jahren hier, ohne dass man je eine Klage von ihm gehört hätte. Er kannte niemand in der ganzen Umgebung, und niemand kannte ihn, obgleich er in dem Rufe eines unermesslich reichen Mannes stand. Die Handwerker und Kaufleute hielten ihn für eine Art von Rechtsgelehrten, und die übrigen Nachbarn meinten, er wäre Generalagent oder etwas dergleichen. Aber alle diese Vermutungen stimmten so wenig wie Mutmaßungen über anderer Leute Angelegenheiten meistens.
Mr. Ralph Nickleby saß eines Morgens, zum Ausgehen angekleidet, in seinem Bureau. Er trug einen flaschengrünen Spencer über einem blauen Leibrock, eine weiße Weste, graumelierte Beinkleider und Stulpenstiefel. Der Zipfel eines schmal gefältelten Busenstreifs drängte sich, als ob er sich mit Gewalt sehen lassen wollte, zwischen dem Kinn und dem obersten Knopf der Weste hervor, während der Spencer nicht weit genug schloss, um eine lange, aus einer Reihe von einfachen goldenen Ringen bestehende Uhrkette zu verbergen, die an einer goldenen Repetieruhr in Mr. Nicklebys Tasche entsprang und in zwei Schlüssel endigte, von denen der eine zur Uhr selbst, der andere offenbar zu irgendeinem Patentvorlegeschloss gehörte. Mr. Nickleby trug das Haar gepudert, als wünsche er, sich dadurch ein menschenfreundlich wohlwollendes Aussehen zu geben. Wenn er dies aber wirklich beabsichtigte, so hätte er vor allem auch sein Gesicht pudern müssen, in dessen Falten, wie nicht minder in den kalten unsteten Augen, beständige Arglist lauerte.
Mr. Nickleby schlug ein vor ihm liegendes Kontobuch zu, warf sich in seinem Stuhl zurück und blickte mit zerstreuter Miene durch die glanzlosen Fensterscheiben. Häuser wie das seine pflegen in London einen trübseligen kleinen Hofraum zu haben, der gewöhnlich durch vier hohe weißgetünchte Mauern eingeschlossen ist und auf den die Schornsteine zürnend herabblicken.
Auf solchen Erdflecken welkt alle Jahre ein verkümmerter Baum, der im Spätherbst, wenn andere Bäume ihre Blätter verlieren, so tut, als wenn er etwas Laub hervorbringen wollte, gar bald aber wieder von seiner Anstrengung ablässt, um bis zum nächsten Sommer dürr dazustehen, wo er dann den gleichen Prozess wiederholt und vielleicht, wenn das Wetter besonders günstig ist, irgendeinen rheumatischen Sperling in Versuchung führt, auf seinen Zweigen zu zirpen.
Man nennt diese dunklen Höfe bisweilen Gärten. Der Mieter wirft gewöhnlich gleich bei seinem Einzug einige Packkörbe und ein halbes Dutzend zerbrochene Gläser hinein, und da bleibt dann alles, bis wieder ausgezogen wird, liegen, um unter dem spärlichen Buchsbaum, dem verkümmerten Immerbraun und den zerbrochenen Blumentöpfen in Schmutz und Kot nach Belieben zu modern.
In einen derartigen Raum schaute Mr. Ralph Nickleby hinaus, als er, die Hände in den Taschen, durch das Fenster sah. Die Aussicht hatte gerade nichts Einladendes, aber Mr. Nickleby war in düstere Gedanken verloren, und seine Augen wanderten schließlich zu einem kleinen schmutzigen Fenster linker Hand, durch das das Gesicht des Schreibers nur undeutlich sichtbar war, und da der Mann gerade aufblickte, so winkte er ihm einzutreten.
Sofort erhob sich der Schreiber von seinem hohen Sessel, der von dem ewigen Auf- und Abrutschen wie poliert aussah, und erschien in Mr. Nicklebys Zimmer. Er war ein großer Mann in mittleren Jahren mit ein paar Glotzaugen, von denen das eine unbeweglich war, einer Karfunkelnase, einem leichenfahlen Gesicht und einem Anzug, der aufs Äußerste abgetragen, viel zu kurz und zu knapp und mit so wenig Knöpfen versehen war, dass man sich wundern musste, wie es ihm gelang seinem Eigentümer nicht vom Leibe zu fallen.
»War das halb ein Uhr, Noggs?«, fragte Mr. Nickleby mit scharfer, unangenehmer Stimme.
»Nicht mehr als fünfundzwanzig Minuten nach der ….« Noggs wollte sagen, »nach der Wirtshausuhr«, besann sich jedoch rechtzeitig und ergänzte: »… nach der Sonne.«
»Meine Uhr ist stehen geblieben«, sagte Mr. Nickleby, »kann mir nicht erklären, warum.«
»Nicht aufgezogen«, meinte Noggs.
«Doch, doch«, versetzte Mr. Nickleby.
»Vielleicht die Feder überdreht.«
»Kann nicht gut sein.«
»Muss wohl«, beharrte Noggs.
»Na, meinetwegen«, sagte Mr. Nickleby und steckte seine Repetieruhr wieder in die Tasche. »Vielleicht ist’s so.«
Noggs gab einen eigentümlich grunzenden Ton von sich, wie er es gewöhnlich am Schlusse eines jeden Wortwechsels mit seinem Herrn zu tun pflegte, um dadurch anzudeuten, dass er recht behalten habe, und versank, da er selten zu sprechen wagte, ohne gefragt zu sein, in ein grämliches Schweigen, wobei er sich langsam die Hände rieb, an den Fingern knackte und sie auf jede mögliche Art verrenkte. Dabei gab er seinem gesunden Auge denselben starren und ungewöhnlichen Ausdruck, den das andere besaß, sodass es unmöglich war zu erkennen, wohin er eigentlich blicke. Es war dies eine von den zahlreichen Eigentümlichkeiten Mr. Noggs’, die jedem, selbst dem gleichgültigsten Beobachter, auf den ersten Blick auffallen musste.
»Ich will jetzt nach der London-Tavern gehen«, sagte Mr. Nickleby.
»Öffentliche Versammlung?«, fragte Noggs.
Mr. Nickleby nickte.
»Ich erwarte einen Brief von meinem Sachwalter betreffs Ruddles Pfandverschreibung. Wenn das Schreiben überhaupt eintrifft, so muss es um zwei Uhr hier sein. Ich werde um diese Zeit aus der City nach Charing Cross gehen. Wenn also Briefe kommen, so werden Sie mir sie entgegenbringen.«
Noggs nickte. In diesem Augenblick wurde die Bureauklingel gezogen. Mr. Nickleby blickte von seinen Papieren auf, und sein Schreiber blieb unbeweglich stehen.
»Man hat geläutet«, sagte Noggs, als halte er es für nötig, seinen Gebieter darauf aufmerksam zu machen. »Zu Hause?«
»Ja.«
»Für jedermann?«
»Ja.«
»Auch für den Steuereinnehmer?«
»Nein. Er soll ein andermal wiederkommen.«
Noggs ließ sein gewohntes Grunzen hören, was so viel bedeuten sollte wie »Ich dachte es ja«, und ging, da sich das Läuten wiederholte, zur Türe.
Bald darauf kehrte er mit einem blassen Herrn, namens Bonney zurück, der, eine schmale weiße Halsbinde nachlässig umgebunden, mit wirrem Haar hastig und unruhig ins Zimmer trat und überhaupt ganz so aussah, als habe man ihn in der Nacht aus den Federn geholt, ohne dass er sich zum Ankleiden hätte Zeit nehmen können.
»Mein lieber Nickleby«, rief der Herr, seinen weißen Hut abnehmend, der mit Papieren so voll gepfropft war, dass es ein Wunder schien, wie er ihn hatte auf dem Kopf tragen können, »es ist kein Augenblick zu verlieren, ich habe einen Wagen vor der Türe. Sir Matthew Pupker übernimmt den Vorsitz, und auf drei Parlamentsmitglieder können wir mit Bestimmtheit rechnen. Ich habe selbst zwei von ihnen aus den Betten geholt, und der Dritte, der die ganze Nacht durch im Crockfordklub am Spieltisch gesessen hat, ist eben nach Hause gegangen, um seine Wäsche zu wechseln und ein paar Flaschen Sodawasser zu trinken. Er wird aber zur rechten Zeit dort sein, um vor der Versammlung seine Rede zu halten. Die durchwachte Nacht hat ihn zwar ein wenig hergenommen, aber das hat nichts zu sagen, er pflegt in solchen Fällen mit besonderem Nachdruck zu reden.«
»Es scheint also alles gut gehen zu wollen?«, versetzte Mr. Ralph Nickleby, dessen Kaltblütigkeit in scharfem Gegensatz zu der Lebhaftigkeit seines Geschäftsfreundes stand.
»Gut gehen?«, rief Mr. Bonney. »Es ist die feinste Idee, die je ausgeheckt worden ist. Vereinigte, verbesserte, hauptstädtische Warme-Semmeln- und Kuchenbäckerei und pünktliche Ablieferungsgesellschaft. Kapital fünf Millionen mit fünfmalhunderttausend Aktien à zehn Pfund. Ha, schon der Name wird machen, dass die Aktien in zehn Tagen über Pari stehen.«
»Und wenn’s so weit ist?«, entgegnete Mr. Ralph Nickleby lächelnd.
»Wenn’s so weit ist, so wissen Sie so gut wie irgendeiner, was dann zu geschehen hat und wie man sich beizeiten ruhig aus der Affäre ziehen kann«, versetzte Mr. Bonney und klopfte dem Geldmann vertraulich auf die Schulter. »Apropos, Sie haben da einen seltsamen Menschen zum Schreiber.«
»Hm, ein armer Teufel«, brummte Ralph und zog seine Handschuhe an. »Und doch hat Newman Noggs seiner Zeit Pferde und Hunde gehalten.«
»Was Sie nicht sagen«, warf der Andere gleichgültig hin.
»Ja, ja. Und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Aber er hat sein Geld durchgebracht. Legte es leichtsinnig an, borgte auf Zinsen und wurde, mit einem Wort, in kurzer Zeit zum Bettler. Er ergab sich dem Trunk, wurde vom Schlag gerührt und kam dann zu mir, um mich um ein Pfund anzupumpen. Und da ich, als er noch in besseren Verhältnissen war …«
»In Geschäftsverbindung mit ihm stand«, ergänzte Mr. Bonney mit einem bedeutsamen Blick.
»Ganz recht. So konnte ich ihm natürlich nichts leihen.«
»Natürlich nicht.«
»Aber ich brauchte gerade einen Schreiber und Bedienten zum Türe Öffnen und so weiter und nahm ihn deshalb aus Barmherzigkeit auf. Und seitdem ist er hier.
Ich glaube zwar, dass es in seinem Kopf nicht ganz richtig ist«, fügte Mr. Nickleby mit einem Blick, der mitleidig sein sollte, hinzu, »aber ich kann den armen Kerl zur Not schon gebrauchen.«
Der weichherzige Mr. Nickleby vergaß hinzuzusetzen, dass der gänzlich mittellose Newman Noggs einen geringeren Lohn bezog, als ihn etwa ein dreizehnjähriger Knabe bekommen haben würde und dass die außergewöhnliche Schweigsamkeit des Mannes ihn zu einem sehr wertvollen Diener an einem Orte machte, wo so viel Geschäfte abgewickelt wurden, an deren Geheimhaltung Ralph außerordentlich viel liegen musste. Die beiden Herren hatten indes große Eile, brachen daher ihr Gespräch ab und verfügten sich zu der bereitstehenden Droschke.
Als sie in der Bishopsgatestreet anlangten, herrschte dort ein sehr bewegtes Treiben. Es war ein sehr windiger Tag, und ein halbes Dutzend Männer durchzogen die Straßen mit ungeheuern Ankündigungen, auf denen in riesigen Buchstaben zu lesen war, dass Punkt ein Uhr eine öffentliche Versammlung stattfinden werde, um die Zweckmäßigkeit einer Petition an das Parlament hinsichtlich der »Vereinigten, verbesserten, hauptstädtischen Warme-Semmeln- und Kuchenbäckerei und pünktliche Ablieferungs-Gesellschaft« zu erörtern, deren Kapital auf fünf Millionen zu fünfmalhunderttausend Aktien à zehn Pfund veranschlagt sei. Die genannten Zahlen waren, wie es sich gehört, in gewaltigen schwarzen Ziffern auf den Plakaten verzeichnet.
Mr. Bonney brach sich unter den tiefen Bücklingen der Diener, die ihm die Treppe freimachten, mit den Ellenbogen Bahn und betrat mit Mr. Nickleby eine Reihe von Komiteezimmern, in deren zweitem sich ein für eine Sitzung hergerichteter Tisch befand, um den mehrere geschäftsmäßig aussehende Personen versammelt waren.
»Hört, hört!«, rief ein Herr mit einem Doppelkinn, als sich Mr. Bonney vorstellte. »Einen Stuhl, meine Herren, einen Stuhl!«
Die neuen Ankömmlinge wurden mit allgemeinem Beifall begrüßt, Mr. Bonney trat rasch an das Ende des Tisches, nahm seinen Hut ab, fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und schlug mit einem kleinen Hammer kräftig auf den Tisch, worauf mehrere Herren »Hört« riefen und sich gegenseitig zunickten, als wollten sie ihre Bewunderung über dieses geistvolle Benehmen ausdrücken. In diesem Augenblick riss ein Diener in fieberhafter Erregung die Tür auf, stürzte herein und schrie: »Sir Matthew Pupker.«
Das Komitee stand auf und klatschte vor Freude in die Hände. Gleich darauf trat Sir Matthew Pupker ein, begleitet von zwei Parlamentsmitgliedern in Lebensgröße, einem irischen und einem schottischen. Alle drei lächelten, verbeugten sich und benahmen sich so obligeant, dass es ein wahres Wunder gewesen wäre, wenn jemand den Mut gehabt hätte, gegen sie seine Stimme zu erheben. Besonders Sir Matthew Pupker, der auf dem Scheitel seines kleinen runden Kopfes ein Flachstoupet trug, war von einem solchen Verbeugungsparoxismus befallen, dass ihm die Perücke jeden Augenblick herunterzufliegen drohte.
Als sich diese bedrohlichen Symptome einigermaßen gelegt hatten, drängten sich die Herren, die mit Sir Matthew Pupker und den Parlamentsmitgliedern näher bekannt waren, in kleinen Gruppen um sie, während diejenigen, die sich einer solchen Ehre nicht zu erfreuen hatten, sich sehnsüchtig heranschlichen und sich lächelnd die Hände rieben in der Hoffnung, etwas anbringen zu können, was die Aufmerksamkeit auf sie lenken könnte.
Inzwischen gaben Sir Matthew Pupker und die beiden anderen Parlamentsmitglieder die Ansichten zum besten, die die Regierung hinsichtlich der Annahme der Bill hege, berichteten ausführlich, was ihnen die Minister, als sie das letzte Mal bei ihnen gespeist, zugeflüstert und welche bedeutungsvolle Winke sie dabei hätten fallen lassen. Aus all dem könnten sie nur die Folgerung ziehen, dass, wenn der Regierung irgendein Thema besonders am Herzen läge, dieses kein anderes sein könne, als das Gedeihen der »Allgemeinen, verbesserten, hauptstädtischen Warme-Semmeln- und Kuchenbäckerei und pünktlichen Ablieferungs-Gesellschaft«.
Das Publikum hatte inzwischen auf den Galerien lebhafte Ungeduld an den Tag gelegt, und es war bereits zu einigen Scharmützeln gekommen, als plötzlich ein lauter Ruf die allgemeine Aufmerksamkeit erregte. Durch eine Nebentür trat jetzt eine lange Reihe von Herren mit entblößten Häuptern auf die Tribüne.
Der Lärm verstummte, und Sir Matthew Pupker übernahm den Vorsitz. In schwungvoller Rede gab er kund, welche Gefühle ihn im gegenwärtigen Augenblick bewegten, was der gegebene Zeitpunkt in den Augen der Welt bedeute und welch wichtigen Einfluss auf den Wohlstand, das Glück, die Bequemlichkeit, die Freiheit und sogar auf die ganze Existenz eines freien und großen Volkes ein Institut üben müsse wie das der Vereinigten, verbesserten, hauptstädtischen Warme- Semmeln- und Kuchenbäckerei und pünktlichen Lieferungs-Gesellschaft.
Sodann stand Mr. Bonney auf, um die erste Resolution zu beantragen, fuhr sich mit der Rechten durch die Haare, pflanzte die Linke zierlich in die Hüfte, vertraute seinen Hut der Sorgfalt des Herrn mit dem Doppelkinn an, der außerdem auch noch die Weinflaschen für die Redner bereit hielt, und erklärte, dass die anwesende Versammlung nur mit Besorgnis und Unruhe auf den gegenwärtigen Stand des Semmelhandels in der Hauptstadt und deren Nachbarschaft blicken könne, dass die Semmeljungen, wie sie gegenwärtig beschaffen seien, das Vertrauen des Publikums ganz und gar nicht verdienten und dass überhaupt das ganze Semmelsystem ebenso nachteilig für die Gesundheit und Sittlichkeit des Volkes wie verderblich für die höchsten Interessen einer Großstadt wären.
Die Rede des ehrenwerten Herrn entlockte den zuhörenden Damen reichlich Tränen und weckte bei allen Anwesenden die lebhaftesten Empfindungen. Er hatte, wie er sagte, die Wohnungen der Armen in den verschiedenen Distrikten Londons besucht und auch nicht die mindesten Spuren von Semmeln daselbst aufgefunden, weshalb er sich zur Annahme berechtigt glaube, dass so mancher Bedürftige jahraus, jahrein keine solchen zu kosten bekäme.
Er hätte ferner bemerkt, dass unter den Semmelverkäufern Hang zu Trunksucht und Ausschweifungen aller Art herrschte, was er der entsittlichenden Natur ihres Geschäftes bei dem gegenwärtigen Betrieb zuschreibe.
Dieselben Laster habe er unter der ärmeren Klasse des Volkes, die doch auch am Semmelkonsum teilnehmen sollte, entdeckt und er glaube den Grund dazu in der Verzweiflung zu finden, die diese Leute antreibe, ein schädliches Reizmittel in berauschenden Getränken zu suchen, da sie nicht in der Lage seien, sich ein so ungemein kräftigendes Nahrungsmittel zu kaufen wie die Semmel.
Er wolle es auf sich nehmen, vor einem Komitee des Unterhauses zu beweisen, dass eine geheime Verbindung bestehe, die den Preis der Semmel in die Höhe schraube und den Austrägern ein Monopol sichere, und er erkläre sich bereit, dies durch die eigenen Aussagen der Verkäufer vor den Schranken dieses Hauses zu beweisen. Er wolle auch dartun, dass diese Sorte Menschen sich durch geheime Worte und Zeichen miteinander verständige.
Die Gesellschaft beabsichtige nun, diesem betrübenden Stand der Dinge abzuhelfen, indem sie erstlich beantrage, dass aller und jeder Privatsemmelverkauf bei schwerer Strafe verboten werde, und zweitens, dass sie selbst das Publikum ausschließlich mit dieser Ware versehen wolle, und zwar so, dass auch die Armen in ihren eigenen Häusern mit Semmeln von vorzüglicher Güte zu herabgesetzten Preisen versorgt werden könnten.
Der patriotische Präsident dieser Gesellschaft, Sir Matthew Pupker, habe bereis eine Bill im Parlament eingebracht, zu deren Unterstützung das gegenwärtige Meeting einberufen worden sei. Und wer diese Bill unterstütze, helfe mit, unsterblichen Ruhm und Glanz über England zu bringen durch Förderung der Vereinigten, verbesserten, hauptstädtischen Warme-Semmeln- und Kuchenbäckerei und pünktlichen Lieferungs-Gesellschaft mit einem Kapital von fünf Millionen zu fünfmalhunderttausend Aktien à zehn Pfund.
Mr. Ralph Nickleby unterstützte den Antrag, und nachdem ein anderer Herr den Zusatzantrag gestellt hatte, an jeder Stelle in dem Entwürfe an das Parlament, wo das Wort »Semmeln« vorkäme, auch das Wort »Kuchen« hinzuzufügen, ging die Resolution einstimmig durch. Nur ein einziger Mann im dichtesten Gedränge rief »Nein«, wurde aber sofort festgenommen und hinausgeführt.
Die zweite Resolution galt der Ausrottung aller Kuchen- und Semmelverkäufer, mochten sie nun Männer oder Weiber, Knaben oder Erwachsene sein, und wurde durch einen weinerlichen Herrn in einer Art Geistlichenhabit vorgebracht, der mit einem so ergreifenden Pathos sprach, dass er sogar den ersten Redner in Schatten stellte. Man hätte eine Stecknadel, ja sogar eine Feder fallen hören können, als er die Grausamkeit schilderte, mit der die Semmeljungen von ihren Herren behandelt würden – was, wie er hervorhob, an sich schon ein hinreichender Grund wäre, um die beantragte, nicht genug zu schätzende Gesellschaft ins Leben zu rufen. Die unglücklichen Jungen würden alle Nacht, selbst in der rauesten Jahreszeit, auf die nassen Straßen hinausgestoßen, um stundenlang ohne Obdach, Nahrung und warme Bekleidung durch Finsternis und Regen, Hagel und Schnee umherzuwandern, während man die Semmeln fürsorglich in heiße Tücher einschlage. (Ausrufe: Schändlich.)
Die Wirkung der Rede auf die Zuhörer war durchschlagend. Die Männer riefen Beifall, und die Damen weinten ihre Taschentücher nass und schwenkten sie dann wieder trocken. Die allgemeine Aufregung war außerordentlich, und Mr. Nickleby flüsterte seinem Freunde zu, die Sache stehe so günstig, dass sie jetzt schon fünfundzwanzig Prozent Agio so gut wie sicher in der Tasche hätten.
Der Antrag ging natürlich unter lautem Beifall durch, und man würde in der Begeisterung wahrscheinlich nicht nur die Arme, sondern sogar die Beine in die Höhe gestreckt haben, wenn das angegangen wäre.
Sodann stand der Herr auf, der die ganze Nacht über im Spielklub zugebracht hatte und daher etwas hergenommen aussah, und erklärte seinen Mitbürgern, welche Glanzrede er zugunsten der Petition zu halten gedächte, wenn sie im Unterhaus zur Sprache käme, und mit welch grausamem Hohn er das Parlament überschütten wolle, wenn es diesem beifallen sollte, den Antrag zu verwerfen. Er bedaure nur, dass der hochgeschätzte Vorredner in den Entwurf nicht eine Klausel aufgenommen habe, nach der es allen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft zur zwingenden Aufgabe gemacht sei, Semmeln und Kuchen zu kaufen, denn er sei kein Freund von halben Maßregeln und huldige dem Prinzip: Aut Caesar aut nihil.
Als die Petition endgültig verlesen war, ließ das irische Parlamentsmitglied, ein temperamentvoller junger Mann, eine Rede vom Stapel, wie sie eben nur ein irisches Parlamentsmitglied zu halten imstande ist. Sie war ganz Poesie und rauschte in einem solchen Glutstrom dahin, dass man sich schon erwärmt fühlte, wenn man den Sprecher nur ansah. Sie gipfelte darin, dass der Redner die Ausdehnung der Vereinigten, verbesserten, hauptstädtischen Warme-Semmel- und Kuchenbäckerei und pünktlichen Ablieferungs-Gesellschaft auch für sein grünes Vaterland fordern werde, auf dass das Geläute der Semmelglocke dessen reiche Täler durchtöne.
Den Schluss machte das schottische Parlamentsmitglied mit verschiedenen erfreulichen Hinweisen auf die voraussichtliche Rentabilität des Unternehmens, was die frohe Stimmung, die der dichterische Schwung des Irländers geweckt hatte, noch erhöhte.
Kurz, sämtliche Reden bewirkten gerade das, was sie erzielen sollten, und brachten den Zuhörern die felsenfeste Überzeugung bei, dass keine Spekulation so vielverheißend und risikolos wie die gegenwärtige sei.
So ging denn die Petition zugunsten der Bill einstimmig durch, und die Versammlung trennte sich unter Beifallsrufen.
Mr. Nickleby und die anderen Direktoren verfügten sich nach einem Speisehaus, wo sie ein Lunch einnahmen und es, da die Gesellschaft ja erst im Entstehen war, mit nur je drei Guineen pro Kopf für ihre Bemühungen in Anrechnung brachten.
3. Kapitel
Mr. Ralph Nickleby erhält traurige Nachrichten von seinem Bruder, weiß sich aber mit edler Standhaftigkeit zu fassen. Der junge Nikolas gefällt seinem Onkel ausnehmend, und dieser fasst den edelmütigen Entschluss, für dessen Zukunft zu sorgen
Mr. Ralph Nickleby trat nach dem Mahle in ungewöhnlich guter Laune den Heimweg an. Als er bei der St.-Pauls-Kirche anlangte, trat er in einen Torweg, um seine Uhr zu richten, und wie er so den Schlüssel in der Hand und die Augen auf den Zeiger der Kirchturmuhr gerichtet dastand, trat plötzlich Newman Noggs an seine Seite.
»Ah, Newman«, sagte Mr. Nickleby aufblickend. »Das Schreiben wegen der Hypothek angelangt, was?«
»Falsch«, brummte Noggs.
»Was? Und es war auch niemand deshalb im Bureau?«
Noggs schüttelte den Kopf.
»Aber was ist denn also gekommen?«
»Ich«, entgegnete Newman.
»Und was sonst noch?«
»Dies da«, erwiderte Noggs und zog einen versiegelten Brief aus der Tasche. »Poststempel Strand, schwarzes Siegel, schwarzer Rand, Frauenzimmerhand, C. N. in der Ecke.«
»Schwarzes Siegel?«, fragte Mr. Nickleby mit einem Blick auf den Brief. »Die Schrift kommt mir bekannt vor. Es sollte mich nicht wundernehmen, Newman, wenn mein Bruder tot wäre.«
»Glaub’s wohl«, versetzte Noggs ruhig.
»Wieso?«
»Na, weil Sie sich überhaupt über nichts wundern«, antwortete Newman.
Mr. Nickleby öffnete den Brief, las ihn mit steinerner Miene, steckte ihn dann in die Tasche und begann, wieder seine Uhr aufzuziehen.
»Es ist, wie ich erwartet habe, Newman«, sagte er dabei. »Er ist tot. Hm, kommt mir recht ungelegen. Ich hätt’s nicht gedacht.«
»Kinder hinterlassen?«, forschte Noggs.
»Zwei. Das ist’s doch eben«, brummte Mr. Nickleby und ging schnell weiter.
»Zwei«, wiederholte Noggs mit leiser Stimme.
»Und auch eine Witwe. Alle drei sind jetzt in London. Hol sie der Henker. Alle drei hier, Newman!«
Noggs blieb ein wenig hinter seinem Gebieter zurück und schnitt merkwürdige Grimassen. Ob infolge von Krämpfen, eines Schmerzgefühls oder eines innerlichen Lachens, konnte niemand als er selbst sagen. Der Ausdruck des menschlichen Gesichtes ist sonst ein Spiegel der Seele, aber Newman Noggs’ Züge blieben in allen Gemütsstimmungen ein unlösliches Rätsel.
»Gehen Sie nach Hause«, sagte Mr. Nickleby nach einer Weile und warf dabei seinem Schreiber einen Blick zu wie einem Hund.
Die Worte waren kaum ausgesprochen, als Newman bereits über die Straße glitt und sich im Augenblick in dem Gedränge verlor.
»Hübsch ausgedacht«, brummte Mr. Nickleby im Weitergehen vor sich hin, »hübsch ausgedacht. Mein Bruder hat nie etwas für mich getan, und ich habe es auch nicht erwartet; aber kaum ist ihm der Atem ausgegangen, hält man sich an mich. Ich soll jetzt für ein stämmiges Weib, einen erwachsenen Jungen und ein dito Mädchen sorgen. Was gehen sie mich an? Ich kenne sie doch gar nicht.«
Unter solchen und ähnlichen Betrachtungen schlug Mr. Nickleby den Weg nach dem Strand ein, zog den Brief zu Rat, um hinsichtlich der Adresse nicht fehl zu gehen, und machte schließlich vor der Türe eines Hauses ungefähr in der Mitte der sehr belebten Straße Halt.
Es musste hier ein Miniaturmaler wohnen, denn neben dem Tor war ein großer vergoldeter Rahmen festgeschraubt, auf dem sich auf schwarzem Samtgrunde zwei Porträts in Marineuniform nebst den dazugehörigen Teleskopen – das eines jungen Herrn in Scharlach, der einen Säbel schwang, und das eines Gelehrten mit hoher Stirne, einer Feder, einem Tintenfass, sechs Büchern und einem Vorhang – befanden.
Daneben sah man noch das ungemein ansprechende Bild einer jungen Dame, die in einem riesigen Wuste von Manuskripten las, und die liebenswürdige ganze Figur eines großköpfigen, kleinen Knaben mit Beinen, die perspektivisch zu der Größe von Salzlöffelchen verkürzt waren.
Außer diesen Kunstwerken prangten noch viele Köpfe von alten Damen und Herren auf blauem und braunem Hintergründe, die sich gegenseitig zulächelten – und eine zierlich geschriebene Preisliste mit gepresstem Rand.
Mr. Nickleby warf einen verächtlichen Blick auf diese Armseligkeiten und klopfte mit Doppelschlägen an die Türe, bis ihm ein Dienstmädchen mit ungemein schmutzigem Gesicht öffnete.
»Ist Madam Nickleby zu Hause?«, fragte Mr. Ralph ungeduldig.
»Sie heißt net Nickleby; Sie meinen vielleicht La Creevy?«, antwortete das Mädchen und wollte sich eben näher auslassen, als eine weibliche Stimme von einer fast senkrechten Treppe herunter die Frage vernehmen ließ, zu wem der Herr wolle.
»Zu Mrs. Nickleby«, erwiderte Ralph.
»Das ist doch im zweiten Stock, Hanna«, fuhr dieselbe Stimme fort. »Was du doch für ein dummes Ding bist. Ist die Herrschaft im zweiten Stock zu Hause?«
»Es is eben jemand hinausgegangen, aber ich glaube, es war von der Dachstube, aus der man den Kehricht heruntergetragen hat«, versetzte das Mädchen.
»So sieh nach«, erwiderte das unsichtbare Frauenzimmer. »Zeig dem Herrn, wo die Klingel ist, und sage ihm, er dürfe nicht mit einem Doppelschlag klopfen, wenn sein Besuch im zweiten Stock gilt. Ich kann überhaupt das Klopfen nicht gestatten, wenn nicht die Klingel gebrochen ist, und dann muss es durch zwei einfache Schläge geschehen.«
»Schon gut«, sagte Mr. Ralph und trat ohne Weiteres in das Haus. »Pardon, sind Sie Madame La – wie ist Ihr Name?«
»Creevy – La Creevy«, versetzte die Stimme, und zugleich tauchte ein gelber Kopfputz über dem Geländer auf.
»Ich möchte, wenn Sie erlauben, einen Augenblick mit Ihnen sprechen, Madam.«
Die Stimme ersuchte Mr. Nickleby heraufzukommen, doch dies war bereits geschehen, ehe sie noch ausgesprochen hatte, und als Mr. Ralph im ersten Stock anlangte, wurde er von der Besitzerin des gelben Kopfputzes empfangen, deren Kleid und Gesicht so ziemlich von derselben Farbe waren.
Miss La Creevy war eine geziert aussehende jugendliche Dame von fünfzig Jahren, und ihr Zimmer bildete ein passendes Seitenstück zu dem vergoldeten Rahmen an der Türe. Nur dass hier die Kunstproduktion üppiger wucherte und der Raum selbst um ein Beträchtliches schmutziger war.
»Ehüm«, begann Miss La Creevy, zimperlich hinter ihren seidenen Halbhandschuhen hüstelnd, »Sie wünschen wohl ein Miniaturporträt? Ihr Gesicht ist sehr markant, Sir. Sind Sie früher schon gesessen?«
»Sie sind, wie ich sehe, hinsichtlich meines Hierseins im Irrtum, Madam«, versetzte Mr. Nickleby in seiner gewohnten plumpen Weise. »Ich habe kein Geld übrig, um es für Miniaturbilder wegzuwerfen, Madame, und Gott sei Dank auch niemand, dem ich eines schenken könnte, im Fall ich welches besäße. Da ich Sie gerade auf der Treppe sah, so wollte ich Ihnen nur einige Fragen über die hier wohnenden Mieter vorlegen.«
Miss La Creevy hüstelte abermals, diesmal um ihre Enttäuschung zu verbergen, und sagte:
»Ach so.«
»Ich vermute aus den an Ihre Magd gerichteten Worten«, fuhr Mr. Nickleby fort, »dass der zweite Stock Ihnen gehört, Madame?«
Miss La Creevy erwiderte, dass dem allerdings so sei, aber da sie die Zimmer des zweiten Stockes zurzeit nicht brauche, so pflege sie sie zu vermieten. Und gegenwärtig seien sie an eine Dame vom Lande mit ihren beiden Kindern vergeben.
»An eine Witwe, Madam?«
»Ja, an eine Witwe.«
»Eine arme Witwe, Madam?«, forschte Ralph mit starker Betonung des kleinen Beiworts, das so viel in sich begreift.
»Hm, allerdings ich fürchte, sie ist arm«, versetzte Miss La Creevy.
»Ich kenne zufällig die näheren Umstände, Madam«, fuhr Ralph fort. »Mit einem Wort, ich bin ein Verwandter und möchte Ihnen raten, die Familie nicht länger zu behalten.«
»Wäre nicht zu hoffen«, entgegnete Miss La Creevy mit einem weiteren Husten, »dass, im Falle die Dame nicht imstande sein sollte, ihre Zahlungsverbindlichkeiten einzuhalten, ihre Familie …«
»Nein, nein, Madam«, unterbrach Ralph hastig, »daran ist nicht im Entferntesten zu denken.«
»Dann allerdings«, erwiderte Miss La Creevy, »erhält die Sache freilich ein ganz anderes Gesicht.«
»Richten Sie sich jedenfalls darnach, Madam«, sagte Ralph, »und treffen Sie demgemäß Ihre Vorkehrungen. Ich bin der einzige Verwandte, den die Familie hat, und halte es für meine Pflicht, Sie in Kenntnis zu setzen, dass ich ihre verschwenderische Lebensweise nicht unterstützen kann. Auf wie lange hat sie sich bei Ihnen eingemietet?«
»Es ist nur wochenweise gemietet worden, und Mrs. Nickleby hat für die ersten acht Tage vorausbezahlt.«
»Dann werden Sie gut tun, ihr sofort zu kündigen. Das Beste ist, wenn sie wieder aufs Land zurückgeht. Hier ist sie nur jedermann im Wege.«
»Allerdings«, erwiderte Miss La Creevy, sich die Hände reibend, »wäre es sehr unpassend für eine Dame wie Mrs. Nickleby, wenn sie Zimmer mieten würde, ohne die Mittel zu besitzen, sie auch zu bezahlen.«
»Natürlich, natürlich, Madam«, bekräftigte Ralph.
»Und da ich vorderhand, hm, nur eine einzeln lebende schutzlose Dame bin«, fuhr Miss La Creevy fort, »so könnte ich einen Verlust an Mietzins nicht verschmerzen.«
»Selbstverständlich nicht, Madam«, stimmte Ralph bei.
»Immerhin«, fuhr Miss La Creevy augenscheinlich zwischen Gutmütigkeit und ihrem Vorteile schwankend fort, »kann ich durchaus nichts gegen die Dame sagen. Wenn sie auch ungemein niedergedrückt zu sein scheint, so ist sie doch sehr gefällig und freundlich, und auch die jungen Leute sind so artig und wohlerzogen, dass man nicht leicht ihresgleichen heutzutage findet.«
»Ganz gut, Madam«, knurrte Ralph und wandte sich zum Gehen, da ihm dies der Armut gespendete Lob nicht behagte, »ich habe meine Schuldigkeit getan und vielleicht noch mehr, als ich hätte tun sollen. Ich bin es natürlich gewohnt, dass mir die Menschen dafür keinen Dank wissen.«
»Ich für meine Person bin Ihnen jedenfalls sehr verbunden, Sir«, versicherte Miss La Creevy mit einem zierlichen Knicks. »Übrigens, würden Sie mir nicht vielleicht die Gunst erweisen, einige Proben meiner Porträtmalerei anzusehen?«
»Sehr gütig, Madam«, lehnte Mr. Nickleby ab und machte sich in großer Eile davon, »aber da ich noch einen Besuch eine Treppe höher abzustatten habe und meine Zeit knapp bemessen ist, so bin ich in der Tat außerstande …«
»Ich werde mich jederzeit glücklich schätzen, wenn Sie etwa im Vorübergehen wieder einmal bei mir vorsprechen wollen«, fing Miss La Creevy wieder an. »Vielleicht haben Sie die Gewogenheit, hier meine Karte anzunehmen, Sir. Ich danke Ihnen. Guten Morgen …«
»Guten Morgen, Madam«, brach Ralph kurz ab und schloss rasch die Türe hinter sich, um jede Fortsetzung des Gespräches zu verhindern. »Also jetzt zu meiner Schwägerin. Na.«
Dann klomm er eine zweite steile Treppenflucht empor, die mit großem architektonischen Scharfsinn nur aus Eckstufen zusammengesetzt war, und hielt eben an dem Geländer inne, um ein wenig zu verschnaufen, als er von Miss La Creevys Dienstmagd überholt wurde, die seit ihrer letzten Begegnung mit ihm augenscheinlich nicht sehr gelungene Versuche gemacht hatte, ihr schmutziges Gesicht mit einer noch viel schmutzigeren Schürze zu reinigen, und von ihrer höflichen Gebieterin abgeschickt worden war, den Herrn anzumelden.
»Wie ist Ihr Name?«, fragte das Mädchen.
»Ralph Nickleby.«
»Mrs. Nickleby, Mrs. Nickleby«, rief das Mädchen und riss die Türe auf. »Mr. Nickleby ist hier.«
Eine tief in Trauer gekleidete Dame erhob sich, als Ralph ins Zimmer trat, war jedoch augenscheinlich nicht imstande, ihm entgegen zu gehen, denn sie stützte sich auf den Arm eines zarten, aber ungemein schönen Mädchens von ungefähr siebzehn Jahren, das neben ihr gesessen hatte. Ein junger Mann, anscheinend ein oder zwei Jahre älter, sprang sofort auf und begrüßte Mr. Nickleby als seinen Onkel.
»Hm«, brummte Ralph mit einem ungnädigen Stirnrunzeln, »du bist vermutlich Nikolas?«
»Das ist mein Name, Sir«, erwiderte der junge Mann.
»Nimm mir den Hut ab«, versetzte Ralph herrisch. »Nun, wie geht’s Ihnen, Madam? Sie müssen Ihren Kummer niederkämpfen, Madam; ich mache es auch nie anders.«
»Der Verlust traf mich so plötzlich und unerwartet«, seufzte Mrs. Nickleby und fuhr sich mit dem Taschentuch über die Augen.
»Gar nichts Unerwartetes«, murrte Ralph und knöpfte kaltblütig seinen Rock auf. »Familienväter sterben alle Tage und, Madam, Mütter nicht minder.«
»Und auch Brüder, Sir«, fügte Nikolas unwillig hinzu.
»Jawohl, Musjö, und auch naseweise Zierbengel und Muttersöhnchen«, bemerkte der Onkel und nahm einen Stuhl. »Sie sprechen sich in Ihrem Brief nicht darüber aus, woran mein Bruder litt, Madam.«
»Die Ärzte konnten keine besondere Todesursache finden«, sagte Mrs. Nickleby, in Tränen ausbrechend. »Ach, wir haben nur allzu viel Grund zu glauben, dass er an gebrochenem Herzen starb.«
»Pah«, sagte Ralph, »so etwas gibt es doch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein Mensch den Hals bricht oder die Nase oder den Arm, den Fuß oder den Schädel, aber ein gebrochenes Herz? Dummheiten! Wenn einer seine Schulden nicht bezahlen kann, so stirbt er an gebrochenem Herzen, und seine Witwe gilt als Märtyrerin.«
»Ich will gern glauben, dass es Leute gibt, denen das Herz nicht brechen kann, weil sie keins haben«, bemerkte Nikolas ruhig.
»Wie alt, um Gotteswillen, ist denn dieser Bursche?«, fragte Ralph wütend, drehte sich auf seinem Stuhl um und musterte mit unaussprechlicher Geringschätzung seinen Neffen von Kopf bis zu Fuß.
»Nikolas geht ins neunzehnte.«
»Was, neunzehn?«, fuhr Ralph auf. »Und was gedenkst du anzufangen, um dir deinen Lebensunterhalt zu erwerben, Musjö?«
»Meiner Mutter will ich unter keinen Umständen zur Last fallen«, rief Nikolas lebhaft.
»Würdest auch wenig genug zu beißen haben, wenn du das vorhättest«, brummte Mr. Nickleby verächtlich.
»Wie wenig es auch sein mag«, erwiderte Nikolas zornig, »in keinem Falle werden Sie es wohl vermehren.«
»Nikolas, Liebling, vergiss dich nicht«, verwies Mrs. Nickleby.
»Bitte, bitte, lieber Nikolas«, flehte die Schwester.
»Halt deinen Mund, Musjö«, schimpfte Ralph. »Das ist ja ein recht netter Anfang, Madam. Ein netter Anfang.«
Mrs. Nickleby entgegnete weiter nichts und bat nur Nikolas durch Gebärden, ruhig zu bleiben.
Onkel und Neffe maßen sich gegenseitig einige Sekunden, ohne ein Wort zu sprechen. Die Züge des Alten waren streng, hart und abstoßend, die des jungen Mannes offen, schön und freimütig. In Ralphs stechenden Augen lag Geiz und Hinterlist, während aus Nikolas’ leuchtendem Blick, Verstand und Mut sprach. Die Gestalt des jungen Mannes war eher schmächtig, aber männlich und wohl gebaut, und abgesehen von der Frische der Jugend, lag in seiner ganzen Haltung etwas, was den Alten in Schranken hielt.
Wie schreiend auch ein derartiger Gegensatz für den Zuschauer sein mag, so wird er doch nur in seiner ganzen Schärfe und Bitterkeit von dem empfunden, der dabei die Rolle des Tieferstehenden übernehmen muss, und Ralph Nickleby hasste Nikolas von dieser Stunde an.
Der gegenseitigen Besichtigung wurde endlich durch Ralph ein Ende gemacht, der mit der Miene höchster Geringschätzung seine Augen abwandte und Nikolas einen Knaben nannte. Dieser Ausdruck wird von älteren Personen mit Vorliebe gegenüber jüngeren im Tone des Tadels gebraucht, wahrscheinlich in der Absicht, den Leuten glauben zu machen, dass sie um keinen Preis wieder jung werden möchten, selbst wenn sie es könnten.
»Nun, Madam«, begann Ralph ungeduldig, »die Gläubiger haben sich das ihrige geholt, wie Sie mir schrieben, und es ist nichts für Sie übrig geblieben?«
»Nichts«, antwortete Mrs. Nickleby.
»Und Sie haben das bisschen Geld, das sie noch besaßen, auf die weite Reise nach London verwendet, um zu sehen, was ich für Sie tun werde?«
»Ich hoffte«, stotterte Mrs. Nickleby, »dass Sie imstande sein würden, den Kindern Ihres Bruders in ihrem Fortkommen behilflich zu sein. Es war der Wunsch des Sterbenden, dass ich mich an Sie wenden sollte.«
»Ich weiß nicht, wie es kommt«, brummte Ralph und ging im Zimmer auf und ab, »aber immer, wenn jemand stirbt, ohne selbst etwas zu hinterlassen, so scheint er zu glauben, er hätte ein Recht, über das Vermögen anderer Leute zu verfügen. – Was hat Ihre Tochter gelernt, Madam?«
»Kate ist gut erzogen«, schluchzte Mrs. Nickleby. »Sag deinem Onkel, mein Kind, wie weit du im Französischen und den anderen Lehrgegenständen gekommen bist.«
Das arme Mädchen schickte sich an, einige Worte hervorzustottern, aber ihr Onkel fiel ihr unhöflich in die Rede.
»Wir müssen versuchen, dich als Hilfslehrerin in einer Klosterschule unterzubringen. Du bist doch hoffentlich nicht zu vornehm dafür?«
»Nein, nein, gewiss nicht, Onkel«, schluchzte das Mädchen, »ich will ja alles tun, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen.«
»Nun, nun«, lenkte Ralph ein, vielleicht durch die Schönheit, vielleicht auch durch den Jammer seiner Nichte ein wenig besänftigt, »du musst es eben versuchen, und wenn es dir zu hart ankommt, so geht’s vielleicht mit der Kleidernäherei oder mit dem Stickrahmen. – Und hast du je etwas gearbeitet, Musjö?«, fuhr er seinen Neffen an.
»Nein«, erwiderte Nikolas unbefangen.
»Das hätte ich mir denken können. Das ist also die Art, wie mein Bruder seine Kinder erzogen hat, Madam?«
»Mein armer Mann hat Nikolas so weit herangebildet, als er es selbst vermochte«, versetzte die Witwe, »und er dachte eben …«
»In Zukunft etwas aus ihm zu machen«, fiel Ralph ein. »Die alte Geschichte. Immer denken und nie handeln. Wäre mein Bruder ein tätiger und kluger Mann gewesen, so würde er Ihnen ein schönes Vermögen hinterlassen haben, Madam, und hätte seinen Sohn in die Welt hinausgeschickt, wie es mein Vater mit mir machte, als ich noch anderthalb Jahre jünger als dieser Bursche war. Dann würde er jetzt in der Lage sein, Sie zu unterstützen, statt Ihnen zur Last zu fallen und Ihre traurige Lage noch zu verschlimmern. Mein Bruder war eben ein unüberlegter, gedankenloser Mensch, Madam, und gewiss kann das niemand mehr fühlen als Sie selbst.«
Diese Bemerkung erweckte in der sonst guten, aber äußerst schwachen Frau den Gedanken, dass sie vielleicht mit ihren tausend Pfund doch am Ende eine bessere Partie hätte machen können. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf und begann, im Übermaß ihres Schmerzes, ihr hartes Los zu beklagen. Unter vielem Schluchzen erzählte sie, dass sie von ihrem armen Gatten in wahrhaft sklavischer Abhängigkeit erhalten worden sei und ihm oft gesagt habe, wie viele bessere Partien sie hätte machen können. Auch habe sie die ganze Zeit über nie gewusst, wo das Geld hinkäme, und es wäre wohl alles weit besser gegangen, wenn er mehr Vertrauen in sie gesetzt hätte, und was dergleichen bittere Erinnerungen mehr sind, die man gewöhnlich bei verheirateten Frauen während ihres Ehestandes oder nachher zu hören bekommt.
Sie schloss mit der Klage, dass der teuere Verblichene sich von ihr nie habe raten lassen, ein einziges Mal ausgenommen – was auch in der Tat vollkommen der Wahrheit entsprach, denn das war damals gewesen, als der Grundstein zu seinem finanziellen Zusammenbruch gelegt wurde.
Mr. Nickleby hörte all das mit einem halben Lächeln an, und als die Witwe mit ihren Wehklagen endlich fertig war, nahm er das unterbrochene Thema genau da wieder auf, wo er durch den Herzenserguss seiner Schwägerin unterbrochen worden war.
»Hast du Lust zu arbeiten, Musjö?«, wendete er sich an seinen Neffen.
»Das versteht sich von selbst«, sagte Nikolas stolz.
»Dann sieh her. Diese Notiz fiel mir heute Morgen ins Auge, und du kannst Gott dafür danken.«
Nach dieser Einleitung zog Mr. Ralph ein Zeitungsblatt aus der Tasche, suchte eine Weile unter den Anzeigen herum und las dann laut vor:
»Erziehungsanstalt. – In Mr. Wackford Squeers’ Erziehungsheim, Dotheboys Hall, bei dem anmutigen Dorfe Dotheboys gelegen, in der Nähe von Greta-Bridge in Yorkshire, werden Knaben beköstigt, gekleidet, mit Büchern, Taschengeld und allem Erforderlichen versehen und erhalten Unterricht in allen Sprachen – lebenden wie toten – in Mathematik, Orthografie, Geometrie, Astronomie, Trigonometrie, Geografie, Algebra, ferner im Fechten (wenn es verlangt wird), Schreiben, Rechnen, in der Fortifikationslehre sowie jedem Zweige der klassischen Literatur. Pensionsgeld zwanzig Guineen jährlich, keine Extraanforderungen, keine Vakanzen und unvergleichlich gute Kost. Mr. Squeers hält sich gegenwärtig in London auf und ist täglich von ein bis vier Uhr im Mohrenkopf in Snow Hill zu sprechen. – N.B. Es wird ein fähiger Hilfslehrer gesucht. Jährliches Gehalt fünf Pfund. Ein Magister der freien Künste erhält den Vorzug.
So«, schloss Mr. Ralph Nickleby und steckte die Zeitung wieder ein. »Erhältst du diese Stelle, so ist dein Glück gemacht.«
»Aber er ist nicht Magister der freien Künste«, wendete Mrs. Nickleby ein.
»Das wird sich, glaube ich, machen lassen«, entgegnete Ralph.
»Aber das Gehalt ist so gering und die Entfernung gar so groß, Onkel«, jammerte Kate.
»Still, mein Kind«, verwies die Mutter, »dein Onkel muss das am besten verstehen.«
»Ich sage es noch einmal«, bemerkte Ralph mit Schärfe, »bekommt er die Stelle, so ist sein Glück gemacht. Behagt sie ihm nicht, so mag er selbst für eine andere sorgen. Wenn er aber ohne Freunde, ohne Geld, ohne Empfehlung und ohne jede Geschäftskenntnis eine ehrliche Beschäftigung in London finden kann, mit der er sich auch nur die Schuhsohlen verdient, so will ich ihm tausend Pfund geben.
Das heißt«, unterbrach er sich, »ich würde sie ihm geben, wenn ich sie hätte.«
»Armer, armer Bruder«, seufzte Kate. »Ach Onkel, müssen wir uns denn schon so bald trennen?«
»Belästige deinen Onkel nicht mit Fragen, wo er doch nur für unser Wohl bedacht ist, mein liebes Kind«, tadelte Mrs. Nickleby. »Lieber Nikolas, weißt du denn gar nichts darauf zu sagen?«
»Doch, doch, Mutter«, raffte sich Nikolas auf, der bisher schweigend und in Gedanken versunken dagesessen hatte. »Wenn ich so glücklich bin, die Stelle zu erhalten, für die ich mich so wenig geeignet fühle, was wird aber aus denen werden, die ich hier zurücklasse?«
»In diesem Fall, aber auch nur in diesem Fall, will ich für deine Mutter und deine Schwester sorgen«, versetzte Ralph, »und ihnen eine Position schaffen, in der sie unabhängig leben können. Es wird dann meine Sorge sein, dass sie keine Woche nach deiner Abreise in ihrer gegenwärtigen Lage bleiben.«
»Dann«, rief Nikolas, sprang freudig auf und ergriff die Hand seines Onkels, »dann bin ich bereit, alles zu tun, was Sie von mir wünschen. Wir wollen unverzüglich unser Glück bei Mr. Squeers versuchen. Höchstens kann er mir eine abschlägige Antwort geben.«
»Das wird er nicht«, brummte Ralph Nickleby. »Er wird dich mit Freuden annehmen, wenn ich dich ihm empfehle. Suche ihm nach Kräften nützlich zu sein, und du wirst dich binnen Kurzem zum Teilhaber an seinem Institut emporschwingen. Du mein Himmel, wenn er dann gar mit Tod abginge, dein Glück wäre auf immer gemacht.«
»Ja, ja, ich sehe schon alles vor mir«, rief der arme Nikolas, ganz hingerissen von jugendlicher Begeisterung. »Oder vielleicht gewinnt mich irgendein junger Aristokrat lieb, der in der Anstalt erzogen wird, bittet mich von seinem Vater, wenn er die Schule verlässt und auf Reisen geht, als Hofmeister aus und verschafft mir nach unserer Zurückkunft vom Festland irgendeine hübsche Anstellung. Was halten Sie davon, Onkel?«
»Hm, höchst wahrscheinlich«, höhnte Ralph.
»Und wer weiß, wenn er kommt, um mich zu Hause zu besuchen, was er natürlich tun würde, so verliebt er sich in Kate, die mir die Wirtschaft führt, und, und – heiratet sie. Wer weiß, nicht wahr, Onkel?«
»Ja, wer weiß«, brummte Ralph.
»Und wie glücklich würden wir sein!«, rief Nikolas begeistert. »Was ist der Schmerz der Trennung gegen die Freude des Wiedersehens. Ich werde stolz darauf sein, Kate eine schöne Frau nennen zu hören, und wie glücklich wird dann erst die Mutter sein, wenn wir wieder alle beisammen sind und diese traurigen Zeiten vergessen sein werden, und dann …«
Die Farben dieses Zukunftsbildes waren zu strahlend, um nicht zu blenden, und Nikolas, der ganz überwältigt war, lächelte leise und brach dann in Tränen aus.
Die einfache Familie, die in ihrer Zurückgezogenheit nicht von dem kennengelernt hatte, was man konventionell »Welt« nennt und was eigentlich so viel bedeutet wie Schurkerei, ließ ihren Tränen bei dem Gedanken an die Trennung freien Lauf.
Als der erste Gefühlsausbruch vorüber war, fuhren sie mit der Schwungkraft noch nie enttäuschter Hoffnung fort, sich die Zukunft aufs Glänzendste auszumalen, bis Mr. Ralph Nickleby einwendete, dass leicht ein glücklicher Bewerber Nikolas des Glückes berauben könne, das die Zeitung in Aussicht stellte, was so viel hieße, wie alle Luftschlösser mit einem Schlage zerstören, wenn man länger warte.
Dies steckte der Unterhaltung ein Ziel, und nachdem Nikolas die Adresse Mr. Squeers’ sorgfältig notiert hatte, schickte er sich mit seinem Onkel an, den Herrn aufzusuchen. Er hatte jetzt die feste Überzeugung, Ralph sehr unrecht getan zu haben, als er bei der ersten Begegnung einen solchen Widerwillen gegen ihn gefasst hatte, und Mrs. Nickleby gab sich nicht wenig Mühe, ihre Tochter zu belehren, welch wohlwollender menschenfreundlicher Herr der Onkel wäre.
Den Appell ihres Schwagers an ihre Einsicht, und das darin fein eingewickelte Kompliment für ihre hohen Verdienste, hatte nicht wenig zur Bildung dieser Ansicht beigetragen, und wenn auch die gute Frau ihren Mann zärtlich geliebt hatte und in ihre Kinder sozusagen vernarrt war, so hatte doch Ralph Nickleby, mit den Schwächen des menschlichen Herzens aufs Innigste vertraut, wenn ihm auch die schöneren Seiten desselben fremd geblieben, eine jener kleinen misstönenden Saiten mit so günstigem Erfolge berührt, dass sie sich allen Ernstes für das beklagenswerte, duldende Opfer der Unklugheit ihres verblichenen Gatten zu betrachten begann.
4. Kapitel
Nikolas und sein Onkel machen, um das Glück heim Schopf zu fassen, hei Mr. Wackford Squeers ihre Aufwartung
Snow Hill! Was für eine Art von Ort mag sich wohl der ruhige Städter unter Snow Hill denken, wenn er dieses Wort mit der vollen Deutlichkeit goldener Buchstaben auf den Landkutschen, die aus dem Norden kommen, liest? Man pflegt sich im Allgemeinen stets einen unbestimmten Begriff von einem Orte zu machen, dessen Namen man oft sieht oder hört; und welche Unzahl von falschen Vorstellungen mögen sich wohl schon an dieses Snow Hill gekettet haben? Es ist ein so vielsagender Name. Snow Hill! Und Snow Hill noch dazu in Verbindung mit einem »Mohrenkopf«!
Und wie verhält sich in Wirklichkeit die Sache? Der Weg führt uns in den Mittelpunkt von London, so recht in das Herz seines geschäftigsten Treibens, in den Wirbel des Lärms und des Verkehrs. Dort, gleichsam um die gewaltigen Ströme des Lebens zu hemmen, die von allen Seiten ohne Unterlass herbeifließen und sich unter seinen Mauern begegnen, steht Newgate.
In der gedrängt vollen Straße, auf die dieses Gebäude düster zürnend herunterblickt, wenige Fuß von den schmutzigen einsinkenden Häusern auf derselben Stelle, wo die Garköche, Fischhändler und Obstverkäufer ihr Gewerbe treiben, sind einst Hunderte von menschlichen Wesen, oft sechs bis acht kräftige Männer auf einmal, unter einem Gebrüll von Stimmen, gegen das sogar der Tumult einer großen Stadt als nichts erscheint, schnell und gewaltsam unter dem fürchterlichen Zudrang von Menschenmassen aus der Welt geschafft worden. Neugierige Augen blickten dann aus allen Fenstern, von allen Dachgiebeln, Mauern und Pfeilern, und wenn dann der zum Beil verurteilte Elende sich mit dem alles umfassenden Blick der Todesangst unter der Masse von weißen, aufwärts gerichteten Gesichtern umsah, so erblickte er auch nicht eines, das den Ausdruck von Mitleid oder Teilnahme getragen hätte.
In der Nähe des Gefängnisses und daher auch in der Nähe von Smithfield, dem Schuldturme, und dem Lärm der City, gerade an einer Stelle von Snow Hill, wo die nach Osten gehenden Omnibuspferde allen Ernstes daran denken, absichtlich zu fallen, und die westwärts ziehenden Fiakergäule zufällig stürzen, befindet sich der Wagenschuppen des Wirtshauses zum Mohrenkopf, dessen Portal durch die Büsten von zwei Mohren behütet wird.
Es war ehedem der Stolz und Ruhm der geistvollen Londoner Jugend, diese beiden Wächter herunterzustoßen, aber schon seit einiger Zeit befinden sie sich in ungestörter Ruhe. Vielleicht weil diese Art von Scherz sich nunmehr auf den St. James Sprengel beschränkt, wo man sich mit leichter tragbaren Türklopfern zu schaffen macht und Klingeldrähte für geeignetes Spielzeug hält.
Mag nun dies der Grund sein oder nicht, genug, sie sind da, zürnend von beiden Seiten des Torwegs herabstierend, und das Wirtshaus selbst, das mit einem weiteren Mohrenkopf geziert ist, blickt finster aus dem Hintergründe des Hofes hervor, während sich über der Türe des hinteren Schuppens, in dem die roten Postkutschen stehen, ein kleiner Mohrenkopf befindet, der dem vor dem Hauptportal stehenden sprechend ähnlich sieht, wie denn auch das ganze Äußere des Gebäudes mit seiner Säulenordnung dem sarazenischen Geschmack angepasst zu sein scheint.
Geradeaus nach vorn zu ging ein hohes Fenster, über dem das Wort »Kaffeezimmer« gemalt war. Wer da zu rechter Zeit kam, konnte durch dieses Fenster Mr. Wackford Squeers mit den Händen in den Rocktaschen auf und abgehen sehen.
Mr. Squeers’ Äußeres war nicht besonders ansprechend. Er besaß nur ein Auge, während man doch im Allgemeinen das Vorurteil hegt, der Mensch müsse zwei haben. Aber dieses eine kam ihm ohne Zweifel sehr zustatten, wenn es ihm auch nicht sonderlich zur Zierde gereichte, denn es war von grünlich grauer Farbe und glich so ziemlich dem Ventilator einer Haustüre.
Die blinde Seite seines Gesichtes war in unzählige Falten und Runzeln gelegt, und das gab dem Mann, besonders wenn er lächelte, einen umso hässlicheren Ausdruck, als seine Physiognomie sowieso eine nur allzu große Ähnlichkeit mit der eines Gauners hatte. Sein Haar war glänzend und glatt gestrichen, ausgenommen an der niedern sich vordrängenden Stirne, wo es steif in die Höhe gebürstet war. Es war ein Bild, das mit der rauen Stimme und dem unbeholfenen Benehmen Mr. Squeers’ trefflich zusammenstimmte.
Etwa zwei- oder dreiundfünfzig alt, war der Mann nur wenig unter Mittelgröße. Er trug ein weißes Halstuch mit langen Zipfeln sowie einen schwarzen Schulmeisteranzug, doch waren die Ärmel seines Leibrockes viel zu lang und seine Hosen viel zu kurz, sodass es fast aussah, als gehörten die Kleider gar nicht ihm.
Mr. Squeers stand also in einem Verschlage bei einem der Kaffeezimmer-Kamine. Auf einer Eckbank stand ein mit einem vermürbten Strick zusammengebundener Koffer, und auf diesem saß ein winziger Junge. Seine Schnürstiefel und Corduroy-Hosenbeine baumelten in der Luft, und die Schultern bis zu den Ohren emporgezogen und die Hände auf den Knien blickte er von Zeit zu Zeit in augenscheinlicher Furcht und Besorgnis nach dem Schulmeister hin.
»Halb drei«, brummte Mr. Squeers, wandte sich vom Fenster weg und schaute verdrießlich nach der Uhr des Kaffeezimmers. »Es wird heute niemand mehr kommen.«
Durch diese Aussicht sehr misslaunig gestimmt, blickte er sodann nach dem kleinen Jungen, um zu sehen, ob dieser nicht etwas täte, wofür man ihn züchtigen könne. Da aber der Junge zufällig gar nichts tat, so gab er ihm nur eine Ohrfeige und sagte ihm, er solle es nicht wieder tun.





























