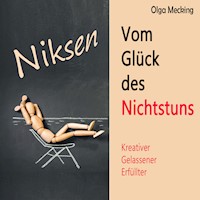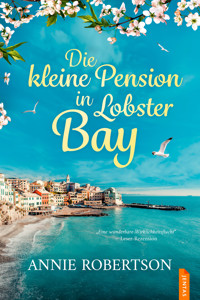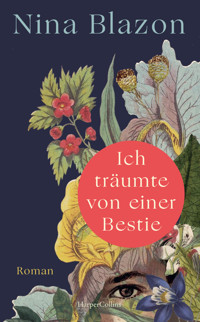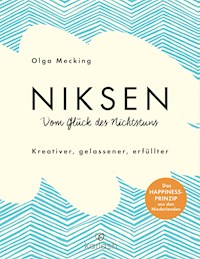
12,99 €
Mehr erfahren.
Einfach mal nichts tun!
Auf der Couch sitzen, aus dem Fenster gucken und die Gedanken frei fliegen lassen – klingt langweilig? Nicht für unser Gehirn: denn Niksen, die holländische Kunst des Nichtstuns, entspannt und macht Studien zufolge kreativ und gesund. Das klingt simpel, aber so einfach ist es nicht: Wir sind gewohnt, uns mit Dopamin-Kicks von außen beliefern zu lassen. Dabei geht das auch ohne Umweg. Während wir faulenzen, beschenkt uns unser Gehirn mit originellen Einfällen, sortiert Erinnerungen und verarbeitet ungestört Gedanken und Emotionen. Eine entspanntes Plädoyer für bewusstes Nichtstun, mit 50 Ideen für Wohlfühlpausen und kreativen Feuerwerken aus dem Off.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Einfach mal auf der Couch sitzen, aus dem Fenster gucken und die Gedanken frei fliegen lassen – klingt langweilig? Nicht für unser Gehirn: denn Niksen, die holländische Kunst des Nichtstuns, entspannt und macht Studien zufolge kreativ und gesund. Ganz so leicht ist das zunächst nicht: Wir sind gewohnt, uns mit Dopamin-Kicks von außen beliefern zu lassen. Dabei geht das auch ohne Umweg. Während wir faulenzen, beschenkt uns unser Gehirn mit kreativen Einfällen, sortiert Erinnerungen und verarbeitet ungestört Gedanken und Emotionen. Ein frisches, smartes und entspanntes Plädoyer mit 50 Ideen zum »Nachniksen« – und kreativen Feuerwerken aus dem Off.
Über die Autorin
Olga Mecking ist Journalistin, Autorin und Übersetzerin. Ihr Artikel über Niksen in der New York Times ging viral und wurde über 100.000-mal geteilt. Seither agiert sie als Niksen-Botschafterin, ist in Blogs zu Gast und gibt Interviews zum Thema. Sie hat Niksen über Jahre intensiv erforscht und praktiziert es selbst regelmäßig und leidenschaftlich. Zusammen mit ihrem deutschen Ehemann wohnt sie in den Niederlanden.
Olga Mecking
Niksen –
Vom Glück des Nichtstuns
Kreativer, gelassener, erfüllter
Aus dem Englischen von Anja Lerz
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing bei Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.
Deutsche Erstausgabe
© 2021 Kailash Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
©Olga Mecking 2020
First published by Kosmos Uitgevers, The Netherlands in 2020
Lektorat: Werner Wahls
Illustrationen: Eva Gans
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
Umschlaggestaltung und Layout: ki 36, Sabine Skrobek Editorial Design, München
ISBN 978-3-641-26454-3V0011
www.kailash-verlag.de
Besuchen Sie den Kailash Verlag im Netz
Inhalt
Einführung: Oh nein, nicht noch ein Wohlfühltrend!
Nicht der Gesundheitsguru, den Sie erwarten
Was war da los?
Überall emsige Menschen
Könnte ich mich irren?
Im Blickpunkt: Meine Vorteile als Außenseiter
Was an Selbstoptimierung problematisch ist
Im Blickpunkt: Ganzheitliche Gesundheitstrends aus aller Welt
Warum nun auch noch Niksen?
Was werden Sie auf diesen Seiten finden?
Nachgenikst
Kapitel 1:Was heißt »Niksen«?
Niksen: Aber wie isst man das denn?
Niksen Niederländer?
Im Blickpunkt: Die Niederländer und das Niksen
Aber wir tun doch ständig irgendwas
Im Blickpunkt: Nichtstun weltweit
Was Niksen nicht ist
Wie wir darüber reden
Eine neue Perspektive
Zum Schluss
Nachgenikst
Kapitel 2:Aber was, wenn die Niederländer es kapiert haben?
Wie ich hier gelandet bin
Kleines Land, große Menschen
Warum die Niederländer so zufrieden sind
Im Blickpunkt: Mein Lieblingsort in den Niederlanden – die Dünen
Glücklich und gesund
Im Blickpunkt: Niederländische Essgewohnheiten
Kulturelle Eigenheiten, die die Niederländer glücklich machen
Im Blickpunkt: Die niederländische Arbeitskultur
Warum niederländische Kinder glücklich sind
Im Blickpunkt: Elternsein in den Niederlanden
Warum niederländische Frauen glücklich sind
Im Blickpunkt: Die sechs Dimensionen der Kultur
Warum die Niederlande perfekt zum Niksen sind
Die Niederländer: Glücklich oder deprimiert?
Zum Schluss
Nachgenikst
Kapitel 3:Warum ist Niksen so schwer?
Im Blickpunkt: Timothy Wilsons »schockierende« Studie
Woher diese Betriebsamkeit?
Geburt einer neuen Branche
Betriebsamkeit als alternatives Statussymbol
Der veränderte Charakter der Arbeit
Im Blickpunkt: Niksen, Männer und Frauen
Technologie
Veränderte Erwartungen
Zur Betriebsamkeit geboren?
Oder sind wir vielleicht auch zum Niksen geboren?
Heimliches Vergnügen
Was macht diese Betriebsamkeit mit uns?
Die gute Seite der Betriebsamkeit
Zum Schluss
Nachgenikst
Kapitel 4:Niksen ist gut für Sie. Ehrlich.
Der Einfluss des Niksens auf Körper und Gehirn
Produktivität neu definieren
Im Blickpunkt: Prokrastinieren
Niksen und Kreativität: Warum wir die besten Ideen unter der Dusche haben
Im Blickpunkt: John Cleese von Monty Python über Kreativität
Durch Niksen bessere Entscheidungen fällen
Zum Schluss
Nachgenikst
Kapitel 5:Das Leben aufniksen
Niksen am Arbeitsplatz
Niksen zu Hause
Im Blickpunkt: Arbeitsteilung
Niksen in der Öffentlichkeit
Im Blickpunkt: Zwei Arten zu niksen
Zum Schluss
Nachgenikst
Kapitel 6:Wenn es mit dem Niksen nicht klappt
Warum Niksen nicht für alle funktioniert
Warum Kultur wichtig ist
Verschiedene Wege für unterschiedliche Leute
Nicht niksen, wenn …
Im Blickpunkt: Flow-Erfahrungen
Was können Sie stattdessen tun?
Wie man sein Gehirn zum Niksen trickst
Zum Schluss
Nachgenikst
Epilog:
Nikstopia erschaffen
Was die Zukunft wohl bringt? Roboter, Stress und mehr Betriebsamkeit!
Was wäre, wenn …?
Eine friedlichere Welt dank Niksen?
Süßes Nichtstun
Nachgenikst
Dank
Anhang:
Anhang 1: Das Nikseneers-Manifest
Wer sind wir?
Was glauben wir?
Was wollen wir?
Anhang 2: Schnelle Niks-Tipps
Im Beruf
Zu Hause .
In der Öffentlichkeit
Anhang 3: Tipps zum Niksen von den Niederländern
Direkt sein
Die Niks-Zeit anderer tolerieren
Eine Niks-freundliche Umgebung schaffen
Niksen in den Kalender schreiben
Tagsüber nach Niks-Zeiten Ausschau halten
Einfach ganz normal sein
Kritisch sein
Bibliografie
Ich sitze auf dem Sofa und lasse einen typischen Tag in meinem Leben Revue passieren. Jeden Morgen werde ich – genau zur richtigen Zeit – vom Klang fröhlich zwitschernder Vögel geweckt. Bevor ich aufstehe, flüstere ich dem Universum ein Mantra zu, irgendetwas Inspirierendes, so etwas wie »Möge dieser wunderbare Morgen ein Segen sein« oder »Hallo Welt, ich komme!«. Ich bereite mir ein gesundes Frühstück zu und starte in meinen Tag, ich lächle mir zu und bin guter Laune.
Ich bin die perfekte Mutter, eine wundervolle Ehefrau, die fleischgewordene Ruhe. Selbstverständlich ist mein Haus blitzsauber. Wenn meine Kinder traurig sind, sage ich immer das Richtige, ich schreie nie, bin nie ungeduldig. Meine Kinder erledigen ihre Aufgaben im Haushalt, ohne zu maulen, und bleiben den ganzen Tag über ruhig und gefasst. Mühelos gleite ich durch den Tag, während sich mein Haushalt um mich herum wie von selbst erledigt. Abends gehe ich mit dem Gefühl ins Bett, die Welt im Großen wie im Kleinen ein wenig verändert zu haben.
So war mein Leben nicht immer. Es gab Zeiten, in denen ich immer müde war. Ich dachte, ich würde das alles nie schaffen, und fühlte mich wie eine Versagerin. Ich war mir sicher, dass ich einfach nicht gewinnen konnte. Aber jetzt bin ich stärker und selbstsicherer denn je. Ich gehe mit allem, was mir vor die Füße fällt, souverän und locker um, nie komme ich ins Schwitzen. Heutzutage bewundern mich die anderen und suchen Rat und Inspiration bei mir.
»Wie machst du das nur, Olga?«, fragen sie mich. Ich überlege, ob ich antworten soll, dass ich eben ein Naturtalent bin. Ich wache jeden Morgen perfekt auf, ich kann gar nicht anders! Aber um die Wahrheit zu sagen, habe ich mein Schicksal selbst voll im Griff und bin dank meiner Entdeckung eines großartigen kleinen Geheimnisses die beste Person geworden, die ich sein kann. »Welches Geheimnis?«, fragen Sie. Niksen oder die niederländische Art, nichts zu tun.
Nicht der Gesundheitsguru, den Sie erwarten
Haben Sie mir das geglaubt? Nein? Gut.
Das mit dem Vogelgezwitscher war das Einzige, was an der Geschichte stimmte. Und selbst das auch nur, weil mein hochgeschätzter Gatte mir aus lauter Mitleid einen Wecker mit Vogelstimmen kaufte, nachdem er lange Jahre mitbekommen musste, wie mich normale Wecker mit einem Schock in den Tag schickten. Und obwohl das auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber, sagen wir einmal, einer Feuerwehrsirene darstellt, sind meine Morgen immer noch traumatisch. Ich habe drei Kinder, die ich vor acht Uhr morgens aus dem Bett und in die Schule bekommen muss, vorzugsweise gefüttert, gewaschen und angezogen. Wenn der Schulbus abfährt, hängt meine geistige Gesundheit schon am seidenen Faden. Aber das ist nur der Anfang; während meine Kinder in der Schule sind, finde ich kaum einen Moment Zeit für mich.
Da sind schließlich meine Kinder, unser Zuhause, die Arbeit, mein Mann – der lange arbeitet – und unsere Familie und Freunde: Ich versuche, mich an das letzte Mal zu erinnern, als ich ganz und gar nichts gemacht habe. Ich komme einfach nicht drauf.
Dabei war ich früher so gut darin, nichts zu tun. Als ich klein war, saß ich oft auf meinem Bett oder im Lieblingssessel meines Vaters und betrachtete das Muster auf dem Teppich oder schaute aus dem Fenster und dachte an absolut gar nichts. Manchmal fragten mich meine Eltern, was ich machte, und schickten mich an meine Hausaufgaben oder gaben mir eine Aufgabe im Haushalt, aber ich hatte reichlich Zeit zum Tagträumen. Und das fühlte sich so gut an.
Aber heute? Als Mutter dreier Kinder, Ehefrau, Autorin und Unternehmerin fühle ich mich immer gehetzt und unter Zeitdruck. Manchmal kommt es mir vor, als schriebe ich mit der einen Hand, kümmerte mich mit der anderen um meine Kinder, bereitete das Abendessen mit meinem linken Bein zu und putzte mit dem rechten das Haus.
Natürlich ist mir bewusst, dass ich mir das so ausgesucht habe. Ich wollte dieses Leben. Aber mir das einzugestehen macht es nicht einfacher. Ich bin, wie so viele andere auch, einfach so … dermaßen … beschäftigt.
Das letzte Mal, dass ich auf meinem Sofa saß und einfach nichts tat, war, als ich tatsächlich darauf zusammenbrach. Es war am Ende des Schuljahrs, und ich litt unter Schlafmangel, war erschöpft und einfach nicht mehr in der Lage zu funktionieren. Ich fühlte mich nur noch dazu imstande, auf der Couch zu liegen und vor mich hin zu starren. So fand mich dann auch mein Mann vor, als er von der Arbeit nach Hause kam.
Damals kam es mir nicht in den Sinn, dass ein Zusammenbruch wie dieser die einzige gesellschaftlich akzeptierte Art des Nichtstuns ist. »Die Verlockung einer Krankheit besteht darin, dass sie eines der größten Laster unserer Gesellschaft zu rechtfertigen vermag: das Nichtstun.«, schreiben die Organisationstheoretiker Carl Cederström und André Spicer in »Das Wellness-Syndrom« (Berlin 2016, S. 155).
Was war da los?
Irgendetwas war da los. Was es auch sein mochte, es gefiel mir nicht, überhaupt nicht. Ich war sehr müde und fühlte mich überfordert, wusste aber nicht, wie ich damit umgehen sollte. In all den Jahren, in denen ich über das Elternsein schrieb, war mir aufgefallen, welch große Rolle Stress im Leben vieler Menschen spielte und dass viele ebenso überfordert waren wie ich. Aber erst durch einen kleinen Artikel in einer unbekannten Zeitschrift kam ich darauf, dass dies symptomatisch für ein sehr viel größeres Problem war, das nicht nur Eltern betraf.
Vor zwei Jahren veröffentlichte Gebke Verhoeven einen Artikel mit dem Titel »Niksen ist die neue Achtsamkeit« in der niederländischen Zeitschrift gezondNU. Der Gedanke gefiel mir überaus gut, und ich weiß noch, wie ich dachte: »Schön, endlich sagt mir mal jemand, dass es okay ist, nichts zu tun. Mit diesem ›Wohlfühltrend‹ kann ich etwas anfangen.«
Aber unmittelbar danach dachte ich: Wie soll ich denn bitte schön, nichts tun? Jedes Mal, wenn ich mir erlaube, mich hinzusetzen, fängt mein Haus an, mit mir zu sprechen. »Nimm mich, nimm mich, nimm mich«, flüstert mir die Wäsche ganz und gar unsexy zu. Habe ich eigentlich die Kinder ermahnt, sich an ihre Hausaufgaben zu setzen?, fragt mich mein Gewissen. Und wenn ich mich umschaue, sehe ich Bücher auf dem Boden und schmutziges Geschirr in der Küche. Ich weiß, dass nichts mehr zu essen im Haus ist, und habe keine Ahnung, was ich zum Abendessen kochen soll. Wie kann ich nur einfach auf dem Sofa sitzen, wenn ich den inneren Drang verspüre, aufzustehen und mich um das Haus und um alle, die darin wohnen, zu kümmern (außer um mich, natürlich)? Andauernd ergeben sich neue Aufgaben. Wenn ich mich hinsetzen will, wird garantiert eins der Kinder krank, oder ich muss irgendeinen Termin vereinbaren, oder mir fällt sonst eine dringende Erledigung ein. Wie soll ich da nur die Zeit für dieses Niksen finden?
Doch nach der Lektüre des Artikels wuchs meine Neugier. Was war das denn eigentlich, was die Niederländer Niksen nennen? Und warum konnte ich das nicht besser? Ich begann, ausführlich über »Niksen« zu recherchieren, und entdeckte, dass einfaches Nichtstun unglaublich förderlich sein kann, besonders für diejenigen, die sich wie ich von ihren Pflichten überfordert fühlen. Es lohnt sich wirklich, dieses Nichtstun oder Niksen in die Tat umzusetzen.
Meine Neugier und meine Rechercheergebnisse schlugen sich in einigen Artikeln nieder. Dann brachte im Mai 2019 die New York Times meinen Artikel »The Case for Doing Nothing« (etwa: Ein Plädoyer für das Nichtstun). Wenige Tage später wurde der Artikel im Internet fast 150 000 Mal retweeted, geteilt und per E-Mail verschickt. Im Juli war Niksen in aller Munde. Es wurde überdeutlich, dass ich einen Nerv getroffen hatte.
Alle wollten mehr über das Niksen wissen, und Medien aus aller Welt schickten mir E-Mails und Interviewanfragen. Literaturagenturen und Verlage wollten mich vertreten. Ich wäre bereit gewesen, das Ganze als viel Lärm um nichts (wortwörtlich!) abzutun, aber irgendetwas an der Thematik schien Leute von überall her anzusprechen.
Ich sammelte und analysierte die Rückmeldungen auf Niksen und kam zu dem Schluss, dass die Menschen ganzheitliche Gesundheitstrends satthatten, die ihnen sagten, sie täten noch nicht genug und sollten sich noch mehr um ihre Selbstoptimierung kümmern. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum sie mit dem Konzept etwas anfangen können. Es handelt sich um die einfachste Form der Selbstfürsorge, also sich selbst etwas Gutes zu tun, die man sich vorstellen kann.
Aber noch etwas anderes fiel mir auf: Wir wissen einfach nicht, wie man das macht. Nichtstun mag einfach klingen, ist es aber überhaupt nicht. Hätte ich für jedes Mal, wenn mich jemand fragte, wie man »mehr nichts tut«, einen Cent bekommen, wäre ich inzwischen wohl Millionärin. Mir wurde klar, dass die meisten lernen müssen, wie man aufhört, ständig so geschäftig zu sein. Ich habe dieses Buch in der Hoffnung geschrieben, Aufschluss darüber zu geben, wie man nichts tut, damit überall auf der Welt Menschen begreifen, dass es in Ordnung ist, auf dem Sofa sitzend eine Runde niks zu tun.
Überall emsige Menschen
Wir sind beschäftigt und im Stress, so sieht’s aus. Die Geschäftigkeit unseres Alltags strapaziert uns, macht uns atemlos, gehetzt und besorgt. Verzweifelt suchen wir überall nach Antworten, nach einer Lösung, immer in der Hoffnung, das nächste Buch oder der nächste Artikel würde uns dabei helfen, uns zu beruhigen oder endlich unseren Erwartungen und Verpflichtungen gerecht zu werden.
Laut einer Gallup-Umfrage (150 000 Befragte aus aller Welt) aus dem Jahr 2019 sind Amerikanerinnen und Amerikaner besonders gestresst. In der Umfrage – bei der es darum ging, Emotionen weltweit besser einordnen zu können – wurden sowohl zu positiven Erfahrungen (mit Fragen wie: Haben Sie gestern viel gelächelt? Wurden Sie gestern den ganzen Tag lang respektvoll behandelt?) als auch zu negativen (Haben Sie gestern Schmerz, Traurigkeit, Sorge oder Wut empfunden?) Daten erhoben.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner waren nicht nur gestresster als die Menschen aus anderen Ländern, sie waren überdies wütender, gestresster und besorgter als noch ein Jahrzehnt zuvor. Zur Altersgruppe der Unter-50-Jährigen zu gehören, über ein niedriges Einkommen zu verfügen und kein Fan von Präsident Trump zu sein waren der Studie zufolge Faktoren, die mit Schwierigkeiten der psychischen Gesundheit in Zusammenhang standen. Global betrachtet waren die negativen Gefühle vergleichbar mit dem Stand von 2017, dem Jahr mit den bislang deprimierendsten Ergebnissen.
In einem Online-Artikel in Psychology Today erklärt die Psychologin Jean M. Twenge, dass es eine deutlich höhere Zahl psychosomatischer Symptome gibt, obwohl die meisten Menschen nicht sagen würden, sie seien deprimiert oder litten unter Depressionen. »Die Wahrscheinlichkeit, dass Studierende am College sagten, sie fühlten sich überfordert, war um 50 Prozent gestiegen. Außerdem äußerten mehr Erwachsene, dass sie unruhig schliefen, unter Appetitmangel litten und alles mit Anstrengung verbunden sei – sämtlich klassische psychosomatische Symptome einer Depression. Fragte man jedoch direkt, ob sie sich ›deprimiert fühlten‹, hatte sich die Antwort im Vergleich zu den 1980er- oder den 2010er-Jahren nicht erheblich geändert.«
Twenge wurde vor allem mit einem Artikel in The Atlantic bekannt, der auch viral ging; in ihm erörterte sie, dass Smartphones für die Depressionsepidemie unter Teenagern verantwortlich seien. Laut Twenge hängt der Anstieg der Depressionen damit zusammen, dass unsere Beziehungen und unsere gesellschaftlichen Bindungen schwächer sind und wir uns immer mehr auf greifbare, aber materielle Ziele wie Geld fokussieren, sowie mit unseren ständig steigenden Erwartungen. Angesichts all dieser Erwartungen und Ziele kann man sich ja denken, dass die Menschen wohl kaum »viel niks« machen.
In Großbritannien sieht die Situation nicht viel besser aus. YouGov, ein global arbeitendes Meinungsforschungsinstitut, untersuchte dort die Stresslevels und entdeckte, dass 74 Prozent der britischen Bevölkerung 2017 so gestresst waren, dass sie mit der Überforderung nicht mehr zurechtkamen. Beinahe die Hälfte der Befragten gab an, der Stress trage zu ungesunden Essgewohnheiten bei, ein Drittel gestand vermehrten Alkoholkonsum ein, und 16 Prozent sagten, sie würden stressbedingt mehr rauchen. Fast die Hälfte der Befragten fühlte sich deprimiert, und zwei Drittel waren besorgt bis hin zur Angststörung. Besonders besorgniserregend ist, dass etwa ein Drittel der Befragten angab, Suizidgedanken zu hegen. Finanzielle Probleme, der gesellschaftliche Erfolgsdruck und den Wohnraum betreffende Sorgen wurden als Hauptgründe für den Stress genannt, dazu kamen gesundheitliche Probleme von Angehörigen. Eine weitere Umfrage der Zeitung The Mirror mit 2000 Teilnehmern zeigte, dass die Hälfte der Briten unter Zeitmangel leidet und die Mehrheit sich »zu gestresst fühlt, um sich zu vergnügen«.
Es ist also kaum verwunderlich, dass ein Artikel über das Nichtstun auf eine so breit gestreute begeisterte Resonanz stößt. Die Einwohner westlicher Länder hungern wahrscheinlich nach einem freien Tag und etwas Ruhe. Vielen würde es guttun, einen Blick in Länder wie die Niederlande zu werfen, wo es reichliche freie Tage, ein gut funktionierendes Sozialversicherungssystem und eine wundervolle »Work-Life-Balance« gibt. In so einem Land hat Niksen, oder die Kunst des Nichtstuns, seinen festen Platz.
Könnte ich mich irren?
Kritische Stimmen, vor allem aus den Niederlanden, warfen mir vor, ich würde mir einen Trend aus den Fingern saugen. Ich wünsche mir wirklich sehr, ich hätte die Durchschlagskraft und die Kreativität, im Alleingang einen weltweiten Trend loszutreten, was aber natürlich nicht der Fall ist. Haben Sie mich mal gesehen? Ich trage jeden Tag Jeans und T-Shirt und habe so rein gar nichts von einer Trendsetterin an mir!
Ich glaube allerdings, dass ich als Außenstehende eine einzigartige und objektive Perspektive auf dieses Land und seine Bräuche beisteuern kann, die ich seit meinem Umzug vor zehn Jahren beobachte. Die Niederländer verfügen natürlich über tiefgreifendes Wissen über ihre eigene Kultur, aber manchmal ist eine Außenseiterposition notwendig, um den Scheinwerfer auf ein Thema zu richten, das den Einheimischen völlig selbstverständlich vorkommt. Inzwischen betrachte ich das Niksen als eins dieser Themen: Es erscheint den Niederländern so normal, dass es ihnen nicht einmal mehr auffällt.
Die Kritik brachte mich jedoch ins Grübeln: Ist Niksen wirklich eine niederländische Angelegenheit? Niederländisch ist nicht meine Muttersprache, und ich wurde auch nicht dort geboren. War es möglich, dass ich die Sache mit dem Niksen ganz falsch verstanden hatte? Eine amerikanische Freundin, die hier mit ihrem niederländischen Ehemann lebt, sagte mir, sie kenne niemanden, der das praktizierte. Doch aller Skepsis zum Trotz wussten meine niederländischen Gesprächspartner alle sofort, was damit gemeint war. Immerhin leuchtet den Niederländern das Konzept ein, auch wenn einige behaupten, sie würden es nicht praktizieren.
Als Schriftstellerin und Journalistin bin ich eine aufmerksame Beobachterin dieses Landes und seiner Bewohner. Ich kann Ihnen versichern, dass Niksen zumindest ein niederländisches Wort ist, und Worte tauchen in der Regel nicht einfach so auf. Meistens ist irgendein Konzept oder eine Philosophie damit verbunden. Die Bedeutung des Wortes ist in den Niederlanden unstrittig. Gleichzeitig sehe ich, dass die Niederländer sich mit dem Niksen ebenso schwertun wie wir anderen auch. Und das finde ich sehr erfrischend.
Ob nun bewusst oder unbewusst, jedenfalls haben die Niederländer die idealen Voraussetzungen für das Niksen geschaffen, sodass es hier leichter als in anderen Ländern und Kulturen angenommen wird. Doch am liebsten mag ich am Niksen, dass es zwar ein niederländisches Wort ist, deshalb aber nicht den Niederlanden gehört. Vielmehr ist es sogar so, dass es in vielen Kulturen eine Vorstellung vom Nichtstun gibt – das werden Sie gleich erkennen.
Meine Vorteile als Außenseiterin
Ich wurde in Polen in eine multikulturelle, mehrsprachige Familie hineingeboren und wohne inzwischen seit zehn Jahren in den Niederlanden. Aufgewachsen bin ich in Deutschland, wo auch mein Ehemann herkommt, und ich habe Verbindungen nach Frankreich und in die Niederlande, wo mein Vater seine ganze und meine Mutter einen Teil ihrer Kindheit verbrachte. Meine Großmutter mütterlicherseits war Ukrainerin, und jüdische Wurzeln habe ich auch.
Nicht immer wissen die Menschen, was sie mit mir anfangen sollen. Mir kommt vor, als werde ich immer wieder gefragt: »Was bist du?«, oder: »Wie sollen wir dich denn einordnen? Was sollen wir mit dir anfangen?«
Wohin ich auch gehe, ich bin eine Außenseiterin. Das ist nicht immer leicht. Schließlich wollen wir alle irgendwo dazugehören.
Dennoch hat es auch seine Vorzüge, Außenseiterin zu sein. Wer wüsste das besser als die Künstlerin und Autorin Jenny Odell, die selbst einen gemischten Hintergrund hat. »Außenseiterin zu sein kann sehr hilfreich dabei sein, neue Sichtweisen auf das vermeintlich Bekannte zu finden«, verriet sie mir in einer E-Mail. Dem kann ich nur beipflichten.
»So unangenehm es auch gewesen sein mag, nicht in eine bestimmte Kategorie hineinzupassen, eröffnen sich mir durch diese Eigenschaft doch Wege, solche Kategorien nicht nur von außen zu untersuchen, sondern auch Verbindungen zwischen ihnen zu entdecken, die mir sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wären«, schrieb sie.
Eine Studie von Hajo Adam zeigte, dass ein Umzug ins Ausland Menschen paradoxerweise dazu verhilft, ein besseres Gefühl ihrer selbst zu entwickeln. Adam nennt das »Klarheit im Selbstkonzept« und definiert dies gemessen daran, inwiefern das Selbstverständnis einer Person »klar und selbstbewusst definiert, in sich beständig und vorläufig stabil ist«.
Und in »Es lebe der Generalist!: Warum gerade sie in einer spezialisierten Welt erfolgreicher sind« spricht sich der renommierte Autor David Epstein dafür aus, dass gerade der breite Horizont vieler Expats sie so erfolgreich macht.
Anstatt sich wie Einheimische tief in eine Materie einzuarbeiten, sammelt eine Außenseiterin oder ein Außenseiter eine Vielzahl Erfahrungen. Viele finden ihre Berufswege erst spät im Leben und nehmen bis dahin einige Umwege in Kauf – und das sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Sie lassen sich in ihrer Arbeit und in ihrem Leben auf Experimente ein.
Für viele Außenseiterinnen und Außenseiter stellt sich der Erfolg nicht trotz, sondern gerade aufgrund ihrer einzigartigen Sichtweise und Erfahrung ein.
Was an Selbstoptimierung problematisch ist
Ehe wir fortfahren, möchte ich eins klarstellen: Ich bin kein Gesundheitsguru, und dies ist kein gewöhnliches Achtsamkeitsbuch. Eigentlich bin ich genauso wie viele von Ihnen (vielleicht ein bisschen kleiner, knapp 1,60 Meter groß, was in jedem Falle eher als klein und in den Niederlanden geradezu als winzig gilt).
Und so überzeugt ich vom Niksen auch bin, stand ich der Vorstellung, dem bereits überquellenden Ratgeberregal selbst etwas beizusteuern und ein Buch zu diesem Thema zu schreiben, doch eher skeptisch gegenüber.
Meine Recherchen der letzten Jahre haben mich jedoch davon überzeugt, dass es tatsächlich unbedingt notwendig ist. Die meisten sollten ein wenig mehr niksen, und überraschend wenige wissen, wie man seine Pflichten ruhen lässt und genau das tut. Ich möchte zwar nicht behaupten, ich sei eine Expertin, habe aber für meine Artikel und dieses Buch intensiv über Niksen geforscht.
Trotzdem mache ich mich mit einer gewissen Vorahnung an die Aufgabe, Sie vom Niksen zu überzeugen. Das liegt daran, dass ich gegenüber ganzheitlichen Gesundheitstrends grundsätzlich skeptisch bin. Bisher konnte ich mich, von ein paar Ausnahmen abgesehen, größtenteils von Achtsamkeits- und Selbsthilfebüchern fernhalten. Einem anderen Ratgebergenre allerdings bin ich auf den Leim gegangen: den Elternratgebern. Als ich vor zehn Jahren mein erstes Kind bekam, empfand ich den Druck, eine gute Mutter zu sein, so sehr, dass ich alles dazu las, was mir in die Hände fiel.
Leider gab mir nichts von dem Gelesenen mehr Zutrauen in meine elterlichen Fähigkeiten. Das Gegenteil war der Fall: Ich fühlte mich eher noch schlechter. Elternratgeber und Selbstoptimierungsbücher ähneln sich insofern, als dass sie auf uns einreden, anstatt uns anzusprechen und mit uns zu reden, und das auch noch in einem leicht besorgten, bevormundenden Ton. Die Expertin oder der Experte will Ihnen unweigerlich zeigen, wie falsch Ihre Gewohnheiten bisher sind und wie viel besser Ihr Leben doch wäre, wenn Sie die guten Ratschläge nur annähmen. Es hat ein Weilchen gedauert, bis mir dämmerte, dass die Bücher mich nicht glücklich machten, sondern nur verunsicherten, aber als mir dieses Muster bewusst wurde, hörte ich auf, sie zu lesen – und fühlte mich in Sachen Erziehung prompt kompetenter.
Wie ironisch es ist, in einem Buch über ganzheitliche Gesundheit ebensolche Trends zu kritisieren, ist mir durchaus bewusst, aber das gehört tatsächlich ganz wesentlich zu diesem Buch. Ich glaube, Niksen unterscheidet sich von anderen Selbstoptimierungstrends, und bin überzeugt, dass Sie mir am Ende des Buchs zustimmen werden. Vor allem verlangt Niksen von Ihnen im Gegensatz zu anderen Trends nicht, sich zu verändern oder zu verbessern. Erfrischend, oder?
Sicher werden mir viele zustimmen, dass ganzheitliche Gesundheitstrends schädlich sein können. Wenn wir beispielsweise von Heilkristallen erwarten, dass sie Krebs heilen, oder von »Vaginal Steaming«, also Dampfbädern für die Scheide, dass sie unseren Hormonspiegel ins Gleichgewicht bringen (nicht lachen – das gibt es wirklich. So richtig bekannt gemacht hat es Gwyneth Paltrow), müssen wir uns auf Enttäuschungen und möglicherweise Schmerzen einstellen.
Inzwischen findet man ganzheitliche Gesundheit und Selbstoptimierung ja überall. Wie Carl Cederström und André Spicer in Das Wellness Syndrom (S. 9) sehr richtig schreiben: »Mit anderen Worten, ganzheitliche Gesundheit hat sich in jeden Aspekt unseres Lebens eingeschlichen (…) Sie diktiert die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, studieren und Sex haben.«
Sie vergleichen es mit einer Ideologie, die die Schwachen schädigt: »Wenn Gesundheit zu einer Ideologie wird, wird das Versagen, sich ihr anzuschließen, zum Stigma.« Gleichzeitig wird angenommen, dass »gesunde Körper produktive Körper« sind. Dasselbe gilt für das Glücklichsein. Gesund und glücklich zu sein hat sich zu einer sozialen Verpflichtung entwickelt, weil wir sonst der Gesellschaft zur Last fallen.
Grundsätzlich gelte die Erwartung, wir müssten die Verantwortung für unser Glück übernehmen, sagt Paul Dolan, ein Wirtschaftsprofessor und Autor von Happy Ever After: Escaping The Myth of The Perfect Life.
In Wirklichkeit fehlt unserem Streben nach Glück auch das noch so kleinste bisschen Freude. Es ist Arbeit durch und durch. Dolan erkennt in dieser Haltung ein soziales Narrativ, das »vorschreibt, was Menschen zu wollen, zu denken und zu fühlen haben«. Glücklicher macht uns das nicht. Außerdem glaube ich, dass Wellness in vielen Fällen als Teil einer Bewegung betrachtet werden kann, die uns zunehmend dazu drängt, die Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und nach Alternativen zu konventionellen Behandlungsmethoden zu suchen. Das ist insofern eine durchaus positive Entwicklung, weil wir unbedingt verstehen sollten, welchen Einfluss unsere Entscheidungen den Lebensstil betreffend auf Gesundheit und Wohlbefinden haben. Das jedoch ist mehr als nur unsere Privatangelegenheit. Gesunde Ernährung ist wichtig, aber kein Mittel gegen Krebs. Solide und allen zugängliche Gesundheitsversorgung und soziale Sicherheit sind von grundlegender Wichtigkeit. Liegt der Fokus auf ganzheitlicher Gesundheit, besteht meiner Meinung nach das Risiko, dass die Verantwortung von Institutionen, Behörden und der Gesellschaft im Allgemeinen auf Einzelpersonen abgeschoben wird, die in schweren Zeiten Hilfe und Unterstützung benötigen.
Manche Kritiker stimmen dem zu. In einer in The New Republic erschienenen Rezension zu »Wollen wir ewig leben?: Die Wellness-Epidemie, die Gewissheit des Todes und unsere Illusion von Kontrolle« von Barbara Ehrenreich beschreibt Gabriel Winant Wellness als eine »zwingende und ausbeuterische Verpflichtung: eine Kette endloser medizinischer Untersuchungen, Medikamente, Gesundheitspraktiken und Fitnesstrends, die drohen, zum Lebensinhalt zu werden, anstatt das Leben zu erhalten«.
Zudem fordert ganzheitliche Gesundheit, wir – besonders Frauen – sollten uns ständig verbessern. Wir müssen an uns arbeiten, ob an unserem Verstand, unserem Körper oder unserer Umgebung. Geh ins Fitnessstudio, mach Yoga! Räum das Haus auf! Arbeite härter, denn wenn du das nicht tust, bist du ein Verlierer und ein Aufgeber. »Gerade der Druck, ALLESsein zu müssen, gibt uns das Gefühl, NICHTS zu sein«, sagt Mary Widdicks, eine Psychologin, Autorin und Mutter dreier Kinder, die für renommierte Medien wie die Washington Post schreibt.
Hinzu kommt, dass die meisten Gesundheitstrends uns glauben machen wollen, sie seien die ultimative Lösung für alle. »Wenn man sich in die Schablone eines anderen zwängt, kann das bei der Suche nach tieferen Werten hinderlich sein«, warnt Gretchen Rubin, die in ihren Büchern mit Titeln wie »Das Happiness-Projekt« und »Die 4 Happiness-Typen« regelmäßig über Glück und Produktivität schreibt und diese Themen auch in ihren Podcasts behandelt. Kurz gesagt: Jeder, wie er mag.
Ganzheitliche Wohlfühltrends aus aller Welt
In den letzten Jahren, ja, Jahrzehnten, sind Wohlfühltrends aus aller Welt aufgetaucht und wieder verschwunden, und ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft neue dazukommen werden. Hier sind einige wichtige oder besonders beliebte.
Achtsamkeit
Achtsamkeit, vor allem in Gestalt achtsamer Meditation, gibt es nun schon eine ganze Weile. Ursprünglich stammt das Konzept aus alten buddhistischen Lehren. Weil sie Stress- und Angstsymptome lindert, hat sie inzwischen Eingang in westliches Denken und Lifestyle-Praktiken gefunden. Der Grundgedanke ist, auf seine momentane Gemütsverfassung zu achten und das innere Gleichgewicht wiederherzustellen, indem man sich auf seine Atmung konzentriert und die auftauchenden Gedanken ohne weitere Bewertung oder gar Scham betrachtet. Dies kann beruhigen und zu einer besseren Verbindung zu sich selbst und anderen führen.
Eine ähnliche Philosophie ist die des Zen. Die japanische Autorin Naoko Yamamoto erklärt, dass man sich »beim Praktizieren des Zen auf das Jetzt konzentrieren und sich darum bemühen muss, Vergangenheit und Zukunft zu vergessen«.
Hygge, gezelligheid, koselig, Gemütlichkeit
Vor ein paar Jahren bestand großes Interesse an hygge. Dabei handelt es sich um ein unübersetzbares Wort aus dem Dänischen, das gemeinsame Zeit mit Freunden in einer angenehmen, entspannten Atmosphäre und den Genuss der einfachen Dinge im Leben umschreibt.
Bei Hygge geht es darum, sich in kuscheligen Wollpullovern und in Decken eingemummelt zu Hause vor dem kalten Winter zu verstecken, wobei das traute Heim vorzugsweise mit Möbeln in dänischem Design eingerichtet ist. Das Norwegische koselig ist Hygge dabei sehr ähnlich. Die Website Life in Norway beschreibt diesfolgendermaßen: »Mehr als alles andere ist koselig ein Gefühl: Es umfasst Behaglichkeit, Vertrautheit, Wärme, Glück, Zufriedenheit. Um sich ›koselig‹ zu fühlen, braucht man koselige Dinge. In den dunkleren Monaten werden Kuscheldecken auf die Terrassenstühle von Straßencafés gelegt und Ladeneingänge mit Kerzen beleuchtet.«
Deutsche Leserinnen und Leser erkennen dies alles in ihrem Wort »Gemütlichkeit« wieder, das neben Zufriedenheit und Wärme auch das wohltuende, schöne Gefühl, zu einer Gruppe dazuzugehören, und allgemeines Wohlbefinden umfasst.
KonMari
Als die KonMari-Methode für das Ordnen und Aufräumen beliebt wurde, misteten auf einmal alle aus und fragten sich, ob ihre Habseligkeiten bei ihnen Freude hervorriefen, um sie dann entweder zu behalten oder zu entsorgen.
Beliebt ist die Methode, die sich binnen kürzester Zeit zum Sensationserfolg entwickelte, vor allem wegen der Frau dahinter: Marie Kondō, die »Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert« schrieb. Marie Kondō spricht das Bedürfnis an, sich durch Entrümpeln Leichtigkeit zu verschaffen, und die Sehnsucht nach einem minimalistischeren Lebensstil.
Das schwedische döstädning ist KonMaris etwas morbide Verwandte und bezieht sich darauf, vor seinem eigenen Tod aufzuräumen und zu entrümpeln, damit die Hinterbliebenen sich nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen.
Einige andere trendy Trends
In letzter Zeit schwirren in den Medien vor allem zwei Trends herum: einmal das koreanische Konzept nunchi, bei dem es darum geht, sich auf die Emotionen anderer einzustellen, sowie die japanische Vorstellung des ikigai, eine Herangehensweise, um den Sinn des Lebens zu finden, die auch schon als geheimer Schlüssel zu Glück, Gesundheit und einem langen, erfüllten Leben bezeichnet wurde.
Warum nun auch noch Niksen?
Wenn es schon eine solche Bandbreite an Trends, Philosophien und Schnellschusslösungen gibt, brauchen wir dann wirklich noch einen Hype? Die Frage höre ich in Interviews häufig. Sie überrascht mich nicht. Immerhin klingt Nichtstun nicht gerade nach einer revolutionären Idee. Aber Sie werden entdecken, dass es beim Niksen um weit mehr als nur das Nichtstun geht. Um viel, viel mehr. Heutzutage, wo wir alle so unglaublich hektische Leben führen, ist die Weigerung, wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend zu rennen, wirklich ungewöhnlich. Niksen wird Ihnen helfen, einen Teil der Geschäftigkeit loszulassen, anstatt neue hinzuzufügen.
Betriebsamkeit ist dabei nur ein Teil des Problems. In fast allen Lebensbereichen kommt noch ein immenser, beständiger Leistungsdruck dazu. Wir erwarten von uns, dass wir bei der Arbeit alles geben (niemals Zeit verschwenden und immer noch