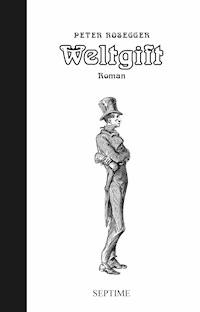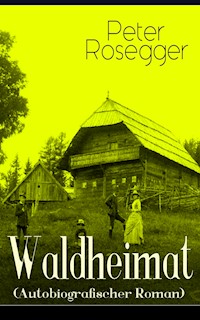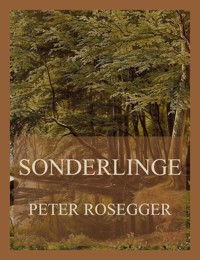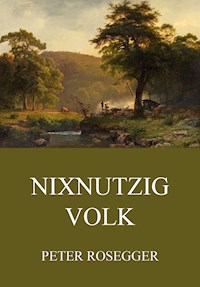
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebevoll erzählt der Walddichter Geschichten aus seiner ländlichen Heimat. Immer lustig, aber auch immer lehrreich. Peter Rosegger war ein österreichischer Schriftsteller und Poet, der 1918 in Krieglach verstorben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nixnutzig Volk
Peter Rosegger
Inhalt:
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Nixnutzig Volk
Vorwort
Batzenlippel. Aus einem Schreibebuch.
Hans Johanns Hauptsache
Der Armeleut-Sucher
Diethelm, der Unnutz
Der Lachenmacher
Die Ja-Sager von Duselbach
Die Tugendhaften
Die Fahnelträgerin
Der Geistbrenner
Der ordentliche Augustin
Das Gericht im Breitschirmhof
Die Lüge der Jungfrau
Der Unkrott und seine Hani
Dämon Weib
Der Urbrandel
Der reiche Freisinger
's ist eine alte Geschichte
Susanna, nit wana!
Der versteigerte Herr Gemahl
Einer, der die Finessen kennt
Wie Einer seine Frau eifersüchtig machte
Ein alter Luderskerl
Winlof, der Schöngeist
Wie er das Gold fand
Der hohe Herr
Ein Theatererfolg
Die Familie Kolbenblutt
Das gelbe Pulver
Ein Tag der Unzukömmlichkeiten
Zum Schlusse wird getanzt
Nixnutzig Volk, P. Rosegger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849653088
www.jazzybee-verlag.de
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Namhafter österr. Volksschriftsteller, geb. 31. Juli 1843 in Alpl bei Krieglach in Obersteiermark als Sohn armer Bauersleute, verstorben am 26. Juni 1918 in Krieglach. Erhielt nur den notdürftigsten Unterricht und kam, weil er für einen Alpenbauer zu schwach war, mit 17 Jahren zu einem Wanderschneider in die Lehre, mit dem er mehrere Jahre lang von Gehöft zu Gehöft zog. Dabei kaufte und las er, von Bildungsdrang getrieben, Bücher, namentlich den »Volkskalender« von A. Silberstein, dessen Dorfgeschichten ihn so lebhaft anregten, daß er selbst allerlei Gedichte und Geschichten zu schreiben anfing. Durch Vermittelung des Redakteurs der Grazer »Tagespost«, Svoboda, dem R. einige Proben seines Talents zusandte, ward ihm endlich 1865 der Besuch der Grazer Handelsakademie ermöglicht, an der er bis 1869 seiner Ausbildung oblag; später wurde ihm zu weitern Studien vom steirischen Landesausschuß ein Stipendium auf drei Jahre bewilligt. Er ließ sich dauernd in Graz nieder, wo er seit 1876 die Monatsschrift »Der Heimgarten« herausgibt, und wo der freundschaftliche Verkehr mit Hamerling, der auch seinen Erstling mit einem Vorwort in die Literatur einführte, auf seine Bildung bestimmend einwirkte. Seiner ersten Veröffentlichung: »Zither und Hackbrett«, Gedichte in obersteirischer Mundart (Graz 1869, 5. Aufl. 1907), folgten: »Tannenharz und Fichtennadeln«, Geschichten, Schwänke etc. in steirischer Mundart (das. 1870, 4. Aufl. 1907), dann fast jährlich gesammelte Schilderungen und Erzählungen, die vielfach aufgelegt wurden (meist Wien), nämlich: »Das Buch der Novellen« (1872–86, 3 Bde.); »Die Älpler« (1872); »Waldheimat«, Erinnerungen aus der Jugendzeit (1873, 2 Bde.); »Die Schriften des Waldschulmeisters« (1875); »Das Volksleben in Steiermark« (1875, 2 Bde.); »Sonderlinge aus dem Volk der Alpen« (1875, 3 Bde.); »Heidepeters Gabriel« (1875); »Feierabende« (1880, 2 Bde.); »Am Wanderstabe« (1882); »Sonntagsruhe« (1883); »Dorfsünden« (1883); »Meine Ferien« (1883); »Der Gottsucher« (1883); »Neue Waldgeschichten« (1884); »Das Geschichtenbuch des Wanderers« (1885, 2 Bde.); »Bergpredigten« (1885);»Höhenfeuer« (1887); »Allerhand Leute« (1888); »Jakob der Letzte« (1888); »Martin der Mann« (1889); »Der Schelm aus den Alpen« (1890); »Hoch vom Dachstein« (1892); »Allerlei Menschliches« (1893); »Peter Mayr, der Wirt an der Mahr«, (1893); »Spaziergänge in der Heimat« (1894); »Als ich jung noch war« (Leipz. 1895); »Der Waldvogel«, neue Geschichten aus Berg und Tal (das. 1896); »Das ewige Licht« (das. 1897); »Das ewig Weibliche. Die Königssucher« (Stuttg. 1898); »Mein Weltleben, oder wie es dem Waldbauernbuben bei den Stadtleuten erging« (Leipz. 1898); »Idyllen aus einer untergehenden Welt« (das. 1899); »Spaziergänge in der Heimat« (das. 1899); »Erdsegen. Vertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauernknechtes«, Kulturroman (das. 1900); »Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben« (das. 1901); »Sonnenschein« (das. 1901); »Weltgift« (das. 1903); »Das Sünderglöckel« (das. 1904); »J. N. R. J. Frohe Botschaft eines armen Sünders« (das. 1904; neu bearbeitete Volksausgabe 1906); »Wildlinge« (das. 1906). Diese Werke erschienen auch mehrmals gesammelt (zuletzt in Leipzig). In steirischer Mundart veröffentlichte R. noch: »Stoansteirisch«, Vorlesungen (Graz 1885, neue Folge 1889; 4. Aufl. 1907); ferner in hochdeutscher Sprache: »Gedichte« (Wien 1891), das Volksschauspiel: »Am Tage des Gerichts« (das. 1892), »Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling« (das. 1891) und »Gute Kameraden, Erinnerungen an Zeitgenossen« (das. 1893). Genaue Kenntnis des Dargestellten, Gemüt und Humor zeichnen die Erzählungen Roseggers aus; seine Stärke liegt in der kleinen Form der Skizze und kurzen Erzählung; in eine Reihe solcher hübschen kleinen Bilder zerfallen auch die besten seiner größern Romane, wie »Jakob der Letzte«, »Der Waldschulmeister«. Vgl. Svoboda, P. K. Rosegger (Bresl. 1886); Ad. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart (Dresd. 1895); O. Frommel, Neuere deutsche Dichter in ihrer religiösen Stellung (Berl. 1902); Hermine und Hugo Möbius, Peter R. (Leipz. 1903); Seillière, R. und die steirische Volksseele (deutsch von Semmig, das. 1903); Kappstein, Peter R., ein Charakterbild (Stuttg. 1904); Latzke, Zur Beurteilung Roseggers (Wien 1904).
Nixnutzig Volk
Eine Bande paßloser Leute
Vorwort
»Wenn die Kerle aneinandergeheftet sind, dann kann sie einer leicht vor sich hertreiben!« sagt der Landwächter Johann Krösel gern, wenn er einen Trupp Zigeuner einzubringen hat. Ich habe aus denselben Gründen meine Bande vom Buchbinder zusammenheften lassen.
Ein ganzer Band nixnutzig Volk? Der Leser macht ein bedenklich ernstes Gesicht. »Waldpoet, das ist man von dir nicht gewohnt.« –
Aber, mein Freund, es ist so lustig, auch einmal abenteuerliche Gesellen und Gesellinnen zu zeichnen und ihnen hie und da ein kleines Frätzlein anzuhängen. Jawohl, allerlei Nixnutze habe ich da beisammen, und fast keiner ist so traurig, daß man sich nicht ein wenig mit ihm oder über ihn lustig machen könnte. Darunter besonders bemerkt auch solche, die als »Nixnutze« gescholten werden, weil sie für das Alltagsleben nicht taugen, weil sie sich dem Weltbrauch nicht fügen können, weil sie es in ihrer treuherzigen Einfalt zu nichts bringen und von ihrem Elend nicht einmal dann etwas merken, wenn sie daran zugrunde gehen. Solch reine Toren wird man hier mehr als einen finden und der zehn Gerechten wegen bitte ich um Nachsicht für andere.
Wenn bei Durchzug dieser Bande Kinder nicht auf die Straße laufen, so ist's mir lieb. Gefahr wäre zwar kaum dabei, aber auch kein Vorteil. Erwachsene hingegen, die sowieso schon wissen, wie es zugeht, mögen an den zweifelhaften Leuten Ergötzung und vielleicht sogar Gewinn finden.
Krieglach, im Sommer 1906. Der Verfasser.
Batzenlippel. Aus einem Schreibebuch.
Dann wurde ich Schauspieler. Unsere Gesellschaft war eine wandernde, weil man uns überall sehen wollte. Wo wir einmal waren, da mochten sie uns nicht fortlassen, bevor sich nicht jeder von uns förmlich losgekauft hatte. Mein schauspielerisches Talent war sehr groß, doch wollte es nicht recht heraus; zwischen Lunge und Leber mußte es sich verklemmt haben, denn wenn ich von der Leber weg sprechen wollte, versagte mir regelmäßig der Atem. Doch war ich der beliebteste der ganzen Truppe und rettete manches Stück. Man gab Ritterstücke und Tragödien. Aber die Leute wollen lachen. Ich hatte nämlich mehrmals die Rolle tragischer Helden bekommen, ich wollte sie gar nicht lustig spielen und sie wurde doch lustig. Das ist das Unbewußte – die Genialität. Der Alte war die ersteren Male verdrießlich über die, wie er sagte, unpassend erregte Heiterkeit, als aber dann das Haus zum Platzen voll ward, so oft ich in tragischen Rollen auftrat, erkannte er meine hinreißende Kraft und versprach mir, wenn ich auch das Zettelaustragen übernehmen wollte, eine Erhöhung der Gage. Wir sagten nicht »Gasche«, sondern Gage, wie sie geschrieben wird, nur wenn der Direktor manchmal aufgebracht war, denn der Mann litt an Jähzorn, verfiel er in den alten Fehler und nannte uns Bagasche, bis der rote Louisel ihm einmal höflich nahelegte, daß er doch keinen solchen Aufwand treiben solle, alldieweilen wir nur auf die zwei letzten Silben Anspruch machten. Denn die Gagen wurden nicht so regelmäßig zugestellt, wie die Rechnungen unseres Herbergsvaters.
Der rote Louisel – wegen seiner roten Gesichtsfarbe und des ziegelblonden Haares so geheißen – hatte allerhand Einfälle; er verfertigte Theaterstücke, neue, und besserte alte aus. Der Schiller und der Schekspier waren auf unserer Bühne nämlich nur möglich, wenn der Louisel die letzte Hand angelegt hatte. Aber er war komisch, dieser Louis Gruber; während er auf Befehl des Alten ganze Seiten streichen mußte, streckte er seine krumme Nase und sagte, das Feine siebe man durch, das Grobe, die Kleie, sei gut für die Säue. Der Louisel war ein gemütliches Haus und seiner geringen Begabung gemäß stets bescheiden. Er hatte etwas Geist und Gemüt, aber kein Taschenmesser. Wir beide tranken beim Wirt nie immer noch eins, wie die alten Deutschen, sondern immer nur eins. Und wenn es dann zum Zahlen kam, sagte der Louisel manchmal zu mir: »Tu' mich auch gleich mit ab, Walter, du weißt, der Alte hat wieder einmal nicht gegagt. Bis er aber seine Gage erhielte, würde er für den ganzen Tisch zahlen. Einmal wurde er von uns andern daran erinnert; er antwortete, beim Wort bleiben zu wollen und für den ganzen Tisch zu zahlen – es war ein großer viereckiger Eichentisch – falls dieser etwas verzehre. Das waren aber nur faule Fische; wir Umsitzenden hatten uns, wenn er bei Taschenmesser war, nicht zu beklagen. Es verstand sich von selbst, daß für zwei solche Kerls, wie der rote Louisel und der Heldenspieler Walter, die Welt der Bretter zu enge werden mußte. Der Louisel hatte wieder einmal ein Stück geschrieben, und ich sollte einen meineidigen Bauern geben, der sehr fromme Reden im Mund führte, dabei seine Blutsverwandten betrog, dann bei einer Geistererscheinung sich bekreuzen will, aber die Hand nicht heben kann, mit der er einst den falschen Eid geschworen. Eine abscheulich langweilige Rolle. Ich hätte trotzdem daraus etwas gemacht, wenn der Dichter nicht darauf bestanden haben würde, mich spießgenau an den Text zu halten und nicht ein einziges Wort zu extemporieren. Die Herren selber können ja nichts, und schöpft man einmal aus dem eigenen Vollen, dann wird man »Batzenlippel« genannt, was soviel heißen soll, als eingebildeter Tropf. Das ist der Neid. Nun diesmal dachte ich gleich, daß sich diese kleinliche Prinzipienreiterei rächen würde. Wenn dem Schauspieler etwas Besseres einfällt, als der Souffleur weiß, warum nicht sagen! Daß geniale Menschen, die mit reicher Phantasie begabt sind, an Gedächtnisschwäche leiden, ist eine alte Erfahrung. Und da ein guter Schauspieler sich auf den Souffleur nicht verlassen soll, so war ich eben wieder ganz auf mein eigenes Ingenium angewiesen bei derselben Premiere. Der erste Akt ging vorzüglich, ich heuchelte flott drauf los, als bewegte ich mich allen Ernstes in der guten Gesellschaft, und schwur mit salbungsvollster Frömmigkeit den falschen Eid. Gegen Ende des Aktes jedoch, wie der Louisel als Geist erscheint, komme ich plötzlich aus der Fassung und kann nicht weiter. Der Geist zischelt mir Flüche zu, die gerade auch nicht im Buche stehen; das verehrungswürdige Publikum beginnt zu kichern, mir wird ganz blau vor den Augen, der Souffleur schreit mir den Text her, das macht mich erst recht irre. »Halt's Maul!« rufe ich ihm zu, »laß dich einsalzen mitsamt deinem Büchel. Weiß es lang' schon, was drinnen steht, besser als du!« Die Leute werden unruhig, da ich schon einmal entgleist und in meinem Fahrwasser bin, so trete ich vor und rede lustig ins Haus hinein: »Verehrungswürdige! Was sollen's denn noch sitzen bleiben bei der Hitze! Den ganzen dritten Akt lang! Daß Sie's nur wissen, der Meineidige hat halt ein böses Gewissen, und wenn er sich vor dem Geist bekreuzen will, kann er die Hand nicht heben, es trifft ihn der Schlag, er fällt zusammen und wird vom Teufel geholt. So – da habt ihr die ganze Geschicht'.« Der Vorhang fällt, aber – weil ich zu weit vorn am Rande stehe – zum Glück hinter mir, so daß er mich von den hinten drohenden Mächten trennt, hingegen dem rasenden Publikum aussetzt. Das rast, aber vor Vergnügen, und wer das nicht miterlebt hat, weiß nicht, was Applaus ist. Von der vordersten Reihe herauf wird mir der Riesenblumenstrauß gereicht, der dem Autor des Stückes bestimmt gewesen. Ich sage noch tiefgefühlte Worte unaussprechlichen Dankes im Namen des Dichters, da höre ich rufen: »Selber behalten! Selber essen!« Das dämpfte etwas, für was halten sie mich denn, daß ich Blumen essen soll!
Das Ende ist zu erraten. Das Stück hatte keins an diesem Abend, die Wurst hatte zwei und das meinige schien gekommen zu sein. Klipp und klar zerreißen wollten sie mich. Der Direktor wollte gar nicht aufhören, mir Backenstreiche zu versetzen, rechts und links, so daß vor meinen Augen allemal die Funken stoben. Umgekehrt, wie bei einem Gewitter, wo zuerst der Blitz und dann der Schlag erfolgt. Der Louisel war halb gebrochen hinter einer Kulisse gesessen, aber nun, da es galt, einen Mord zu verhindern, eilte er herbei, um mich aus den Händen des Tyrannen zu befreien. Jene aber, die sich mit meinem Blumenstrauß befaßt, brachen plötzlich in ein mächtiges Spektakel aus, sie hatten darin, verborgen wie eine Schlange unter Rosen, eine riesengroße Leberwurst entdeckt. Diese sensationelle Entdeckung änderte – wie das schon oft so vorkam – den Lauf der Geschichte. »Volkes Stimme ist Gottes Stimme!« deklamierte der Alte – er hatte keinen übeln Baß – »und wenn's dem Publikum recht ist, so kann's uns um so lieber sein.« Wir zogen uns in das Theaterrestaurant, zum Schöpsenwirt, wo unser Logement war, zurück, und der Direktor hat zur Wurst das Bier gezahlt.
Nach solchem Erfolge – der weder dem Zufall, noch dem Talente, sondern einzig nur dem Ingenium zuzuschreiben war – litt es mich natürlich nicht mehr länger bei der Schmiere. Ich wollte mich bloß einmal im Burgtheater engagieren lassen, vorher aber eine Kunstreise durch Amerika machen, denn später bekommen erste Kräfte für derlei Seitensprünge keinen Urlaub mehr.
Aber nun spreche ich aus schlimmer Erfahrung. Keinem Kollegen von der Kunst möchte ich raten, so aus dem Stegreif zu reisen. Man extemporiert wohl auf der Bühne, aber nicht nach Amerika. Das muß gut memoriert sein und für den Mimen ist der Impresario noch weit wichtiger, als der Souffleur. Ich kam natürlich gar nicht hinüber. In Bremerhaven haben sie mich zurückgewiesen; sie ahnten in mir einen Defraudeur und ahnten recht. Wollte ich nicht das größte, mindestens zweitgrößte Genie Europas nach der Neuen Welt hinüberlotsen? Auf der Rückreise wandte ich mich wiederholt an Mäcene, wovon die meisten Zwei-, andere auch Fünf-, einige sogar Zehnpfennigstücke gaben. Ich sah nun, daß meine Ruhmesbahn starke Krümmungen hatte. Eine davon führte mich aufs Schloß, wobei ich den Vorteil, der in einem einstweiligen Berufswechsel lag, sofort erkannte. Ablenkende Nebenumstände bleiben unberührt; es sei vor allem kurz angemerkt, daß ich mir auf jenem Landschlosse einen Herrn aufgenommen habe.
Ein Baron, im übrigen ein ganz netter Mensch. Nur etwas hochmütig. So ließ er z.B. seine Stiefel jeden Tag stundenlang antichambrieren vor seinem Zimmer. Mir folgte er, obgleich ich wenig zu sprechen pflegte, nahezu auf den Wink; besonders wenn ich ihn zum Diner befahl, gehorchte er augenblicklich. Doch hatte er seine Kapricen. Ich besaß in seiner Lade immer gute Zigarren, er aber versteckte mir regelmäßig den Schlüssel dazu. Ich galt als Erzieher seiner nächsten Umgebung. Waren aber ein paar lederne Kerle dabei, die manchmal ein bischen gewichst werden mußten, wenn sie Politur annehmen sollten. Doch auch die Pantalons, Jacketts und Paletots mußten täglich mit dem Stock gezüchtigt werden. Derlei erregt natürlich die Galle, und eines Tages, als ich diese nichts weniger als angenehme Aufgabe an einem unordentlichen Pantalon erfüllte, stak zufällig schon der Herr drin. Wegen dieses Versehens gab es Verdruß. Der Herr faßte mich am Kragen, warf mich an die Wand und stieß mich mit einigen Fußtritten zur Tür hinaus, daß ich die Treppe hinabkollerte. Diesen Wink verstand ich so, als ob mich der Herr nicht in seinem Hause haben wollte. Da ich soweit immer mit ihm zufrieden gewesen war, so tat ich seinen Willen und ging davon.
Nun wieder freier Weltbürger. Doch das ist kein Beruf, der seinen Mann ernährt, weshalb sich meine Ideale anderen Richtungen zuwendeten. Plebejische Neigung zur Arbeit hat meinen Charakter nie besudelt, und wenn die Staatseinrichtung in Preußen bürgerliche Existenz nur gegen Arbeit garantiert, so hatte ich dafür bloß ein Lächeln der Verachtung. Weil mich aber Frost und Hunger – ich will brutal aufrichtig sein – zu einem Erwerbe zwangen, so ging ich auf dem Stadtplatz von Lichtenfelde zu einem Sicherheitswachmann hin und schleuderte ihm einen Schimpf ins Gesicht. Er blickte mich an, zuckte die Achseln und wandte sich einer anderen Weltgegend zu. Ja, mein Gott, was soll ein Notleidender dann nur anfangen! In Österreich ist es doch bei Arreststrafe verboten, eine Amtsperson zu beleidigen. Glauben denn diese Herren, man wird ihrer Arrestlöcher wegen einen Diebstahl begehen? Wartet mal, ich will euch noch kurios zwingen, mir ein warmes Winterquartier zu verschaffen. Am Marktplatz, der voller Zeugen war, stieg ich auf die Brunnenstufe und schleuderte eine Majestätsbeleidigung hin, daß das Krämervolk nur so niederzuckte vor Schreck. Nun brauchte ich nicht mehr lange zu warten; zwischen zwei untadelhaft strammen Adjutanten marschierte ich dem Arreste zu, und der Richter verbürgte mir zuvorkommend drei Monate. Das genügt. Dann ist April, die Straßen sind trocken, und die Ruhmesbahn führt dann hoffentlich schnurgerade nach Wien. Man will aber nicht mit leeren Händen kommen.
Ich hatte einmal gelesen, daß ein Hauptmerkmal von Genialität ununterbrochene Schaffenslust sei. So fragte ich meine Torwache, ob sie ungefähr wisse, was ein Dichter ist. »Na nu! Jlauben Sie man, wir sinn so unjebildet, um nich zu wissen, wer das Lied jedichtet hat: Ei, was kraucht im Busch herum? Mir scheint, es is Napolium! Wir können unsern Joethe uswendig – wissen Sie!« »Schön. Dann werden Sie auch Verständnis haben für die Persönlichkeit, der zu dienen Sie die Ehre haben. Es wird für Sie noch viel Trinkgeld abfallen, wenn Sie die Fremden in dieses Lokal führen, in welchem Goethe der Zweite interniert war. Jawohl, mein Herr, Goethe der Zweite! Ich schreibe hier einen neuen Faust!«
»Ach herrje, is nich der alte noch jut?« sagt der Schwachkopf, brachte aber doch Tinte, Feder, Papier und Streusandbüchse, worauf ich ihn kurz entließ. Mein Schreibtisch war aufs beste eingerichtet, und ich ging an die Arbeit, das heißt: ich versuchte die Feder, ob sie nicht spießig sei, und das Papier, ob es nicht die Tinte durchlasse. Soweit alles in Ordnung, übrigens ... Man kommt sich in solchen Stunden, trotzdem einem nichts einfällt, etwas einfältig vor. Plötzlich jedoch hatte ich's – ein wahrhaft klassischer Stoff! Sofort begann ich zu schreiben vom Liebespaar, das nicht zusammenkommen soll und deshalb einen Doppelselbstmord begehen will, sich aber in dem Mittel vergreift. Die Einfälle purzelten nur so herbei, einer nach dem andern, bis mir auch noch einfiel, daß die ganze Geschichte der rote Louisel einmal erzählt hatte. Um so besser, ist gleich ein Zeuge vorhanden, daß sie wahr ist. Wenn's nach mir so viele wissen sollen, warum soll's vor mir nicht auch einer gewußt haben! Es liegt mir dran, das Stück auf die Bühne zu bringen, ehe mir etwa der Rote den Stoff stiehlt.
Bis das Frühjahr gekommen, war die Majestätsbeleidigung so gründlich herausgehungert, daß meine Seele wie eine weiße Taube vom Mund auf hätte können nach dem Berliner Schloßplatz fliegen. Dann begannen zwischen Preußen und Österreich die diplomatischen Verhandlungen, wobei ersteres den kürzeren zog. Preußen wurde nämlich verhalten, mich an Österreich abzugeben, und zwar franko und rekommandiert. Als ich unter sicherem Geleite angekommen wieder auf der Scholle des geliebten Vaterlandes stand, zu Jung-Bunzlau, haperte es mit der Sprache. Bei der gründlichen Ausbildung in meiner Jugend waren die süßen Laute der tschechischen Sprache vergessen worden. Was anfangen? Für das Burgtheater war es keine Jahreszeit, so ging ich nach Karlsbad. Aber nicht etwa, weil ich mir auf der preußischen Festung stark den Magen verdorben hätte, denn vielmehr als Gesandter! Aus dem Notenwechsel zwischen den Regierungen hatte es sich nämlich ergeben, daß mein Vater nach Karlsbad zuständig war, nun so sandten sie mich dorthin, um die Gemeinde zu vermögen, mir die weiteren Subsistenzmittel auszuwerfen. Ich verzichtete darauf, nachdem diese Stadt mich nun blindlings verleugnete und mir jegliche Ehrengabe verweigerte. Meine Absicht, mich der Chirurgie zuzuwenden, indem ich mich in einer Badeanstalt als Heizer und Frottierer unterzubringen versuchte, mißlang. So ging ich in Staatsdienste und nahm ein Amt als kaiserlich-königlicher Straßenschotterer an. Hier konnte ich aber gerade einmal die menschliche Undankbarkeit studieren. Ist es glaublich? Nicht eine einzige der Herrschaften, wie sie da auf der Straße, die ich ihnen bereitet, zwei- oder vierspännig darüberrollten – nicht eine einzige hat mich gegrüßt, den ganzen Sommer über nicht eine einzige. Erst gegen den Herbst hin fiel es einem Herrschaftskutscher ein, mit der Peitsche nach mir zu hauen, weil ihm der Schotter zu grob war. Komisch sind die Leute. Ihm gefiel der grobe Schotter nicht und unsereinem soll der grobe Kutscher gefallen.
Endlich um die Zeit von Allerheiligen konnte ich mich aufmachen nach Wien. Zum Behufe ethnographischer Studien wählte ich den Fußweg. Er ist auch etwas näher als die Eisenbahn, die mehrmals um die Ecke biegt. Unterwegs traf ich einen Naturarzt, einen drolligen Patron. Der suchte mich für seine Grundsätze zu gewinnen, er wollte partout das menschliche Leben verlängern. Dem sagte ich es, ob er denn glaube, daß die Natur ein langes Leben der Personen wünsche? Bei der ungeheuren Zahl an Mehrgeburten! Warum gab die Natur uns den Alkohol, den Tabak, den Heißhunger und die Weiber? Doch offenbar zur Kurzweil, das heißt, um uns das langweilige Alter zu ersparen. Wenn alles darauf ausgeht, die Zeit zu verkürzen, wieso kann es der Heilkünstler wagen, das Leben zu verlängern! Solch gemeingefährliche Leute sollte man gar nicht frei herumgehen lassen! – Na, wie der Mann gestutzt hat! Einem schlichten Wanderer hatte er diese philosophische Auffassung wohl nicht zugetraut. Er meinte wahrscheinlich, sie wäre auf meinem Sack gewachsen. Während dieser Erörterungen wanderten wir gerade durch die böhmischen Wälder. Da packte mich mein Begleiter, der Naturarzt, ganz jählings an der Gurgel, warf mich hin und sagte, er wolle mir die Zeit verkürzen. Da ich mich nicht mehr zu wehren vermochte, so wollte ich ihm meine Habe schon freiwillig abtreten. Da wurde er von einem heranrasselnden Wagen verscheucht, und ich war froh, den gelehrigen Heilkünstler, der plötzlich so – kurzweilig geworden war, los zu sein.
In Wien hatte ich einen Freund. Es war der Baron, auf dessen Landschloß ich einmal Erzieher gewesen. Er besaß ein Palais auf der Ringstraße und hätte sich über meinen Besuch gewiß herzlich gefreut, wenn er nicht gerade verreist gewesen wäre. Um in der Burg eine Audienz zu erwirken, beim Theaterintendanten, das war eine Angelegenheit späterer Tage, bis mein neuer Anzug fertig sein würde. Da ich an diesem Abend also weiter nichts anzufangen wußte, ging ich in ein Vorstadttheater. Weder der Kassierer noch der Billeteur erkannte mich, ich war nämlich vorher noch nie dort gewesen. Das Theater war zum Brechen voll, ich hatte einen der obersten Plätze genommen und konnte mich ganz in das neue Volksstück vertiefen, das gegeben wurde. Allen Respekt, das heiße ich Komödie spielen – und schreiben! Die können es um einiges besser, als weiland wir von der Schmiere, mit Einschluß des Louisel, der auch just kein Plattschädel gewesen ist. Ein Landpfarrer, der sein Stubenmädchen liebt und es mit einem andern trauen muß. Mag bitter sein! Und ein halbwilder Mensch, der ihn verraten hat und doch nachher zum Pfarrer kommen muß, weil seine Mutter ins Wasser gegangen ist. – Nach meiner Ansicht war diese Figur verhaut. Inkonsequente Charakterdurchführung. Was kommt er denn zum Pfarrer, wenn er ihn nicht leiden mag? – Ich blieb indes bis zum Schluß – um etwas Besonderes zu erleben.
Als der Vorhang gefallen, brach ein solcher Beifallssturm los, und ein Lärmen nach dem Verfasser, daß dieser, von zwei andern gezerrt, auf die Bühne kam. Ein Mensch – mir kommt er bekannt vor, den muß ich ja schon – Wo mag ich ihn nur – Jesses und Jusef, ist das nicht der Louisel? Der rote Louisel – wenn er heute gleichwohl schwarz ist auf und auf, und blaß im Gesicht vor Aufregung. Der Louisel ist's! »Louisel, Collega!« schrie ich und klatschte mir die Hände zuschanden. »Louisel! Collega!« Aber er hört's nicht, denn die tausend anderen lärmen noch abscheulicher. Immer wieder kommt er heraus, der Popularitätshascher, ich schwenke das Sacktuch, es war freilich nicht mehr weiß, er sah es nicht, er sah und hörte mich nicht, so tief war er vertölpelt in seinem Erfolgsdusel. – Armer Junge!
Nun endlich beschaute ich mir auch den Theaterzettel recht. Meiner Six! L. Gruber! – Gruber schrieb sich doch der Rote. Daß mir das nicht gleich auffiel! – Natürlich lief ich wie wahnsinnig durch alle Gänge, verlief mich in alle Winkel, fand aber nicht den Eingang auf die Bühne. Diese verdammten Stadttheater. Wie einfach war es doch bei uns auf dem Lande, zur Bühne zu kommen! Vom Anger durch das Scheunentor und drinnen war man. Aber hier die Schlamperei! Wohin man wollte, dahin kam man nicht; und wohin man nicht wollte, dahin kam man. Am hinteren Ausgang, wo die Schauspieler sich entfernten, habe ich ihn erwartet. Nach einer Weile kam er mit mehreren aufgeregt sprechenden Herren heraus. Ich flog ihm an den Hals: »Louisel! Ich bin's, ich der Walter!« Vor eine Straßenlaterne zog ich ihn, er schaute mich erstaunt an. Er murmelte was. »Das Stück hast du gemacht!« rief ich fast toll vor Vergnügen. »Louisel, dieses großartige Stück! Bist aber doch ein Mistvieh, du! Wenn man noch du sagen darf zu dir.«
»Du sagen schon,« antwortet er sich fassend, »das – das andere aber kannst du für dich behalten.«
»Nicht böse sein, Brüderl!« Immer wieder von neuem mußte ich ihn umarmen, den Gefeierten. Mehrere Männer schleppten ihm Kränze nach, einer rief den Fiaker. Jetzt erst wurde es mir klar, wie gern ich den Louisel hatte. »Närrisch werde ich dir vor Freude!« rief ich, »dieses Wiedersehen! Ein solches Wiedersehen! Knabe, dieser Abend wird gefeiert. Gefeiert, wie die Götter keinen in ihrem Kalender haben.«
»Du mußt mich schon entschuldigen,« sagte er zerstreut, wie Dichter immer sind, »ich bin heute in einen kleinen Privatkreis geladen.«
»Genier' dich nicht, alter Freund! Jeder Kreis ist mir recht, auch der privateste, wenn nur du drinnen stehst. Große Gesellschaft habe ich, soviel du weißt, nie geliebt. Da sind mir die gemütlichen Zirkel weit angenehmer. Wohl auch hübsche Damen, wie? Na, heute will ich dir das Vorrecht, Löwe zu sein, nicht streitig machen. Kolossal lieb von dir, daß du mich mitnimmst!«
Dieweilen bemerkte ich, daß ihm mein Anzug aufgefallen war. »Der ist etwas malerisch, Junge, was? Nun, den neuen hat der Schneider noch nicht fertig.«
»Bei welchem läßt du denn arbeiten?« fragte er.
»Das weiß ich im Moment noch nicht. Beim kaiser-königlichen Hofschneider, denke ich.«
»Nicht wahr, Walter,« sagte er freundlich, aber verteufelt bestimmt, »du bist so gut und kommst nächster Tage einmal zu mir. Warte, ich will dir meine Adresse aufschreiben.«
»Dein Stück muß ins Burgtheater!« rief ich begeistert.
Er stieß jenes kurze heisere Lachen aus, das wir bei ihm immer das ungläubige Lachen genannt haben.
»Laß das gut sein, Louisel!« sagte ich, »es soll meine Sorge sein. Das Stück kommt in die Burg!«
Mittlerweile überreichte er mir das Papier mit der Adresse und unter demselben – ich erkannte es schon im Greifen. Nur wußte ich nicht, wieviel. Damit war ich aber auch entlassen. Der Schlucker! Gedrückt fühlte er sich in Gegenwart eines künftigen Hofschauspielers. Diesen Abend wollte gerade er einmal der Hahn im Korb sein in seinem Privatkreis. Ich will ihm's nicht verdenken. Aber neugierig war ich doch. Kaum war der Wagen davongefahren, ging ich hart unter die Laterne. Zehn Gulden! Schundig, bei diesem vollen Hause. Und für morgen ist dieser verliebte Pfarrer wieder angesetzt. Ich höre, die ganze Woche hindurch. Ein Schweineglück! Lasse Zeit, Louisel. Das Glück ist kugelrund.
In wenigen Tagen war ich soweit beisammen, daß ein Antrittsbesuch bei der Intendanz gemacht werden konnte. Ich ließ mich also melden, doch war Seine Excellenz diesmal nicht zu sprechen. Es werden Tage kommen, mein lieber Herr, wo du bei Walter antichambrierst! Dann unterhielt ich mich leutselig mit dem Wiener im Vorzimmer. Natürlich war die Rede von dem neuen dramatischen Stern, der aufgegangen.
»Ich bitte Sie,« sagte ich, »noch heute wäre dieser Mensch bei der Schmiere! Ganz natürlich! Seinen Erfolg hat er mir zu verdanken, mir einzig und allein. Wenn meine Bemühungen nicht schon auf kleinen Theatern das bischen Talent zum Leuchten gebracht hätten! Ist übrigens ein guter Junge, wird sich hoffentlich noch machen, wenn er die Ratschläge vernünftiger Freunde nicht in den Wind schlägt.«
»Sie kennen also diesen Anzengruber?« fragte der Diener ergebenst.
»Anzengruber? Nein, den kenn' ich nicht Wieso?«
»Weil Sie sagen, daß er Ihnen den Erfolg verdankt.«
»Ich spreche vom Louisel. Von Gruber, wenn Sie die Güte haben wollten, etwas weniger zerstreut zu sein.«
»Wenn Sie vom Verfasser des Pfarrers sprechen, lieber Herr,« versetzte der Kammerdiener unangenehm dreist, »so heißt derselbe nicht Louisel, sondern Ludwig, und nicht Gruber, sondern Anzengruber. Früher ein fahrender Komödiant; seit kurzem ein kleiner Polizeibeamter soll es sein. Heute steht's in allen Blättern.«
In solchen Momenten greift der klügste Mensch sich an den Kopf. Ist das möglich? Ist eine solche Falschheit möglich? Hat sich der Mensch jahrelang unter falschem Namen herumgetrieben, hat seine Freunde damit beschwindelt und hat schließlich noch die Frechheit, Polizeibeamter zu werden!
Ein Komödiant müsse doch Komödie spielen können, hatte damals der gute Cerberus an der Pforte der Intendanz gesagt. Zum Teufel, ja, das muß er können. Verstellen muß er sich können. Das muß er! Aber – wie es sich später zeigte – der Hund ging weiter. Da hat er sich immer gleißnerisch für einen kleinen, bescheidenen Kerl ausgegeben und in Wahrheit war's ein großer Mann! – Nein, eine solche Unverläßlichkeit überschreitet die Grenzen!
Hans Johanns Hauptsache
Wenn ich sage, es war ein einzig guter, rührender Mensch, so legt jeder das Buch hin und läuft davon. So sage ich lieber, er war ein Taugenichts.
Und das war er auch.
In den Schulen, wo er stets vorgeschriebene Marschroute hatte, da ging es noch an. Aber als er selbst der leitende Teil ward, als Lehrer in der Dorfschule, da ging es nicht mehr an. Die unterschiedlichen Kinder machten ihm viel zu große Sorgen, als daß er sich ihrem Unterrichte widmen konnte. Ob sie in der Fibel lesen konnten oder auf der Schiefertafel die Ziffern zusammen zählen und in einer sehr verläßlichen Ordnung hinschreiben, das war Nebensache. Hauptsache war die Gesundheit. Und so kümmerte er sich, ob das kleine Volk auch warme Jöpplein hätte und Schuhe an den Füßen, ob die Kinder wohl gewaschen und gekämmt wären – und wo es mangelte, da griff er flink zu und trachtete, beim Bäcker, beim Müller, beim Fleischer, als den Großen des Dorfes, für die armen Wald- und Gebirgskinder altes Gewand zu bekommen; er nahm auch Eßwaren und ließ durchblicken, daß solche Wohltaten an ihren eignen Kindern würden vergolten werden. Die großmütigen Spender verstanden das so, daß – wie die Kinder der Armen Not an Hemden und Strümpfen hätten, die Kinder der Reichen zumeist Not an guten Schulnoten haben, und daß der Herr Lehrer dann wohl den richtigen Ausgleich treffen würde. Hans Johann sah auch wirklich nicht ein, weshalb er die Spenden für mittellose Kinder nicht mit hübschen Fleißzetteln und ausgiebigen Fortgangsklassen der reichen Bürgerskinder schlichten sollte. Hauptsache war die Gesundheit. Und so setzte er sich auch gerne zu den Kindern auf eine Bank und gab ihnen Verhaltungsmaßregeln, wie sie gesund bleiben, ihren Körper stärken und zur Arbeit tüchtig werden könnten. Solches Bestreben war nicht fruchtlos und nach einem Jahre schon waren alle Kinder reinlich gehalten, soweit ordentlich gekleidet und von frischerem Aussehen. Wer Bezirksschulinspektor aber konnte bei der Schulschlußprüfung nichts als den Kopf schütteln und die Hände ringen, und als die Kinder nach überstandener Plage lustig davondrollten, stellte er sich vor den Lehrer hin, rang wieder die Hände und rief: »Aber um Gottes willen! Herr Johann!«
Sonst sagte er nichts. War auch nicht nötig.
»Seh's eh ein,« sprach der Lehrer ganz gemütsruhig, »daß ich nicht recht tauge zu einem Lehrer.«
»Wenn Sie irgendwo eine Stelle als Kindsmagd bekommen können, greifen Sie sofort zu.« Mit diesem wohlwollenden Rate ging der Bezirksschulinspektor seines Weges.
Und der Hans Johann des seinen. Denn er war erledigt. Aber nicht auf lange. In demselben Orte hatte er unschwer die Briefträgerstelle bekommen. Er hatte täglich über Berg und Tal zu gehen und den zerstreuten Vierteln die Post zu vermitteln. Das tat er auf das gewissenhafteste, und wenn ihm ein Bauer eine Post auftrug, für ihn im Dorf Einkäufe zu besorgen, oder eine Bäuerin irgend was Wichtiges zur Nachbarin zu befördern hatte, so tat er's bereitwillig, vergaß aber dabei manchmal, einen Brief abzugeben. Es war zuwider, aber Besonderes daran konnte Johann nun nicht finden. Was pflegen sich die Leute denn zu schreiben? Daß sie, Gott sei Dank, soweit gesund sind, daß der oder die geheiratet hat oder gestorben ist, daß es sonst nichts Neues gibt und daß sie schön grüßen lassen. Ob die Bauern das wissen oder nicht, Hauptsache ist, daß man ihnen mitunter eine Gefälligkeit erweisen kann. Das ging ein Jährchen so herum. Dann kam die Geschichte mit dem Geldbrief. An den Obergamshofer in Spittelberg hatte Johann einen Geldbrief zu bestellen. Aber der Weg dahin ist ziemlich weit, unterwegs hatte er ein mühseliges Bettelweib getroffen. Dem war die Fußkrücke entzweigegangen und so konnte es nicht recht vorwärts. Johann ging ins Wegmacherhaus um Werkzeug und zimmerte der Alten eine neue Krücke. Denn es war just des Obergamshofers Weidknecht des Weges gekommen, dem konnte er den Geldbrief mitgeben. »Ja richtig, Mathes,« sagte er noch, »das Blattel da mußt unterschreiben. Nicht können tust schreiben? Nachher mach halt drei Kreuzeln. Bin froh, daß du mir den Weg ersparst. Hauptsach' ist, daß das Mutterl da wieder auf die Füße kommt. Bleib schön gesund, Mathes.«
Einige Wochen später kam's zutage, daß der Obergamshofer keinen Geldbrief erhalten hatte, daß ihm aber sein Weidknecht durchgebrannt war. Dieses Ereignis kostete dem Briefträger allerhand und auch den Dienst.
Jetzt hatte er Zeit, sich den Hauptsachen zu widmen, und merkwürdig – jetzt verlangte niemand danach. Ja, es kam allmählich ungefähr so heraus, als ob für den Hans Johann nun die Hauptsache wäre, einstweilen nicht zu verhungern. Er bewarb sich also wieder um einen Dienst. Das Steueramt im nächsten Bezirksorte suchte einen Amtsboten. Aber den Johann nahm man nicht an, aus Besorgnis, er würde aus Erbarmen mit den Parteien die Steueraufträge unterschlagen. Das Bezirksgericht hatte für einen Gerichtsarrest die Profosenstelle ausgeschrieben; der Bewerber Hans Johann wurde rundweg abgelehnt; der hätte keinem Arrestanten die Türe verschlossen nach dem Grundsatz, Hauptsache bei den Menschen sei die Freiheit. Soweit war unser Johann schon in Verruf gekommen. Dann verscholl er auf einige Zeit, um später in einem Haushaltungsbureau aufzutauchen.
Hier war er fleißig und akkurat und füllte seine Stelle völlig aus. Aber es war das Haushaltungsbureau eines Siechenhauses. Seine Erholungsstunden brachte er bei den Siechenden und Krüppeln zu, um ihnen die Zeit zu vertreiben und sie aufzumuntern. Er ließ sich von ihnen ihre Anliegen erzählen; sie, auf die sonst niemand mehr hören wollte, an denen jeder gleichgültig vorüberging, waren seiner Teilnahme so froh. Er besorgte den Ofen, wenn sie fröstelte, holte ihnen ein frisches Glas Wasser, wenn sie dürstete, schrieb ihnen Briefe an Angehörige. Dann blieb er noch länger und las ihnen erbauliche oder lustige Geschichten vor oder trieb Schwänke und Späße in eigner Person. So daß die Armen getröstet und munter wurden. Wenn er darob bisweilen seinen Bureaudienst versäumte, so dachte er, ob die Reisballen, die Strohsäcke und Bettdecken und Medizinen aufgeschrieben werden oder nicht, wenn sie nur da sind. Hauptsache sind die armen Leutle und daß sie immer einmal ein bissel Zerstreuung haben.
Da war in der Anstalt ein alter Holzhändler, so vergichtet und mühselig, daß er in der dunkeln Stube bleiben mußte, wenn draußen die warme Sonne schien, weil niemand war, der ihn ins Freie führte. Als nun der Schreiber Johann erschien, der tat es gerne. Er blieb auch sitzen unter dem Kastanienbaum neben dem alten Manne und hörte geduldig seinen Klagen zu. Und eines Abends, als die übrigen Spazierhumpler und Sitzer sich verzogen hatten, weil es kühl geworden und auch Johann seinen Schützling ins Haus führen wollte, blieb der Alte sitzen, langte mit der dürren, fiebernden Hand hinter seine Brustjacke und zog ein verknülltes, vergriffenes Paket heraus.
»Herr Johann!« sagte er leise und hastig, »das gehört Ihnen. Es ist mein Geld, sie wissen nichts davon. Ich mag nit, daß es in den großen Sack kommt, da spürt kein Mensch was davon. Sie sind der Mensch, der's recht anwendet. Es gehört Ihnen. Da, da – nur geschwind einstecken!«
Johann nahm das Paket in die Hand. »Sie meinen, daß ich's Ihnen aufheben soll.«
»Ich brauch's nimmer. Will nur, daß wer was hat davon. Erspart ist's redlich. Aber dumm dürfen Sie nit sein und es ausplauschen. Tun's es gut einschieben.«
Es schien ihm nicht weh zu tun, dem Alten, wie er nun seinen Sparpfennig hingab, an dem er wohl viele Jahre lang gesammelt hatte und an dem sein Herz gehangen war. Aber angelegentlich verfolgte sein Auge den Vorgang, wie Johann das Paket in seine Brusttasche steckte. »Schön fleißig zuknöpfeln!« murmelte der Alte und knöpfte mit krampfigen Fingern über Johanns Tasche den Knopf ein. Bald hernach wankte er am Arm des Schreibers ins Haus.
An demselben Abend war's, daß der Direktor der Anstalt dem Hans Johann eröffnete, daß er entlassen sei. Grund gab er keinen an, war auch überflüssig. Johann wußte recht gut, daß er nicht aufgenommen worden, um die Pfleglinge zu unterhalten, sondern um die Rechnungen und Wirtschaftskorrespondenzen zu besorgen. Da er letzteres vernachlässigt hatte, so fand er seine Abdankung völlig in Ordnung.
Stärker überrascht war er nachher auf seinem Zimmerchen, und zwar von der Menge Geldes, die er im Paket fand. Dafür kann man ja ein Schloß kaufen und den alten Holzhändler in der Kalesche hineinführen! Und dann kann der Hans Johann sein Kammerdiener werden – so ist allen geholfen.
An einem der nächsten Tage, als er mit solch neuem Lebenslaufe beginnen will, ist der alte Gichtkrüppel richtig schon seit frühmorgens tot. Der Johann steht wie zerschlagen da. »Was tu ich jetzt!« Auf die Leiche verwendete er nicht viel, denn davon hat niemand was und der Hans Johann ist ein praktischer Mann. Auch Almosen teilte er nur spärlich aus; Almosen sagte er, mache Bettler; den Leuten müsse man viel gründlicher helfen. Von seinen großen Mitteln ließ er noch nichts verlauten, nur daß er ein Weilchen später im vorderen Labachtal, dort wo es windgeschützt und sonnig ist, ein Grundstück kaufte und große Erdarbeiten beginnen ließ. Eine Anstalt für Gichtleidende und Unheilbare soll errichtet werden, wo die armen Kranken besonders gut gehalten werden müssen und wo er mitten unter ihnen leben will, um zu helfen, zu trösten, wie es nötig sein wird.
Während die weitläufigen Grundfesten zu diesem Gebäude gegraben und gebaut wurden und stellenweise schon ein Mauerwerk emporzustreben begann, half der Johann einem notigen Kleinhäusler das Heu und das reife Korn unter Dach bringen, denn das – meinte er – sei für den Bauern die Hauptsache. Inzwischen, zu den kleinen Ruhepausen, trachtete er im Heu oder auf den Garben dem Söhnlein des Kleinhäuslers das Abc beizubringen; derlei Buchstaben, sagte er, seien zwar nicht die Hauptsache, auch die Lesekunst nicht und auch die Gelehrtheit nicht, aber daß man mit solchen Wissenschaften in der lieben Welt weiterkomme und ein tüchtiger Mann werde, das sei die Hauptsache.
»Wann d' schon alleweil von der Hauptsach' redest, da hast eine!« Mit diesen Worten versetzte ihm der Kleinhäusler eine klatschende Ohrfeige. »Garbentragen heißt's jetzt und nit schulfuchsen!«
Der Johann griff sich an sein also besachtes Haupt und schwieg. Richtig ist's eh, dachte er, wenn sie im Winter was zu essen haben wollen, muß man jetzt ernten. Daß er für sich nur Undank erntete, das war er schon gewohnt und fand es auch für selbstverständlich. So viel Tiefblick hatte er wohl, um zu wissen, daß es am besten sei, einem, dem man was Gutes getan hat, nachher in weitem Bogen auszuweichen; denn die Begegnung mit dem Wohltäter, den sie nicht mehr brauchen, ist den Leuten zuwider und der ganze Mensch wird ihnen zuwider, sie wollen am liebsten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Außer sie brauchen ihn wieder plötzlich einmal, dann halten sie es auch für selbstverständlich, daß er ihnen neuerdings hilft, und wenn er das zufällig einmal nicht kann, so werden sie ihm weit feindseliger als einem anderen, der ihnen nie was Gutes getan. Das alles hatte Johann erfahren und er dachte weiter nicht darüber nach. Er war jedem dankbar, der sich von ihm etwas Gutes tun ließ und blieb ihm dankbar und betrachtete ihn als einen Gönner, dieser mochte oft noch so roh und erkennungslos sein. Nun, so hat den Johann auch die Ohrfeige nicht im mindesten beirrt, er half emsig Garben tragen, und abends, als der Häusler ihm freundlich eine gute Nacht zurief, schlich der Johann gerührt in seine Behausung und dankte Gott für die vielen guten Menschen, die er erschaffen hat.
Wenn Johann dann wieder hinausging, um die Fortschritte seines Baues zu beschauen und wie emsig hier brave Leute arbeiteten, um armen Kranken ein Heim zu schaffen, da freute ihn die ganze Welt. Jedoch aber! Als die dritte Auszahlung war und der Baumeister darauf drang, endlich doch auch einen Kostenüberschlag zu bestimmen, da kam für unsern Idealisten einmal eine wirkliche Überraschung. Er hatte gemeint, mit seinen zweieinhalbtausend Gulden, dem Nachlasse des alten Holzhändlers, ein stattliches Krankenhaus mit den hierzu erforderlichen Stiftungen bestreiten zu können, und nun zeigte es sich, daß das Geld schon verbraucht war, während das Mauerwerk kaum noch mannshoch aus der Erde hervorstand. Da haben wir's jetzt. Der Johann griff sich an den Kopf und rief: »Deuxl, Deuxl noch einmal, daß so was so saumäßig teuer mag sein!« Nun mußte der Bau eingestellt werden und mit dem Gelde, das zu so hohen Dingen bestimmt gewesen, war nichts geschaffen als ein durchwühlter Boden mit Schutt und Steinen. Hans Johann wollte sich jetzt den Kopf wegreißen. Nicht ob der Leute Gelächter und Spott, denn hierin hatten sie ja recht, und er lachte und spottete mit ihnen – ach wie bitter bitterlich ist es, sich selbst auslachen zu müssen. Daß er aber ein so grundschlechter Verwalter des Nachlasses gewesen und kein einziger Notleidender davon auch nur um eines Hellers Wert Erleichterung hatte, das wollte ihm nicht gestatten, einen solchen Kopf noch länger auf dem Rumpfe stehen zu lassen. Jetzt wußte er endlich auch, was bei ihm die Hauptsache war. Eine grenzenlose Dummheit.
Fast schien es, als hätte er nun auch allen Kredit verloren. Wenn er jemand auf der Straße das Bündel wollte tragen helfen, oder wenn er am geländerlosen Labachsteg schwindelige Leute hinüberführen wollte, da sagten sie dreist: »Schau du auf dich selber!« Und das war tatsächlich ein guter Rat, denn er begann leiblich zu verkommen und zu verderben. Auf der Baustelle, zwischen den Mauern und Sandhaufen baute er Erdäpfel an, aber diese wußten, daß der stolze Grund nicht ihnen vermeint gewesen, fühlten darob ihre Ehre verletzt und wollten nicht recht wachsen. Als sie im Spätherbste endlich doch so weit waren, daß sie den Spaten lohnten, dachten die Nachbarsleute: der Johann verschenkt sie ja doch! und stahlen ihm die Erdäpfel in der Mondnacht.
So ist die praktische Seite von Johanns Tätigkeit stets unpraktisch ausgefallen, während über die ideale das Fazit im Himmel gezogen wird, wir einstweilen also keinen Einblick haben. Zu jener Zeit aber behauptete ein tiefsinniger Mensch, der Hans Johann würde seinen Mitmenschen noch einmal tüchtig imponieren und er hätte das Zeug zu einer großen Heldentat. Man hörte aber nichts weiter, als daß Johann in einem Eisenwerke ein Weilchen Schichtenschreiber war. Später soll er in einem Meierhofe des Unterlandes als Taglöhner gesehen worden sein. Und dann hörte man gar nichts mehr von ihm. Er war verschollen und auf der verlassenen Baustelle, wo das große Krankenhaus hätte stehen sollen, wucherten Nesseln und Disteln.
Um so merkwürdiger ist es, daß viele Jahre später von Leuten, die darum wußten, bei Mostar in der Herzegowina auf einem Friedhof ein halb verwitterter Grabstein gefunden wurde, der die Inschrift trug: Hans Johann, Soldat aus dem steirischen Infanterieregimente 27. Und darunter einige Worte in türkischer Sprache. Die darauf angestellten Forschungen ergaben folgendes: Hans Johann soll unter außergewöhnlichen Umständen für einen jungen Rekruten, der sehr an Heimweh litt, eingestanden sein, sei aber ein spottschlechter Soldat gewesen. Bei dem Einmarsche der Österreicher in die Herzegowina habe sich auf einem Bergpasse zwischen den Österreichern und den Türken ein Gefecht entsponnen. Johann sollte schießen, da sah er in demselben Augenblick, von einer anderen Kugel getroffen einen türkischen Soldaten fallen. Das Gewehr warf er weg und eilte hin, um dem Schwerverwundeten beizustehen. Während er ihm aus seiner Feldflasche Labung einzuflößen suchte, sank er selbst nieder, von einer österreichischen Kugel getroffen. Der türkische Soldat, der mit dem Leben davongekommen, habe den barmherzigen Österreicher mit Ehren begraben lassen und den Denkstein mit der Inschrift gestiftet. Die türkischen Worte auf demselben heißen zu deutsch: Aller Hauptsachen Hauptsache ist die Liebe.
Der Armeleut-Sucher
In den sechziger Jahren war's, als eines Tages ein merkwürdiger Mensch nach Alpel kam. Auf einem Steirerwäglein war er dahergefahren mit einem stattlichen Schimmel, den er selbst leitete. Auch er war stattlich, hatte ein rundliches Bäuchlein, um das der breite Ledergurt geschnallt war, wie ums Faß der Reifen. Vor diesem Bäuchlein soll er sich gefürchtet haben, daß es allmählich für die dünnen Beine zu groß und schwer werden könnte. Einer jener Hammerwerksbesitzer aus dem Murtale war er, denen es um jene Zeit noch so gut ging, bei denen das Gewerbe noch so glatt in der Väter Geleise lief, daß sie selbst ihre leibliche und geistige Tätigkeit vorwiegend auf Essen, Trinken und andere vergnügliche Übungen anwenden konnten. Weil es standesgemäß war, tat's auch der Wolfhardt von den sieben Hämmern. Dabei traf ihn aber das Mißgeschick, daß er fett wurde. Der Arzt verordnete ihm eine Abmagerungskur, er aß ein halbes Jahr lang nur Gemüse, Obst, spärlich Rindfleisch, und wurde dabei noch beleibter. Denn der Appetit war für alles vorhanden, für Sauerkraut wie für Kapauner, für Apfelbrei wie für Torten, für Obstmost wie für Bier und Sekt. Alles schmeckte ihm, alles bekam ihm wohl; doch nun hatte der Wolfhardt von den sieben Hämmern hinter seinem Speckwanste seltsamerweise noch ein Herz, das sonst hinter solchen Wülsten leicht zu ersticken pflegt. Ein Kanzeleiferer, ein fremder Gastprediger, hatte es aufgeweckt. Der Christ gehöre dem Reiche Gottes, das dort ist, wo die Ärmsten der Armen sind. Der Richter komme um Mitternacht und fordere Rechenschaft über die Verwaltung des Vermögens. Ein bißchen Herz für die Armen hatte Wolfhardt ja immer gehabt; nun, bei seinem Wohlleben fielen ihm sehr oft solche Leute ein, die nichts oder nur ungenügend zu essen hatten, und die in Gefahr waren, an Auszehrung zu sterben, während er im Speck umzukommen fürchtete. Zum Glücke gestatteten es seine Vermögensverhältnisse – denn er hatte die sieben Hämmer an eine Gesellschaft für schweres Geld verkauft – den Armen etwas zukommen zu lassen, um so leichter, als er unverheiratet war. Nur kamen ihm auch in dieser Sache Bedenken, wie Wolfhardt ja einer von denen war, die besonders in gesetzterem Alter vor lauter Bedenken zu keiner Betätigung kommen können. Freilich wollte er Arme ernähren, fürchtete darüber aber, die Allerärmsten zu übersehen. In seiner Gegend gab es ja Leute genug, die sich kümmerlich fortbrachten, aber sie brachten sich trotzdem fort. Eigentlich Arme gab es nicht, während in anderen Tälern, besonders in den unfruchtbaren Gebirgsgräben, gewiß auch solche Leute sein würden, die an Entbehrung und Hilflosigkeit zugrunde gehen müssen. Was nun, wenn sein Leben im Fette plötzlich erstickt und die arme Seele muß dem strengen Richter Rede stehen, wie es mit der Nächstenliebe gewesen sei? Ob zur selben Zeit, da er sich seinen Speck geholt, nicht Mitmenschen an Hunger gestorben wären? – Wenn Wolfhardt daran dachte, wurde ihm übel. Eines Tages spannte er seinen Schimmel ein, setzte sich auf den Wagen und fuhr ins Land hinaus, um Arme zu suchen.
So war denn dieser merkwürdige Mensch in unser Alpel gekommen. Er hatte ein breites Gesicht und einen falben Backenbart, der auf dickem Halse wie ein wulstiger Pelzkragen herumlag. Die Äuglein schienen verwachsen zu wollen; das eine war abgestanden, er hatte daran ein »Blümerl«, wie die Leute sagten. Mit dem anderen lugte er schlau hin, und den Kopf mit dem befederten Steirerhute neigte er im Gespräche schief vor, weil er etwas schwerhörig war. Trotzdem sah man ihm die Behaglichkeit an, mit der er in seiner wohlgepolsterten Haut stak. Aber mit unserer Gegend war er nicht ganz zufrieden. Die alten großen Bauernhöfe mit frisch-heiterem Gesinde, die weiten Haferfelder, die saftigen Wiesen und Weiden mit den beleibten Rindern, die schlagbaren Waldungen sahen nicht danach aus, als ob er sich in einem Tal von Notleidenden befände. Doch wies ihn der Ortsrichter in die Grabelhütte. Dort wäre freilich wohl Elend daheim. Hochwasser habe die Wiesen verschüttet, die Lawine eine melkende Kuh begraben, dazu hätten die Leutchen ihr Grundbuch voll Schulden.
Ja, das könnte etwas sein, dachte Wolfhardt, und ließ sein Rößlein gegen die Grabelhütte traben. Vor derselben saß ein altes Mütterlein und kräutete Feldrüben ab. Sie antwortete auf sein Befragen, sie müsse lügen, wenn sie sage, es gehe ihnen gut. Aber zu beißen hätten sie allerweil noch ein bissel was, gesund seien sie auch und das sei die Hauptsache. Auf Borg, wenn er geben wolle, nähmen sie schon, aber schenken hätten sie sich noch nichts lassen müssen. Da sei die alte, kranke Sina oben in der Kohlstatt freilich wohl ärmer dran.
»Ich kann natürlich nur die Ärmsten bedenken,« sagte Wolfhardt, wünschte schön guten Tag und ließ sich von einem Hirtenknaben hinausbegleiten zur Sina in der Kohlstatt. Das Fuhrwerk mußte zu Tale bleiben und der stattliche Herr schnaufte und schnob den steinigen Bergweg hinan, blieb alle zehn Schritte stehen, um sich mit rotem Sacktuch Gesicht, Haupt und Nacken zu trocknen. Zum Glücke für seine Lunge begegnete er der Sina schon unterwegs. Wie eine dünne braune Raupe kroch sie am steilen Berghange herum und sammelte Preiselbeeren in einen Korb. Bis der Korb voll sei, entgegnete sie auf Wolfhardts Anrede, laufe sie mit demselben ins Mürztal und verkaufe die Preiselbeeren.
»Aber Ihr sollt ja krank sein, höre ich?«
»O, freilich wohl. Seit Jahr und Tag krank. Dazu hat mich die Gicht, wissen S'; aber ins Mürztal dermach' ich's schon noch.«
Die ist krank und hat noch dazu die Gicht und lauft mit dem Beerenkorb ins drei Stunden entfernte Mürztal. Andere sind gesund und können nicht einmal das Rückerl Berg herauf.
»Werden Euch die Preiselbeeren wohl gut bezahlt?«
»Das glaub' ich!« kreischte sie lachend auf, »Heuer schon gar, weil's nit g'raten sind. Und die Kindberger Frauen brauchen sie zum Einsieden.«
»Wie viel bekommt Ihr denn für so einen Korb voll?«
»Gar fünf Sechserln hat sie mir gegeben, 's letztemal, die Frau Lebzelterin. Lebt eins davon wieder prächtig eine ganze Woche.«
»Verdient Ihr Euch nicht auch auf der Kohlstatt?«
»Seit etlich' Jahren nimmer. Mein Mann hat dem Riegelberger seinen Wald verkohlt, nachher ist er gestorben. Hock' ich jetzt halt allein in der Hütten und heiz' mir schön warm ein.«
»Die Hütte gehört doch Euch?«
»Ei wo? Wird die Hütten mein gehören! Ist dem Riegelberger seine. Ich wohn' halt gleich so drin und wenn keine Gichtwochen sind und es geht 's Beerengeschäft soweit, aftn fahlt mir nix.«
»Sagt mir, gute Frau, gibt's in dieser Gegend herum nicht irgendwo arme Leute?«
»Arme Leut'?« sagte die Sina langsam nach und besann sich. »Die armen Leut' gfolgen (langen) freilich überall aus. Aber da weitum wüßt' ich nit recht. Müßt nur der Hautjud! Sollt' der Herr nit beim Zwickel-Sommerstall vorbeikommen sein? Dort hat er alleweil gewohnt mit seinen Häuten. Na, dem gehts freilich schlecht.«
Beim Waldbauern hat der Hammerherr näheres erfahren über den »Hautjuden«. Das sei ein armer Hausierer, der seit zwanzig Jahren in Alpel und Umgegend herumgehe, um Tierhäute zusammen zu kaufen. Besonders nach Hunde- und Katzenhäuten, die billig zu haben seien, stehe sein Sinn. Aber auch Wiesel- und Marderfelle, Fuchshäute und Rehdecken könne er brauchen, was manchem Wildschützen schon etliche Groschen eingetragen habe. Gewohnt habe er in schlechten Bodenkammern oder Scheunen oder leerstehenden Ställen, wo er auch seine Hautlager gehabt. Auch ein Jüngel wäre bei ihm gewesen, das in ersteren Jahren mit dem Alten, später selbständig hausieren gegangen und große Bündel von Häuten, aber auch Fetzen, altes Schuhwerk und Knochen, rostiges Blech, Haar von Pferde- und Ochsenschwänzen gesammelt habe und andere Dinge, die in Bauernhöfen unbrauchbar, fast umsonst oder gegen etwas Bandelzeug, Zwirn oder Nadeln an die Hausierer abgegeben werden. Hatten sie einen größeren Vorrat beisammen, so ließen sie ihn mit Ochsen zur Eisenbahn hinausführen und verreisten selbst auf einige Zeit, bis sie plötzlich wieder da waren, Häute, Lappen, und allerlei Trödel sammelten.