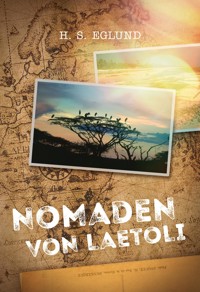
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vicon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein packender Roman mit tiefen Einblicken in Wissenschaft, Mythen und Zeitgeschichte – in drei Teilen: Laetoli – Aksum – Jambiani Der junge Wissenschaftler Martin Anderson steht vor einer glänzenden Karriere. Auf Grönland hat er die verschollene Hafenanlage des Wikingerfürsten Eirik entdeckt. Dafür wird er von der Fachwelt gefeiert. Die Schwedische Akademie in Stockholm bietet ihm ein eigenes Institut. Die Universität in Amsterdam will ihn als Professor verpflichten. Statt dessen geht Anderson nach Tansania. Denn ihn erreicht ein Ruf von Professor Miller, einer Koryphäe der Archäologie. Miller forscht in Laetoli an Millionen Jahre alten Fossilen menschlicher Vorfahren. Der alte Kauz behauptet: Ich habe die ersten Menschen gesehen! „Sind Sie sicher, dass es kein Traum war?“ „Ganz sicher! Ich habe sie gesehen, eine kleine Familie. Ganz deutlich vor mir, wie Sie jetzt. Es war nachts, verhältnismäßig kühl, eine sternenklareNacht. Der Hitzekoller scheidet also aus.“ Andersons Verwirrung wächst, als er Sewe Akashi begegnet, Millers junger Assistentin. Er beschließt, die Australopithecinen auf eigene Faust zu suchen: in Laetoli, der kargen Ödnis am Fuße des erloschenen Vulkans … Fünf Jahre später kehrt Anderson nach Ostafrika zurück. Mittlerweile gilt er als Fachmann für versunkene Zivilisationen, findet Gehör bis in höchste Regierungskreise. In Aksum im Norden Äthiopiens will er nach den Überresten des sagenhaften Goldlandes Punt graben, das in den Annalen der altägyptischen Pharaonin Hatschepsut erwähnt wird. Doch in der Grenzregion zu Eritrea ereilt ihn ein Krieg: Als die Nordallianz Aksum bombardiert, kann Anderson nur knapp flüchten. Mit Mühe und Not schlägt er sich nach Süden durch, zum Ufer des Turkanasees – ins rettende Kenia. Er fühlte die Erschöpfung, Müdigkeit, als hätte er nie im Leben geschlafen. Er streckte sich lang aus. Die Bilder des Krieges marterten sein Gehirn. Zwanzig Tote oder fünfundzwanzig. Einer hatte ein flüchtiges Gesicht, hob sich klar und deutlich aus der Statistik. Noch einmal sah er das Blut und die schlierige Masse zerquetschten Gehirns, hörte die Einschläge der Granaten und die Schreie. Am Ostufer von Sansibar kommt der Wissenschaftler endlich zur Ruhe. In Jambiani bereitet er Millers letztes Manuskript für die Veröffentlichung vor. In Stone Town entsteht das Institut, das er mit Hilfe der Schwedischen Akademie finanziert. Ungeduldig wartet er auf die ersten Studenten. Plötzlich steht Sewe Akashi vor seiner Tür …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
H. S. EglundNomaden von LaetoliDies ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
H. S. Eglund
Nomaden von Laetoli
Roman
1.Auflage
ViCON-Verlag
Niederhasli 2021
H.S. Eglund ist Ingenieur und Publizist. Der gebürtige Leipziger hat als Wissenschaftsjournalist und Reporter aus Afrika unter anderem für „Der Tagesspiegel“, „Frankfurter Rundschau“ und „Die Zeit“ gearbeitet. Seit 2005 ist er als Fachjournalist für erneuerbare Energien tätig.
Schon 1993 veröffentlichte Eglund seine erste Kurzgeschichte: „Die Nonne und das Sterben“. Mit ihr gewann er den Essay-Wettbewerb des Bezirksamtes Berlin-Kreuzberg. Es folgten Geschichten und Essays in mehreren Anthologien bei Elefanten Press in Berlin. 2009 erschien im Verlag Cortex Unit sein Wenderoman „Die Glöckner von Utopia“. Im März 2011 gründete er den Kulturblog Berg.Link, den er gemeinsam mit Urs Heinz Aerni aus Zürich gestaltet. 2016 erschien sein Roman „Zen Solar“, gleichfalls bei Cortex Unit. H.S. Eglund lebt und arbeitet in Berlin-Prenzlauer Berg.
© Urheberrecht: H.S. Eglund
© Urheberrecht und Copyright: ViCON-Verlag
1. Auflage 2021
Lektorat: Andrea Mayer, Berlin, www.textverdelung.de, nach deutschen Normen lektoriert
Verlag: ViCON-Verlag, Heiselstrasse 105, CH-8155 Niederhasli
Internet: www.vicon-verlag.ch
E-Mail: [email protected]
ISBN: 978-3-9524761-9-2
ISBN E-Book: 978-3-9525294-4-7
Satz und Layout: LP Copy Center Wettingen
Foto Autor: Ludwig Rauch
Fotos Cover: H. S. Eglund
Coverdesign: Design Resort Bülach
Druck: online-Druck.biz
Inhalt
Laetoli 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel
Aksum8. Kapitel 9. Kapitel 10. Kapitel 11. Kapitel 12. Kapitel 13. Kapitel 14. Kapitel 15. Kapitel
Jambiani16. Kapitel 17. Kapitel 18. Kapitel 19. Kapitel 20. Kapitel 21. Kapitel
- -
Laetoli
„Ich habe immer gefunden, dass Engel die Eitelkeit besitzen, von sich selbst als deneinzigen Weisen zu sprechen.
Das tun sie mit der zuversichtlichen Unverschämtheit,
die systematischem, vernunftgemäßem Denken entspringt.“
WILLIAM BLAKE
1. Kapitel
Heiß zitterte die Luft. Feiner Staub mischte sich in den dunstigen Hauch, der von Westen über die karstige Ebene zwischen dem Krater des Ngorongoro und der Serengeti trieb. Wie weißes Porzellan glänzte der Himmel und um die blassgrüne Caldera des erloschenen Vulkans ballten sich drohende Wolken. Stumm teilte ein Blitz den Horizont. An den saftigen Hängen des Ngorongoro regnete es bereits, doch die benachbarte Hochebene weiter nordwestlich lag unberührt und verdorrt. Tief fiel das Plateau in eine schmale Schlucht ab, deren trockene Sohle rötlich schimmerte. Das war Olduvai, der Riss am Fuße des Kraters, und die Luft war schwanger von heißer, erbarmungsloser Elektrizität.
„Schauen Sie, das ist Afrika“, sagte Aaron Miller. Seine Stimme klang heiser. „Im Internet und in den Prospekten der Reiseveranstalter wird es Ihnen als Paradies präsentiert. Aber Sie müssen auf der Hut sein. Nirgends liegen Paradies und Hölle so nah beieinander, das sage ich Ihnen.“
Er schluckte, an seinem Hals zuckten Falten.
„Paradies und Hölle, Licht und Dunkelheit. Himmel und Erde, Hoffnung und Furcht, Geburt und Tod. Hier hat die Schizophrenie der menschlichen Rasse ihren Ursprung. Hier im Osten Afrikas.“
Der alte Professor hatte dünne, trockene Lippen in einem roten, sonnenverbrannten Gesicht. Schlohweiße Haare fielen über seine Stirn. Zwischen rissigen, verkrusteten Wangen thronte eine energische Nase. Gebannt starrte er auf das Schauspiel der Elemente.
„In Afrika, Mister Anderson, ist das Paradies in Wahrheit eine Hölle. Lassen Sie sich nicht täuschen.“
Es war die Jahreszeit der kurzen Schauer, die jeden Nachmittag am Ngorongoro niedergingen. Seine saftigen Hänge dampften vom Regen wie ein Dschungel, aber die Schlucht von Olduvai lag offen, ungeschützt und glühend. Das vulkanische Gestein war spröde und knochentrocken, malerische Schichten durchzogen die steilen Wände. Längst hatte die karge Vegetation resigniert.
„Die Leute hier erzählen eine Sage, dass diese Klippen früher den Thron eines weisen Königs trugen“, erzählte Miller. „Eines Tages wird er auferstehen und dann wird es keinen Unterschied mehr geben zwischen dem Himmel und der Unterwelt und dem schmalen Streifen dazwischen, den wir ach so aufgeklärten Europäer die wirkliche Welt nennen.“
Er ließ die Hand sinken und strich sich über das Kinn.
„Was rede ich schon wieder. Die Leute hier ... Sie sehen doch selbst: Olduvai ist der Riss am Rande des Planeten.“
Sein Gesprächspartner war Martin Anderson. Er war blond und viel jünger als der alte Mann, schmal und groß. Noch hatte seine Haut nicht den dunklen Teint angenommen, der sich unter der gnadenlosen Sonne Tansanias einzustellen pflegt.
Schweißnass klatschte Andersons Hemd gegen seinen Rücken, immer wieder wischte er sich mit einem Taschentuch über das Gesicht. Er konnte kaum verhehlen, dass ihm die Predigt des Alten auf die Nerven ging. Dieses Geschwätz von Rasse, Paradies und Hölle.
Insgeheim verfluchte er den alten Mann, sehnte sich nach einer Erfrischung. War er für diesen Unsinn hierhergekommen? Den langen Weg aus Europa? Aus Amsterdam mit dem Flugzeug nach Nairobi, in diese lärmende, stinkende, überhitzte Kloake der kenianischen Metropole; danach mit dem Bus über trockene Pisten bis Arusha, endloser Staub. In Arusha hatte ihm der schwarze Mitarbeiter der Autovermietung die Schlüssel für den Jeep in die Hand gedrückt, für den Sprung zu den Seen von Momella, zum Basiscamp der Archäologen. Dort war es besser, viel kühler. Sanfter Wind spülte über die grasigen Wellen, und die sinkende Abendsonne spiegelte sich auf den Seen, zwischen dichten Kolonien von Flamingos.
Müde bat er:
„Lassen Sie uns hineingehen, Herr Professor. Sonst werden wir nass. Vom Schweiß oder vom Regen.“
Hinter ihnen parkte der Jeep mit dickem Stahlgehörn vorm Kühler. Der Wagen stand an der grauen Wand einer verwitterten Baracke, Olduvai Gorge Visitors Center. Vor der Baracke hockten junge Massai mit farbigen Bändern an der Stirn. Sie warteten auf die Touristen, die sich in dem kleinen Museum drängten. Auch unter dem Schatten spendenden Pavillon am Rand der Schlucht standen Reisende, die ein verstaubter Bus ausgespuckt hatte.
Erstaunt griff Anderson in seine Hosentasche, zog das Handy hervor. Seit der Ausfahrt aus dem Camp am Morgen war es tot gewesen, ohne Verbindung. Nun hatte er plötzlich Empfang, an diesem Vorposten zwischen Hölle und Himmel. Lautlos vibrierte das Gerät, auf dem Display leuchtete eine SMS.
„Ich soll Ihnen Grüße ausrichten von Professor Leiden aus Amsterdam“, las er ironisch. „Sie mögen aufpassen, dass Sie keinen Koller kriegen.“
„Hat er das wirklich geschrieben?“
„Nicht so“, korrigierte Anderson lächelnd. „Er schreibt: Grüßen Sie den alten Globetrotter und greifen Sie ihm ein bisschen unter die Arme.“
„Dieser Leiden, der hat sein Lebtag nichts anderes gesehen als seinen Schreibtisch“, grunzte Miller unwillig. „Hat er Sie gut behandelt?“
„Ich konnte mich nicht beklagen.“
„Bilden Sie sich nicht zu viel darauf ein. So schnell, wie Sie in seiner Gunst steigen, so schnell lässt er Sie fallen. Wie ich hörte, waren Sie vorher an der Universität in Reykjavík.“
„Und in New York. Und in Paris und in Brisbane. Darf ich Ihnen meine Vita zeigen?“
„Seien Sie nicht gleich beleidigt, junger Mann“, knurrte der Alte. „Ich kenne Ihre Meriten. Sie haben ein paar interessante Arbeiten über Wikingersiedlungen auf Grönland publiziert. Sie haben recht, lassen Sie uns reingehen. Ich zeige Ihnen die Artefakte.“
Der Türsteher grüßte Miller, auch die Kassiererin an dem kleinen Tisch hinterm Eingang nickte freundlich. Miller führte seinen jüngeren Kollegen in einen Raum, dessen Wände große Schautafeln und Karten zierten. Längst waren die Farben verblichen, verstaubt, vertrocknet. Am Fliegengitter im Fenster klebten tote Insekten. Unter der Decke quietschte ein altertümlicher Ventilator.
„Lange ist es her, als Mary Leakey in Olduvai die Gebeine der frühesten Homininen ausgrub“, dozierte Miller. „Sie waren so alt, dass sie an der Luft sofort zerbröselten. Damals war ich ein junger Student, nur wenig jünger als Sie heute, Mister Anderson. Mit dieser Entdeckung rückte Afrika in die Schlagzeilen der Fernsehsender und Zeitungen: nicht als Schauplatz des Hungers oder der mörderischen Bruderkriege, nicht als Opfer von Dürren und Heuschrecken, sondern als Wiege der Menschheit. Afrika: Hier begann der Vormensch seine Wanderung bis in die entlegensten Winkel der Erde.“
„Und jetzt kommen die Touristen hierher zurück.“
„Spötteln Sie nur, junger Mann. Ich kam mit derselben Arroganz in dieses Land. Doch was wissen wir schon über Tansania? Abgesehen von den Prospekten für die Touristen …“
Schwitzende, hellhäutige Leiber scharten sich um die Vitrine in der Mitte des stickigen Raumes um ein paar Gipsabgüsse von Fußspuren. Vor Jahrzehnten waren sie freigelegt worden, der schlagende Beweis, dass die frühe Menschheit ihre Wurzeln in Ostafrika hatte. Im Rift Valley, in den grasigen Savannen am Ngorongoro, hatte sich der urzeitliche Affe auf die Hinterbeine erhoben, war er zu seinem langen Weg aufgebrochen. Mit den Ausgrabungen hatten die Australopithecinen, die Südaffen, wie die Wissenschaftler jene Ahnen bezeichneten, zum zweiten Mal das Licht der Welt erblickt.
Unschlüssig standen die Touristen an der Vitrine, sichtlich enttäuscht, dass die erhabenen Vorfahren so erbärmlich und armselig daherkamen: eine Handvoll verlorener Fußspuren, vor dreieinhalb Millionen Jahren in den weichen Tuff des vulkanischen Bodens getreten. Der Museumsbeamte, ein rabenschwarzer Tansanier im Khaki der Ranger, lehnte an der Wandtafel mit dem Stammbaum der Menschheit. Ohne Hast drehte er sich eine Zigarette. Professor Miller senkte die Stimme.
„Die Fakten finden Sie in jedem Lehrbuch der Anthropologie: Es waren zwei aufrecht gehende Frühmenschen, vermutlich eine Frau und ein Mann. Eine dritte, undeutliche Spur deutet darauf hin, dass ein Kind bei ihnen gewesen sein könnte. Offenbar war der Boden warm und leicht formbar von vulkanischer Aktivität. Möglicherweise waren sie auf der Flucht vor einer Eruption des Kraters. Denn kurz darauf ging der Ascheregen nieder, der die Spuren konservierte, über Millionen von Jahren.“
Anderson war froh, dass sich das Gespräch auf die wissenschaftlichen Details verlagerte. Er fragte:
„Wo genau wurden diese Abdrücke gefunden?“
„In der Schlucht von Laetoli. Sie liegt vierzig Kilometer südlich, bei den Nebenkratern Lemagrut und Sadiman. Die Vereinten Nationen haben die originale Fundstätte gesichert. Wenn Sie ein paar Tage warten, bekommen Sie die Erlaubnis, sich die Spuren vor Ort anzusehen. Im Prinzip hat sich dort seit den Ausgrabungen Leakeys nichts verändert. Die Zeit hat hierzulande ein anderes Maß als im fernen Europa.“
Hier gerinnt die Zeit in der Hitze, dachte Anderson. Ströme von Schweiß flossen seinen Rücken hinab. Langsam schoben sich die Touristen zum Ausgang. Der Museumsbeamte wechselte einige Worte auf Kisuaheli mit Miller, dann ging auch er hinaus. Anderson wollte ihm folgen, doch der alte Anthropologe hielt ihn zurück, zog eine Fotografie aus der Tasche.
„Jetzt wollen wir darüber reden, was Sie nicht in den Lehr-büchern finden“, flüsterte er erregt. „Schauen Sie sich das an, bitte!“
Anderson nahm das Bild und drehte sich zum Fenster. Draußen stiegen die Reisenden in den Bus, in die kühle Frische der Klimaanlage, mit der Aussicht auf eine bequeme Fahrt zur Lodge, wo Dusche, Büfett und Swimmingpool warteten. Der Auspuff spuckte Qualm, knatternd fuhr der Bus an, hinterließ Rußwolken über dem braunschwarzen Basalt.
Anderson folgte ihm einige Sekunden mit den Augen, dann vertiefte er sich in das Foto. Es war zerknittert wie ein Taschentuch. Offenbar hatte der Alte die Aufnahme wochenlang mit sich herumgeschleppt. Anderson erkannte Fußspuren, genau wie in der Vitrine. Das musste in Laetoli sein, an der ursprünglichen Fundstelle, am frühen Morgen oder am späten Abend. In diesen Stunden werfen die spärlichen Dornenbüsche der ausgedörrten Vegetation lange Schatten. Die dicke Schutzplane, mit der die archäologischen Kostbarkeiten gesichert wurden, war sorgfältig zur Seite geschlagen. Man konnte jede Einzelheit erkennen. Aufmerksam musterte Anderson das Foto, bevor er es Miller zurückreichte.
„Sehen Sie genau hin!“, beharrte der Alte. „Fällt Ihnen nichts auf?“
Nochmals betrachtete Anderson das Bild, schüttelte den Kopf:
„Die Spuren stimmen mit den Abdrücken hier im Museum überein. Auf den ersten Blick ...“
„Haben Sie nicht gelernt, Ihre Augen zu benutzen?“, fuhr ihn Miller barsch an. „Ich habe Ihre Aufsätze gelesen und Sie hergebeten, weil ich dachte, dass Sie vielleicht etwas von dem verstehen, was hier vorgeht. Also sperren Sie gefälligst Ihre Augen auf!“
Wütend warf er das Foto auf die Vitrine. Widerwillig beugte sich Anderson darüber, ließ seine Augen abwechselnd von der Aufnahme zu den Gipsabdrücken unter der Glashaube gleiten.
„Sir, Ihnen ist eine großartige Aufnahme gelungen. Sie sind sehr früh aufgestanden, um dieses wunderbare Foto zu schießen.“
„Darauf können Sie Gift nehmen, mein Lieber!“ Millers rotes Gesicht färbte sich dunkelrot. „Ich habe unzählige Nächte an diesem Loch zugebracht. Sehen Sie nicht dieses merkwürdige Lichtmuster auf dem Boden der Schlucht? Diese Flecken haben fast genau dieselben Umrisse wie die Spuren. Wenige Minuten nach meiner Aufnahme waren sie verschwunden.“
„Die Sonne ist weitergewandert. Das ist nicht ungewöhnlich.“
„Aber diese Ähnlichkeit! Schauen Sie genau hin!“
Anderson betrachtete das Bild, mehr als vage Übereinstimmung vermochte er nicht zu erkennen. Um die Fußabdrücke herum hatte die Sonne ein dichtes Netz von Lichtflecken ausgelegt, alle mehr oder weniger elliptisch verzerrt.
„Das ist nur ein Zufall, Herr Professor“, murmelte er. „Wissenschaftlich lässt sich daraus nichts ableiten.“
„Ich weiß“, erwiderte Miller, der sich augenblicklich beruhigte. „Einem alten Knacker wie mir wird ohnehin niemand glauben. Ich habe den Afrikakoller, das hat sich sogar bis zu Professor Leiden nach Amsterdam herumgesprochen. Vielleicht stimmt es sogar. Aber in der Nacht vor dieser Aufnahme ist mir der Australopithecus erschienen. Eine Gruppe von drei Individuen, genau wie bei den Fußspuren. Ich blieb noch weitere Nächte dort, ohne dass sich die seltsame Erscheinung wiederholte. Niemals wieder stellte sich ein ähnliches Lichtmuster ein, nicht am nächsten Morgen, auch nicht am übernächsten. Was hat das zu bedeuten? Hat es überhaupt etwas zu bedeuten?“
„Sind Sie sicher, dass es kein Traum war?“
„Ganz sicher! Ich habe sie gesehen, eine kleine Familie. Ganz deutlich vor mir, wie Sie jetzt. Es war nachts, verhältnismäßig kühl, eine sternenklare Nacht. Der Hitzekoller scheidet also aus.“
Anderson schwieg. Fast zärtlich nahm Miller das Foto an sich.
„Ich habe Sie hergebeten, weil ich sichergehen wollte. Beweisen Sie mir, dass ich verrückt bin, dass ich mich verrannt habe. Sie sind jung und neu in Afrika, Ihr Urteil wird ehrlich ausfallen. Ich bin zu lange hier, schon zu verwirrt, stecke viel zu tief drin in diesem ganzen Schlamassel.“
Heftig atmend wandte sich der alte Professor zum Ausgang. Beinahe stieß er mit dem Museumsführer zusammen. Breit lächelte der Ranger, zu Anderson gewandt.
„Sind Sie zum ersten Mal in Tansania, Mister?“
„Ja.“
„Gefällt es Ihnen?“
„Ziemlich heiß hier.“
Demonstrativ fächelte Anderson mit der Hand nach Luft. Unentwegt lächelte der Afrikaner, tiefe Falten um den Mund und auf der schwarzen Stirn.
„Hat Ihnen der Professor das Foto gezeigt? Hat er Ihnen von seiner Begegnung erzählt?“
Anderson nickte. Der Ranger winkte ab:
„Er ist ein herzensguter Mensch, hat viel für dieses Land getan. Bitte helfen Sie ihm, sich nicht zu blamieren.“
Martin Anderson zuckte mit den Schultern. Er ging an dem lächelnden Afrikaner vorbei, vor die Tür, wo die Gewitterhitze unbarmherzig auf der Savanne lastete, auf dem dunklen, heißen Basalt von Olduvai oder Oldupai, wie die Massai sagen. Es ist das Wort, das sie für den wilden Sisal benutzen, eine ungewöhnlich schöne und kräftige Pflanze, die an hoher Staude herrlich blüht und an deren fleischigen, scharfen Blättern man sich leicht die Adern aufreißen kann.
***
„Haben Sie ein Telegramm für mich?“
„Nein, Sir.“
„Wann kommt die nächste Post?“
„Der Bote kommt immer nachmittags. Vielleicht haben Sie morgen Glück.“
„Gibt es hier keinen Handyempfang?“
„Nein, der Router ist ausgefallen. Schon seit Wochen, es ist zum Haareraufen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine Funkverbindung herstellen. Wir haben einen Sender für den Notfall.“
„Nach Amsterdam?“
„Nein, Sir, nach Arusha. Weiter reichen die Antennen nicht.“
Anderson hatte einen Laptop untern Arm geklemmt, mit der anderen Hand wischte er nachdenklich über die holzgetäfelte Rezeption. Kerzengerade stand der Concierge vor ihm, mit feingliedrigen, dunklen Händen und schmalem Goldkettchen am Gelenk.
„Sir, ich tue wirklich, was ich kann. Das sollten Sie wissen.“
„Ja, das weiß ich. Vielen Dank. Wie heißen Sie?“
„George, Sir.“
„Um wie viel Uhr kommt der Postbote, George?“
„Um sechs Uhr, mit dem Fahrzeug, das die Lebensmittel bringt.“
Anderson schaute auf die Uhr hinter der Rezeption. Sie funktionierte.
„Jetzt ist es fünf.“
George nickte steif. „Manchmal kommt der Bote schon eher. Heute zum Beispiel. Das hängt davon ab, in welchem Zustand die Straßen sind. Sir, bestimmt ist Ihr Telegramm morgen dabei.“
Groß und rund hefteten sich seine braunen Augen auf den Gast.
„Kann ich noch etwas für Sie tun?“
„Nein. Ist die Bar schon geöffnet?“
„Offiziell nicht. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen einen Drink. Welchen wollen Sie?“
„Haben Sie etwas gegen Bauchschmerzen? Ich fühle mich nicht wohl.“
George lächelte. „Natürlich, Sir, den Konyagi. Der ist billig und er reinigt den Magen. Aber seien Sie vorsichtig. Es ist erst Nachmittag und hier oben ist die Luft dünn. Konyagi ist eher etwas für kühle Abende.“
„Haben Sie Professor Miller gesehen?“
„Um diese Zeit pflegt der alte Herr seine Aufzeichnungen zu machen. Er möchte nicht gestört werden.“
„Ist er allein?“
„Nein, seine Sekretärin ist bei ihm.“
„Gut.“ Anderson zupfte sich an der Lippe. „Dann bringen Sie mir den Konyagi.“
George nickte ergeben. Beflissen schlüpfte er hinter die Bar, die sich in der Lobby befand, ein paar Treppenstufen hinab, in der Halle, deren nördliche Front hinter den Tischen auf eine großzügige Terrasse wies. Martin Anderson lief auf die hohe Glasfront zu. Ein älteres Ehepaar grüßte ihn kurz. Am Nachbartisch lungerten Jugendliche, möglicherweise Finnen oder Schweden oder Dänen, nein, keine Dänen, denn während seiner Studien auf Grönland hatte Anderson einige Brocken dieser Sprache gelernt, er hätte sie sofort erkannt. Er zwängte sich zwischen den Tischen hindurch, schob die Glastür auf und trat ins Freie.
Ein erfrischender Hauch pfiff um die Lodge. Als er sich über die Brüstung lehnte, blickte er geradewegs in den Krater des Ngorongoro, in diese gigantische, reiche Schüssel, die sich in endlosem Schwung unter ihm ausdehnte. Eisgraue Wolken wälzten sich über den Kraterrand wie Muren aus Schlamm. Träge schoben sie sich über bewaldete Hänge, schickten dichte Regenfetzen in den flachen Grund. Warme Tropfen schlugen Anderson ins Gesicht. Er nahm einen Plastikstuhl, rückte ihn unter das Vordach, dazu stellte er einen kleinen, runden Tisch. Er setzte sich auf den Stuhl, legte den Laptop auf den Tisch und begann, seinen Nacken zu massieren. Die Muskeln fühlten sich hart an. Anschließend lehnte er sich zurück, ließ die Hände unschlüssig sinken. Surrend schob sich die Glastür auf, George brachte den Konyagi. Der Weinbrand war klar wie Regen und als der Concierge den Verschluss aufdrehte, stieg feiner Nebel aus der Flasche.
„Danke“, meinte Anderson. „Ich gieße mir selbst ein.“
Gehorsam stellte George die Flasche, das Glas und einen kleinen Napf mit Eis auf den Tisch. Er klemmte das Tablett unter den Arm und fragte:
„Kann ich Ihnen noch etwas bringen?“
Anderson schüttelte den Kopf. Wieder surrte die Glastür, er blieb allein. Hinter den Wolken glomm zaghaftes Leuchten. Dieser helle Streifen wuchs schnell, als triebe das Licht die Wolken vor sich her. Plötzlich brach die Sonne durch, fingerte mit gierigen Strahlen in den Krater. Gleißendes Licht krallte sich in die Baobabs und die Akazien, die man mühelos erkennen konnte. Ausgelassen tobte eine Horde Paviane über die Terrasse. Wenige Augenblicke später spannte sich der Himmel blau und unberührt über den Ngorongoro, brannte die Sonne auf Andersons Arm. Die Paviane setzten sich auf die Brüstung und hielten ihre Schnauzen in die Sonne. Ein starkes Männchen baute sich vor Anderson auf, beäugte ihn voller Argwohn. Knurrend zog das Tier die Oberlippe hoch und entblößte zwei starke, gelbe Reißzähne.
Erneut schob sich die Glastür auf. Vorsichtig trat der ältere Herr heraus, der Anderson vorhin am Tisch gegrüßt hatte. Er war breit und bullig und er ließ den Pavian nicht aus den Augen.
„Entschuldigen Sie bitte meine Aufdringlichkeit“, sagte er mit ausgeprägtem englischem Akzent, „aber Sie dürfen den Affen nicht so nah an sich heranlassen. Wenn er merkt, dass er Sie in Schach halten kann, macht ihn das übermütig.“
„Was soll ich tun?“, fragte Anderson, ohne sich zu bewegen.
Der Pavian fixierte ihn, zitternd und knurrend.
„Sie könnten ihn verscheuchen“, sagte der Brite. „Treten Sie nach ihm, er wird flüchten.“
Blitzschnell flog seine Hand in die Richtung des Tieres. Mit einem Schrei machte der Affe kehrt, johlend floh die Horde von der Terrasse.
Höflich fragte der Mann:
„Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze?“
„Als Beschützer gegen die Paviane?“
„Nein. Die sind weg, zumindest für heute.“
„Möchten Sie einen Konyagi? Wir können George bitten, dass er uns ein zweites Glas holt.“
„Gern“, erwiderte der Engländer, der kurzes, graues Haar hatte und ein gegerbtes Gesicht mit tiefen Lachfalten und eine Boxernase mit blassen Ringen unter den Augen. Er winkte dem Concierge und holte sich einen Stuhl.
„Diese Affen sind seltsame Geschöpfe“, sagte er. „Im antiken Ägypten wurden sie verehrt als Inkarnation des Gottes Thot, denn diese Kreaturen beten die Sonne an. Das können Sie in den Tempeln von Abu Simbel sehen, in einem dreitausend Jahre alten Wandfries. Oder haben Sie es bei C. G. Jung gelesen? Als er den Jubel der afrikanischen Paviane beim Sonnenaufgang erlebte, schrieb er: Der Augenblick, in dem es Licht wird, das ist Gott. Dieser Augenblick bringt die Erlösung.“
Er streckte die Hand aus.
„Entschuldigen Sie, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Simon Bloomsbury aus London.“
Der junge Wissenschaftler schlug ein.
„Martin Anderson. Sind Sie beruflich hier?“
„Früher war ich oft in Ostafrika“, erzählte Bloomsbury. „Ich habe mit den Leakeys am Turkana-See gegraben, in Kenia, und weiter südlich, das Rift Valley runter.“
„Sind Sie Archäologe?“
„Nein. Ich habe damals in der Botschaft in Nairobi gearbeitet, als Attaché. Wissen Sie, das ist etliche Jahrzehnte her, aber Ostafrika hat mich nie losgelassen. Meine Frau und ich, wir kommen jedes Jahr hierher. Machen Sie Urlaub?“
„Nicht ganz. Kennen Sie Professor Miller?“
„Natürlich. Ich hatte im vorigen Jahr die Ehre, drei Tage mit ihm auf Safari zu verbringen. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch.“
„Wir sind Kollegen. Er hat mich nach Tansania geholt, weil er glaubt, etwas Wichtiges entdeckt zu haben.“
„Darf man wissen, worum es sich handelt?“
Anderson zuckte die Schultern. „Eine Erscheinung. Eine Begegnung. Ich denke, er weiß es selbst nicht genau. Er hat etwas gesehen und jetzt versteigt er sich in eine Idee.“
Bloomsbury wiegte den Kopf. „Ein seltsamer Mensch. Als wir damals in der Serengeti unterwegs waren, suchte uns eines Nachts ein schweres Gewitter heim. Das erleben Sie nur in Tansania, dass Ihnen in wenigen Sekunden alle Zelte wegschwimmen, weil der trockene Boden so viel Wasser auf einmal gar nicht schlucken kann. Also flüchteten wir in die Jeeps. Mit einem Mal tauchte ein großes Hyänenrudel auf und begann, unser Lager zu durchwühlen. Die Safariführer wollten ihre Waffen zücken, aber der alte Miller schaltete die Scheinwerfer seines Wagens ein, stieg in aller Seelenruhe aus und stellte sich vor die Hyänen. Ich sehe seine hagere, gebeugte Gestalt im Regen noch genau vor mir. Die Hyänen zogen sich zurück, duckten sich ins Gras und warteten. Miller wartete auch, stehend, zwei Stunden lang, bis das Gewitter aufhörte und die Sonne kam.“
„Und dann?“
„Dann hat er die Guides zur Sau gemacht. Ob sie nichts anderes im Kopf hätten, als auf die Tiere zu schießen. Auf eure anbefohlenen Kreaturen, wie er sich ausdrückte. Sie hätten ihn erleben sollen: Der Erzengel höchstselbst fuhr mit Blitzen auf seine Opfer nieder, umwoben von dampfenden Schwaden.“
Bloomsbury grinste, glucksendes Lachen schüttelte seinen massigen Körper. George brachte ein zweites Glas. Hinter ihm betrat eine junge Frau die Terrasse. Sie war schlank, hochgewachsen, mit geradem Rücken. Sie trug einen Sarong aus blauem Batik, der ihre Schultern frei ließ. Ihre Haut war viel heller als die pechschwarze Haut der Massai oder als bei George, dem dunklen Kikuyu. Ihre Gesichtszüge waren glatt, verschlossen und ruhig, das Haar streng nach hinten gekämmt und im Nacken gebunden. Sie setzte sich an die Brüstung und legte einen Arm auf das Geländer.
„Das ist die Sekretärin von Mister Miller“, flüsterte George. „Demnach hat er seine Aufzeichnungen beendet. Sie können jetzt zu ihm gehen, wenn Sie wollen.“
Anderson nickte, goss Konyagi in das zweite Glas. George verschwand. Bloomsburys Mund zuckte. Er beugte sich zu Anderson.
„Hat dieser George wirklich gesagt, dass sie seine Sekretärin ist?“
„Ja. Mittags erledigt Miller seine Korrespondenz, sie hilft ihm dabei.“
„Ich weiß nicht, was Professor Miller um diese Tageszeit tut, aber bestimmt schreibt er keine Briefe“, entgegnete Bloomsbury amüsiert. „Ich wette, diese junge Dame dort drüben kann nicht einmal lesen, geschweige denn schreiben.“ Er grinste. „Dieser Miller, alle Achtung. Der versteht was vom Leben.“
Er hob das Glas, stieß es gegen Andersons Konyagi.
„Auf die Hyänen, auf die Paviane und den alten Miller. Sie haben Glück, junger Mann. Sie dürfen mit einer der letzten Legenden dieses paradiesischen Weltzipfels arbeiten.“
Die Sonne knallte auf die Terrasse. Sie war ein Stück über den Himmel gezogen und strahlte in die Fassade, dagegen bot das Vordach keinen Schutz. Anderson glaubte zu spüren, wie sie seine Arme versengte. Zum Glück waren die Schmerzen verflogen, hatte der Konyagi seine Magensäfte neu eingestellt. Die satten, grünen Hänge dampften. Der lange See Makat im Grund des Kraters glänzte blaugrau wie Blech. An seinem Ufer bewegten sich dunkle Punkte. Bloomsbury zog einen Feldstecher aus der Jacke. Langsam ließ er die Linsen über den Ngorongoro schweifen, von den fruchtbaren Quellen im Norden zu den schwarzen Sümpfen am gegenüberliegenden Rand der riesigen Schüssel. Er reichte den Feldstecher zu Anderson.
„Jede Menge Elefanten. Wenn Sie genug Zeit haben, sollten Sie unbedingt eine Safari machen.“
Anderson richtete die Linsen auf den See und die dunklen Punkte. Gemächlich schritten die massigen Leiber zur Tränke, in langer Prozession. Bei jedem Schritt wippten ihre Köpfe, ihre Ohren und die Schultern. Beinahe berührten ihre Rüssel die grasige Erde. Zwischen den Ungetümen flatterten weiße Vögel. Anderson erkannte eine Herde kleiner, braun und weiß gestreifter Antilopen, die jenseits der Elefanten ästen. Er setzte die Gläser ab. Es blieben die gemächlich ziehenden Punkte der Kolosse. Bloomsburys Stuhl scharrte über die Steinplatten.
„Meine Frau und ich wollen noch eine kleine Spritztour in den Krater machen. Sie können das Fernglas ruhig behalten, ich brauche es heute nicht mehr. Geben Sie es nachher bei George ab. Vielleicht treffen wir uns beim Abendessen.“
Anderson nickte und richtete die Linsen erneut auf den See. Die Glastür surrte, sie blieb offen. Ein Geier huschte vor Andersons Augen. Mit gespreizten Schwingen schwebte der große Vogel über den Elefanten, um in respektvoller Entfernung zu landen. Prüfend hielt die Leitkuh ihren Rüssel in den See. Auch die übrigen Tiere erreichten das schlammige Ufer.
***
Als die Sonne hinter die Lodge gesunken war, warf der hohe Giebel scharfe Schatten über den Tisch. Das Licht überm Krater schien eine Spur gnädiger, aber vielleicht täuschte der Konyagi. Anderson fühlte sich matt und ausgelaugt, angekettet an den Stuhl. Vor mehr als zwei Stunden war Bloomsburys Jeep in den Krater eingefahren. Anderson hatte das weiße Safarimobil mit dem Feldstecher verfolgt, bis es zwischen dichten Büschen verschwand. Die Somalierin war aufgestanden und ins Haus gegangen. Ihr Sarong raschelte, als sie leichtfüßig seinen Tisch streifte.
Später hatte er einige Notizen in den Computer getippt, eine Skizze von Millers Fotografie, aus dem Gedächtnis heraus, dazu meteorologische Beobachtungen. Er hatte eine Karte des Kraterumlandes aufgerufen und sie eingehend studiert. Mit der Maustaste scrollte er nach Süden, nach Laetoli. Dort war der Fundort der fossilen Spuren vermerkt: restricted area.
Anderson lehnte sich zurück, ließ den Blick in den Himmel schweifen. Endlich, im Schatten des hohen Giebels, konnte er einigermaßen klar denken. Seltsamerweise dachte er an Grönland, an die kalten Abende in Qassiarsuk, als er die Sonne in der Labradorsee versinken sah. Am Rande der Arktis war es kalt, immer kalt oder wenigstens kühl, sogar im Sommer. Niemals feuerte die Sonne so steil und unerbittlich wie hier. Man konnte sich ganz auf seinen analytischen Verstand verlassen, der in den nördlichen Breiten reibungslos funktionierte. In Ostafrika dagegen war es heiß und es roch nach Verwesung. Die Hitze drückte auf den Magen und er spürte nichts als unbändiges Verlangen nach Erfrischung. Jede Bewegung trieb Schweiß aus der Haut. Jedes Wort kostete Kraft, jeder Atemzug füllte die Lungen mit erstickendem Brodem. Denk an Qassiarsuk und vergiss den alten Mann, sagte er zu sich. Denk an den kühlen Fjord, an das Packeis und an das Eis in deinem Konyagi.
In diese Gedanken schob sich der heisere Vorwurf Millers: Haben Sie nicht gelernt, Ihre Augen zu benutzen? Nachdenklich legte Anderson die Finger an seine Schläfe. Was bildete sich der senile Trottel eigentlich ein? Hatte nicht Miller selbst bestätigt, dass er, Martin Anderson, ein fähiger Wissenschaftler war? Dass er durchaus gelernt hatte, seine Augen aufzusperren? An Grönlands Küste hatte er Stück für Stück des Puzzles zusammengesetzt, bis er endlich Eiriks Hafen gefunden hatte: eine Handvoll verrotteter Holzpfähle im knietiefen Schlick. Weil niemand vor ihm an dieser Stelle gesucht hatte, waren die stummen Zeugen der Wikinger tausend Jahre lang verborgen geblieben, eingebettet in Salz und Sedimente. Nein, du warst es, der Eiriks Hafen aufgespürt hat. Weil du die Augen aufgemacht hast. Lass dir nichts einreden, du bist kein Schuljunge mehr.
In diesem Augenblick kam George auf die Terrasse, mit frischem Eis und einem Telefon. Seine weißen Zähne blitzten, als er strahlend verkündete:
„Ein Ferngespräch für Sie, aus Europa.“
Hastig griff Anderson nach dem Hörer, in dem die näselnde Stimme von Professor Leiden knarrte, Dekan der Fakultät in Amsterdam.
„Hallo, Herr Kollege“, säuselte Leiden. „Schön, dass ich Sie endlich an die Strippe kriege. Habe es auf Ihrem Handy versucht, aber das scheint gestört.“
„Der Empfang ist gestört, meistens. Wir kommen nur per Funk bis Arusha durch. Dass ich Ihren Anruf entgegennehmen kann, grenzt an ein Wunder.“
Leiden lachte, keckernd wie ein junger Fuchs.
„Wie ist es bei Ihnen? Sehr heiß?“
„Unglaublich heiß. Und unglaublich schwül. Das macht es nicht einfacher …“
„Einfacher – womit?“
Anderson war versucht, seine ersten Eindrücke unverblümt zu schildern. Aber er traute dem einflussreichen Dekan nicht. Ein Instinkt warnte ihn und Millers knappe Worte: Gunst war etwas, das man bei Leiden schnell gewann und ebenso schnell verlieren konnte.
„Nun ja, immerhin bin ich zu Besuch bei einer Koryphäe.“
„Haben Sie Stress mit ihm?“
„Vermutlich ist es der Jetlag. Ich muss mich erst an das Klima gewöhnen. Auf Grönland wird es nicht halb so heiß.“
„Sie sagen es, Herr Kollege. Wie macht er sich denn, unser Alterchen? Ich habe ihn zwanzig Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen. Haben Sie dieses Phantom tatsächlich getroffen? Ich beneide Sie. Miller ist eine Legende, im wahrsten Sinne des Wortes.“
„Wenn Sie einverstanden sind, tauschen wir die Rollen. Sie kommen nach Tansania, ich übernehme Ihren Job in Amsterdam.“
„Oha! Sind das nicht gewagte Ambitionen für einen aufstrebenden Forscher wie Sie?“
„Ich dachte eher daran, Ihnen eine Auszeit im herrlichen Osten Afrikas zu ermöglichen“, erwiderte Anderson sarkastisch. „Die Touristen geben viel Geld aus, um den Ngorongoro zu sehen oder das weltberühmte Museum von Olduvai. Es ist sehr reizvoll, wissen Sie. Bestimmt reizvoller als Ihr Amt an der Universität. Einen Sack Flöhe zu hüten erscheint mir leichter.“
Anderson hatte einen Scherz versucht, um sich selbst zu ermuntern. Kaum waren seine Worte durch den Äther und die Drähte nach Amsterdam geeilt, vereiste Leidens Stimme.
„Der Sack Flöhe, von dem Sie so rührend sprechen, sind honorige Professoren und ihre Mitarbeiter. Allesamt gestandene Experten ihres Faches. Ich stelle mir vor, dass es mit einem einzigen Floh wie Aaron Miller viel schwieriger ist. Um in Ihrem Bilde zu bleiben.“
„Verstehe“, gab Anderson trocken zurück. „Sie wollen nicht tauschen. Ich kann Sie einfach nicht locken. Schade. Also werde ich hier weiterhin die Augen aufhalten.“
„Tun Sie das, geschätzter Kollege. Wir setzen große Hoffnungen in Sie. Miller geht demnächst in Ruhestand. Zuvor muss er seinen Lehrstuhl übergeben. Möglicherweise an Sie. Das ist Ihre Chance, den Alten zu beerben. Was nützt uns eine Legende, die irgendwo im afrikanischen Busch verschollen ist?“
„Da haben Sie recht, Herr Dekan.“
„Wie lange werden Sie ungefähr in Afrika bleiben?“
„Das hängt davon ab, wann ich die Genehmigungen bekomme. Sagen wir, eine Woche oder zwei.“
„Sie bekommen einen Monat, wenn Sie Miller zur Räson bringen. Er muss nach Amsterdam kommen, um seinen Nachfolger einzuarbeiten. Danach kann er von mir aus wieder im Busch verschwinden, auf Nimmerwiedersehen.“
„Okay, ich werde es ihm ausrichten.“
Leiden schwieg, in der Leitung knackte es, zirpten elektrische Grillen. Plötzlich lachte er.
„Hat er Sie sehr hart rangenommen, der alte Quälgeist?“
„Na ja. Er sagte, ich solle gefälligst meine Augen aufmachen. Sicher ein gut gemeinter Tipp.“
„Todsicher, darauf können Sie Gift nehmen. Machen Sie sich nichts daraus. Er war es, der Sie angefordert hat. Weil Sie Eiriks Hafen ausgegraben haben. Offenbar hat ihm das imponiert. Er kann es nur nicht richtig zeigen. Seien Sie nachsichtig mit ihm.“
„Bin ich, versprochen.“
„Na gut, dann will ich Sie nicht weiter stören. Ich hatte mir Sorgen gemacht, weil ich Sie auf dem Handy nicht erreichen konnte.“
„Danke, Herr Dekan. Sehr freundlich von Ihnen.“
„Gern geschehen. Und halten Sie mich auf dem Laufenden, bitte. Wissen Sie, Aaron Miller ist vielleicht ein seltsamer Kauz. Aber er hat auch gute Seiten.“
Leiden hängte auf, die Grillen verstummten. Anderson legte den Hörer zurück und bemerkte erst jetzt, dass George die ganze Zeit wie ein geschnitzter Götze neben ihm gestanden und gewartet hatte. Wortlos trug er das Tablett zur Bar.
***
Eiriks Hafen. Vor tausend Jahren angelegt, bildete der hölzerne Kai das Sprungbrett zum amerikanischen Festland, nach Helluland und nach Vinland. So berichtete Leif Eiriksson, so überlieferten es die Sagas. Und bezeugen das Scheitern. Nach verlustreichen Scharmützeln mit Indianern – Skraelingar – kehrten die Seefahrer nach Grönland zurück. Nicht nur dieser Expedition war kein Glück beschieden. Innerhalb weniger Jahrhunderte verfiel die kleine, isländische Kolonie an den zerklüfteten Westfjorden, sie überlebte das Mittelalter nicht. Von ihren Wurzeln in Island und Skandinavien abgeschnitten, ging sie elend zugrunde. Inzucht schwächte die Kolonie, brachte Seuchen und Verkrüppelung. Den Rest erledigten die Angriffe der Inuit. Und die Zeit, die alle Spuren verwischte. Fast alle.
So wurde den Nachfahren Eiriks das gelobte Grünland zur Falle, der niemand entrann. Bei diesem Gedanken stockte Martin Anderson. Es war eine paradiesische Falle: Denn dieses Land, diese große, weite Insel am arktischen Meer war wunderschön. Aufgewachsen an der rauen Nordsee, war ihm das karge, eisige Grönland sofort vertraut gewesen. Er liebte den eisigen Ozean, durch den die Wale zogen auf ihrer Jagd nach Plankton. Er liebte die kreischenden Möwen, die sich gegen den steifen Wind stemmten, und das Geräusch der Wellen an den eisigen Zungen der Gletscher. Vor allem liebte er die Kühle, die klare, salzhaltige Luft und den weiten, endlosen Blick über den Schnee. Als er schließlich am Strand von Brattahlid stand, kam ihm Leif Eiriksson auf seltsame Weise vertraut vor. Es war Juni und ein sanfter Hauch drückte die grünen Flechten gegen das Gestein.
Dagegen Afrika, das Paradies, von dem Aaron Miller schwärmte: Hier gab es nichts, was ihn anzog. Im Gegenteil: Gnadenlos lähmte die Hitze jeden Elan, jede Imagination, drückte bleischwer auf die Gedanken. Er war Millers Ruf gefolgt, weil der alte Professor als Koryphäe der Anthropologie galt. Anthropologie, die Wissenschaft vom frühen Aufbruch des Menschen, vom Beginn seiner Wanderschaft durch die Jahrmillionen. Professor Leiden hatte ihm geraten: Das ist Ihre Chance. Wenn Sie wollen, können Sie den Alten beerben. Seit Jahren war Millers Lehrstuhl in Amsterdam verwaist. Man munkelte, dass der alte Kauz sogar ein traumhaftes Angebot aus Harvard abgelehnt hatte. Lieber zog er es vor, in Tansania zu bleiben.
Seufzend vertiefte sich Anderson in seinen Laptop. Nie hatte er sich sonderlich für Millers Fachgebiet interessiert. Afrika lag für ihn weiter ab als die Antarktis. Sein Thema waren die Wikinger, eine Nation von Seefahrern wie zuvor die Phönizier oder die Polynesier. Die Wikinger fuhren nach Grönland und Amerika, als sie bereits Schwert, Kreuz und Schrift kannten.
Mit Ostafrika hatte dies wenig zu tun. Hier war die Zeit seit Jahrmillionen stecken geblieben, eingedampft in der Glut einer gnadenlosen Sonne. Seit dem Auszug der Frühmenschen hatten die Völker Afrikas keinen signifikanten Beitrag zur Zivilisation geleistet. Kein herausragendes Seefahrervolk schlug hier seine Boote an. Keine bahnbrechende Idee nahm hier ihren Ursprung. Der Schwarze Kontinent war ein schwarzes Loch, in dem Milliarden Dollar Entwicklungshilfe versanken, ein Fass ohne Boden, das Herz der Finsternis.
Der junge Forscher vertiefte sich in einen Bericht der Weltbank. Es war niederschmetternd: Nicht nur, dass Afrika keinen nennenswerten Beitrag zum Fortschritt geleistet hatte. Es schien sich gegen jede segensreiche Gabe der Zivilisation zu sperren. Trotz Milliardenhilfen gediehen weder Wohlstand noch Demokratie, sondern Berge von Unrat, Schmutz und Leichen.
Er dachte: Als ob die ersten Menschen diese verlorene Weltecke verlassen mussten, um anderswo, in Europa und Asien, zur vernunftbegabten Spezies zu reifen. So gesehen, hatte Miller nicht unrecht: Sie waren aus dem Paradies geflüchtet, weil es die Hölle war. Verbrannte Erde statt Garten Eden. Darüber konnte der malerische Ngorongoro nicht hinwegtäuschen, dessen vielfältige Pflanzen und atemberaubende Fauna wie das Überbleibsel grüner Vorzeit schienen: üppiger, unberührter Dschungel.
Millers rauer Bass riss ihn aus den Gedanken. „Ich dachte, Sie sind auf Safari.“
Ohne Umschweife setzte sich der Professor an Andersons Tisch. Er nahm die Flasche, warf einen Blick auf das Etikett.
„Konyagi, nicht schlecht. Haben Sie Probleme?“
„Nicht mehr. Die Hitze hatte sich auf meinen Magen gelegt, aber jetzt ist alles bestens.“
„Seien Sie vorsichtig, der Abend fängt erst an.“
Miller faltete die Hände und musterte sein Gegenüber aus kleinen Augen.
„Wie ich hörte, hatten Sie ein Telefonat mit unserem Dekan.“
„Hat es Ihnen George erzählt?“
„In Afrika hören sogar die Wände mit. Vermutlich hat Ihnen dieser Schwätzer in den Ohren gelegen, dass ich nach Amsterdam kommen soll. Um meinen Schreibtisch frei zu machen. Leiden will mich aufs Altenteil abschieben, der feine Herr Dekan.“
„Hat er Sie in den vergangenen zwanzig Jahren wirklich nicht zu Gesicht bekommen? Sind Sie tatsächlich ein Phantom? Ein legendäres Phantom?“
Miller feixte.
„Hat er es so gesagt, auf diese Weise? Der Schlawiner, hat es selber faustdick hinter den Ohren.“
„Wie meinen Sie das?“
„Der hat seine Schäfchen längst im Trockenen. Was ihm noch fehlt, ist die Amtskette des Rektors.“
„Und ein Professor, der in Amsterdam Vorlesungen hält. Sie haben gut reden, als wohldotierter Ordinarius. Niemand kann Ihnen vorschreiben, was Sie zu tun und zu lassen haben.“
„Das stimmt, Gott sei Dank. Doch hat Ihnen unser verehrter Dekan nicht erzählt, dass meine Professur ruht? Dass meine Bezüge in eine Stiftung fließen, aus der er freie Dozenten bezahlt? Diese Leute vertreten mich und sie vertreten mich gut, soweit ich das beurteilen kann.“
„Bekommen Sie keine Forschungsgelder?“
„Um ehrlich zu sein, die Anträge verursachen mir zu viel Aufwand. Dieser ganze Papierkram, ich hasse ihn. Für mich brauche ich nur ein schmales Budget. Schauen Sie, hier in der Crater Lodge habe ich freie Kost und Logis. Weil mich manchmal sehr vermögende Reisende besuchen, wie zum Beispiel das Ehepaar Bloomsbury. Ich habe den Nimbus eines modernen Livingstone. Die Leute lieben solche Legenden.“
„Wenn sich die Leute um Sie reißen, warum wollen Sie ausgerechnet mit mir arbeiten?“
Miller wurde ernst.
„Weil Sie es wie ich lieben, draußen zu sein. Im Grunde sind wir der Feldforschung verfallen, dem Abenteuer. Weil Sie frischen Wind um die Nase höher schätzen als den Staub einer Amtsstube.“ Er zögerte. „Weil Sie genauso ein Eigenbrötler sind wie ich. Und weil ich wählerisch geworden bin. Meine Zeit läuft langsam ab, verstehen Sie?“
Eine Pause entstand. Ohne Vorwurf in der Stimme sagte Miller:
„Es macht mir nichts aus, wenn Sie morgen früh zurückfahren. Ich kann Sie nicht zur Zusammenarbeit zwingen. Diese Entscheidung lege ich in Ihre Hände.“
„Ich habe nicht vor abzureisen“, widersprach Anderson. „Obwohl ich zugeben muss, ein wenig verwirrt zu sein. Ich habe ein völlig anderes Arbeitsgebiet als Sie, die Wikinger im hohen Mittelalter. Wie passt das mit Ostafrika zusammen, Herr Professor?“
Miller hob die Brauen.
„Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie den Winter auf Grönland in einem Zelt zubrachten, ganz allein. Stimmt das?“
„Ich wollte wissen, wie es ist, an einer rauen Küste zu stranden. Wie es sich anfühlt.“
„Wie es sich anfühlt, soso. Sie wollten verstehen, was die Wikinger über den Atlantik getrieben hat, nicht wahr?“
„Ich könnte nicht einmal genau sagen, wonach ich suchte. Ich weiß nur: Da war eine Suche, tief in mir. Eine unbestimmte Suche, mit unbestimmtem Ziel.“
Miller holte eine schmale Broschüre aus seinem Hemd und legte sie auf den Tisch.
„Das ist Ihr Bericht über die Entdeckung von Eiriks Hafen. Sie erwähnen isländische Sagas, die Sie während des Winters lasen. Sie beschreiben zahlreiche Naturerscheinungen, die Sie verblüfften. Zum Beispiel das Polarlicht als Signal zum Aufbruch von Leifur Eirikssons erster Expedition nach Vinland. Das ist hübsche Prosa, aber keine wissenschaftliche Arbeit. Das hat Ihnen den Vorwurf der Gefühlsduselei eingebracht, wenn ich mich der Fachpresse richtig entsinne.“
„Mag sein“, hielt Anderson dagegen. „Doch ich habe Eiriks Hafen gefunden. Der Erfolg gab mir recht.“
„Stimmt, sehe ich ebenso. Warum also wollen Sie mir einreden, dass meine Beobachtungen in Laetoli unwissenschaftlich seien?“
Anderson schwieg. Miller wandte das Gesicht zum Krater, über den die Wolken einen zarten Saum zauberten, rosa glänzend. Fast berührte die Sonne den Kraterrand. Er fuhr fort:
„Ich werde das Gefühl nicht los, dass unsere feine, wissenschaftliche Analytik nur taugt, das Wesentliche zu übersehen. Beantworten Sie mir eine Frage: Warum wanderten die Wikinger nach Grönland und danach zur amerikanischen Küste? Was trieb sie übers Meer? Warum wanderte der Frühmensch aus Ostafrika aus?“
„Nach neuesten Untersuchungen soll sich vor fast drei Millionen Jahren das feuchte, tropische Klima geändert haben“, zitierte Anderson aus einem Bericht, der in seinem Laptop steckte. „Damals entstand die trockene, grasige Savanne. Das ist nur eine Theorie. Noch wissen wir zu wenig.“
„Ich kenne diese These. Klimatische Verschiebungen im Nordatlantik werden dafür verantwortlich gemacht oder die Land-brücke von Panama oder tektonische Bewegungen in Indonesien. Das sind nebensächliche Details. Wenn Sie von Millionen Jahren sprechen, können Sie leicht um hunderttausend irren. Der fossile Fund des Kenyanthropus platyops wird auf 3,5 Millionen Jahre geschätzt, der Ardipithecus ramidus aus Äthiopien gar auf 4,4 Millionen Jahre. Und der unlängst gefundene Jahrtausendmensch aus den Bergen von Tugen in Kenia soll sechs Millionen Jahre alt sein. Früher oder später werden wir unsere ganze, nette Sippe genau kennen. Beantwortet das meine Frage? Warum wanderte der frühe Mensch aus Ostafrika aus? Wohin brach er auf? Leiteten ihn die Sterne? Oder ein innerer Kompass?“
„Vielleicht sollten Sie Philosophie lehren, Herr Professor. Kosmologie.“
„Eher Psychologie“, verbesserte ihn Miller. „In all den Jahren meiner Forschungen in Afrika ist mir klargeworden, dass es einen Grund geben muss, warum der Homo sapiens zum globalen Nomaden wurde. Vielleicht war es ein angeborener Wandertrieb. Tiere und Pflanzen passen sich der veränderten Umwelt an, wenn sie neue Räume erobern. Doch beim Menschen ist das anders: Sofort beginnt er, den neuen Lebensraum nach seinen Bedürfnissen zu verändern. Zu verwüsten, müsste man genauer sagen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Unser Gehirn, unsere Werkzeuge, unsere Sprache, diese ganze Zivilisation sind eine Folge dieses Expansionstriebs.“
„Immerhin sind wir damit erfolgreich. Kein anderer Säuger hat es geschafft, sich mit sieben Milliarden Exemplaren über die Erde zu verbreiten.“
„Ob das ein Erfolg ist, bleibt abzuwarten.“
„Vermehrung ist das Ziel der Evolution, oder nicht?“
„Vermehrung von Leben in seiner Gesamtheit, als ausbalanciertes Ökosystem, aber nicht einer einzigen Spezies“, brummte Miller. „Sieben Milliarden Menschen sind ein Erfolg, wenn man wie ein Buchhalter rechnet.“
Die Sonne erreichte die Kammlinie, ließ die Wolken erglühen. Dunstige Schatten senkten sich in die Caldera. Zikaden zirpten von den Hängen vor der Lodge. In den Baumwipfeln hockten große Vögel, ausgelassen schnatternd. Aus dem Krater drang die schrille Trompete der Elefanten. Plötzlich rollte tiefes Grollen über den Ngorongoro, ein starkes, dumpfes, weittragendes Keuchen aus den riesigen Lungen eines starken Löwen. Beiläufig sagte Miller:
„Vorhin kam ein Telegramm aus Dar.“
„Was für ein Telegramm? Ich habe George gefragt ...“
„Vergessen Sie George. Das Telegramm kam mit dem Truck, der die frischen Vorräte bringt.“
Miller entfaltete den Zettel und gab ihn Anderson.
„Ihre Erlaubnis für Laetoli ist nicht vor Ende der Woche zu erwarten. Die Behörden wollen sich vorher in Amsterdam erkundigen.“
Anderson las den Text, auf einem gedruckten Formular, mit blassblauer Tinte gestempelt. Als Absender war das Department für Nationale Archive in Dar es Salaam angegeben. In der Zeile für den Empfänger stand sein Name: Dr. Martin Anderson. Jemand hatte ihn fein säuberlich ausgestrichen und darüber gesetzt: Professor Aaron Miller, Arusha. Säuerlich meinte Anderson:
„Dann sitze ich mindestens fünf Tage untätig herum.“
Vorsichtig nahm ihm Miller den Zettel aus den Fingern und verstaute ihn in seinem Hemd.
„Eine Menge Freizeit“, bestätigte er. „Haben Sie Lust, den Ngorongoro zu sehen? Und danach die Serengeti?“
2. Kapitel
Martin Anderson erwachte unter einem Moskitonetz, das von der Decke hing. Neben dem Bett stand ein Schemel, darauf hatte er den Rucksack gestellt. Auf dem Boden lagen seine Jeans und eine Jacke, die er gestern Abend auf der Terrasse benutzt hatte, als mit der Dunkelheit ein kühler Wind über die Hänge des Ngorongoro gekrochen war. Es war ein irres Gefühl, hoch über dieser wabernden Pfanne zu stehen, in beinahe vollkommener Nacht. Aus der Lobby fiel spärliches Licht, bis George um Mitternacht die Generatoren abstellte und die Gäste auf die Zimmer bat, wegen der Leoparden, die sich gelegentlich zur Lodge verirrten. Daran erinnerte er sich jetzt, als er die Augen öffnete: an den lärmenden Busch im Krater, an diese schwarze, geheimnisvolle Wand.
Er lüftete das Moskitonetz und rollte sich von der Matratze. Das Wasser aus der Dusche war lau. Es schmeckte abgestanden, er spülte mit Konyagi nach. George hatte ihm gestern eine Flasche auf das Zimmer gegeben, falls die Magenschmerzen erneut einsetzten. Anderson rasierte sich, kramte eine bequeme Leinenhose aus dem Rucksack und eine strapazierfähige Weste. Dazu schnürte er derbe Stiefel an seine Füße. In der Hosentasche verstaute er ein Notizbuch, ein Taschenmesser, Sonnengläser und Öl gegen die Insekten.
Als er vor die Tür trat, parkten im Hof weiße und grüne Landrover. Junge Männer lungerten rauchend an den Autos. Er ging in die Lobby. Der Speisesaal war voll von Touristen. An den Tischen und auf der Terrasse tummelten sich Reisegruppen. Vor der Rezeption stapelte sich Gepäck. George stand am Tresen, sprach mit einem Kofferträger in rotem Overall. Hinter der Lobby gähnte milchiges Nichts. Der Vulkan war verschwunden. Gespenstisch schälte sich ein großer Baobab aus dem Dunst. Anderson erkannte die Bloomsburys und Miller, der mit den Engländern am Tisch saß. Vor dem Alten standen ein Glas Tee und ein kleiner Teller mit Zwieback.
„Guten Morgen, Herr Kollege“, rief Miller jovial. „Gut geschlafen?“
„Ausgezeichnet“, bestätigte Anderson. „Hier oben gibt es zum Glück kaum Mücken.“
„Wie geht es Ihrem Magen?“
„Alles in Ordnung.“
Miller lächelte blass. Er wies auf eine Gruppe junger Touristen, die sich an der Rezeption sammelte.
„Diese Meute wird uns bei unserer Safari öfter über den Weg laufen. Sie haben fünf Jeeps, als wollten sie den Krater durchkämmen.“
Anderson spürte heftigen Hunger. Er lief zum Büfett, wählte Mango und Ananas, dazu etwas Toast mit trockenem Käse und ein Ei. Gerade wollte er zu Millers Tisch zurückkehren, als die junge Somalifrau durch die Lobby kam. Ihr Gesicht war verschlossen wie gestern auf der Terrasse. Sie trug einen olivgrünen Anzug aus Khaki, sah aus wie eine Rangerin. Anderson jonglierte seinen Teller durch enge Stuhlreihen zurück zu Millers Tisch. Beinahe stieß er mit der jungen Frau zusammen.
„Mister Anderson, das ist meine Mitarbeiterin Mary Sewe Akashi aus Nairobi“, sagte der Professor förmlich und erhob sich aus seinem Stuhl. „Miss Akashi ist Botanikerin.“
Er wandte sich an die junge Frau.
„Mary, das ist der hoffnungsvolle Kollege aus Amsterdam, von dem ich dir erzählt habe. Er ist für einige Tage unser Gast.“
„Herzlich willkommen in Ostafrika, Mister Anderson“, erwiderte sie ruhig. Ihre Augen waren klar und ohne Hast. „Haben Sie sich schon eingelebt?“
„Ich glaube schon.“
„Gut. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.“
Sewe setzte sich an den Tisch. Auch Miller und Anderson nahmen Platz. George kam heran. Die junge Frau bestellte Kaffee, Anderson ließ sich einen Tee bringen. Der Tee schwappte grünbraun im Glas. Interessiert fragte Sewe:
„Mister Anderson, wie war es gestern in Olduvai?“
„Ich hatte bisher wenig mit Archäologie und Frühmenschen zu tun“, antwortete er verlegen.
„Mein Gebiet sind die Völker des Nordens, die Wikinger. Sie gehören eher in die Geschichte des Abendlandes, der westlichen Zivilisation.“
„Ich weiß“, sagte sie. „Was, glauben Sie, verbirgt sich hinter den Beobachtungen unseres Professors?“
Anderson köpfte das Ei. Er fühlte sich verhört. Demonstrativ schob Miller einen Zwieback zwischen seine Lippen und kaute still. Es war nicht sicher, ob er zuhörte.
„Das ist eine schwierige Sache. Ich bin eher vorsichtig.“
„Das ehrt Sie, Martin“, ließ Sewe nicht locker. „Ich arbeite hier seit über zwölf Jahren. Noch nie habe ich solche Lichter gesehen. Diese Erscheinung ist sehr rätselhaft, meinen Sie nicht? Erst recht diese mysteriöse Begegnung in Laetoli, mitten in der Nacht.“
Anderson schwieg, flüchtete zum Toast. Miller brummte:
„Mein lieber Kollege glaubt nicht an solche Phänomene, an solche Lichter, höchstens ans Nordlicht. Eigentlich glaubt er überhaupt nichts. Er ist ein Wissenschaftler, Miss Mary. Da zählen nur Beweise, handfeste Beweise. Fakten, Fakten, Fakten. Der akademische Zweifler ist nicht so leicht zu überzeugen, verstehen Sie?“
„Darum geht es nicht, Aaron“, wies sie den Alten milde zurecht. „Unser Gast will sein Urteil nicht fällen, bevor er sich mit eigenen Augen überzeugt hat.“ Aufmerksam richtete sie ihre Pupillen auf ihr Gegenüber. „Habe ich nicht recht, Martin?“
Anderson wollte etwas entgegnen, aber George erschien am Tisch.
„Der Guide sagt, dass Sie jetzt starten können. Die Verpflegungspakete sind fertig. Der Nebel wird sich schnell lichten.“
„Gut, danke, George“, murmelte Miller und schob den Zwieback von sich. „Sag dem Guide, er soll eine Plane mitnehmen für den Fall, dass die Hitze zu groß wird. Ich erwarte unglaubliche Hitze.“
„Es sieht ganz danach aus“, nickte der Concierge. „Ich habe Ihnen einen Kühltank reserviert. Das war nicht leicht. Wir haben heute sehr viele Gruppen.“
„Du wirst es weit bringen, mein Junge. Sehr gut, danke.“
George lächelte, entfernte sich zur Rezeption. Miller knüllte eine Serviette auf den Tisch und hievte sich aus dem Stuhl.
„Wir treffen uns am Wagen“, ächzte er. „Fragen Sie nach Isaak. Er ist unser Guide.“
Miller lief zwei Schritte vom Tisch, dann drehte er sich um.
„Dieser Isaak ist der beste Safariführer in ganz Ostafrika. Es wird bestimmt ein wunderbarer Tag.“
Als der Alte zur Rezeption schlurfte, wunderte sich Anderson, wie dünn er war. Holmen gleich baumelten seine Arme von dürren Schultern, als wären sie genietet. Er wandte sich an Sewe.
„Woher kennen Sie den Professor?“
„Aus Addis Abeba. Ich habe dort als Übersetzerin gearbeitet. Der Professor verhandelte mit den äthiopischen Behörden über eine Analyse von Schädelfunden aus Hadar. Sie liegen in Addis im Nationalmuseum. Er suchte jemanden, der Amharisch spricht. Wir lernten uns zufällig in der Bibliothek kennen.“
„In welcher Bibliothek?“
„In der Universität von Addis, in der alten Kaiserresidenz. Später saßen wir oft stundenlang im Park und redeten. Er wollte viel über Ostafrika wissen, schier unersättlich.“
„Deshalb sind Sie ihm nach Tansania gefolgt?“
„Nicht sofort. Ich bekam eine Stelle bei den Vereinten Nationen in Nairobi. Ich habe dort ethnobotanische Kataloge aufgebaut. Vor drei Jahren traf ich den Professor in Arusha wieder.“
„Er wird bald nach Europa zurückgehen. Bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet, muss er seinen Lehrstuhl übergeben. Werden Sie ihn nach Amsterdam begleiten?“
Langsam schüttelte Sewe den Kopf.
„Der Professor geht nirgendwo hin, nie mehr. Er ist endgültig angekommen, hier, in Tansania.“
Sie lächelte mild, als spräche sie zu einem Kind. Dabei glitt ihr Blick auf die Terrasse, die taufeucht glänzte. Noch immer waberten die Nebel aus dem riesigen Krater. Goldiger Glanz lag auf den Schwaden. Leise fragte sie:
„Er ist so dicht davor zu finden, wonach er sucht. Warum sollte er ausgerechnet jetzt nach Europa zurückgehen?“
„Er hat Verpflichtungen. Seine Studenten und die Kollegen.“
„Die Studenten und die Kollegen, ach so. Ich habe drei seiner Studenten kennengelernt, die den Weg zu ihm nach Afrika gefunden haben. Keiner von denen ist nach Amsterdam zurückgekehrt. Ein junger Mann blieb in Nairobi bei der Umweltbehörde. Er setzt meine Arbeiten fort. Die beiden anderen sind nach Kapstadt gegangen, an die Universität. Die vielen anderen jungen Leute, die irgendwo auf der Welt in einem Hörsaal sitzen und nur auf ihren Professor warten, sind vollkommen uninteressant. Denen reichen die Bücher.“
„Millers letzte Veröffentlichung liegt zwanzig Jahre zurück“, wandte Anderson ein. „Im Prinzip zehrt er von früherem Ruhm.“
„Bevor Aaron nach Afrika kam, hat er auf der ganzen Welt geforscht und gelehrt, ganz im Sinne seiner hochgeschätzten Wissenschaft. Zehn Jahre länger in dieser Tretmühle hätten dem nichts Wesentliches hinzugefügt.“
„Zwanzig Jahre in Afrika offenbar auch nicht.“
„Das können Sie nicht beurteilen“, sagte sie nachsichtig. „Sie sind ja erst zwei Tage hier.“
Ihr Lächeln war entwaffnend. Auch Anderson musste lächeln. Draußen schlich ein junger Pavian über die Terrasse, lugte neugierig in die Lodge. Überm Krater breitete sich die Sonne aus. Rasch hob sich der Nebel. Schon schimmerte der Makatsee aus der dunstigen Tiefe. Sewe stand auf.
„Wir treffen uns am Wagen. Denken Sie bitte daran: Es wird sehr heiß heute. Nehmen Sie ein paar Tücher mit, für den Nacken und für die Pausen.“
„Ich werde daran denken. Es wird heute sehr heiß und morgen und die nächsten fünf Tage.“
Sie verschwand zur Rezeption. Anderson trat auf die Terrasse. Sofort floh der Pavian zur Brüstung, um ihn aus sicherer Entfernung zu belauern. Ein warmer Wind strich heran, von Nordwest, ließ die Grashalme sanft erzittern. Martin Anderson lauschte, wie der Wind die Büsche schüttelte. Dieser Wind war ganz anders als die heftigen Böen am Strand von Grönland. Er sah, wie der Luftzug streng in die Kronen der Bäume griff. Wie eine Welle lief diese Bewegung über die Kraterhänge. Ihm fielen Worte ein, die er bei Thor Heyerdahl gelesen hatte. Grün wurde die Erde am Siebten Tag: Dieser Siebte Tag ist jetzt und für alle Generationen. Als er die Terrasse verließ, hockte sich der junge Pavian auf seinen Hintern und begann zu dösen.
***
Isaak hatte das Wagendach ausgestemmt. Gemächlich schaukelte der Landrover über die Piste, durch Haine von staubgrünen Sukkulenten. Die Straße war sandig, mit großen Löchern. Anderson hockte auf der Rückbank, sein Magen revoltierte. Manchmal hatte er Mühe, Halt zu finden, wenn ihn das unebene Terrain gegen die Scheibe warf. Einmal klammerte er sich an Sewe, murmelte errötend eine Entschuldigung. Der Professor saß vorn bei Isaak. Weil die Büsche hoch und dicht standen, schien es, als würde der Wagen durch eine Röhre fahren. Staub drang ins Innere, legte sich auf die Kleidung, auf die Haare und die Schleimhäute im Mund. Es war feiner, rötlicher Staub von roter, eisenhaltiger Erde. Anderson dachte an kühle Getränke, an eine Dusche, an Wasser schlechthin. An Wasser, das in Grönland stets sauber, klar und eisig war und das in Ostafrika völlig abwesend schien. Dieser trockene, rote Boden hatte seit Äonen keinen Regen aufgenommen. Doch das war ein Irrtum, das musste ein Irrtum sein, denn Anderson hatte die Regenschleier an den Kraterhängen selbst gesehen.
Er dachte an den Regen des Nordens, dessen Pfützen sich tagelang zwischen den Flechten und flachen Küstengräsern hielten. Auf Grönland war die oberflächliche Krume fast immer feucht, Staub war unbekannt, nicht zu reden von der schmalen Küstenkante, über die beständig eisige Gischt fegte. Anderson versuchte, sich Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen, denn er spürte, dass ihn diese Gedanken ablenkten, dass sie ihn den Schweiß und die Übelkeit vergessen ließen und die unangenehme Aussicht, für mehrere Stunden in das enge Gefährt eingesperrt zu sein. Dabei hatte die Sonne ihren mörderischen Himmelslauf erst begonnen.
Anderson schaute auf Millers Hinterkopf, auf die schlohweißen Haare. Der Alte hatte das Fenster heruntergekurbelt und lehnte den Ellenbogen hinaus, den Kopf zur Seite geneigt. Vielleicht schlief er. Geradewegs hielt der Landrover auf den Kratergrund zu, der noch weit entfernt schien, denn die Akazien hoben sich kaum gegen die dunklen Kraterwände in der Ferne ab.
Seltsam, dachte Martin Anderson, es ist wie eine ferne Küste. Erneut ertappte er sich bei dem Gedanken, in Grönland zu sein, dieses Mal an Bord der kleinen Yacht, die ihn nach Neufundland brachte, nach Vinland, wie es in den Sagas hieß. Wenn er lange genug auf den Makatsee starrte, der fern vor ihm blinkte, hatte er tatsächlich das Gefühl, auf dem Meer zu sein. Allerdings war das Licht auf dem Nordatlantik nicht so grell gewesen. Selbst der heißeste Sommer erreicht am nördlichen Wendekreis nicht mehr als fünfzehn Grad Celsius, kein Vergleich zur Hitze Ostafrikas.
Oft hatte er Stunden an der rauen Küste zugebracht, um auf das Meer zu schauen oder dem Anschlag der Wellen zu lauschen. Er hatte an der Reling der Yacht gehockt, bis er die amerikanische Küste dämmern sah, zunächst als schmalen Schatten über dem Horizont, dann als deutlicher Streifen, unmöglich konnten es Wolken sein. Diese Reise hatte er vier Mal wiederholt, von verschiedenen Buchten aus, bis er sicher war, Eiriks Hafen gefunden zu haben, jene legendären Stege, von denen die Boote des Wikingers und seines Sohnes ins Gelobte Land aufgebrochen waren.
Es war das Wasser, dessen Zeichen er in den langen arktischen Monaten zu lesen gelernt hatte, vor allem Wasser, das längst versiegt war. Die Wikinger brauchten eisfreie Häfen oder Buchten mit kurzem Anschluss zu den westwärts gerichteten Strömungen, die im Herbst lange schiffbar waren. Zudem waren sie auf Trinkwasser angewiesen, das im Winter nicht einfror, denn das hätte die Versorgung in den ohnehin schwierigen Wochen der langen Nacht erschwert. Anderson kam eine einfache Überlegung zu Hilfe. Wasser hat eine bemerkenswerte Eigenschaft, die es von allen anderen Substanzen scheidet: Knapp oberhalb des Gefrierpunktes erreicht es seine größte Dichte. Die Dichte der anderen Stoffe steigt, je weiter die Temperatur absinkt. Nur für Wasser gilt ein eigenes Gesetz. Deshalb ist Eis leichter, stets schwimmt es obenauf und sackt nicht in die Tiefe wie festes Metall in einer Schmelze. Ist ein Gewässer ausreichend tief, friert es niemals vollständig ein. Am Grund bleibt eine flüssige Blase, die den Winter überdauert.
Die darüberliegende Deckschicht aus Schnee und Eis wirkt als Isolator, der den klirrenden Frost der Arktis aussperrt. Eisbären und die Inuit wissen das: Sie graben wärmende Höhlen in den Schnee, um die lebensfeindlichen Winter zu überstehen. Beherrscht das ewige Eis die Oberfläche, so bleibt unterm meter-dicken Panzer genug Wasser frei, in dem sich vielfältiges Leben tummelt. Physiker bezeichnen es als Anomalie des Wassers, als wäre es ein Patzer der Natur. In Wahrheit ist es der Schlüssel zur Evolution des Lebens.
Der mit allen Wassern gewaschene Wikingerhäuptling Eirik kannte den Begriff der physikalischen Anomalie nicht. Aber er kannte die Vorzüge eines sorgfältig ausgewählten Siedlungsplatzes. Als sein isländischer Clan nach einem Hafen Ausschau hielt, mussten ihm eisfreie Buchten mit ihren Tümpeln aus dem Schmelzwasser der Gletscher geeignet erscheinen, nach Süden gelegen, zur Sonne hin, windgeschützt und tief genug, um auch im arktischen Winter nicht gänzlich einzufrieren.
Selbstverständlich hätten sie Eis brechen können, um es am Feuer aufzutauen. Doch Feuer war ein kostbares Gut, weil Holz fehlte. Anderson war sich sicher: Er hatte Spur aufgenommen, die Spur der eisfreien Tümpel.
Immer wieder überprüfte Anderson seine Beobachtungen, vermaß längst ausgetrocknete Senken und Gesteinsablagerungen am Meer, berechnete das Ufergefälle und die Wanderung der Gletscherzungen. Sorgfältig trug er alle Daten zusammen, ließ die Computer tagelang rechnen, bis er mit einiger Sicherheit zwei geeignete Lagerplätze auf seiner Karte vermerken konnte. Nur wenige Wochen nachdem er seine Ergebnisse veröffentlicht hatte, fanden Taucher unter der Wasserlinie die Holzpfähle eines groben Kais. Sie setzten sich in einem verlandeten Seitenarm des Fjords vor Qassiarsuk fort, versteckt in Jahrhunderte altem Schlick. Die Pflöcke waren mit ähnlichem Werkzeug behauen wie die altertümlichen Stege in Trondheim oder in Vik. Später gruben Studenten die Fundamente einer Siedlung aus, auf einem grasigen Hang der Küste.
Das Wasser hatte ihm den Weg gewiesen. Wo es sich einst zurückzog, traten seine Spuren offen zutage. Man musste nur in der Lage sein, sie zu lesen. Aber je intensiver Anderson über seinen Erfolg nachdachte, seine Methode analysierte, umso näher geriet er an das Eingeständnis, dass er vor allem Glück gehabt hatte. Eine gehörige Portion Glück gehört wohl dazu: Am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu erscheinen, mit der richtigen Idee im Kopf; ein Wink des Schicksals, der mit gedruckter Unsterblichkeit belohnt wird. Schwarz auf weiß steht der Name des Entdeckers fortan in den Annalen.
„Mister Anderson“, hatte ihm Professor Leiden auf der Pressekonferenz in Kopenhagen ins Ohr geflüstert, „Sie sind ein Glückspilz. Was muss ich tun, um Sie zu uns zu holen?“





























