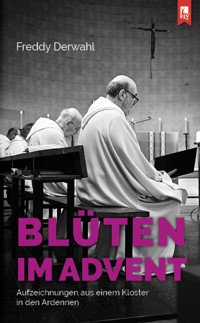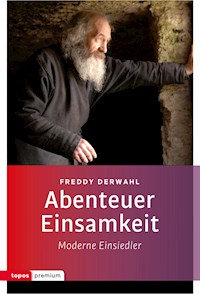1. Kapitel - Ihr Garten
2. Kapitel - Ihr Tagebuch 1976
3. Kapitel - Ihr Leben mit Max
4. Kapitel - Ihr Tagebuch 1977
5. Kapitel - Der Winter in Lourmarin
6. Kapitel - Ihr Tagebuch 1978
7. Kapitel - Dieses Licht, die Freiheit
8. Kapitel - Mein Tagebuch für Nonna 1978
9. Kapitel - Monate später
1. Kapitel
Ihr Garten
Ihr Garten war eine Insel. Abgeschirmt von Mauern aus Bruchstein lag sie mitten in der Unterstadt von Eupen. Ein hohes, meist geschlossenes Tor führte zur Straße, doch brach kaum Verkehrslärm herein. Wer nicht wusste, was sich dort befand, vermutete eine Residenz diskreter Bourgeoisie. Ein Patrizierhaus von Textilindustriellen mit der Jahreszahl 1729 erhob sich über die Dächer, drei breite Etagen, im Giebel das Familienwappen. Da war etwas Geheimnisvolles, Begehrenswertes, ich habe es auch immer so empfunden. Versteckt dahinter ein Schattenreich unter den Kronen mächtiger Bäume. Ahorn, Rotbuchen, Linden und Zypressen; eine Trauerweide hatte der letzte Herbststurm umgerissen. So brach mehr Licht ein, es fiel auf die von ihr liebevoll gepflegten Rosenbeete, Vorzugsfarbe Florentiner Rot, sanfte Übergänge ins Dunkle. Stundenlang schnitt und zupfte sie darin, doch Farn und wilden Margeriten ihre kleine Freiheit lassend. Das war ihr Anspruch, der Garten sollte ganz ihre Handschrift tragen. Sie nannte ihn »zarte Wildnis« und lächelte dabei. Ich habe dieses Lächeln sofort sehr geliebt. Es schloss alles ein.
Der Garten ging über zwei Ebenen. An den oberen Grenzen standen die Kiefern und Fichten so breit, dass er an einen Park erinnerte. Vielversprechend, verlockend, als könne man hindurch und hinaus wandern. Neben den Blausteintreppen, die auf die höheren Bereiche führten, hatte sie Ginster, Mohn und Lilien gepflanzt. Die Malven gewährten freies Geleit. Blühten sie auf, war gewiss, dass endlich der Sommer gekommen war, ihre Zeit. Dann begann über den Moospfaden das Licht zu tanzen, abwechselnd helles und dunkles Grün. Die Spinngewebe wie Silberfäden, die Blumen mit diskret zaubernder Macht. Viel lockere Harmonie, sensible Handanlegung, viel Zufall und ihm doch nicht alles überlassend.
Die Rasen wurden nie ganz gemäht. Immer blieb da und dort ein Teil unberührt, wo bald schon Löwenzahn, Butterblumen und Wiesenschaum aus dem Boden schossen. Das war ihre Art der Kompromisse, sie wollte keine englische Gartenkultur, keine puritanischen Quadrate. Das kniehohe Gras erinnerte sie an ihre bayerische Kindheit, an ein ländliches Reich mit Weiden, die bis an die Ufer des Chiemsees reichten, an Obstbäume, Geruch von Heu und Feldprozessionen. Es geschah ohne eine Spur Wehmut, in strahlender Gelassenheit. Ich habe immer bewundert, mit welcher Unbekümmertheit sie durch die Jahreszeiten ihres Lebens schritt. Das kleine Mädchen, das sie einmal war, lächelt auf den Fotos schon früh mit einem Hauch fraulichen Charmes; älter werdend staunte sie manchmal wie ein von Freude überraschtes Kind. Sah man sie zwischen den Stauden mit bloßen Händen die Erde verteilen, geschah es zugleich konzentriert und verspielt. Auch das war sie: dunkelgrüne Schürze und ein Strohhut mit breiter Krempe, bäuerlich und doch immer sehr Frau.
Das mit dem Gemüse hat sie Max überlassen. War er ihr Freund, ihr Geliebter, ihr Partner? Beide haben das jahrelang verschwiegen, kam das Gespräch darauf, flachsten sie vergnügt und nannten sich »Brüderchen und Schwesterchen«. Der Begriff »Josefsehe« war unpassend; während er schmunzelnd abwinkte, protestierte sie sogleich im Namen der Sinnlichkeit. Als keusche Susanna war sie tatsächlich nicht vorstellbar. Ihre Verwandten aus erster Ehe nannten sie verächtlich »das Weib«. Wenn Max jedoch oben am Rande der Nadelhölzer zwischen Bohnen und Möhren das Unkraut jäte, ließ sie ihn schaffen, als sei er ihr Gärtnergehilfe. Für Salat, Zwiebeln, Knoblauch oder Kräuter hegte sie noch mediterrane Sympathie, aber Porree und alle Kohlarten hielt sie für »schreckliches Wintergemüse«. Sollte er sich ruhig seine Bio-Illusionen bewahren, sie verband mit Gartenkunst nichts anderes als eine Spielart der Absichtslosigkeit. So stellte sie sich den Garten Eden vor: alles sollte wachsen, aber auch wuchern, es bahnte sich seinen Weg in eine selige Unordnung. Keine Frucht, die in diesem Paradies verboten war.
Wie bei allem, was sie tat oder geschehen ließ, waltete in der Arglosigkeit eine etwas philosophische Neigung. Nicht im Sinne rationaler Theorien, viel eher als schöpferische Signale, die sie subtil witterte und in vollen Zügen genoss. Dazu kannte sie Zitate von Plato bis Heidegger, die sie seit ihrer Zeit als Primanerin bei den Ehrwürdigen Schwestern auf der Fraueninsel in ein blassblaues Notizbuch eingetragen hatte. Sehr sparsam ging sie damit um, keine Bildungsnachweise, auch keine Lebenshilfe. Meist Zufälle, manchmal Fügungen. Ciceros Weisheit, ein Gärtchen und eine Bibliothek bedeuteten vollkommenes Glück, war mit einem Rotstift unterstrichen. Über den späten Sommer kannte sie Rilke-Gedichte. Ernst Jüngers Gartenliebe war ansteckend. Sie suchte diese Worte nicht, sie fielen ihr zu. Davon gab es inzwischen zwei Dutzend Hefte, voll gespickt mit Perlen aus allen Jahrhunderten der Geistesgeschichte, die sie als »poetische Aufklärung« sammelte. Gemeint war eine sonderbare Mischung aus Melancholie und Sachlichkeit. Das blieb immer sehr wichtig: Poesie als ganz kurz gelungener Durchblick auf die Schönheit. Kleine Stundenbücher, die nichts beweisen, sondern nur andeuten sollten. Alles wollte sie nicht wissen.
Es hat eine Zeit gegeben, da haben wir über den magischen Begriff »Schönheit« gestritten. Die tieferen Schichten des Schönen sollten ebenso darin enthalten sein wie ihr spannendes Vorspiel und das weit darüber hinaus Führende. Bis zu den Ursprüngen der Romantik waren es manchmal nur noch einige Schritte, doch beim Abdriften ins metaphysische Raunen witterte sie die Gefahr, das schlichte Schöne zu zelebrieren und hüllte sich in Schweigen. Sie suchte den »nicht-geographischen Ort der Schönheit«. Erst sehr spät, kurioserweise in einem Wartezimmer vor ihrem ersten Klinikaufenthalt, schlug sie vor, uns doch, für den Inbegriff von Schönheit, auf »Herrlichkeit« zu einigen, das Wort verspreche »noch mehr Teilnahme«.
Ohne Sonne konnte sie nicht leben. Erst im Mai, »nach den Eisheiligen«, kehrte sie in die kleine ostbelgische Grenzstadt zurück. Die triste Jahreszeit, die für sie spätestens in der zweiten Oktoberhälfte begann, hatte sie mit Max in ihrem Winterquartier in der Provence verbracht. Licht war alles. Dazu bedurfte es nur noch einer Spur Einsamkeit. Sie schafften es lässig, zu zweit allein zu sein. Der Touristenrummel in den Gässchen von St. Paul-de-Vence war ihnen ebenso zuwider wie das Gedränge auf unseren Weihnachtsmärkten. So pendelten sie in den toten Jahreszeiten zwischen den Seealpen und den Wäldern der Ardennen hin und her. Es geschah wie auf Pilgerfahrten, ohne jede Eile, etwas kontemplativ und in der Vorfreude auf eine neue Saison. Auch das hat sie später eingesehen, dass es vielleicht ein Fehler war, sich von der Sonne nicht trennen und den Sommer nicht aufgeben zu wollen. Sie bedauerte, versucht zu haben, den ewigen Kreislauf mit ihrer schwachen Hand anzuhalten. Schon sehr krank, hielt sie sogar das Sterben für »Mitarbeit an der Schöpfung«. Der geliebte Garten führe in eine geheimnisvolle Tiefe.
Das Wort »Heimat« hat sie nie benutzt, heimwärts zu fahren war ihr fremd. Den Begriff zu verinnerlichen kam ihr nicht in den Sinn, keine Innerlichkeit verwurzelten Lebens. Landesgrenzen nahm sie nicht wahr. Der Wechsel von der deutschen in die französische Sprache geschah zwischen Max und ihr fließend. Es galt auch für die Bücher. Sie vertiefte sich in Briefe von Hermann Hesse an seine dritte Ehefrau Ninon. Es war, als gewähre ihr der Meister intime Einblicke, wie einer heimlichen Geliebten. Noch lieber wäre sie seine »Nebenfrau« gewesen, es sei weniger fragil als Fast-Ehefrau, sie suche weder schnelle Abenteuer noch Eroberungen, sondern »Erfüllung«. Max las stundenlang Simenon-Romane, »lauter Lustmorde«, grinste er. Im volkstümlichen Lütticher Viertel jenseits der Maas führte er sie zu den Tatorten und sagte, wie nach einer Entdeckung: »An dieser Kirchentüre erhängte sich Joseph Kleine. Drüben wartete eine farbige Prostituierte. Dort oben nahmen sie Drogen.« Aber, ob Provence oder belgische Provinz, zuhause waren sie nur bei sich selbst: ein weites Land.
Unübersehbar jedoch, dass Südfrankreich ihre Zuneigung galt. Ihr Häuschen in Lourmarin zu verlassen, fiel ihr jedes Jahr schwerer. Der Rückkehr dorthin fieberte sie nach den ersten Herbststürmen entgegen. Langres, das Tor zur Bourgogne, war nicht nur Wetter-und Wasserscheide, ab hier witterte sie schon den Süden. Die Namen der Weinorte Meursault oder Chardonnay hatten einen verlockenden Klang. Zwischen Beaune und Cluny schlängelte sich »die Straße der romanischen Kirchen«. Massiv und bucklig standen sie inmitten der kleinen Friedhöfe. Sie schwärmte im Halbdunkel von der plötzlichen Kühle, dem abgenutzten Glockenstrang und den ausgetretenen Steinen. Ringsum in den Dörfern war bereits eine andere Architektur, der Sonne zugewandt, flachere Dächer, rote Ziegel, Hochterrassen mit getrockneten Blumen und Gerät für den Kräutergarten.
Abseits von der Autobahn steuerten sie den Landgasthof von Cormatin an, das Tagesmenu 16 Francs, ein Viertel Roter inklusive. Max begann mit der beleibten Wirtin über die Gewürzmischung für Perlhuhn in Macon-Soße zu fachsimpeln. Sie war ihnen seit Jahren vertraut und spendierte zum Kaffee ein Gläschen »Marc«, starken bräunlichen Tresterschnaps. Empfahl ihnen die Alte einen Trödlermarkt, nahmen sie Umwege in Kauf. Bei einem Antiquar, der eher einem Autoschlosser glich, erwarb sie das Porträt eines unbekannten regionalen Meisters, »Junge Frau aus Martailly«, eine ländliche Schönheit mit dezentem Ausschnitt. Wurde es spät, blieben sie über Nacht. »Uns drängt niemand.« Vor dem Einschlafen im engen französischem Bett mokierte sich Max über ihre Schwäche für Idylle: »Du schwärmst von diesem Land wie ein Kind.« Sie gab es zu und sagte: »Ach, lass mir das.« Nach einer kleinen Pause: »Ich bin noch ein Kind.« Sie wollte Wiederholungen, wie bei Märchenerzählern.
Wenn ich es recht bedenke, war ihr Eupener Garten an sich eine große Hommage an die Provence. Zwar bemühte sie sich, vergebliche Kopien zu vermeiden, doch sprang die ungestillte Sehnsucht ins Auge, als wolle sie alle Winterreste verbannen. Die Blumen verwegen gemischt. In Mauernischen, auf Fenstersimsen, in Terracotta-Töpfen kräftiges Geranienrot mit dem bitteren, ätherischen Geruch der Blätter. Die violetten Lavendelähren dicht bei dicht in langen Reihen, die sich im Wind bogen. Ihr Duft wie die Leichtigkeit des Seins. Sie sagte es mit einem breiten Lächeln: »So möchte ich beerdigt werden, zwischen Lavendelbüschen.« Weder Kränze, noch Gebinde, kein Denkmal, kein Kreuz. Nur ein Grab mit ihrem Mädchennamen, dem Geburts- und Todesjahr, sonst alles voller Lieblingsblumen. Sollte es sein müssen, im Winterschlaf mit ihr vereint.
Ich habe sie gefragt, weshalb kein Kreuz? Sie zögerte, wollte darüber noch nachdenken, nun ja, vielleicht doch ein sehr bescheidenes, klein wie ihre Lebensdaten. Den Tod verachtete sie, doch über das Paradies zu rätseln fand sie spannend. Göttliche Musik, aber keine Bach-Passionen mehr, kein blutender Gottessohn. Bestenfalls verschwebender Nachklang von Mozarts Adagio aus dem geliebten Klavierkonzert Nr. 23 in A-Dur, besser noch rauschendes Quellwasser, Kirschblüten, Vater und Mutter mit offenen Armen, Meeresweite, Küsten des Lichts, volle Segel, verklärter Eros der Engel, das Ende der Theologie vom Tode Gottes. Das Kreuz sei »da oben in schlechter Erinnerung«. Ihre Vorstellung von Ewigkeit barg eine konkrete Landschaft, sie lag irgendwo in einem Ölgarten zwischen dem Luberon und der Camargue, »wo die Sonne nicht untergeht«. Dort küsste der heilige Franz Dornröschen wach.
Zu sterben wünschte sie sich in der Provence, bis zuletzt im Licht. Olivenbäumen und Weinstöcken traute sie »mehr Schutz« zu. Für die zwangsläufig seltenen Grabbesuche, sollte man hinter den Zypressen an der Friedhofsmauer von Lourmarin einen Gartenstuhl bereit stellen. Es helfe, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Gebete und sogar Segenswasser seien willkommen, sie glaubte an ihre Fähigkeit, im Erdreich »tief einzudringen«.
Über das Gartenareal in Eupen erhob sich eine riesige Rotbuche. Souverän und verlässlich, sollte ein Sturm es wagen, seine Ruhe zu stören. Ihre wogende Krone war ein Signal für die Jahreszeiten. Magische Schatten in den Sommermonaten, vergebliche Verweigerung herbstlicher Trennungen, wehrlose Tristesse im langen Winter, mächtiges Rascheln des Laubs bis weit in den Frühling hinein. Kehrten beide im Mai aus Lourmarin zurück, ging ihr erster Blick hinauf zu dem Baum. Sein Laub schwebte erst jetzt zu Boden, zarte, noch behaarte Knospen wagten sich scheu ans Licht. Wieder war Ankunft, ein neuer Kreislauf begann. So wollte sie leben: allem Abschied voran. Ihre Hoffnung war anzukommen, mit zu kreisen im großen Reigen der Schöpfung, die ins Mysterium führt. Immerwährende Wiederkehr wünschte sie sich nicht. Alles noch ein Mal, vielleicht gar als Stiefmütterchen oder Frosch, bitte nicht! Sie wollte Fortschritte, keine Fortsetzungen. »Hinauf steigen, Gipfelwind«, schwärmte sie, »es muss irre sein, alles Himmelfahrten«. Sie konnte sich durchaus mehrere vorstellen, von Seligkeit zu Seligkeit.
Neben dem Baum stand ein Brunnen. Es war gewiss kein Kunstwerk, doch hatten ihn die Jahrzehnte unter dem alten Riesen mit einer Patina bedeckt, die, bei etwas Phantasie, an klassische Vorbilder erinnerte. Drei ehemals weiße Schalen, an deren Überlauf sich das Wasser verteilte. Blätter und Gras bedeckten sie mit Farbschichten, die von Rostbraun bis Graugrün variierten. Ranken von wildem Wein hatten sich an der tragenden Säule festgesaugt, nahte der Herbst, wandelte sie sich in flammendes Rot, als ginge es hier zwischen Wasser und Feuer um Leben und Tod. Auch verströmte dieser Brunnen ein verschwenderisches Repertoire an Geräuschen. Sprudelnde Lebensfreude, plätscherndes Vergnügen, zähe Langeweile, klatschende Eile oder jener betörende Singsang, wenn sich in der Windstille einer Sommernacht die Wasserflächen gleichmäßig verteilten. Meister all dieser Musik waren die Buchenzweige, die sich manchmal in die Becken senkten und im Auf und Ab die leichte Strömung regulierten.
Die Pumpe wurde erst eingeschaltet, wenn sich die letzten Nachfröste verzogen hatten. Dann befreite Max die braune Brühe von allem Unrat. Schoss endlich der blanke Strahl aus den Düsen, klatschte die Herrin der wieder erwachten Schönheit in die Hände. Obwohl keineswegs ein Objekt der Begierde, verehrte sie dieses sprühende Ungetüm. Fließendes, reines Wasser war von sakraler Bedeutung. Sie verband damit ebenso die Segensspritzer der Taufe, die eiskalten Waschbecken ihrer Kindheit, wie jene weißen Wildbäche, die sich aus dem Hochwald in ihren Chiemsee stürzten. Der Brunnen am Fuße des Berges Garizim, an dem sich Jakob und Rahel umarmten, und dessen Rand sich auch die samaritanische Sünderin näherte, beflügelte ihre Liebes-Vorstellungen. Auf ihren Romreisen hatte sie Abendstunden auf einer Terrasse der Piazza Navona im Schatten des Vierströme-Brunnens verbracht. Den dunklen Klosterbrunnen von Maulbronn entdeckte sie in einem Hesse-Roman. Sie kannte noch bayerische Bauernhöfe, deren Brunnen die Namen der Ortsheiligen trugen, vorzugsweise Maria oder Johannes Baptist. Als man vor ihrem ostbelgischen Herrenhaus die Tröpfchen sprühende »Vogelsmarie« aufstellte, hat es sie gerührt. Wasserspiele, selbst die demütigen, machen das Mythische hörbar. Sie wollte lauschen, wenn die Tiefe erzählt.
»Casta«, keusch wie ein Bergsee musste ihr Wasser sein. Unberührbarkeit und Labsal fest umschlungen. Wenn sie nach ihrer Rückkehr aus Frankreich Laub und abgebrochene Äste ins Feuer warf, begann ein neues Glück. Sobald der bescheidene Wasserlauf wieder zirkulierte und von Schale zu Schale silbern glitzerte, stellte sich das ein, was sie als »Wasserlust« genoss.
An jenem Morgen, bevor ich sie erstmals in die Klinik fuhr, wollte sie unbedingt noch einmal zum Brunnen. Ich beobachtete, wie sie die Wasserspiegel mit den Fingerspitzen streifte. Es war ein sehr zärtlicher Abschied. Dann nahm sie mich in den Arm und lächelte: »Ich habe zu den Tropfen gesagt: auf Wiedersehen Tropfen.«
Auch dies gehörte zum Sommerritual, Max oben zwischen seinem Suppengrün, sie barfuß, mit Schlauch oder Gießkanne über Rasen und Beete. Ein Detail subtiler Sinnlichkeit war unübersehbar: ihre roten Fußnägel im nassen Gras. Diese Kleinkunst beherrschte sie souverän, ein Hauch Verlockung im Vorübergang, inmitten lapidarer Normalität ein appellierendes Signal. Sie spielte nicht damit, sie verkörperte es. Ihr erotisches Universum ging weit über Berührungen hinaus. Ohne Zögern stimmte sie der Vermutung zu, dass zwischen ihr und dem Garten so etwas wie eine Liebesbeziehung bestehe. Eine brisante Mischung aus Verehrung und Treue. Sie »das Weib«, der Garten männlich. Sie streichelte seine Gewächse, er überschattete sie. Dann schallendes Lachen: »Wie der Heilige Geist die Jungfrau.«
Als sie aus ihrem Winterquartier mitteilte, dass sie einem Unternehmer den Auftrag erteilt habe, neben den Blautannen und Himbeersträuchern, im seitlichen Teil der ersten Etage, ein Schwimmbad zu errichten, klang es, wie eine selbstverständliche Steigerung ihrer Garten-Phantasien. Niemand brauche eine Hand zu rühren, sie selbst habe bereits alles mit einem Gartenarchitekten besprochen und ihm Anweisungen gegeben, wie alles auszusehen habe. Nur eine Bedingung, spätestens Ende Mai wollte sie erstmals kopfüber ins Wasser. Dieses Schwimmbecken, das niemand »Pool« nennen durfte, erwies sich als eine Zugabe ihrer südlichen Sehnsüchte. Es war bescheiden und verlockend zugleich, eine Hommage an jeden gelungenen Sommertag. Zwischen Schilf und Seerosen entstand ein Teichbad, das von einem künstlichen Bachlauf gespeist wurde. Unter einem Laufsteg versteckt die Pumpen und Filter. Das Wasser grünlich wie die Flüsschen im nahen Weideland. Weder Chlor-Zugaben noch sonstige Chemie, allein die Pflanzen, die das Becken in kleinen Sümpfen umrandeten, sorgten für eine permanente Reinigung.
Ringsum diskrete Farben, Efeuranken über dem schmalen Eingang, tiefblaue Lobelien, Kletterrosen am Treppenaufgang zur obersten Etage, in der Mitte des Rasens ein Apfelbäumchen. Unerwünschte Einblicke gab es nicht, da und dort stand Sichtschutz aus Bambuswänden. Max hatte auf der Schattenseite eine Hängematte gespannt. Es war sein Platz, er behauptete, sich darin geborgen zu fühlen »wie ein Fötus«. Dann schlief er ein, Brille und Pfeife im Gras neben dem Zeitungshaufen, »Le Soir«, die »FAZ«, »Die Zeit« und das lokale »Grenz-Echo«. Neben den Fliesen am Beckenrand erhob sich in leichter Schräge eine Mauer. Ein wahres Prachtstück, die Meisterin hatte sie eigens aus massiver Grauwacke bauen lassen. Über die ganze Breite stand sie den ganzen Tag über in der prallen Sonne und saugte alle Wärme auf. Mehr noch: Zwischen dem flimmernden Wasser und der hohen Wand gab es heimliche Übergänge. Wasserfrische und heißer Stein in verträumter Nachbarschaft. Sprangen wir kopfüber ins Becken, trockneten die Spritzer in Windeseile. Darüber die Leichtigkeit der Libellen, in der Dämmerung schossen Schwalben in Sturzflügen über den Teich.
In der Ecke stand ein Badehäuschen. Es bot viel Platz für Luftmatratzen, Schläuche, Sonnenschirm und Liegestühle. Das Besondere war jedoch das betörende Geruchsgemisch des Tannenholzes und der Fläschchen und Tuben mit Sonnencreme, Badeöl und Eau de Toilette. Unter dem Spiegel lagen Lippenstift und Wimperntusche, Haarspangen, Kämme und Modeschmuck. Am Kleiderbügel hingen Badeanzüge und Bikinis in allen Farben, sie hatten den intimen Duft der Frauen angenommen, man konnte ihn heimlich einsaugen. Es war naheliegend: Wenn bei Sommerfesten im dunklen Garten die Lampions glühten, wurde diese Zauberkammer zu einem Ort zärtlicher Begegnungen. Die Mädchen folgten zögernd, ihre Absätze klackten auf den Fliesen, dann huschten wir vorbei am Wasser und verschlossen die Türe.