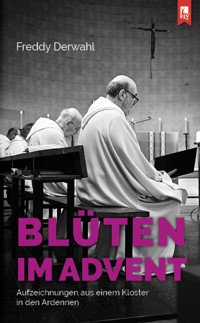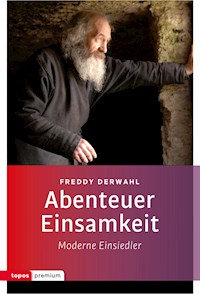Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonifatius Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Gottessuche, Gottesnähe, Gotteserfahrungen. Darum geht es Freddy Derwahl, der nicht nur von persönlichen Erlebnissen berichtet. Denn er hat Nonnen, Mönche und Einsiedler besucht, dem nächtlichen Schweigen hinter den Mauern und in der Natur, dem kaum wahrnehmbaren Flüstern Gottes "zugehört". Mit angemessen leiser doch kraftvoller Stimme lädt er ein, ihm ins Schweigen zu folgen, das "den großen schöpferischen Pausen des Lebens entspricht". Der Autor nimmt uns mit zu heiligen, aber auch ganz irdischen Orten in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Algerien, auf dem Berg Athos und in der ägyptischen Wüste. In der Ruhe der Worte schenkt er uns Rastplätze des Schweigens, um die Kraft und Freude des Glaubens an Gott mitzuteilen: vor allem den Suchenden, den an ihm Leidenden oder nichts von ihm wissen Wollenden. Zitat "Wenn man das Wesentliche nicht verpassen will, muss man Ja sagen. Ja in das Flüstern Gottes hinein." (Gastschwester Julienne, Karmelkloster Mazille/Burgund)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FREDDY DERWAHL
Das Flüstern Gottes
Begegnungen auf inneren Reisen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Wir danken „Vaticanmagazin“ undVerlag Butzon&Bercker für einige Auszüge.
Covergestaltung: Weiss Werkstatt München
Covermotiv: © Weiss Werkstatt München unter Verwendung von© shutterstock/oksana2010,
© shutterstock/shutting,
© shutterstock/sergio34
eISBN 978-3-89710-889-9
© 2021 by Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Druck: cpi-print.de
Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn
Er flüstert, um gehört zu werden.
Gabriel Ringlet
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.In den Wäldern
2.Mariawald
3.Chartres
4.Der Einsiedler im Kastanienwald
5.Athos, der Heilige Berg
6.Der Versöhner Frère Roger
7.Stille Tage in Mazille
8.Gott hat mich gesucht
9.Auf jedem Sarg lag eine Rose
10.Stille Audienz beim schwarzen Papst
11.Unterwegs mit Anselm Grün
12.Die Zärtlichkeit einer Frau
13.Hingeworfen am Ende der Nacht
14.Über die Höllenbrücke der Jakobspilger
15.Der nackte Fuß der Sünderin
16.Die Nacht mit Isaak dem Syrer
17.Der letzte Ritter von Ujué
18.Ihre leuchtenden Augen
19.Martin Luther und Mutter Oberin
20.Gott blüht durch Überraschungen
21.Die Bohème und der heilige Paulus
22.Makarios und das leere Meer
23.Winternacht in der Kartause
24.Am Grab des Freundes
25.Zum Schluss: Die heilige Stille
Vorwort
Über seine persönlichen Beziehungen mit Gott zu schreiben, ist immer abenteuerlich. Vielleicht täuscht man sich und hatte gar keine. Anmaßung schleicht heran. An sich ist man unwissend und verirrt sich in Traumbilder. Man möchte und kann nicht. Da ist viel Stückwerk an Erinnerung. Auch Scham, weil Wesentliches fehlt und die Neigung besteht, dem strengen Nachdenken oder gar Beten aus dem Weg zu gehen. Doch sind nicht Gebete der einzige Zugang? Wie war das mit uns, als ich vor deiner Stimme immer wieder weglief?
Bevor der Arbeitstitel über das „Flüstern Gottes“ zum Titel wurde, habe ich lange nachgedacht. Über Flüstern zu schreiben ist eine schwierige Aufgabe, wer es nicht zerreden will, muss sich selbst in die strenge Stille begeben, im Leisen unterkriechen. Doch das Flüstern Gottes? Grenzt das nicht an ein Sakrileg? Es ist ein Versuch auf dünnem Eis. Den Blick und das Gehör geschärft für die Erfahrungen jener, die das Schweigen geübt und ausgehalten haben, bis es sich endlich leise offenbarte. Doch die Deutung fällt schwer: Wer bin ich denn, was weiß ich schon?
Als christlicher Autor stehe ich in der Pflicht. Als mein Freund, der Verleger Ralf Markmeier, vorschlug, „gegen allen Mainstream“ ein Buch über Gottesbegegnungen in meinem Leben zu schreiben, hat mich das überrascht. Ich sollte Menschen, denen diese Fragen fremd sind oder die suchen und nicht zu finden glauben, einen Hauch von Ermutigung geben. Aus meiner Scheu wurde eine Herausforderung. Ich kannte Gott nur aus seinen Vorübergängen. Von jeder „Erleuchtung“ weit entfernt, weiß ich aber Geschichten, die an das spannende Thema heranreichen. Vielleicht ist man gerade deshalb ein legitimer Zeuge, wenn man von staunenden Annährungen und Randerfahrungen zu erzählen wagt.
Mehr noch: Da war so etwas wie ein lebenslanger roter Faden der Beobachtungen. Meine eigenen Gotteserlebnisse waren schwierig, doch durfte ich die tatsächlichen bei Anderen ins Auge fassen, sie hinterfragen und beherzigen. Das weite Feld des Lebens und Schrifttums der Heiligen oder die intensive Gottsuche in den Klöstern boten dazu spannende Möglichkeiten. Da fanden Gespräche und Begegnungen statt, die sofort ins Eigentliche vorstießen.
Zentrales Ereignis wurde mein früher Wunsch, Mönch zu werden. Er war leidenschaftlich und schwach zugleich. Zum Widerstand gegen Verweigerungen fehlte es mir an Kraft. Die Hoffnung gab mich nicht preis, doch ich gab sie auf. Dann kam eine entscheidende Wende, die ich erst viel später begriffen habe: Ich hatte mich selbst und meinen Wunsch verlassen, aber ich war nicht verlassen. Nicht ich besaß die Hoheit über meinen Lebensweg, sondern er wurde mir in umgekehrter Richtung von dem „Ganzanderen“ aufgezeigt. Ich hatte zu lernen, als eine Art Mönch mitten in der Welt zu leben und notfalls daran zu leiden wie ein Hund. Der orthodoxe Theologe Paul Evdokimov, bei dem ich oft Zuflucht suchte, nannte es „verinnerlichtes Mönchtum“, es ist allein Herzenssache. Das Herz hat kopflose Gründe, sie tun bitterlich weh und können sehr glücklich machen.
Weder meine Frau noch meine fünf Kinder, noch meine Freunde und Freundinnen legten mir bei meinen Expeditionen Steine in den Weg. Ich begann zu begreifen, dass meine Lebenskurve auch eine Sehnsuchtskurve war. Der ruhige Gott begann das Leben zu beruhigen. Die stillen Zeichen waren sich sammelnde Orientierungen, für die es schließlich nur eine Richtung gab. Die Reisen mündeten in eine einzige, in eine innere Reise: Ich sollte über das geistliche Leben, das ich selbst nicht geschafft hatte, schreiben, berichten, erzählen und filmen, immer wieder, es ist eine endlose Geschichte, die Antwort auf eine Berufung mit anderen Mitteln.
So habe ich über Jahrzehnte hinweg Klöster, Abteien, Mönche und Einsiedler besucht. Zunächst die Trappisten in Mariawald, meine erste Liebe. Dann in Belgien die Abteien Chevetogne, Rochefort, Orval, Val-Dieu, das luxemburgische Clervaux, in den Niederlanden Benedictusberg, im bevorzugten Frankreich fast alle Zisterzienserklöster, im baskischen Spanien La Oliva, in Italien die Camaldoli, in Griechenland mehrmals den Heiligen Berg Athos, in Rumänien die Moldauklöster, in Ägypten die Wüsten- und Einsiedler-Regionen, in den USA Genesee Abbey und schließlich in Algerien das Kloster der sieben ermordeten Mönche in Tibhirine sowie den letzten Überlebenden Frère Jean-Pierre am Hohen Atlas im marokkanischen Midelt.
Ich sprach mit den ganz Alten und den ganz Jungen, mit Äbten und einfachen Brüdern, mit Kranken und Sterbenden, mit Wissenschaftlern und Künstlern, mit Eintretenden und Gescheiterten, mit Einsiedlern und ihren Schülern und nicht zuletzt mit Nonnen und Schwestern. Vielleicht waren die Frauen in ihrer sensiblen Nachdenklichkeit die dankbareren Gesprächspartner. Ob steinalt gebeugt oder blutjung, da war immer Zuhören und Verständnis, die ich als mütterlich empfunden habe.
Dabei sind viele Tagebücher, Reisenotizen, Bücher, Bildbände und Fernsehreportagen entstanden. Immer war alles anders und doch ging es allein um das Eine: Gottessuche, Gottesnähe, Gottesstille, der leise, der flüsternde Gott. Eine amerikanische Reklusin schrieb, manchmal, wenn sie die tiefste Stille erreiche, „höre ich ihn hinter meinem Rücken“. Ob ich diese Stille gehört habe, weiß ich nicht. Doch hörte ich, wie andere sie hörten.
Bei der Suche nach der elementaren Begegnung habe ich auch einzelnen heiligen oder heiligmäßigen Männern und Frauen eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die an sie gerichtete Stimme Gottes verstummt, selbst kaum hörbar, nicht. Sie schwebt nach wie ein Lobpreis der Lebensüberwindung. Die Mystikerin und Patronin Europas Teresa von Avila in schmerzlicher Verlassenheit, der Wüsteneinsiedler Charles de Foucauld beim tödlichen Angriff auf Tamanrasset, der belgische Blutzeuge Jean Arnolds auf dem Schafott der Nazis und zur Jahrtausendwende die sieben „Schlafenden“ auf dem Klosterfriedhof von Tibhirine. Sie alle lassen, nach ihrem dramatisch beendeten Leben, weiter aufhorchen.
So bin ich sehr dankbar, dass ich bei diesen intimen Gesprächen herausragender Menschen mit Gott ein Zeuge sein durfte. Ein überall wie ein Freund willkommener Begleiter durch geistliche Landschaften auf meist unbegangenen Wegen. Eigentlich liegt da der tiefere Grund der Entstehung dieses Buches: Die Kraft und die Freude des Glaubens an Gott den Menschen mitzuteilen: vor allem den Suchenden, den an ihm Leidenden oder nichts von ihm wissen Wollenden.
Freddy Derwahl
Eupen, am Aschermittwoch 2021
Die Wälder waren, nach dem gütigen morgendlichen Lächeln meiner Mutter, mein erstes Erlebnis auf Erden. Eine Mischung aus Freiheit und Furcht. An sich eine Gotteserfahrung. Ich spürte große Stille, große Weite. An den Rändern verbreitete die Moorlandschaft des Hohen Venn eine Ahnung von Abenteuer, eine Sehnsucht nach Nähe und Ferne. Vielleicht sogar nach mehr. Sie bleibt für immer.
1. In den Wäldern
Dem Wald war nicht zu trauen. Finster verlief seine Grenze dicht am Rand der ostbelgischen Stadt Eupen. Sie lag vor den Wäldern, es war nur eine kleine Distanz, doch herrschte Spannung. Die Tannen standen hoch aufgerichtet, fast eine Wand, auf die man schaute, und manchmal war es, als starrten daraus Augen zurück. Nachts vermischte sich ihre Front mit dunklen Wolken oder dem Sternenhimmel. Kamen die Stürme, wurden sie bedrohlicher, fiel das Mondlicht auf die Zweige, glich der Schein einem unheimlichen Signal aus der Höhe. Eine Blockhütte stand einsam beim Dickicht, eine Kanzel beugte sich zwischen alten Buchen über dem Abhang, unten im Tal rauschte der Fluss, die Hill. Ihr Name klang hell und schnell, ihre Quelle lag oben im Moor, nahe einer alten Römerstraße im Hohen Venn. Andere Reviere, Wege und Bachläufe hießen Eiterbach, Blutacker oder Schwärzfeld, Unruhe stiftende Namen. Sie haben meine Kindheit geprägt, da war schon früh ein Herzklopfen, vom Wald ausgelöst, zugleich Wildnis und Märchenwald, Zuflucht und Verlies, großer Respekt.
Unsere Wälder reichten bis tief hinab in die Vogesen und erstreckten sich immer mächtiger über die Ardennen, bis sie an der belgisch-deutschen Grenze in ein grünes, nahezu heiteres Wiesen- und Heckenland übergingen. Bei den Wanderungen der Jugendgruppe machten wir uns das, was wir als Heimtücke gefürchtet hatten, vertraut. Doch als Fälle von Freitod an der Talsperren-Mauer bekannt wurden, die Mordkommission nach Gewaltverbrechern fahndete und unter Einsatz von Militär im winterlichen Wald Verirrte gesucht wurden, kehrte das Gefährliche dieser Landschaft zurück. Zwei Kinder verliefen sich im Hilltal und wurden erst nach Tagen von einem Holzfäller entdeckt. Zugeschneite Höfe mussten mit einem Nothubschrauber versorgt werden, die Tollwut der Füchse und die Wildschweinpest brachen aus.
Schlimmer als der „Schwarze Mann“ war die Weite der Wälder. Als ein verheerender Brand in einer Sommernacht große Flächen vernichtete, waren die Feuerwände, wie ein Fanal, bis auf der Straße Kaiser Karls des Großen von Aachen nach Lüttich sichtbar. Das Wild flüchtete in die tieferen Reviere. Die Gefahr blieb bis zum nächsten starken Regen bestehen, jederzeit konnte der Wind die Funken im glühenden Torfboden wieder anfachen.
Als letztes Jahr erstmals ein Wolf im Großen Moor auftauchte, löste das Bild, das einem Meister-fotografen gelungen war, einen Schock aus. Tief in den Menschen dieser Landschaft sitzt immer noch eine Spur jener Furcht aus Kindertagen, die ihnen von den Märchen der Brüder Grimm und von alten Legenden eingeflüstert wurde. Der Mythos Wolf verkörperte alles, was man sich hier an drohender Gefahr vorstellen konnte.
Doch war da auch eine völlig andere Seite, die in den Bann zog: die Schönheit, die Stille und Unberührtheit der Wälder. Wer den Weg unter den Buchen des Soortales hinauf stieg, spürte den Hauch einer anderen Zeit. Auf federndem Boden ging es ins Weglose. Das Pfeifengras im Hohen Venn bog sich im Herbstwind ockerfarben wie Savanne. Heidekraut und Birken säumten die Uferpfade. Pilze, Blau- und Preiselbeeren wurden gesammelt. In den Gräben sickerte das rote Torfwasser. Im späten November fiel der erste Schnee und verwandelte die unsichere Landschaft in einen glitzernden Hinterhalt. Kam Nebel auf, verschwand die Welt. Ging am Kreuz der Verlobten die Sonne unter, tauchte sie die Stätte des tragischen Todes eines jungen Paares in das Licht eines sakralen Ortes. Im Frühjahr blühten Narzissen und Wollgras. Dann wagte sich das junge Rotwild aus dem Dickicht, beim geringsten Geräusch die Lauscher gespitzt, die feuchten Riecher in die Windrichtung, die nicht trog und die Muttertiere mit ihren Kitzen in eleganten, federleichten Sprüngen zurück in die Verstecke trieb. Die Stille kehrte zurück und nur noch die Vennbäche, die von der ehemaligen Baraque Michel und der Eifelgrenze zu Tal eilten, verrieten mit ihrem monotonen Rauschen die Wegstrecke. Ihr im Altweibersommer zu folgen, war ein grandioses Erlebnis, die Waldgänge führten auf Holzwegen ins Unbegangene.
Die Stille der Wälder war gewaltig. Sie wirkte wie ein Schock. Auch ihr traute man alles zu, so als beginne an ihren Nahtstellen ein unheimlicher Bezirk. Unsere Kinderphantasie malte sich darin eine rückzugslose Tiefe aus, die Welt hatte ihr letztes Wort gesprochen. Kein Wort mehr, kein Wort. Selbst wenn die hohen Tannen eine Handbreit Himmel freigaben, auf dem der Kondensstreifen eines Flugzeugs verkümmerte, drang der Düsenlärm nicht bis in die Tiefe. Am Rand des Verlorenseins nur Waldesstille, die im Spiel des Windes ihre tieferen Schichten preisgab. Noch ein Grillengezirp, noch ein Fliegenschwarm, ein stürzendes Blatt, dann ergriff die Stille radikal Besitz.
Es herrschte das Reich einer Verborgenheit, die alles zulässt. So waren die Mordfälle, die manchmal erst nach Monaten aufgedeckt wurden, von bestürzender Grausamkeit, überfallartig wurde erstochen und erschlagen, selten fiel ein Schuss, er hätte verraten. Auch ließen sich die Täter in der Abgeschiedenheit Zeit, um ihre Spuren zu verwischen, manche Leiche wurde erst durch ihren Verwesungsgeruch tief im Unterholz entdeckt. Wer hier dieser Untaten gedenkt, spürt Unruhe, vielleicht ist man selbst ein längst erspähtes Opfer, vielleicht grinst drüben hinter den mächtigen Bäumen bereits das Böse mit geschliffener Waffe.
Als ich bei Hemingway las, die Wälder seien „Gottes erste Kirchen“, habe ich das als eine starke Bestätigung empfunden. Da war eine Annäherung an das Mysteriöse. Die hohen Buchen erschienen wie gotische Säulen abendländischer Kathedralen, die Sonne im Blattwerk wie das Leuchten vor dem Allerheiligsten. Ich war glücklich zu spüren, dass es nur Gott sein konnte, der seine Hand im Spiel hatte. Es war ein Gott der Urzeiten, der an der geduldigen Stille unserer Kirchen Gefallen fand. Hier herrschte die Macht seiner Nähe, das Verborgene und das Weite, das im Dunkel glühende Heilige. Die Wälder waren voller Gottesspuren. Stille als biblisches Zeichen: Wie vor dem brennenden Dornbusch. Die Verklärung reichte bis in die Geschichte des Elias zurück, dem ein „sanftes verschwindendes Säuseln“ blieb, als Gott an seiner Höhle vorüberzog. Jesus ist im Schutz der Nacht auf den Berg Tabor in Galiläa gestiegen um zu beten. Welch erschütternde Szene: Der Sohn Gottes will nichts als die Stille und zieht sich in sein Eigenes zurück.
Mariawald war meine erste Liebe. Bereits mit 14 wollte ich in die strenge Trappistenabtei in der Eifel eintreten. Der einzige Beweggrund war nach schmerzlichen Todeserfahrungen die Losung „Gott allein“. Die Angst vor einem Leben ohne Gott hatte diese extreme Neigung ausgelöst. Nichts schien mich aufzuhalten. Ich wollte gleich dahin aufbrechen. Es sollte anders kommen, doch die Sehnsucht blieb und das Kloster ein existenzieller Ort.
2. Mariawald
Der Name des einzigen deutschen Trappistenklosters, Mariawald, schloss sich den frühen Walderlebnissen nahtlos an. Die Kindheit war zu Ende gegangen, der Wald als Gotteszeichen, tief und mysteriös, jedoch geblieben. Maria stand für das stille Unbegangene, sie trat weihnachtlich aus dem Dornwald, er trug ihren Namen. Die hinter hohen Mauern lebenden Schweigemönche verbreiteten wie die finsteren Reviere leise Schrecken und Faszination. Nur hinter einem hohen Gitter konnte man sie sehen, wenn sie in einer langen Prozession die Kirche verließen; manche mit dem runden Haarkranz der Tonsuren auf dem kahlen Schädel oder mit hochgezogenen spitzen Kapuzen. Es war wie eine Mischung aus dem geheimbündlerischen Ku-Klux-Klan und der martialischen Fremdenlegion. Kamen oder gingen sie, brannten am Hochalter Kerzen. Die Glocke schlug heftig, sie hatte etwas Alarmierendes, wie eine Sturmwarnung.
Alles schien riskant, doch habe ich mich daran nicht satt sehen können. Noch war keine Ahnung vom eigentlichen Sinn dieser liturgischen Choreografie, doch vermittelte sie das Bild einer geschlossenen und entschlossenen Männergemeinschaft, die couragiert aus der Welt trat. Meine Eltern, die uns zum Sonntagsausflug in die Abtei mitnahmen, hielten die Mönche für „verrückt“; es empörte mich, sie hatten nichts verstanden. Auch ich „verstand“ nicht viel, doch schlimmer, da war eine Ahnung, milde und unheimlich zugleich, sie provozierte ängstliches Staunen und zog zugleich mächtig an. Leise bebte die Erde, als ziehe der Schatten Gottes vorüber.
Auf der Eifelstraße, vom Rursee nach Monschau, habe ich mich noch Jahrzehnte später nach dem schon fernen Kermeter-Hochwald umgesehen, aus dessen Tannen die weiße Front der Abteikirche von Mariawald herausstach. Wald und See waren dunkel, das weiße Gemäuer strahlend rein. Ein flackernder Stern in finsterer Nacht, von der Welt umschlossen, blieb er sichtbar. Das demütige Licht hatte etwas mit Treue zu tun, es konnte nur die Treue Gottes sein: „Fürchtet euch nicht!“
Als ich während der Genesung nach einer Masernerkrankung im Sammelsurium einer alten Pralinenschachtel die Broschüre „Die weißen Mönche von Mariawald“ entdeckte, sollte dies weitgehende Folgen haben, denn der Autor, P. Andreas Schmidt, gab als Grund für dieses „verrückte“ Leben nur zwei Worte an: „Gott allein“. Es war ein Schock und eine lebenslängliche Offenbarung. Ich war damals 12, doch wirken die beiden Worte noch immer. Dass eine Radikalität über mich hereinbrach, von deren Höhen und Abstürzen ich keine Ahnung hatte, liegt in dieser Offenbarung Gottes begründet. Wer sich auf sie einlässt oder es zumindest versucht, wird es weit bringen, auch dahin, wohin er nicht will. Kindliche Ängste hatten bisher mein Leben überschattet, vor allem der Tod erschütterte mich, nachdem ich meine Großmutter, die ich über alles liebte, aufgebahrt im Sarg gesehen hatte. All ihre Güte blass und erstarrt, die Kränze, Tannengeruch, da war er wieder, der Wald. „Gott allein“ blieb der einzige Ausweg, die Rettung.
Julien Greene, der selbst in die Nähe des Mönchtums geraten war, schrieb dazu in seinem Tagebuch „Was an Tagen noch bleibt“ den erschütternden Satz: „Wer berufen ist, bleibt berufen, weil er dem Ruf nicht gefolgt ist.“ Worte, die mein Leben begleiten, fast ein Verdikt, doch so ist die Erinnerung an erste Liebe. Sie ist schmerzlich und schön zugleich, kein Verrat gibt sie preis, leise wie sie kommt, verschwindet sie wieder. Ich war der Heftigkeit dieser Liebe nicht gewachsen und doch nicht ganz von ihr verlassen. Die Formen änderten sich, das Eigentliche blieb. Sie war reines Geschenk, Gott nimmt seine Geschenke nicht zurück, er verwandelt sie für andere Feste.
Mein Wunsch, dem Ruf der Trappisten von Mariawald zu folgen, stieß auf den heftigen Widerstand meiner Eltern. Meine Mutter weinte bitterlich und verkündete ihren baldigen Tod. Mein Vater ging energisch vor, verbot mir jeden Kontakt und zensierte meine Lektüre. Es waren schlimme junge Jahre. Keine Gebete, keine Aussprache halfen, uns gemeinsam waren nur die Tränen. Etwas Fremdes war zwischen uns getreten, es verlangte einen anderen Frieden. Als ich das Risiko einging, mich 16-jährig für drei Tage aus einem Jugendlager zu entfernen und per Anhalter 50 Kilometer zur Abtei Mariawald zu fahren, blieb dieses Abenteuer lange unbemerkt. Das letzte Stück führte zu Fuß durch den Wald und wie in der Kindheit fürchtete ich hinter jeder Wegbiegung die plötzliche Begegnung mit dem Schrecken. Doch dann lichtete sich das Dickicht und gab den Blick frei auf die weiße Klostermauer: Ankunft, Stunde des Glücks.
Ich folgte der Heiligen Messe und den Nachtwachen von der Empore, schuftete mit den Novizen im Heustall, erzählte den Oberen meine sonderbare Geschichte. Sie lächelten über mein Alter und empfahlen demütige Geduld. Die mich tief prägende Szene war ein Novize, der sich auf den Boden vor einer Kreuzwegstation hingeworfen hatte. Sie fasste alles zusammen, was ich mir unter diesem Leben vorstellte: radikale Hingabe an den „Gott allein“. Andere Entdeckungen bargen weiter den Zwiespalt meines Waldgangs, Staunen, leise Furcht, Faszination: die mit Strohhüten im Gänseschritt zur Feldarbeit ziehenden Mönche; ihre überlebensgroßen Schatten kurz vor drei Uhr im Kreuzgang unterwegs zum Nachtoffizium; die anschließenden stillen Messen im Halbdunkel der Seitenkapellen; die sich in braunen Kutten vor dem Abt tief verbeugenden Brüder; die Stundengebete und ihr melodisches Summen. Besonders erschrak, dass sich die Mönche freitags nach der Vigil in ihren in einem nach oben geöffneten Schlafsaal befindlichen Zellen selbst geißelten. Der Novizenmeister nannte es „Disziplin“ und sagte: „Es fließt kein Blut dabei.“ Hier herrschte militärische Härte. Sie übten sich in einer Strenge, als wollten sie Gottes Nähe erzwingen.
Erst zur Nacht, die bereits um 19.30 Uhr begann, löste sich die Strenge beim Gesang des „Salve Regina“. Es ist ein flehentlicher Ruf an die „Mutter der Barmherzigkeit“. Alle Lichter erloschen, allein vor der Madonna flackerte eine Kerze. Da waren im zärtlichen gregorianischen Gesang die Worte vom „Weinen und Klagen im Tal der Tränen“. Ein letzter Gruß an „unsere Frau der Hoffnung“, sie möge „uns nach diesem Elend Jesus zeigen“. In allen Klöstern des Ordens endet mit diesem Ritual der Tag. Die Nacht ist gekommen, die Stunde der Sehnsucht.
In der Eupener Marienkirche habe ich an einem Winterabend gebetet für die Erlaubnis, in Mariawald einzutreten. Vielleicht war es das glühendste Gebet meines jungen Lebens. Solche Gebete werden immer erhört, doch manchmal nicht auf die Weise, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Erlaubnis der Eltern ist nie erfolgt, als sie starben, war es zu spät. Die Gnade wartet nicht, sie kehrt auf anderen Wegen zurück. Ich trat in ein Leben mit einem Riss, der so tief ging, dass er nie mehr ganz heilen würde. Was immer auch geschah, wohin ich mich auch von dieser Sehnsucht entfernte, sie kam still und leise zurück. Viel wichtiger als das Schweigen und die strengen Observanzen der Trappisten blieb die Losung „Gott allein“. Ich hatte noch zu lernen, dass sie auf andere Weise auch in der tobenden Welt unsere Herzen berührt.
Der Kathedrale von Chartres darf man alles zutrauen. Alljährlich machen sich in Paris tausende Jugendliche auf den Weg. „Nur noch die Füße beten“, schrieb der Nobelpreisträger François Mauriac. Tief unten in der Krypta befindet sich die „Schwarze Madonna“. Wir gehörten zur jungen 68er Generation und trugen Kreuze, die Studentinnen flochten Feldblumen in ihr Haar. Nicht Bob Dylan sang, wir sangen Marienlieder.
3. Chartres
Das Pfingstwochenende 1969 war in Paris ein Ereignis. 15.000 Studentinnen und Studenten versammelten sich in der Frühe vor dem Bahnhof Montparnasse. Die Barrikaden des putschartigen Monats Mai des Vorjahres waren noch nicht vergessen, und doch schien alles ganz anders. Keine Demonstranten skandierten auf den Straßen, keine roten Fahnen und weltrevolutionären Spruchbänder. Keine „Internationale“ erschallte, niemand erhob die Faust. Weder Schlagstöcke noch Wasserwerfer, noch Tränengas. Es war kein Aufmarsch, sondern eine friedliche Abfahrt im Regionalzug, der die Wartenden hinüber nach Palaiseau ins Département Essone bringen sollte, dem Wohnort des Dichters Charles Péguy. Er war hier im Sommer 1913 zu einem Abenteuer aufgebrochen, das über ein Jahrhundert hinaus Folgen haben sollte. Péguy hatte ein Gelübde für die Heilung seines schwer kranken Sohnes abgelegt und pilgerte zur Schwarzen Madonna in der Kathedrale von Chartres. 100 Kilometer in glühender Hitze, vier Tage hin und zurück über Nationalstraßen, Dorfplätze und Bauernpfade. Es war ein erschütternder Pilgerweg in der Einsamkeit. Bald danach brachen befreundete Dichter und Künstler auf. Es folgten das junge Frankreich und seine europäischen Freunde.
Péguy war einer der ersten, der im September 1914 in der Marneschlacht durch einen Kopfschuss fiel. Erst wenige Monate zuvor hatte er die Sakramente empfangen. Sein Tod löste nach dem Krieg neue Chartres-Wanderungen aus, der sich immer mehr Menschen anschlossen. Vor allem die Studenten der keineswegs religiös engagierten Sorbonne-Universität machten sich auf den langen Weg. Es herrschte Umbruchzeit: Die kurze, dramatische Lebensgeschichte des Dichters rüttelte auf, seine poetischen Hymnen an die Muttergottes von Chartres kannten die jungen Menschen auswendig, sie trafen auf eine labile Ruhe. Da waren die kaum beendeten Materialschlachten und die Milde der Muttergottes, die frischen Gräber der Soldatenfriedhöfe und dann die appellierenden Marienlieder, „jetzt und in der Stunde unseres Todes“. Damals wie heute waren junge Menschen unterwegs, statt Waffen trugen sie Kreuze und Kornblumen. Über die wogenden Felder der Beauce fuhr der heiße Wind.