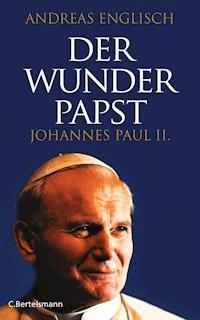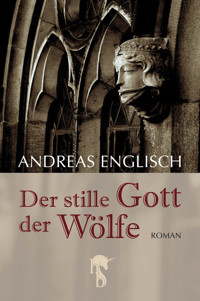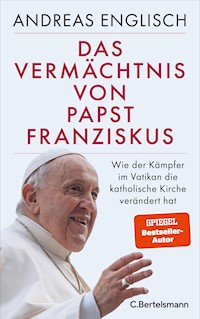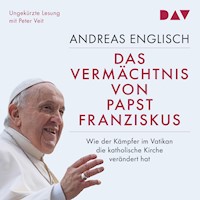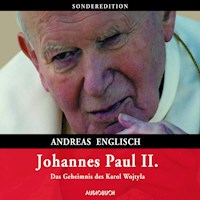9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Andreas Englisch über den mutigen Kampf des Papstes
»Spiritueller Alzheimer« – diese Diagnose hat zweifellos das Zeug dazu, in die Kirchengeschichte einzugehen. Dass es ein Papst ist, der seiner Kurie diese Form der Demenz attestierte, hat selbst den Kenner des Kirchenstaats Andreas Englisch überrascht. Mit der Weihnachtsansprache 2014 eröffnete Papst Franziskus den Kampf gegen den Teil der Kurie, der ihn seit seiner Wahl mit Spott, Verachtung und arroganter Ablehnung überzieht. Er seinerseits zeiht seine Widersacher des Hochmuts, der Verschwendung und der Niedertracht, nennt sie einen Haufen gottloser Bürokraten, die nur auf Machterhalt aus sind, und wirft ihnen vor, Christus vergessen zu haben und in spiritueller Leere zu leben.
Nicht nur die Kardinäle halten den Atem an, die Welt horcht auf. Was hat diese Attacke zu bedeuten? Was gab den Anstoß, und wie wird die Kurie reagieren? Wie ist der Einfluss von Gegnern und Unterstützern des Franziskus-Kurses einzuschätzen? Andreas Englisch analysiert die Lage im Machtzentrum der katholischen Kirche. Eines wird klar: Es geht nicht um vatikaninterne Geplänkel. Franziskus hat den Kampf eröffnet. Und der Ausgang ist völlig offen. Dieses Buch ist explosiv wie die Lage im Vatikan, spannend wie ein Thriller und basiert auf Informationen, über die nur ein intimer Kenner wie Andreas Englisch verfügt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Andreas Englisch
DER KÄMPFER
IM VATIKAN
Papst Franziskus und sein mutiger Weg
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
© 2015 by C. Bertelsmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: buxdesign München Bildredaktion: Dietlinde OrendiSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-18015-7V005www.cbertelsmann.de
Inhalt
Prolog
Auftakt
Du hast uns dein Lächeln verwehrt
Das neue Zentrum der Macht
Hallo, wie geht’s?
Der Papst zu Besuch
Sechs Jahre zuvor – Aparecida
Exkurs: Im Flugzeug des Papstes
Das Geheimnis des Jorge Bergoglio
Dann wird die Kurie bezahlen …
Der Paukenschlag
Herausforderung Walter Kasper
Kasper gegen Ratzinger
Der Aufstieg des Rebellen
Krach im Hause der Soldaten Jesu
Das Comeback des Jorge Mario Bergoglio
Schätze im Himmel – und auf der Erde
Der Grundstein für die Kirche von morgen
Der Angriff
Der Druck auf den Papst
Was will der Papst?
Verärgerung im Vatikan
Was bringt den Papst so auf?
Feinde
Besuch im Lager der Feinde
Rebellion
Sitzen geblieben
Der Papst bei den Ärmsten von Rom
Zwei Päpste
Überraschung von Turin
Franziskus geht in die Geschichte ein
Das Projekt des Papstes Franziskus
Glauben
Fürsprache im Himmel?
Zufall?
Gibt es Gott?
Abrechnung
Macht
Der große Unbekannte
Trügerische Sicherheit
Adelige Kunden
Was hat der Papst vor?
Der Kampf um die Kontrolle der Vatikanbank
Der Weg zurück
Mordkomplott gegen den Papst?
Franziskus gegen die Kurie
Das Böse in der Bank
Papst Franziskus und die Gangster
Gefährlich, weil er recht hat
Der Mann ohne Angst
Franziskus beendet eine Epoche
Hochverrat um die »grüne« Enzyklika
Regeln für die Menschen, nicht Menschen für die Regeln
Ausblick: Die große Frage
Epilog
Dank
Register
Bildteil
Prolog
Im März des Jahres 2013 geht ein 76-jähriger Mann aus Argentinien durch die nächtliche römische Innenstadt zum Priesterheim in der Via della Scrofa. Es ist ungewöhnlich kalt in Rom in diesem März. So kalt, dass die Zitronenbäume der Römer hoch oben auf den Dachterrassen noch unter Schutzfolien auf den Frühling warten. Der Wind fegt durch die Gassen, sodass die nächtlichen Spaziergänger den Kragen hochziehen müssen.
Auf dem Weg in das Priesterheim, vorbei an der menschenleeren, im Sommer von tausenden Touristen überrannten Piazza Navona trifft der Mann aus Argentinien einen Priester aus Kanada, der ihm zuwinkt. Das Gespräch der beiden Männer ist kurz: »Bete für mich!«, bittet der Mann aus Argentinien, und verwundert fragt der kanadische Priester: »Warum? Machst du dir Sorgen?«
Ja, dieser Argentinier macht sich Sorgen. Er war gerade dabei, in Rente zu gehen, und er hat nur noch einen Lungenflügel, und er weiß, dass sie ihn dorthin schicken wollen. In jenen Palast neben der riesigen Kuppel des Petersdoms, die man in der Nacht auch in entlegenen Gassen Roms erahnen kann, weil das Streulicht den Himmel über ihr erstrahlen lässt, in den Vatikan, als nächsten Papst.
Dabei hatte dieser Mann aus Buenos Aires eigentlich keine Chance gehabt, jemals das Oberhaupt der größten Kirche der Welt zu werden. Genau das nahmen seine Feinde in der Kurie ihm ungemein übel, und genau das machte ihn für seine Unterstützer so wertvoll: Er hatte nie eine einzige Chance gehabt. Dass es Jorge Mario Bergoglio jemals auf den Thron des Papstes schaffen könnte, war eine völlig abwegige Vorstellung. Genauso gut hätte irgendein hergelaufener Freizeitsportler Boxweltmeister aller Klassen werden können.
Er hatte keine Chance gehabt. Sie hatten ihn nach einer kurzen Karriere als Chef der Jesuiten in Argentinien abgeschoben als Beichtvater in ein Erholungsheim. Er stand in einem ärmlich eingerichteten Aufenthaltsraum am Ende der Welt und sah auf einem flimmernden Schwarzweiß-Fernseher zu, wie am anderen Ende der Welt der Sohn des erfolgreichen italienischen Parlamentariers und Zeitungsverlegers Giorgio Montini, jener Giovanni Battista Montini, zu Papst Paul VI. aufstieg. Es war so wie immer; eine weitere der einflussreichen italienischen Familien hatte einen Papst gestellt, wie die Colonna, die Borghese, die Pacelli zuvor.
Aber wie sollte der Sohn des Eisenbahners Bergoglio, der Beichtvater eines Heims in Buenos Aires, sich auch nur vorstellen, dass er es schaffen könnte, das Unmögliche zu erreichen? Er war ein Mann, der nach vatikanischen Maßstäben eine absolute Null war. Dass dieser Pater es schaffen könnte, in die engere Wahl für das Amt des nächsten Papstes zu gelangen, schien unmöglich. Das war nicht vorgesehen. Er war ein Jesuiten-Pater, und noch nie war ein Jesuit Papst geworden.
Er hatte auf das Amt des Papstes nie eine Chance gehabt – und das war es, was seine Unterstützer so schätzten. Sie wollten einen Außenseiter, einen absoluten Außenseiter, der das Unglaubliche schaffen könnte. Er sollte den Kreislauf durchbrechen, der es unmöglich gemacht hatte, dass ein Mann von unten und von sehr weit her es schaffte, den Thron Petri zu erreichen.
Aber diesmal konnte ein solcher totaler Außenseiter das entscheidendste aller Kräftemessen im Vatikan gewinnen und das Amt des Papstes erobern, um das zu tun, was sie von ihm erwarteten: aufzuräumen. Jetzt kam es nur noch darauf an, ob sie wirklich wussten, wie hart sein Kampf gegen die Kurie gewesen war, ob er tatsächlich der Außenseiter war, den sie wollten, zumindest viele von ihnen, sehr viele.
Die alles entscheidende Frage war, wie viel sie wussten. Die Kardinäle, die möglicherweise daran dachten, ihn zu wählen, wie sie es schon einmal versucht hatten im Jahr 2005. Wie viel wussten sie über die Demütigungen, die er erlitten hatte, über die Erniedrigungen und Beleidigungen, die immer wieder aus dem Vatikan auf ihn, den argentinischen Bischof, eingeprasselt waren? Wussten sie, wie oft man ihm, diesem Jorge Bergoglio aus Buenos Aires, nicht einmal einen Termin gegeben hatte in der Kurie? Wussten sie davon, dass die Kurie ihn immer wieder lächerlich gemacht hatte, dass sie hinter seinem Rücken Bischöfe und Universitätsrektoren ernannt hatte, ohne ihn, der eigentlich zuständig gewesen wäre, auch nur anzuhören? Die Kurie hatte ihn zum Narren gemacht, jahrzehntelang.
Der Wind zerrt in dieser Nacht an seinem billigen Priesterrock. In seiner Heimat ist es jetzt Herbst und nicht so bitterkalt wie in diesem römischen Frühjahr. Er kommt langsam voran. Er weiß, dass seine Probleme mit Füßen und Beinen ihn zu einem watschelnden Gang zwingen; er weiß, dass er von Weitem wirkt wie ein schaukelndes Schiff, ein altes Schiff, das sich durch die frostige Nacht in Rom kämpft.
Wie viel wussten sie? Das war die Frage, um die sich alles drehte. Konnte ihnen verborgen geblieben sein, dass kein anderer Bischof auf der Welt so viel Ärger mit der Kurie gehabt hatte wie er? Wussten sie, dass Ettore Ballestero aus dem Staatssekretariat im Vatikan schon alles hatte vorbereiten sollen, um ihn abzuservieren, um ihn endgültig abzuschieben? Die Kardinäle hatten überall ihre Ohren, das wusste er. Aber selbst wenn nicht, wenn sie nicht ihre Spitzel im Staatssekretariat hatten, wäre es überhaupt möglich, dass den Kardinälen verborgen geblieben war, was ein Jahrzehnt lang in Buenos Aires passiert war?
Er kennt die Antwort auf diese Fragen, während er über das holperige Kopfsteinpflaster der römischen Innenstadt geht, vorbei an den Brunnen, die eisiges Wasser ausspeien, das die Plätze der Stadt noch feuchter wirken lässt. Natürlich wussten sie Bescheid. Er hätte vorsichtiger sein müssen. Aber es war nun einmal geschehen. Er hatte dem Nuntius, dem Botschafter des Vatikans, der ihn hintergangen und hereingelegt hatte, wieder und wieder sogar den Gruß verweigert, er hatte ihm nicht einmal die Hand gegeben. Er wusste, dass sie in seinem erzbischöflichen Ordinariat hinter seinem Rücken darüber getuschelt hatten: Er gibt dem Nuntius nicht einmal mehr die Hand, so groß ist der Krach mit der Kurie im weit entfernten Rom. Gegen diese Gerüchte gab es kein Mittel. Überall in Lateinamerika wussten die Bischöfe mittlerweile, dass Bergoglio einen bitterbösen Streit mit der Kurie austrug und erhebliche Prügel bezog. Und mit Sicherheit erzählten sie es weiter, nach Europa, nach Nordamerika. Leugnen half nichts. Es gab Fotos, auf denen jeder sehen konnte, wie er voller Abscheu dem Nuntius den Rücken zukehrte. Wenn die Kardinäle jetzt einen Mann zum Papst machen wollten, der einen regelrechten Krieg gegen die Kurie vom Zaun brechen würde, der nach all diesen Skandalen unter der Regentschaft des hilflos wirkenden deutschen Papstes Benedikt XVI. keine Gnade kennen würde, dann war er die beste Lösung, das war ihm klar.
Schon einmal war ein Mann in diesen Palast eingezogen, um alles zu verändern. Er hatte 33 Tage lang regiert und war dann so überraschend gestorben, dass noch heute viele Menschen glauben, sein Tod sei kein natürlicher gewesen. Aber jetzt geht es nicht um einen Italiener mit dem Namen Papst Johannes Paul I., der die Gefahr in dem Palast der Päpste wenigstens hatte ahnen können. Diesmal geht es um einen Mann von weit her, um ihn, der nur einen zerschlissenen Koffer aus Buenos Aires mitgebracht hatte.
Zu oft hatte er die eleganten Herren kennengelernt, die in dem Palast unter der Kuppel den Ton angaben. Es wäre Wahnsinn, dort hineinzugehen, so alt wie er schon ist. Er hat keinen einzigen Freund in dieser Stadt. Jeder Schritt, den er an den abgebröckelten Fassaden vorbeigeht, die nur im Glanz der Sommersonne so warm und ockerfarben leuchten, jetzt aber feucht und abweisend wirken, zeigt ihm, wie einsam er hier ist. Denn er dürfte hier gar nicht sein, dürfte diesen Weg Richtung Via della Scrofa im schneidenden Wind, der durch die Gassen wie durch Schluchten fegt, gar nicht gehen. Ein paar Dutzend Augen am Abendbrottisch im Hauptquartier seines Jesuiten-Ordens würden die Plätze absuchen, an denen der grimmige Erzbischof von Buenos Aires eigentlich sitzen müsste; aber er wird nicht da sein. Nicht nur die Kurie hatte ihn tief gedemütigt, auch sein eigener Orden. Sie hatten ihn in die Wüste geschickt, als Beichtvater in ein bedeutungsloses Haus, nach einem sehr heftigen Streit. Er will sie nicht sehen, nicht mit ihnen an einem Tisch sitzen, nicht mit ihnen unter einem Dach schlafen. Er zieht es vor, allein durch diese in der Kälte so abweisende Stadt zu einem anonymen Priesterheim zu gehen, wo sein Koffer in einem schmalen Zimmer steht.
Sollte es so weit kommen, sollten sie ihn zum Papst wählen, wie konnte er dann verhindern, dass alles herauskommen würde, dass sie entdecken würden, wie man ihn in Lateinamerika sieht? Als einen Revoluzzer, einen Linken! Wie könnte ein Papst die römisch-katholische Kirche regieren, der im Ruf steht, ein Kommunist zu sein? Wieder und wieder hatte er betont, dass er nur ein Mann des Evangeliums sei, dass die Armen ihm am Herzen liegen, weil sie Christus am Herzen lagen. Aber genutzt hatte es nichts; sie sehen in ihm einen politischen Revoluzzer und wollen ihn so sehen. Genau diese Bewunderer könnten ihm viel gefährlicher werden als alle Feinde, sollte er zum Papst gewählt werden.
Aber wichtiger als alles andere scheint ihm eines: Er muss verschwinden. Dieser grimmige Mann aus Argentinien, er selbst, er muss aufhören zu existieren. Ein neuer Jorge Mario Bergoglio muss entstehen. Ein strahlender, ein lachender Mann. Ein Mann, dessen Gesicht die Freude des Glaubens widerspiegelt. Aber einen solchen Jorge Mario Bergoglio hatte es nie gegeben. Er muss sich neu erfinden; ein strahlender Papst für die Massen, der in dieser Rolle immer so lange durchhalten muss, so lange Freude verbreiten muss, bis er wieder hinter den schützenden Mauern des Vatikans sein würde. Erst dort darf der nachdenkliche Jorge Bergoglio aus Argentinien wieder sein trauriges Gesicht aufsetzen. Aber für die Menschen auf dem Petersplatz und für die über eine Milliarde Christen vor den Fernsehschirmen zu Weihnachten und Ostern wird ein anderer Mann gebraucht.
An diesem Abend, als er mit tief in den Manteltaschen vergrabenen Händen gegen den beißenden Wind anschreitet, bleibt die entscheidende Frage: Er selbst, was will er selbst dort in dem Palast am vatikanischen Hügel? Wenn er frei wählen könnte, was würde er dann im Vatikan tun und was würde er wollen? Er würde ein bisschen Geld erbitten für die Landstreicher, die er in den Kolonnaden an der Via della Conciliazione gesehen hat, an den Hausnummern 50 bis 54, wo sie immer schlafen, nur ein paar hundert Meter vom Eingang des Petersdomes entfernt. Aber er weiß, dass es der Kaste der Männer, die seit Jahrhunderten diesen Palast regieren, nicht um ein paar hundert Euro geht. Sie hatten in undurchsichtigen Bankgeschäften eine Milliarde Dollar verbrannt. Einer ihrer eigenen Banker wurde unter einer Brücke in London erhängt aufgefunden, ein anderer im Hochsicherheitsgefängnis in Voghera hingerichtet, und eine der Sekretärinnen der Bank sprang in den Tod, ohne dass je geklärt werden konnte, warum. Es gibt nur einen Grund, es zu wagen und dort in diesen Moloch, in die Zentrale von einer Milliarde Christen zu ziehen, und dieser Grund ist der seltsame Rabbiner aus Nazareth und sein Vertreter, dieser Shimon bar Jona, den die Welt Petrus nennt. Auch er war ein Fremder gewesen, war von weit her, aus einem Kaff in Galiläa, nach Rom gekommen – und auch er hatte Angst gehabt. Eines ist dem Mann aus Argentinien in dieser Nacht klar: Wenn er dort hineingeht, in den Palast der Männer, die seit Jahrhunderten die Kirche kontrollieren, dann ist er dort nicht willkommen. Aber dieser Shimon bar Jona war auch nicht willkommen. Als der alte Mann aus Argentinien in dem Priesterheim in der Via della Scrofa ankommt, weiß er, das er jetzt darüber nachdenken muss, ob er im Namen des Zimmermannssohnes Jesus von Nazareth gegen eine uralte Macht antreten will, und er kommt in dieser Nacht zu dem Schluss, dass er, wenn er gerufen wird, gehorchen muss.
Auftakt
Hatte Gott diesen rebellischen Papst Franziskus tatsächlich in den Vatikan geschickt, um alles umzukrempeln, was sie, die Kurienkardinäle, in jahrhundertelanger Arbeit aufgebaut hatten?
Konnte das sein?
Oder war die Wahl von Franziskus ein Unfall gewesen, was viele Kardinäle annahmen? Also ein Fehler im System, kein göttlicher Wille, sondern ein menschlicher Fehler, der diesen seltsamen Bischof aus Buenos Aires auf den Thron Petri geschickt hatte?
Hatte Gott mit der Ernennung dieses Jorge Mario Bergoglio vielleicht gar nichts zu tun, und musste man folglich in dieser Wahl gar nicht Gottes Wunsch nach Änderungen in der Kirche erkennen? Hätte dieser Aufstieg des Argentiniers zum Nachfolger des heiligen Petrus schlicht und einfach nicht geschehen dürfen? War etwas schiefgelaufen in dem seit Jahrhunderten erprobten System der Papstwahl?
Die Mehrheit der rund dreißig Kurienkardinäle, die ein Viertel der Wahlberechtigten des Konklave ausmachen, glaubte genau das: Dass die Wahl von Jorge Mario Bergoglio ein vermeidbarer Fehler gewesen war, ein Unfall, ein Unglück.
Von der ersten Sekunde an hatte der neue Papst aus Argentinien ihnen in der Kurie, der Kirchenregierung, den Krieg erklärt. Der Papst polarisierte vom ersten Augenblick an und spaltete die Kurie in zwei Teile, den großen Teil gegen und den kleinen Teil für sich. Es gab keine Fraktion, die den Papst mehr oder weniger schätzte; es gab nur Ja oder Nein, Bewunderung oder totale Ablehnung bis zum Hass. Diesen Papst und die römische Kurie verband vor allem eins: Streit, und der wurde so erbittert ausgetragen, dass die Anhänger von Papst Franziskus um sein Leben fürchteten.
Ich persönlich wurde ein paar Wochen nach der Wahl von Papst Franziskus in den Streit hineingezogen, denn ich hatte noch eine alte Rechnung offen: Ich hatte mich vor über 25 Jahren ein wenig zu genau für die Verbrechen der Vatikanbank interessiert.
Du hast uns dein Lächeln verwehrt
Vatikanstadt, 13. März 2013: Es ist kalt an diesem Abend. Auf dem Petersplatz frieren Hunderttausende, als plötzlich weißer Rauch aus dem Schornstein über der Sixtinischen Kapelle aufsteigt. Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio ist soeben zum ersten Papst der Geschichte gewählt worden, der vom amerikanischen Kontinent kommt. Ihm steht an diesem Abend eine einfache Möglichkeit offen, um ein beruhigendes Zeichen an die Kurie zu senden; ein Zeichen, das besagt, dass alles beim Alten bleiben wird, auch mit dem neuen Papst. Er muss nichts weiter tun als das, was seit Jahrhunderten Päpste nach der Wahl tun: Sich auf den Balkon des Petersdoms stellen, zusammen mit dem Generalvikar seiner neuen Diözese Rom, Kardinal Agostino Vallini, und das sagen, was Päpste auf diesem Balkon nun einmal sagen. »Sia laudato Gesu Cristo« (Gelobt sei Jesus Christus). Doch nichts dergleichen wird er tun. Und die Kurie wird schlagartig wissen, dass nun neue Zeiten anbrechen und dass es einen Kampf geben wird zwischen diesem neuen Papst und der Kurie.
Erste Unruhe macht sich bereits unter den Kurienkardinälen breit, als sich abzeichnet, dass der neue Papst sofort, im ersten Augenblick nach seiner Wahl, eine seltsame Neuerung beschlossen hat: Er will nicht allein auf den Balkon treten, wo die Welt ihn erwartet. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen verfolgen weltweit vor den Fernsehschirmen den Augenblick, wenn der neue Papst zum ersten Mal die wartende Menge segnen wird. Was mag es da zu bedeuten haben, dass der Papst einen von ihnen, einen von 115 Kardinälen, ausgewählt hat, um sich begleiten zu lassen? Es gibt erste Befürchtungen, und die Kurie rechnet mit einem beunruhigenden Signal, aber sie rechnet mit nichts, was auch nur annähernd so schlimm für sie ist, wie das, was da kommen wird.
Es wird eine katastrophale Kampfansage an sie sein, denn der Mann, den der Papst ausgewählt hat, um ihn in diesem entscheidenden Moment zu begleiten, zeichnet sich vor allem durch eines aus: Die römische Kurie hat ihn jahrelang fertiggemacht, ebenso wie den Papst selber, wie Jorge Mario Bergoglio.
Die Vorgeschichte dessen, was sich auf dem berühmtesten Balkon der Welt am Petersdom an diesem Abend abspielen sollte, als der 266. Nachfolger des heiligen Petrus ihn betritt, erlebte ich im Herbst des Jahres 2006.
Am 31. Oktober 2006 hatte Papst Benedikt überraschend den brasilianischen Franziskaner-Pater und Erzbischof von São Paulo Kardinal Claudio Hummes zum neuen Chef der Kongregation für den Klerus ernannt. Das war eine erstaunliche Entscheidung, denn Hummes gehört zu der rebellischsten aller Organisationen, mit denen der Vatikan sich seit Jahrzehnten herumschlagen muss, dem Rat der lateinamerikanischen Bischöfe CELAM. Aus der Sicht des Vatikans gehört die CELAM zur wichtigsten antivatikanischen Keimzelle der Welt. Nirgendwo sonst sind so viele Bischöfe und Kardinäle in einer Organisation vereint, die sich mit den Päpsten einen Kampf nach dem anderen liefert. Claudio Hummes war sogar Präsident der CELAM gewesen, und jetzt geschah das Unglaubliche, ausgerechnet einer der Rebellen sollte ins Zentrum der Macht geholt werden. Einer der engsten Freunde des deutschen Papstes, der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller, kennt Hummes gut und hatte bei Joseph Ratzinger ein gutes Wort für ihn eingelegt. Jahrzehntelang hatte Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation die Lehre der Theologie der Befreiung, die auch Claudio Hummes unterstützt, radikal bekämpft. Jetzt wagte er den Versuch, Claudio Hummes in den Vatikan zu holen. Die Kritiker, vor allem das Staatssekretariat, warnten den Papst, dass dieser Versuch schiefgehen würde – und er ging schief.
Mit seiner Ernennung war Claudio Hummes als Kardinalspräfekt der Chef aller katholischen Priester. Papst Benedikt XVI. hatte Claudio Hummes vor allem deswegen für dieses Amt ausgewählt, weil er in der heftigen Auseinandersetzung um Priester, die sich sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hatten, eine gute Figur abgegeben hatte. Aus Sicht von Papst Benedikt XVI. vereinte Hummes zwei wichtige Eigenschaften: Auf der einen Seite hatte er sich dadurch bewährt, dass er rückhaltlose Aufklärung wollte, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf der anderen Seite gehörte er zu den Kardinälen, die immer wieder beteuerten, dass nur eine verschwindend geringe Minderheit der Priester sich jemals einer sexuellen Straftat schuldig gemacht hat.
Damals also, im Jahr 2006, erwartete ich mit meinen Kollegen voller Spannung die Ankunft von Claudio Hummes in Rom. Wir hatten den Kardinal gebeten, uns nach seiner Ankunft ein kurzes Interview zu geben, und er hatte eingewilligt. Wir sollten uns im Haus der heiligen Martha, dem Hotel der Kardinäle, treffen, um mit ihm zu sprechen. Vor dem Abflug aus São Paulo erklärte Hummes überraschend Grundsätzliches zu seinem neuen Job. Die Ehelosigkeit der Priester, der Zölibat, sei kein Dogma der Kirche, sondern eine disziplinarische Norm, die man auch abschaffen könne. Während Claudio Hummes im Flugzeug auf dem Weg nach Rom saß, rätselte ich mit meinen Kollegen darüber, ob der alte Grundsatz auch im Fall Hummes gelten werde: Bisher war es noch immer so gewesen, dass jeder wichtige Kirchenmann, der nur in Erwägung gezogen hatte, Priestern die Ehe und ein Sexualleben zu erlauben, sich an diesem heißen Eisen so schwer verbrannt hatte, als wäre ihm eine Granate in der Hand explodiert. Im Fall Hummes war die Situation noch weit dramatischer, weil nicht irgendein Kardinal, sondern der neue Chef aller Priester gesagt hatte, dass er sich den Priesterstand auch ohne den Zölibat vorstellen könnte. War das die neue Linie der Kirche, würde man sich weltweit fragen.
Als wir im Haus der heiligen Martha ankamen, unmittelbar nachdem Claudio Hummes gelandet war, überraschten uns die Ordensfrauen an der Rezeption mit der Nachricht, dass Claudio Hummes nicht da sei. Er sei sofort nach dem Eintreffen, unmittelbar und mit höchster Dringlichkeit, zu Papst Benedikt XVI. gerufen worden. Sofort wussten wir, dass auch Claudio Hummes sich schwer an dem Thema Zölibat verbrannt hatte. Während wir auf den Kardinal aus Brasilien warteten, wurde ihm vom Papst der Kopf gewaschen, und zwar gründlich. Claudio Hummes musste bitter büßen und für seine Meinungsäußerung teuer bezahlen. Er wurde gezwungen, eine Schrift zu veröffentlichen, in der er das Geschenk der Ehelosigkeit der Priester lobte. Das war eine schallende Ohrfeige. Innerhalb der Kurie galt Claudio Hummes seitdem als erledigt, sein Fehler galt als unverzeihlich. Das Schicksal von Claudio Hummes war besiegelt, von der Kurie wurde er ausgestoßen, behandelt wie ein schwarzes Schaf; während seiner Amtszeit sehnte er sich nur nach Brasilien zurück.
Doch dann wird am 13. März 2013 Papst Franziskus gewählt, und er zeigt in seiner allerersten Amtshandlung, was er von dem abgestraften Mann hält. Er holt ihn – und nur ihn – auf den berühmtesten Balkon der Welt am Petersdom. Als die Kardinäle das Konklave verlassen, wissen sie, dass laut Protokoll der Papst nur mit zwei Begleitern den Balkon betreten wird, um sich der Welt zu zeigen, dem Kardinalvikar von Rom Agostino Vallini und dem Zeremonienchef Guido Marini. Aber plötzlich sagt Papst Franziskus zu Claudio Hummes: »Monsignore Claudio, kommen Sie mit mir, seien Sie bei mir in diesem Moment auf dem Balkon. Rasch! Nehmen Sie Ihr Birett.«
Überrascht greift Hummes zu seinem Kardinalshut und folgt dem Papst.
Aber bevor der neue Papst den Balkon betritt, vollzieht sich etwas Erstaunliches, das vielleicht Rätselhafteste dieses Pontifikats: Papst Franziskus ist auf dem Weg zum Balkon über dem Petersplatz. Er weiß, dass er jetzt handeln muss. Er hat keine Zeit mehr zu verlieren. Der bisherige Jorge Mario Bergoglio muss verschwinden, dieser eigenbrötlerische, mürrische Intellektuelle hat keine andere Wahl, als unterzugehen – und zwar für immer. Nur in Momenten, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn Papst Franziskus dieses Lächeln der Freude des Christen beim besten Willen nicht mehr aufbringt, dann darf der traurig wirkende Jorge Mario Bergoglio zurückkehren. Nur noch im Privaten darf er ihn auftauchen lassen.
Für den Balkon und die Massen muss ein anderer Mann her, ein neuer Mann. Auf dem Platz vor dem Dom von Buenos Aires war nie ein lächelnder Jorge Mario Bergoglio durch die Reihen gefahren, hatte nie ein strahlender Bischof reine Freude vor den Menschen verbreitet, stundenlang. Auf dem Weg zum Balkon muss der Mann aus Argentinien diesen neuen Jorge Mario Bergoglio erfinden. Dieser neue Bergoglio muss stark sein, stark genug, um es mit der Kurie aufzunehmen, mit der Kirche der Bürokraten, die Christus vergessen haben. Die Massen würden einen Papst, den sie wegen seines strahlenden Lächelns lieben und feiern, stark machen, stark genug, um den Kampf im Innern der Kirche aufnehmen zu können. Die Menge auf dem Petersplatz würde sich nicht einmal vorstellen können, dass Jorge Mario Bergoglio je anders gewesen war als dieser strahlende, winkende, segnende, die Massen stets aufs Neue begeisternde Mann, dass dieser Bischof von Rom in seinem alten Bistum in Buenos Aires jahrzehntelang ein mürrischer, als griesgrämig bekannter Mann gewesen war. Dass ein Jesuit es schaffen könnte, sich 76 Jahre nach seiner Geburt zu verwandeln, sich neu zu erfinden, schien undenkbar. Doch Jorge Mario Bergoglio weiß, dass die Verwandlung nötig sein würde, weil er die Menge braucht, um den Krieg im Innern der Kirche gewinnen zu können.
Nur eine Handvoll Menschen kann ermessen, dass Bergoglio in diesen wenigen Minuten einen neuen Mann hervorzaubert. Seine Priester aus Buenos Aires, die ihn seit Jahrzehnten kannten, fragten ihn in einem Brief im Sommer 2015: »Warum hast Du uns zwanzig Jahre lang Dein Lächeln verwehrt?« An diesem ersten Abend hat er geahnt, dass die, die ihn daheim in Argentinien wirklich kannten, mit Fassungslosigkeit den neuen, lachenden, strahlenden Papst Fanziskus würden über den Petersplatz fahren sehen, einen Mann, den sie so noch nie gesehen hatten.
Dann ist es soweit, und ein lächelnder Papst Franziskus tritt auf den Balkon über dem Petersplatz. Jetzt kommt es darauf an, und Franziskus macht alles richtig. Er lässt den eigenbrötlerischen, missmutigen, verschlossenen Intellektuellen Jorge Mario Bergoglio verschwinden und einen lächelnden, gewinnenden Papst Franziskus erstehen, der mit dem Wort »Buonasera« die Welt anrührt. Dieser Mann würde neue Hoffnung bringen. Ein warmherziger, ein positiver, ein lächelnder Mann, der weiß, dass er nicht mehr zurück kann. Jetzt ist er Papst Franziskus, und nur noch hinter verschlossenen Türen darf der enttäuschte, düstere, verbitterte Jorge Mario Bergoglio weiter existieren.
Was an diesem Abend der Wahl von Papst Franziskus nur wenigen auffällt, ist, dass Papst Franziskus mit Claudio Hummes einen der Chefs der Rebellen-Organisation CELAM auf den Balkon des Petersdoms geholt hat. Jahrzehntelang hat die CELAM sich aus Rom demütigen lassen müssen, und nun steht nicht nur ein Papst, der zur CELAM gehörte, auf dem Balkon. Schon an diesem ersten Abend fragen sich die Kurienkardinäle: Wer ist eigentlich dieser Jorge Mario Bergoglio, und was will er? Will er die Kurie, so wie sie existiert, zerschlagen? Will er eine neue Regierung der Kirche? Werden die Kardinäle der Kurie jetzt dafür bezahlen müssen, dass sie Männer wie Hummes und Bergoglio jahrzehntelang schikaniert haben? An diesem Abend fängt es an.
Das neue Zentrum der Macht
Das Pontifikat von Papst Franziskus beginnt, nach den ersten Irritationen unmittelbar nach der Wahl, mit einem Paukenschlag, der seine Beziehung zur Kurie entscheidend prägen wird: Der Papst weigert sich, ins päpstliche Appartement im Apostolischen Palast einzuziehen. Er beschließt, im schlichten Gästehaus der heiligen Martha zu wohnen. Eine nur auf den ersten Blick kleine Geste, denn damit hat er nicht nur gegen den Luxus des Palastes protestiert; er will sich auch nicht isolieren lassen. Bis heute ist er mittendrin, isst in der Mensa, wo die übrigen leitenden Angestellten des Vatikans speisen. Diese Entscheidung trägt wesentlich dazu bei, dass dem Papst nichts mehr verheimlicht werden kann. Er ist immer präsent. Der Papst lebt dort, wo das Herz des Vatikans schlägt, im Gästehaus der heiligen Martha. Jahrzehntelang wurden dort Gerüchte und geheime Informationen ausgetauscht, von denen der Papst im weit entfernten Apostolischen Palast nie etwas mitbekommen hat. Damit ist jetzt Schluss.
Bis zur Übersiedlung von Papst Franziskus in das Gästehaus der heiligen Martha gab es in Rom eine Menge Möglichkeiten, sich äußerst Exklusives zu leisten. Viele Touristen aus den USA zeigen gern sich selbst und der Welt, dass sie es zu etwas gebracht haben, indem sie ein sündhaft teures Abendessen an der Via Veneto einnehmen. Dort entstanden auf hart umkämpften und klar abgetrennten Teilen des Bürgersteiges gläserne Restaurant-Separees für Urlauber, die einmal im Leben dort, wo in den 50er-Jahren das Dolce Vita zelebriert wurde, viel Geld ausgeben wollen. Natürlich kann man sich auch eine Shopping-Tour durch die Via dei Condotti gönnen, wo sehr reiche Kauflustige in Schlangen vor den Luxus-Boutiquen geduldig warten, bis die Sicherheitsleute wieder einen Schwung Kauflustige in die Boutique lassen, damit sie dort nach der langen Warterei endlich Unmengen Geld ausgeben können. Doch den exklusivsten Ort der Welt schafft unmittelbar nach seiner Wahl der Papst. Diese exklusivste Leistung der Stadt Rom ist relativ preisgünstig, schlägt nur mit 85 Euro zu Buche; dennoch ist sie den normalen Sterblichen verwehrt: eine Nacht im Hotel des Papstes, dem Gästehaus der heiligen Martha.
Wer mit eigenen Augen die Frauen und Männer sehen möchte, die es am Hofe von Papst Franziskus tatsächlich zu etwas gebracht haben, sollte abends nach 22 Uhr zum mittlerweile abgesperrten Petersplatz gehen und auf die kleine Pforte links vom Haupteingang des Petersdoms schauen, am sogenannten Arco delle Campane (Bogengang der Glocken). Nach 20 Uhr werden die Tore des Vatikans für alle Touristen und Besucher gesperrt. Nur wer im Vatikan wohnt, kann dann noch hinein und hinaus. Tagsüber strömen zehntausende Touristen am Arco delle Campane vorbei, wenn sie aus dem Petersdom kommen. Doch am Abend ist es hier still, lediglich eine schmale Tür neben dem Bogen ist erleuchtet, die von Schweizergardisten bewacht wird. Außer ein paar Streifenwagen, die den Platz kontrollieren, ist er leer. Wer eine Weile wartet, kann am späten Abend ab und zu Frauen oder Männer sehen, die ganz selbstverständlich auf den Petersplatz zugehen und die schweren Holzabsperrungen ein wenig zur Seite rücken, um auf den Platz zu gelangen. Selbstverständlich kommt sofort ein Streifenwagen der Polizei bedrohlich schnell herangeschossen. Sobald der Wagen stoppt, holt der oder die Betreffende das Exklusivste, was Rom zu bieten hat, aus der Tasche: einen kleinen, unscheinbaren Schlüssel mit einem Messinganhänger, der etwa so groß ist wie zwei Scheckkarten. Die Polizisten beäugen den Schlüssel und lassen mit einem freundlichen Buonanotte (Gute Nacht) den Gast passieren, der allein über den riesigen Petersplatz marschieren darf. Am Grenzübergang, dem Arco delle Campane, wiederholt sich das Ritual. Die Soldaten der Schweizergarde setzen einen misstrauischen Blick auf gegenüber jedem, der allein über den Petersplatz spaziert. Sobald der Betreffende dann in die Tasche fasst und den Schlüssel zeigt, darf er nicht nur passieren, sondern wird auch mit einem Salut begrüßt. Nachdem der Gast die Grenzstation der Schweizergardisten hinter sich gelassen hat, betritt er ein regelrechtes Zauberreich.
Dieser Eindruck hat vor allem damit zu tun, dass rund um den Petersplatz nahezu 24 Stunden täglich das Leben tobt. In den Stoßzeiten schieben sich die Autos im Schritttempo durch die Straßen und über die Plätze. Geschäfte und Bars haben bis spät in die Nacht geöffnet. Es ist Tag und Nacht sehr laut. Knatternde Vespas, wummernde Bässe der Beschallungsanlagen der Bars, der ohrenbetäubende Lärm der Polizei- und Rettungswagen erfüllen die Luft. Sobald jedoch der privilegierte Gast des Hotels des Papstes den Grenzübergang am Arco delle Campane hinter sich gelassen hat, erstirbt schlagartig der Lärm der Stadt, und ein Zauberreich tut sich auf. Mich überrascht es jedes Mal aufs Neue, wie unglaublich leise es am späten Abend im Vatikan ist, obwohl der Petersdom mitten in einer 3,5-Millionen-Einwohner-Stadt liegt. Man kann den Flügelschlag der Vögel hören, das Rascheln der Eidechsen im Gras.
Auf dem Weg zum Hotel des Papstes geht der Gast über einen der geschichtsträchtigsten Orte der Welt, die ehemalige Privat-Rennbahn von Kaiser Nero. Hier, am anderen Ufer des Tibers, hatte sich Nero eine Rennbahn bauen lassen, die zunächst für ihn allein reserviert war. Weil Kaiser Nero mit seinem roten Bart aber gern in der Öffentlichkeit auftrat, ließ er später die Römer in diesen Circus. Hier soll das Massaker während der Christenverfolgung unter Nero stattgefunden haben. Hier soll Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden sein. Wenn man am späten Abend an der Basilika des Petersdoms vorbeigeht, sieht man in der Dunkelheit am Durchgang nahe der Ausgrabungsstätte unter dem Petersdom einen roten Markierungsstein. Dort stand der Obelisk im einstigen Zentrum der Rennbahn des Circus. Sobald man die Stelle passiert hat, an der der Obelisk stand, durchquert man einen weiteren Durchgang und schaut auf die kleine Grünfläche, ein paar Bäume und ein Stück Rasen, die um einen Brunnen herum direkt hinter der Tankstelle des Vatikans liegt. Kaum kommt der nächtliche Spaziergänger in die Nähe dieser Grünfläche, tritt der Gendarm des Vatikans aus seinem Unterstand, der in Sichtweite des Hauptquartiers der Gendarmerie liegt. Der Gendarm wird den Hotelgast zunächst misstrauisch beäugen, bis der den Hotelschlüssel mit dem Anhänger des Hauses der heiligen Martha aus der Tasche zieht. Sogleich wird der Gendarm die Hacken zusammenschlagen und eine besonders gute Nachtruhe wünschen. Danach kann der Besucher sich nach links wenden, wo hinter einer sich mit leisem Zischen öffnenden Glastür die Eingangshalle des Hotels des Papstes liegt. Wer vor 22 Uhr nach Hause kommt, hat eine Chance, das Licht in den Fenstern über dem Eingang des Gästehauses zu sehen und vielleicht sogar den Schatten eines Mannes, des 266. Nachfolgers des heiligen Petrus. Papst Franziskus wohnt in den beiden Räumen direkt über dem Eingang, in der einzigen, äußerst bescheidenen »Suite« des Hotels. Die Fahne des Vatikans, die über dem Eingang des Hauses flattert, lässt sich nur vom Zimmer des Papstes aus hissen, das geschieht aber diskreterweise nur dann, wenn der Papst nicht in seinem Zimmer weilt.
Nachdem Papst Franziskus entschieden hatte, ins Haus der heiligen Martha einzuziehen, stellten die Gendarmen zunächst Trennwände vor dem Gebäude auf, aber nach ein paar Monaten ließ Papst Franziskus sie wieder abbauen. Die Tür zum Haupteingang schließt um 23 Uhr. Wer danach kommt, muss den sogenannten Nachtschlüssel benutzen. Mit diesem Schlüssel kann man das Törchen links neben dem Gästehaus der heiligen Martha aufschließen und durch einen Seiteneingang in das Foyer des Hotels gelangen. Die Rezeption ist um diese Zeit nicht mehr besetzt. Wer rechtzeitig kommt, geht durch die Glastür direkt an der Büste von Papst Johannes Paul II. vorbei die Treppe hinunter zum Empfang. Dort erwarten die Ordensfrauen des Ordens der Barmherzigen Schwestern von San Vincenzo dei Paoli den Gast.
Im Jahr 1884 kamen die ersten vier Nonnen des Ordens in den Vatikan, auf Wunsch von Papst Leo XIII. Dieser Papst hatte Angst davor, dass sich die furchtbare, damals als asiatische Krankheit bekannte Cholera in Italien weiter ausbreiten und den Vatikan erreichen könnte. Die Ordensfrauen sollten sich auf den Fall vorbereiten, dass im Vatikan schlagartig zahlreiche Kranke versorgt werden müssten. Der Papst wollte die Kranken im Fall einer Epidemie nicht wegschicken. Sie sollten am Petersdom in einem alten Hospital behandelt werden. Dieses Gebäude gibt es nicht mehr. Es wurde abgerissen, und an dieser Stelle ließ Papst Johannes Paul II. das Gästehaus der heiligen Martha errichten.
Es gibt keinen anderen Ort im Vatikan, an dem man die revolutionären Veränderungen von Papst Franziskus so konkret erleben kann wie hier. Der Papst bewegt sich selbstverständlich im Haus. Zu Beginn dieser Neuerung war die Tatsache, dass Franziskus im Gästehaus wohnt, so unvorstellbar für den Vatikan, dass die Verantwortlichen für das Haus nicht wussten, was sie tun sollten. Gendarmen wurden extra bereitgestellt, die sofort, wenn der Papst sein Zimmer verließ und mit dem Fahrstuhl zum Abendessen hinunter- oder danach wieder hinauffahren wollte, mit ihm in den Fahrstuhl stiegen und für ihn die Knöpfe drückten. Schließlich hatte ein Papst früher im Apostolischen Palast auch nicht einfach selbst einen Fahrstuhl benutzt. Doch nach und nach gelang es Franziskus, der Verwaltung des Hauses klarzumachen, was sein größter Wunsch ist: Er möchte, dass um ihn möglichst wenig Aufhebens gemacht wird. Die Gendarmen verschwanden daraufhin wieder aus den Fahrstühlen. Der Papst drückt die Knöpfe jetzt selbst.
Mir persönlich erscheint die Vorstellung, dass der Papst im Haus der heiligen Martha wohnt, nach wie vor unglaublich. Ich erinnere mich gut an die Einweihung des Hauses im Jahr 1996. Papst Johannes Paul II. kam natürlich. Er war damals noch gut zu Fuß, ließ sich das Haus zeigen und segnete es. Aber eines war ganz klar: Dieses moderne Gebäude mit den deprimierend dunklen Fluren und den tristen Zimmern mit ihren schweren, dunklen Möbeln, die eher an Särge als an behagliches Wohnen erinnern, das war das Haus ausländischer Kardinäle und ihrer Gäste, nicht das des Papstes. Dieses Gebäude ist das Gegenteil des Apostolischen Palastes. Es liegt auf der lauten und weltlichen Seite von Sankt Peter, weit weg vom Zentrum der Macht.
Das Haus der heiligen Martha war damals nagelneu. Und Johannes Paul II. war der erste Papst, der es vor Franziskus betreten hatte. Der Apostolische Palast hingegen wurde während der Regierungszeit des Medici-Papstes Leo X. Anfang des 16. Jahrhunderts fertig. Das bedeutet, dass die Päpste bereits in diesem Palast wohnten, als Martin Luther die Kirche noch gar nicht gespalten hatte. Ebendieser Papst Leo X., Giovanni de’ Medici, wird die verhängnisvolle Bulle der Exkommunizierung Martin Luthers Decet Romanum Pontificem im neuen Apostolischen Palast verfassen. Das erste Gold, das Christophorus Columbus aus der Neuen Welt nach Spanien schickt, wird der spanische König in den Palast des Papstes senden, wo es bis heute als Blattgold eine Decke ziert.
Der Apostolische Palast ist mit der Geschichte der Menschheit eng verknüpft. In diesem Palast bewohnte schon Papst Alexander VI. die bis heute erhaltenen Gemächer, und dort teilte er auf einer fehlerhaften Karte Südamerika in einen portugiesischen und einen spanischen Teil. So entstand das heutige Brasilien.
Gemessen an diesem Palast gleicht das Gästehaus der heiligen Martha einer unscheinbaren modernen Pension, wie es sie zu Abertausenden auf der Welt gibt. Die Unterschiede zwischen einer Pension und einem Palast liegen auf der Hand: Fünf Jahrhunderte lang hatten Päpste daran getüftelt, wie sie ihre Macht und Bedeutung am besten in Szene setzen könnten, und das Ergebnis ist beeindruckend. Ich kann mich sehr genau an alle privaten Audienzen mit Papst Johannes Paul II. erinnern, und ich muss zugeben, dass der Effekt des Weges bis zum Papst beeindruckend ist. Auf diesem Weg quer durch den Apostolischen Palast schrumpft jeder Besucher vor lauter Ehrfurcht. Jeder, der einmal durch die prächtige Loggia des Raffael gegangen ist, die das Genie aus Urbino mit exotischen Tieren geschmückt hat, und jeder, der den beeindruckenden Clementina-Saal durchschreitet, in dem die Ehrengarde der Schweizergardisten Aufstellung nimmt, wird mit jedem Schritt demütiger angesichts dieser Herrlichkeit. Dann geht es aber noch weiter, durch weitere vier Säle, vorbei am Thron des Papstes, der dem Besucher klarmacht, dass er dabei ist, einen der wichtigsten und einflussreichsten Männer der Welt zu treffen. Steht der Gast endlich an der Apostolischen Bibliothek vor dem Papst, wie erschlagen von solcher Schönheit und Demonstration der Macht, fühlt er sich gleichzeitig sehr klein, aber auch unendlich geehrt, hier überhaupt sein zu dürfen. Das ist natürlich ein seit Jahrhunderten beabsichtigter Effekt. Der lange Weg durch das Potpourri der Pracht der Päpste trifft die Besucher mit Wucht. Ich habe Dutzende von Delegationen überwältigt staunend durch den Apostolischen Palast gehen sehen, und wenn die Gäste schließlich vor den Papst traten, schien es angemessen, dass sie vor ihm auf die Knie fielen in äußerster Demut.
Was für ein Unterschied zu dem Empfangsraum von Papst Franziskus im Haus der heiligen Martha! Es ist ein Zimmerchen am Fuß der Eingangstreppe auf der linken Seite in der Nähe der Rezeption. Wenn nicht der Papst in dem Raum mit einem Besucher sitzt, wird das Zimmer von den Kirchenmännern gern schon mal zum Fußballschauen genutzt, weil darin ein Fernseher steht. In den Zimmern des Hauses gibt es nämlich keine Fernseher. Der Empfangsraum hat den Charme eines Wartezimmers bei einem Kassenarzt, nur dass statt einer veralteten Zeitschrift das päpstliche Jahrbuch Annuario Pontificio auf dem Tisch liegt. Dass der lange Weg durch die farbenprächtige Eleganz der Jahrhunderte wegfällt und der Besucher im Gästehaus der heiligen Martha nur eine profane Treppe hinuntergehen muss, um in das Zimmerchen zu kommen, wo er mit dem Papst zusammentreffen wird, hat genau den Effekt, den Franziskus sich wünscht: Bei seinen Treffen geht es um Inhalte. Die Form ist beiläufig. Der Papst sitzt in dem schlichten Zimmer in seiner dünnen weißen Soutane, durch die seine schwarze Straßenkleidung schimmert, und empfängt dort die Besucher.
Papst Franziskus spricht auch anders als seine Vorgänger Papst Benedikt XVI. oder Papst Johannes Paul II. Joseph Ratzinger hatte sicherlich harte theologische Positionen, aber eine sehr weiche Stimme. Papst Benedikt XVI. sprach wie ein Lehrer, mit Rücksicht und Langmut. Er erklärte mit Präzision komplizierte theologische Zusammenhänge, schoss aber immer wieder übers Ziel hinaus. Ich erinnere mich an die Predigt während des Weltjugendtages in Sydney (Australien). Die Ansprache war so kompliziert, dass selbst der Jesuiten-Pater Federico Lombardi erklärte, dass er die Predigt noch mal nachlesen müsse, um zu erklären, worum es gehe. Wie die 300000 jungen Menschen die Rede kapieren sollten, wenn Lombardi sie nicht verstand, war mir ein Rätsel.
Johannes Paul II. hingegen sprach in den Jahren, als er noch ein gesunder, energischer Mann gewesen war, wie ein Kämpfer. Er konnte sehr hart sein. Legendär ist, wie er auf dem Flughafen von Managua im Jahr 1983 den Trappisten-Pater Ernesto Cardenal zusammenbrüllte. Ich selbst musste mich auch einmal zurechtweisen lassen. Im päpstlichen Flugzeug hatte ich dem Papst gesagt, dass wir am Sonntag während einer Papstreise im Pressezentrum viel würden arbeiten müssen. Papst Johannes Paul II. rügte mich verärgert: »Am Sonntag gehörst du in die Messe und nirgendwo sonst hin, und da wirst du auch hingehen.«
Papst Franziskus hat eine werbende Stimme, die eher um Verständnis bittet als gebietet. Er trägt seine Kernbotschaft, sein Anliegen, stets wie ein Bittsteller vor. Nicht wie ein Nachfolger des Medici-Papstes Leo X., der seinen Clown auspeitschen ließ, wenn der nicht lustig genug war. Was sein Anliegen ist, kann Franziskus in einfachen Worten sagen, wieder und wieder. »Lassen wir die Armen nie allein«, fordert der Papst in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium. Dort schreibt er auch: »Heute und immer gilt: Die Armen sind die ersten Adressaten des Evangeliums. Ohne Umschweife ist zu sagen, dass (…) ein untrennbares Band zwischen unserem Glauben und den Armen besteht.«
Was den Papst sehr beunruhigt, formuliert er direkt: »Die Anbetung des Goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel« (Evangelii Gaudium).
Papst Franziskus kommt von jenem Kontinent, der laut Weltbank-Statistiken der Teil der Welt ist, in dem der Unterschied zwischen Reich und Arm so dramatisch ausfällt wie nirgendwo sonst. Deswegen schreibt der Papst auch: »Heute wird von vielen Seiten eine größere Sicherheit gefordert. Doch solange die Ausschließung und die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft und unter den verschiedenen Völkern nicht beseitigt werden, wird es unmöglich sein, die Gewalt auszumerzen. Die Armen und die ärmsten Bevölkerungen werden der Gewalt beschuldigt, aber ohne Chancengleichheit finden die verschiedenen Formen von Aggressionen und Krieg einen fruchtbaren Boden, der früher oder später die Explosion verursacht« (Evangelii Gaudium).
Franziskus weiß, dass seine Haltung, die bedingungslose Hinwendung an die Armen, die harte Kritik an den bestehenden kapitalistischen Systemen, die Forderung einer gerechteren Verteilung von Reichtum, ihm Feinde einbringt, die seine Haltung heftig attackieren. Deswegen betonte er in der Evangelii Gaudium: »Falls jemand sich durch meine Worte beleidigt fühlt, versichere ich ihm, dass ich sie mit Liebe und in bester Absicht sage, weit entfernt von jedem persönlichen Interesse und politischer Ideologie. Mein Wort ist nicht das eines Feindes, noch das eines Gegners.«
Von einem kleinen Zimmerchen aus, am Fuß der Treppe im Gästehaus der heiligen Martha, beginnt also Papst Franziskus nun, den ältesten und vielleicht am stärksten verkrusteten Apparat der Welt, die römische Kurie, auseinanderzunehmen. Der Papst der Armen will mit aller Kraft den alteingesessenen Kirchenfürsten den Boden entziehen und an einer neuen Kirche bauen.
Hallo, wie geht’s?
Seine Revolution leitete Papst Franziskus sehr einfach ein: Päpste waren bis zur Wahl von Jorge Mario Bergoglio Träger eines Amtes gewesen. Papst Franziskus schaffte das ab. Der Papst ist ab jetzt ein Mensch, kein Amtsträger. Um das zu erreichen, zerschlug der 266. Nachfolger des heiligen Petrus aus dem fernen Argentinien das ganze komplexe Gebilde, das um das Amt des Papstes herum aufgebaut war.
Ein Papst war bisher immer verwaltet worden. Da gab es zunächst einmal seine beiden Sekretäre, den ersten, den entscheidenden, und den nachgeordneten zweiten Sekretär, die im Laufe der Amtszeit eines Papstes in der Regel enorme Machtfülle aufbauten. Das galt auch für Dr. Georg Gänswein, den Sekretär von Papst Benedikt XVI.; er hatte es mit einem Papst zu tun, der an der Amtsführung wenig interessiert war und sich mehr seinen theologischen Studien widmen wollte. Zwangsläufig übernahm der Sekretär also eine Art Management des Papsttums.
Papst Franziskus vernichtete diese Konstruktion, indem er seinen Sekretären alle Macht nahm. Er beschäftigt zwar zwei Sekretäre, die ihm zuarbeiten, aber er verhindert, dass sie Macht über ihn gewinnen. So schuf Papst Franziskus das erste Pontifikat, in dem die Sekretäre den Papst nicht auf seinen Auslandsreisen begleiten.
Das nächste Amt, das dran glauben musste, war das Amt des Präfekten des päpstlichen Hauses. Kurz vor dem Rücktritt von Papst Benedikt war Georg Gänswein zum Präfekten des päpstlichen Hauses befördert worden. Eines war damit klar: Er wollte auch nach dem Rücktritt seines Chefs Joseph Ratzinger im Vatikan bleiben und nicht nach Deutschland zurückgehen. Um dies sicherzustellen, griff er zu der ungewöhnlichen Maßnahme, sich zum Präfekten des päpstlichen Hauses befördern zu lassen, obwohl er gleichzeitig Sekretär des Papstes war. Normalerweise kontrolliert der Präfekt des päpstlichen Hauses den Zugang zum Papst. Es gab so gut wie niemanden, der am Präfekten vorbei zum Papst gelangen konnte. Doch auch diese Regel setzte Papst Franziskus außer Kraft. Wer den Papst treffen darf, das bestimmt jetzt der Papst allein. Auch eine dritte Gepflogenheit eliminierte Franziskus. Die Päpste hatten neben ihren Sekretären, die sich um alle offiziellen Kontakte kümmerten, immer noch ein zweites Sekretariat, das alle privaten Kontakte der Päpste organisierte. Im Fall von Papst Johannes Paul II. war das eine Ordensfrau gewesen, für Papst Benedikt hatte lange sein enger Freund Bischof Josef Clemens die Kontakte zu Freunden des Papstes gehalten. Eine der Hauptaufgaben dieses privaten Sekretariats war es, die Telefonate des Papstes vorzubereiten. Wenn der Papst etwa einen alten Schulfreund anrufen wollte, dann bereitete das private Sekretariat das Gespräch vor.
Doch Papst Franziskus dachte nicht daran, sich durch diesen Filter abschirmen zu lassen. Er greift selbst zum Telefonhörer, wenn er jemanden sprechen will. Dabei kommt es immer wieder zu verwirrenden und manchmal amüsanten Situationen. Als Papst Franziskus etwa einen Besuch bei seinem eigenen Orden, den Jesuiten, anmelden wollte, deshalb den Pförtner der Jesuiten neben dem Petersdom direkt anrief und sich mit dem Satz meldete: »Hier spricht der Papst«, antwortete der Pförtner: »Und ich bin der Kaiser von China.«
Auch ein weiteres Prinzip setzte Papst Franziskus außer Kraft: die Regeln des päpstlichen Terminkalenders. Seit etwa hundert Jahren hatten die Päpste ihren Terminkalender mit den Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit abgestimmt. Das war früher der Chef der Vatikan-Tageszeitung Osservatore Romano, später der Boss des Presseamtes. Und das bedeutete vor allem: Die Terminkalender des Papstes waren öffentlich.
Jeder konnte sich darüber informieren, wann der Papst wo sein würde, wann er wen besuchen, wann er wo predigen und wann er wo die Heilige Messe lesen würde. Papst Franziskus schaffte das ab. Nachfragen im Presseamt, beim Pressesprecher Pater Federico Lombardi, förderten das eigenartige Ergebnis zutage, dass Lombardi zugeben musste: »Ich habe keine Ahnung, wann genau dieser Papst was tut.«
Besuche von Mitarbeitern beim Papst waren jahrhundertelang nach sehr genau geregelten Abläufen vor sich gegangen, eine Gepflogenheit des päpstlichen Hofes, die Papst Franziskus ebenfalls pulverisierte. Wer eine Privataudienz beim Papst haben wollte, musste sich früher zunächst an den Präfekten des päpstlichen Hauses wenden und bekam dann, nach einigen Tagen oder Wochen oder manchmal nach Jahren, wie Bischof Emanuel Milingo, einen Brief, der durch einen Boten des Vatikans persönlich zugestellt wurde und die genauen Umstände der Privataudienz für den Mitarbeiter erläuterte.
In diesen Briefen wurde genau aufgelistet, wann der betreffende Besucher wo sein musste, um von den Mitarbeitern der Präfektur des päpstlichen Hauses empfangen und später weiter zum Papst gebracht zu werden. Zudem enthielt der Brief weitere Anweisungen, so auch die Beschreibung dessen, was der Besucher anzuziehen hatte. Wenn der Besucher dann korrekt gekleidet zur rechten Uhrzeit am Eingang für Mitarbeiter, dem Bronzetor, eintraf, nahm ihn ein Mitarbeiter der Präfektur des päpstlichen Hauses in Empfang und geleitete ihn über die Treppe am Eingang des Vatikans in der Nähe der spektakulären Bramante-Treppe hinauf in den Damasus-Hof. Dort ging es weiter mit dem Fahrstuhl hinauf in den zweiten Stock, zur sogenannten Seconda Loggia. Dort erwarteten die Schweizergardisten den Besucher, die ihn weiter in den sogenannten Volieren-Saal brachten. Dieser ist ein lang gestreckter Raum, in dem eine Reihe mit zahlreichen Stühlen auf die Besucher wartete; er diente dazu, Taschen und Mäntel abzulegen. Mitarbeiter des Renaissance-Genies Raffael Sanzio haben diesen Flur ausgemalt. Der Volieren-Saal ist mit exotischen Vögeln verziert. In diesem wie ein Tanzsaal großen Raum hatten Besucher die letzte Gelegenheit, sich auf das Gespräch mit dem Papst in Ruhe vorzubereiten. Ab diesem Punkt übernahm der Chef, also der Präfekt des päpstlichen Hauses, und führte den Gast durch die prachtvolle Sala Clementina, in dem die toten Päpste aufgebahrt werden, anschließend durch drei weitere Zimmer bis zu einem Eckzimmer, das in den kleinen Thronsaal übergeht. Danach wurde es ernst. Der Präfekt begab sich in die Apostolische Bibliothek, und dann, nach einer gewissen Wartezeit, durfte der Besucher die Bibliothek betreten und das Gespräch mit dem Papst beginnen.
Wie anonym und wenig herzlich diese Gespräche sein konnten, zeigt ein kleines Detail. In dem zweiten Empfangssaal, der gleich hinter der Eingangstür liegt, die in die päpstliche Wohnung führt, also genau ein Stockwerk über der Apostolischen Bibliothek, gibt es einen »Notknopf« für unangenehme Gespräche. Die Päpste empfingen in diesem Saal, der schon Teil der Privatwohnung des Papstes ist, an einem großen Tisch. Auf der Seite des Tisches, an der der Papst saß, ist für den Besucher unsichtbar ein Knopf angebracht, den der Papst in dem Fall drücken konnte, wenn ihm das Gespräch richtig unangenehm wurde. Statt dem Besucher zu sagen, dass er bitte gehen möge, weil er die päpstliche Geduld überstrapaziert hatte, drückte der Papst auf den Knopf. Dann leuchtete eine Lampe im Nebenzimmer auf, und der Sekretär kam hereingeschossen, um den Papst aus der peinlichen Situation zu befreien. Der Sekretär behauptete in solchen Fällen, dass eine dringende Aufgabe auf den Papst warte, und der Besucher wurde hinausbugsiert.
Ein Punkt wurde bisher während der Gespräche mit einem Papst von den Mitarbeitern besonders gefürchtet. Solange der Papst sich einfach informieren ließ, war alles gut, aber wehe, wenn er Nachfragen hatte … Das war auch die Standardfrage eines jeden Kollegen: »Hat der Papst nachgefragt?« Diese Nachfragen eines Papstes konnten für Mitarbeiter besonders heikel oder peinlich werden. Die Tatsache, dass der Papst ein absoluter Monarch ist, bedeutet vor allem auch, dass er ununterbrochen Entscheidungen treffen muss zu Vorgängen, über die er sich aus Zeitmangel gar nicht gründlich informieren kann. Deswegen ist es normal, dass die Mitarbeiter dem Papst vortragen, worum es geht; der Papst nickt das meiste einfach ab, Nachfragen sind selten. Aber wenn ein Papst nachfragt, ist das für die betreffenden Mitarbeiter oft unerwartet und unangenehm.
Kurz nach dem Amtsantritt von Papst Franziskus traf ich mich mit einigen seiner engeren Mitarbeiter, um mich über den neuen Stil des Papstes zu informieren. Was ich zu hören bekam, war aus vatikanischer Sicht unfassbar. Statt Wochen damit zuzubringen, auf einen Termin beim Papst zu warten, und dann durch den pompösen Palast des Vatikans laufen zu müssen, bis man zu einem direkten Gespräch mit dem Papst kam, hatte Papst Franziskus eine neue Form der Papst-Audienzen eingeführt.
Mein Freund, der an einer Schaltstelle im Vatikan arbeitet, berichtete mir: »Der neue Papst ruft einfach direkt an und will, dass wir ihn auch anrufen, wenn wir eine Frage haben, in seinem Zimmer im Haus der heiligen Martha.«
»Und wenn er ans Telefon geht, was sagst du dem Papst dann?«
»Ich sag auf Spanisch zu ihm: ›Holá, que tal?‹« (Hallo, wie geht’s?).
Mir fiel regelrecht die Kinnlade herunter, als er das sagte.
Ungläubig fragte ich: »Du sagst zu Seiner Heiligkeit, dem Heiligen Vater, Stellvertreter Gottes auf Erden, der in seiner unermesslichen Weisheit regiert und früher auch genauso angesprochen wurde, einfach ›Hallo, wie geht’s?‹?«
»Ja«, sagte er. »Er will das so. Ich habe ihn noch nie mit Heiligkeit oder Heiliger Vater angesprochen.«
Ich war perplex. »Und stellt er Nachfragen?«, wollte ich wie seit Jahren wissen.
»Natürlich.«
»Und ist das unangenehm?«
»Überhaupt nicht. Das letzte Mal, als er eine Nachfrage stellte, hatte ich ihm gerade erzählt, dass ich mit einer Delegation abends ausgegangen war. Ich sagte ihm: ›Ich habe die Leute, die ich zu dir gebracht hatte, dann abends ausgeführt, wir sind essen gegangen, es gab super Steaks.‹«
»Und was hat er nachgefragt?«
»Er hat gefragt: ›Wer hat denn bezahlt?‹ Ich sagte ihm, dass ich bezahlt habe, und dann erwiderte er: ›Aber nicht doch, lass mich das bezahlen. Im Vatikan sagen immer alle über mich, ich habe gar kein Geld, aber das stimmt nicht. Ich habe ein bisschen Geld, ich kann das Essen schon bezahlen.‹ Ich habe ihm geantwortet: ›Nee, ist schon gut, ich zahle das.‹ So ist der Papst eben.«
Der Papst zu Besuch
Aber der neue Ton in den Gesprächen mit einem Papst war nicht die einzige Revolution im Umgang von Papst Franziskus mit seinen Mitarbeitern, also mit dem, was man seit Jahrhunderten den päpstlichen Hof nennt. Knapp tausend Jahre lang galt im Vatikan ein klares Prinzip, das besagte: Was immer es auch zu besprechen gibt, der Papst geht nie zu den Gesprächspartnern, völlig egal, was sie von ihm wollen, er lässt sie immer kommen, zu sich in den Palast. Das Beispiel für diese Regel ist so berühmt, dass es in mehrere Sprachen als »Canossa-Gang« eingegangen ist. Der arme deutsche Kaiser Heinrich IV. pilgerte im Winter des Jahres 1076/ 1077 nach Canossa zur Burg Mathildes von Tuszien, der Herzogin der Toskana, und kniete dort tagelang im Schnee, um Papst Gregor VII. milde zu stimmen. Der Papst hatte damals vor allem eines erreichen wollen: Das Zeichen der Unterwerfung des Königs bestand nicht allein darin, dass er sich im Schnee auf die Knie warf. Als Zeichen der Unterwerfung galt vor allem, dass der König zum Papst über die gefährliche Süd-Route pilgern musste, um den Streit auszuräumen, der Papst hingegen hätte nicht im Traum daran gedacht, das Gleiche zu tun, also zu dem König zu pilgern, um das Problem aus der Welt zu schaffen.
Dieses Prinzip, dass der Papst Gespräche stets in seinem Palast zu führen hat, galt natürlich auch für das Gegenteil. Das heißt: Wer einen Papst demütigen wollte, entfernte ihn mit Gewalt aus seinem Palast oder zwang ihn, den Palast zu verlassen. Alle Niederlagen der Päpste haben damit zu tun, dass sie gezwungen waren, ihren Palast zu verlassen. Es gibt also ein einfaches Kriterium, um die großen Krisen der Päpste zu erkennen. Immer dann, wenn der Papst seinen Palast verließ, befand er sich in einer extremen Notsituation. Eine dieser Notlagen war der Angriff auf Rom durch den französischen König Karl VIII., der im Jahr 1494 versuchte, Papst Alexander VI. aus der Familie Borgia gefangen zu nehmen. Der Papst musste über den noch heute existierenden Fluchtweg aus dem Apostolischen Palast in die Engelsburg laufen. Denselben Weg trat Papst Clemens VII. aus der Familie der Medici an, um den Landsknechten Karls V. während der katastrophalen Plünderung Roms im Jahr 1527 zu entgehen. Pius VII. hatte weniger Glück. Die Soldaten Napoleons nahmen den Papst am 5. Juli 1809 im päpstlichen Quirinals-Palast fest. Der Papst wurde über Grenoble und Savona schließlich schwer krank nach Fontainebleau bei Paris gebracht und dort insgesamt fünf Jahre festgehalten, bevor er nach Rom zurückkehren konnte. Papst Pius IX. floh als Priester verkleidet in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus Angst vor einer Verhaftung im Jahr 1848 nach Gaeta in das Königreich beider Sizilien, bevor die Truppen Garibaldis ihn erwischten.
Dieses Prinzip, dass der Papst nur in extremen Gefahrensituationen den Palast verlässt, hätte einen Heiligen beinahe umgebracht. Als Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz angeschossen wurde und zu verbluten drohte, setzten die Höflinge durch, dass das alte Prinzip unangetastet blieb, dass der Papst seinen Palast nicht verlassen dürfe. Das bedeutete konkret, dass Papst Johannes Paul II., der durch den Bauchschuss extrem viel Blut verlor, trotz der Wunde in die Vatikan-Klinik gebracht werden sollte, in das vom Vatikan sieben Kilometer entfernte Gemelli-Krankenhaus. Diese Aktion hätte den Papst fast das Leben gekostet, zumal das Blaulicht am Rettungswagen nicht funktionierte. Die nächste rettende Klinik lag nur etwa 800 Meter vom Ort des Anschlags entfernt, der Papst hätte nach wenigen Minuten im Heilig-Geist-Krankenhaus behandelt werden können.
Aber selbst in einer solchen extremen Notsituation hielt sich der Vatikan an das Prinzip: Der Papst verlässt niemals seinen Palast, wenn er nicht einen Besuch abstatten will. Papst Johannes Paul II. verlor auf dem Weg in das Gemelli-Krankenhaus so viel Blut, dass die Ärzte nach seiner Ankunft die Letzte Ölung (Krankensalbung) empfahlen, weil sie davon ausgingen, dass der Papst die Operation nicht überstehen würde.
Vor diesem Hintergrund wird die Sprengkraft der Entscheidungen, mit denen Papst Franziskus das System des Vatikans angreift, überdeutlich. Das eherne Prinzip der Präsenz des Papstes in seinem Palast ist selbstverständlich auch ihm bekannt, nur denkt er nicht daran, sich an die alte Regel zu halten. Er ließ der Kurie mitteilen, dass er seine Mitarbeiter kennenlernen wolle – und zwar alle, nicht nur die Kardinäle, sondern auch die kleinen Fische, die bisher nie von Päpsten empfangen worden waren.
Die Chefs der Kongregation und die päpstlichen Räte waren entsetzt. Sie wussten, dass es bei einem Besuch ihrer jeweiligen kompletten Abteilung beim Papst dazu kommen könnte, dass unzufriedene Mitarbeiter dem Papst unangenehme Details aus der Kongregation oder dem päpstlichen Rat verrieten. Aber dass es noch viel schlimmer kommen könnte, ahnten die Bosse nicht. Sie hegten angesichts der drohenden Mitarbeitergespräche die Hoffnung, dass die steife Atmosphäre eines Besuchs im Apostolischen Palast eventuelle Nörgler kaum ermutigen würde, ihren Unwillen über ihre Chefs zu äußern. Doch Papst Franziskus hatte etwas ganz anderes vor. Statt im Apostolischen Palast auszuharren und die Mitarbeiter zu sich kommen zu lassen, brach er die Regel und ließ sich einen einzigen Gendarmen kommen, der einen klaren Auftrag erhielt: »Fahr mich in die Büros meiner Mitarbeiter.«
Unerkannt zwischen den zehntausenden Touristen ließ sich der Papst in seinem Ford Focus aus dem Palast chauffieren, auf die Via della Conciliazione. An dieser langen Straße, die Benito Mussolini in das verwinkelte Viertel vor dem spektakulären Petersplatz schlagen ließ und Rom damit eine furchtbare Bauwunde zufügte, liegen zahlreiche Kongregationen des Vatikans. Der Papst ließ sich durch die Torbögen in die Innenhöfe der Gebäude fahren, stieg aus und ging dann nach einem einfachen Prinzip vor: Er besuchte die Büros von oben nach unten. Er klopfte an die Türen, ließ sich von den überraschten Mitarbeitern in die Beratungssäle bringen, und dort konnte jeder, der in dieser Abteilung des Vatikans arbeitet, dem Papst sagen, was immer er mochte, meckern, worüber er wollte. Der Papst wiederum konnte den Mitarbeitern erklären, was er von ihnen erwartete.
Diese Gespräche des Papstes direkt mit den Mitarbeitern aller Chargen waren es, die dem Vatikan eine neue Ausrichtung verordneten. Der Papst stellte den Vatikan komplett um. Er gab den päpstlichen Räten und Kongregationen eine neue Bestimmung. Ein drastisches Beispiel, um dies zu verdeutlichen, ist die päpstliche Akademie der Wissenschaften.
Jahrelang hatte sich die Akademie mit theoretischen Fragen des Glaubens beschäftigt, jetzt gab der Papst der Akademie eine gänzlich andere Ausrichtung: Sie soll überaus praktische Forschungen betreiben zu den Entstehungsgründen der modernen Sklaverei. Prinzipiell wollte der Papst mit diesen Gesprächen den Mitarbeitern seine neue Grundlinie klarmachen. Der Hirte soll den Schäfchen nicht »Löckchen drehen«, es geht also nicht darum, die Frommen noch frommer zu machen, sondern darum, sich um den Teil der Menschheit zu kümmern, der echte Probleme hat, wie Hunger oder Arbeitslosigkeit, also unter unerträglicher Armut leidet.
Der Papst ließ sich bei diesen Besuchen für seine Mitarbeiter viel Zeit. Er interessierte sich vor allem für die Meinungen und Sorgen der »kleinen Fische«. Legendär ist sein Besuch in den Kongregationen und päpstlichen Räten in der Via della Conziliazione Hausnummer 5, weil er sich mit den Mitarbeitern so lange unterhielt, dass er es nicht schaffte, alle Büros dieses Gebäudes an einem Tag zu besuchen. Er musste einsehen, dass irgendwann Büroschluss war und dass er ein zweites Mal in das Gebäude zurückkommen musste, um den restlichen Büros einen Besuch abzustatten. Für Papst Franziskus gehen Menschen eben immer vor, und mehr als alle anderen die einfachen Gläubigen.