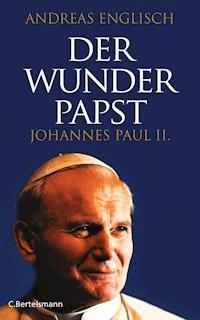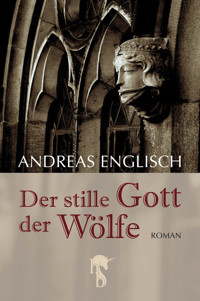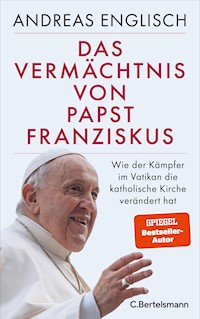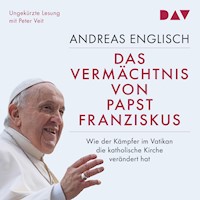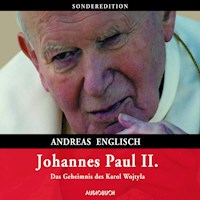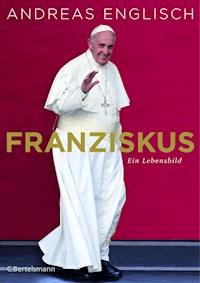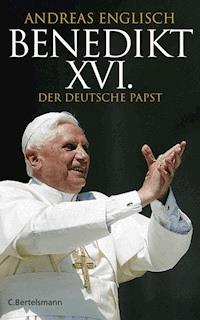
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Benedikt XVI. ist der achte deutsche Papst und der erste nach einer Unterbrechung von fast 500 Jahren. Der langjährige BILD-Korrespondent und Bestsellerautor Andreas Englisch kennt ihn seit langen Jahren und hat ihn auf allen Reisen rund um den Globus begleitet. Hier schildert er aus nächster Nähe den bemerkenswerten Wandel des Joseph Ratzinger vom Präfekten der römischen Glaubenskongregation zum weltoffenen und dialogorientierten Papst. Andreas Englisch gibt auf persönliche Weise darüber Auskunft, was hinter den Kulissen des Vatikans wirklich vor sich geht und wie er selbst von einem eher distanzierten Wegbegleiter des mächtigen Kurienkardinals zu einem Bewunderer des – gegenüber dem weithin ausstrahlenden Charisma des nunmehr selig gesprochenen großen Vorgängers Johannes Paul II. – eher stillen und diskreten, aber ähnlich wirkungsvoll der »Liebe in der Wahrheit« (so der Titel seiner jüngsten Enzyklika) hingegebenen deutschen Papstes wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1139
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Andreas Englisch
Benedikt XVI.
Der deutsche Papst
C. Bertelsmann
1. Auflage
© 2011 by C. Bertelsmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: R·M·E Roland Eschlbeck und Rosemarie Kreuzer Fotos: L’Osservatore Romano/Photographic Service/Cittá del Vaticano; Riccardo Mussachio & Flavio IannielloBildredaktion: Dietlinde OrendiSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-06820-2V002
www.cbertelsmann.de
Für meine Frau Kerstinund meinen Sohn Leo,in Dankbarkeit für ihre Geduld
2005
Papst wider Willen
Wer soll es machen?
Nach allem, was mir meine Freunde und Informanten im Vatikan erzählten, die Schweigsamen und die weniger Schweigsamen, begann alles so:
Vatikanstadt, Sixtinische Kapelle, April 2005. Die Stille in der großen Kapelle, erbaut nach dem Willen Papst Sixtus IV., lastete schwer auf den einhundertfünfzehn Kardinälen, die einen neuen Papst wählen sollten. Sie alle wussten, dass dort draußen vor dem Vatikan, nur ein paar Schritte entfernt, die Millionen, die Karol Wojtylas Tod betrauert hatten, warteten. Dass sie, die Kardinäle der heiligen katholischen Kirche, das Rätsel lösen würden, wer um Gottes willen so vermessen sein sollte, die Nachfolge des Jahrtausendpapstes anzutreten, wer auf den Balkon treten würde als 264. Nachfolger des heiligen Petrus. Die Zeiten, als die Wahl des Papstes eigentlich nur die italienische Kirche interessierte, weil einer ihrer Kardinäle zum Papst befördert werden würde, waren seit Karol Wojtyla endgültig vorbei. Der Papst aus Polen hatte eine globalisierte Kirche geschaffen, und deswegen sah diesmal die ganze Welt nach Rom.
Jahrhundertelang hatten die Kardinäle der Wahlversammlung bei Kerzenschein in der düsteren Kapelle gesessen, die nur wegen der hoch oben liegenden Fenster so dunkel ist; man hatte geglaubt, die Kapelle im Falle eines Krieges so leichter verteidigen zu können. Der schwarze Ruß der Kerzen war von den schillernd bunten Fresken Michelangelo Buonarrotis unter der Decke und an der Stirnwand der Kapelle abgewaschen worden. Noch immer drohte das Weltgericht Michelangelos den Kardinälen, noch immer schlug der Satan auf dem Fresko auf die Sünder ein. Schon kurz nachdem der Zeremonienchef Bischof Piero Marini sie hier eingeschlossen hatte, kurz nach seinem »extra omnes« (was bedeutet, dass alle Unbeteiligten das Konklave zu verlassen hatten bis auf die Kardinäle und die Ärzte mit ihren Helfern, die im Konklave bleiben durften) hatten sich die Blicke auf einen Mann gerichtet. Auf einen Italiener, auf Carlo Maria Kardinal Martini. Er war der ewige Zweite gewesen, mehr als ein Jahrzehnt lang war sein Name gefallen, immer wenn es darum ging, wer der nächste Papst sein könnte. Selbst den Kardinälen aus den entferntesten Teilen der Welt musste man nicht erst erklären, wer Martini war, in welcher Bank er saß. Der schlanke Mann, der so gar nicht wie ein Italiener aussah, der mit seiner hellen Haut und seiner beachtlichen, fast alle überragenden Größe eher an einen Dänen oder Schweden erinnerte, war ein Kirchenstar, seine Bücher weltweit bekannt. Alle Kardinäle kannten die Eigenart Martinis, seinen Blick über die Menschen schweifen zu lassen; diese Gewohnheit gab ihm das Aussehen eines seltsamen Adlers, der die Umgebung im Auge behält, über die Köpfe der Menschen hinweg in die Ferne schaut, das Große im Blick hat, statt sich von den Kleinigkeiten irritieren zu lassen. Der brillante Kopf, der Mann, der eine Vision hatte, Erfahrungen in der größten Diözese Italiens, in Mailand, mitbrachte, galt als ein perfekter Kandidat. Voller Neid hatte so mancher Kardinal auf Martini geschaut. Tage, manchmal Wochen warteten Kardinäle bei einer Konferenz oder einer Synode darauf, dass ein Journalist sie um ein Interview bat, sie um ihre Meinung fragte, allzuoft vergeblich.
Sobald Martini erschien, schoss eine Armada Presseleute auf ihn zu. Er hatte extra einen Stab von Mitarbeitern einrichten müssen, der die Pressemeute abfing und ihnen sorgfältig einen Termin nach dem anderen bei dem großen Kardinal einräumte. Nachdem Papstsprecher Joaquin Navarro-Valls der Welt verraten hatte, dass Papst Johannes Paul II. an der Parkinson-Krankheit leide, dass es möglicherweise sogar zu einem Rücktritt des Papstes kommen könnte, hatte die katholische Kirche über Carlo Maria Martini spekuliert. Theologische Fachleute hatte das spitzfindige Thema diskutiert, ob Martini sich selber Gehorsam schwören könnte, denn als Jesuit war er zum besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst verpflichtet. Diese Fragestellung war ohne Beispiele, weil noch nie ein Jesuit den Sprung auf den Thron des Papstes geschafft hatte. Viele einflussreiche Politiker, darunter auch George Bush sen. und Helmut Kohl, hatten Martinis Nähe gesucht, weil sie vermuteten, dass er der nächste Papst sein könnte.
Jahr um Jahr war verstrichen, Carlo Maria Kardinal Martini hatte Buch um Buch geschrieben, immer wieder mit Bravour Interviews gegeben. Eine halbe Bibliothek war entstanden, in deren Büchern nur darüber spekuliert wurde, wie die katholische Kirche unter Papst Carlo Maria Martini aussehen werde. Und Karol Wojtyla hatte regiert und regiert, gelitten und gekämpft, aber er war nicht vorzeitig gegangen. So war Martinis Zeit verstrichen, und die Zeit hatte dem perfekten Nachfolger auf dem Thron Petri stark zugesetzt, das Zittern seiner Hand konnte der ebenfalls an Morbus Parkinson erkrankte Martini schon lange nicht mehr verbergen. Er war alt geworden und schwach. Den Blicken, die sich fragend in der Kapelle auf ihn richteten, entzog er sich mit gesenktem Kopf; noch immer vereinigte er viele Stimmen auf seinen Namen im ersten Wahlgang, aber seine hängenden Schultern sprachen eine eindeutige Sprache: Ich kann es nicht machen, nicht mehr. Ich bin zu alt und zu krank.
Aber wenn Carlo Maria Kardinal Martini ausfiel, war es dann Zeit für die große Revolution, den ersten Papst vom amerikanischen Kontinent? Der kühne Plan, einen Mann aus der Neuen Welt zu wählen, war in den vergangenen Jahrzehnten gereift. Karol Wojtyla war es nicht müde geworden zu betonen, dass Lateinamerika die Hoffnung sei; die Mehrheit der Katholiken in der Welt lebt auf dem amerikanischen Kontinent, mehr als 550 Millionen Menschen; während in Europa die Zahl der gläubigen Katholiken und der Anwärter für das Priesteramt dramatisch abnahm, zog sie in Amerika an. Ein Mann stand bereit, dieses Wagnis auf sich zu nehmen: der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Er galt als brillant, mutig, erfahren, er kannte die katholische Kirche weltweit, und außerdem galt er als ausgezeichneter Theologe – so schien es nur wenige zu überraschen, dass Bergoglio immer mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte. Doch sein Blick, den die Kardinäle von ihren Pulten aus suchten, hob sich nicht; finster blickte Bergoglio, der mit seinen grauen Augenbrauen und den dunklen Tränensäcken aussah wie ein alter Rabe, auf die Wahlurne, mürrisch nahm er den Ausgang der ersten Wahlgänge zur Kenntnis, unwirsch nahm er wahr, dass er immer mehr Stimmen sammelte. Der bittere Zug um seinen Mund machte den Kardinälen klar, dass er Bescheid wusste, er kannte die Stimmen, die auf den einsamen Fluren des Kardinal-Hotels Domus Sanctae Marthae hinter ihm tuschelten. Er sollte gemeinsame Sache gemacht haben mit den Killern der Militärjunta Argentiniens, behaupteten seine Feinde. Bergoglios niedergeschlagene Mine hellte sich nicht auf, er wusste, dass sie ihn sogar verdächtigten, im Jahr 1976 Priester an die Junta verpfiffen zu haben. Aber stimmte das? Wer konnte es wissen, wer konnte es beweisen? Aber wer konnte sichergehen, dass es nicht so war? Was würde passieren, wenn sie ihn erst einmal zum Papst gewählt hätten und dann Indizien auftauchen würden, die hieb- und stichfest zeigten, dass er ein Spitzel des Militärs gewesen war? War es nicht verdächtig, dass Bergoglio nicht eingesperrt worden war von den gottlosen Schächtern des Militärs? Ein Held war er also nicht gewesen. Was, wenn er ein Mittäter gewesen war? Wie sollten die Kardinäle einem solchen Papst huldigen? Loswerden nach der Wahl konnten sie ihn nicht mehr, wenn es zum Skandal kommen sollte. Sie konnten höchstens auf seinen freiwilligen Rücktritt hoffen, auf den er sie, im schlimmsten Fall bis zu seinem Tod warten lassen konnte. Viel zu riskant. Bergoglio war keine sichere Wahl.
Aber wenn nicht Martini und auch nicht Bergoglio, wer dann? Der Mann mit den schlohweißen Haaren spürte die Blicke der Kardinäle. Warum eigentlich nicht, dachten viele, warum nicht der Theologe aus Bayern? Hatte nicht Karol Wojtyla ihn besonders hervorgehoben, ihn nicht nur einen guten Mitarbeiter, sondern »meinen bewährten Freund« genannt in seinem letzten Buch? Warum also nicht der Präfekt der Glaubenskongregation, der ewige Weggefährte Wojtylas? Sollte der doch das scheinbar unlösbare Problem angehen, das der Tod des polnischen Papstes ihnen allen beschert hatte: Woher jemanden nehmen, der, gemessen an der Leistung des Jahrtausendpapstes Wojtyla, nicht verblassen würde? Ihnen allen war klar: Joseph Ratzinger zum Papst zu wählen, war eine regelrechte Grausamkeit, denn er hatte einen Fehler gemacht. Er hatte in seinen Schriften den Massen, denselben Massen, die draußen darauf warteten, den nächsten Papst bejubeln zu können, ihr Klatschen, ihre Gesänge während einer heiligen Messe verbieten wollen, hatte ihnen klargemacht, dass er ihr Verhalten eines Gottesdienstes für unwürdig erachte. Joseph Ratzinger zum Papst zu wählen, bedeutete, ausgerechnet den, der den frommen Katholiken die Party während der Messfeier verboten hatte, zu zwingen, selber eine zu veranstalten und die Massen mitzureißen, mit seinem Charisma zu bezaubern und zwar auf allen Kontinenten. Joseph Ratzinger hatte natürlich niemals in Erwägung gezogen, dass er selber in die Lage versetzt werden könnte, sich vor genau diese Massen stellen zu müssen. Joseph Ratzinger zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass er sein Leben dort beschließen würde, wo er es bisher verbracht hatte, in der Stille der Studierstube. Wie konnte man diesen Mann, der klipp und klar gesagt hatte, dass er mit der lauten Art, einen Gottesdienst zu feiern, nichts zu tun haben wollte, vor die johlenden Massen schicken? Würden die Massen des Kirchenvolkes ihn das nicht büßen lassen, es ihm heimzahlen wollen, ihn mit ihrem Applaus regelrecht herausfordern? Als wollten sie sagen: Nun komm schon, Papst Ratzinger, wage es doch, uns den Applaus und unsere Fahnen zu verbieten, sie gelten nämlich jetzt dir. Also dachten viele Kardinäle damals: Das können wir ihm nicht antun, das hat er nicht verdient, dieser Joseph Kardinal Ratzinger. Er hatte sich selber ausgeschlossen von der Wahl zum nächsten Papst, er hatte immer wieder erklärt, dass er völlig ungeeignet sei für dieses neue Bild des Papstes, wie Karol Wojtyla es geschaffen hatte: ein Papst zum Anfassen und ein Papst der Massen, der die Massen regelrecht liebte.
Wie war das noch gewesen im Sommer des Jahres 2000 während des Weltjugendtages in Rom, als Karol Wojtyla die Millionen aufforderte, noch viel lauter zu singen und zu klatschen, damit ganz »Rom es hören könne«. Welch abgrundtiefer Unterschied zum Stil des Präfekten der Glaubenskongregation, der es liebte, kaum hörbare Gebete in kleinen Kirchen mit wenigen Teilnehmern sprechen zu lassen. Ausgerechnet diesen Joseph Ratzinger hinauszuschicken vor die Leute, damit sie ihn bejubelten und in einer religiösen Massenparty als würdigen Nachfolger Karol Wojtylas feierten, das war regelrecht unmenschlich. Joseph Ratzinger hatte stets nur seine Meinung gesagt und erklärt, wie er sich würdevolle Gottesdienste vorstelle, ohne Applaus und ohne Tänzer am Altar, aber er hatte nie behauptet, vormachen zu wollen, wie das geht, die Massen unter Kontrolle zu halten; aber jetzt erwogen die Kardinäle, ihm genau das aufzubürden – als wollten sie sagen: Du hast es doch besser gewusst; nun gut, so zeig uns, wie es besser geht. Es gab einen weiteren Grund, der die Wahl Joseph Ratzingers zum nächsten Papst fast unmöglich erscheinen ließ: sein Charakter. Ratzingers Sekretär Georg Gänswein würde mir später in aller Deutlichkeit sagen: »Joseph Ratzinger steht nicht gern im Mittelpunkt.« Aber wie sollte ein Mann der nächste Papst sein, der es nicht aushalten konnte, angegafft zu werden, eine Show abzuliefern, mit dem Jeep winkend über den Petersplatz zu fahren und die Aufmerksamkeit der Fernsehkameras auf sich zu ziehen? Das von diesem alten Mann zu verlangen, schien unfair.
Der dritte Grund, ihn nicht zu wählen, war, dass Joseph Kardinal Ratzinger keine Ahnung von der Politik der Kirche hatte; er hatte sich nie um das Staatssekretariat bemüht, im Gegenteil: Er war während der Debatte um die Aufnahme der Türkei in die EU von Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano bitter gerügt worden. Als Ratzinger sich in einem Interview gegen die Aufnahme der Türkei aussprach, war ihm Sodano über den Mund gefahren und hatte öffentlich erklärt, das sei lediglich Joseph Ratzingers private Meinung gewesen, aber nicht die der Kirche. Genau diese Tatsache, dass Ratzinger keine Freunde und Vertrauten im Staatssekretariat besaß und bisher kein Interesse für dieses Außenministerium der Kirche aufgebracht hatte, das, genau das machte ihn in den Augen der Kardinäle, die in der Kirchenregierung arbeiteten, aber auch zum idealen nächsten Papst. Eine ganze Reihe von Kardinälen im Vatikan wünschte sich nämlich, dass das Staatssekretariat endlich wieder aufatmen konnte. Alles hatte Karol Wojtyla, Karol der Große, an sich gerissen. Die Verhandlungen des Kardinalstaatssekretariats mit den Staatsoberhäuptern der Welt waren ein Witz. Karol entschied sowieso alles, ohne Karol passierte gar nichts. Er war der Boss und der Held, dem selbst seine Feinde ein unfassbares politisches Geschick attestierten. War es nicht so gewesen, dass sogar Michail Gorbatschow über Karol Wojtyla gesagt hatte, ohne ihn wäre das Sowjetreich nicht friedlich zusammengebrochen? Die Kurienkardinäle wussten, dass das Gerücht stimmte, er habe den Kardinalstaatssekretär Agostino Casaroli angebrüllt am Telefon. Okay, er hatte sich danach entschuldigt, aber angebrüllt hatte er ihn. So waren die Machtverhältnisse zwischen dem Papst und dem Kardinalstaatssekretär gewesen. Wenn jetzt ein Papst kommen würde, der das Staatssekretariat wenigstens wieder zu Atem kommen lassen würde, ihm die politische Bedeutung zurückgäbe, das war für viele ein innig gehegter Traum. Das hieß aber auch, einen Papst zu wählen, der genau wusste, dass er sofort teilweise entmachtet wäre. Geheim halten ließ sich das nicht lange. Der Papst würde damit leben müssen, in der Öffentlichkeit als ein weit schwächerer Papst zu gelten als sein Vorgänger. Dem höflichen, leisen Joseph Ratzinger dies alles aufzubürden, schien ungerecht: Als offensichtlich teilweise entmachteter Papst regieren zu müssen, auf das Wohl und Wehe vom Staatssekretariat angewiesen, das sich endlich von der Kontrolle des übermächtigen Papstamtes befreit hatte. Konnte man dem friedliebenden Joseph Ratzinger den sich abzeichnenden internen Krieg aufbürden? Bei jedem außenpolitischen Erfolg würde das Staatssekretariat sich auf die Schulter klopfen, im Falle einer Niederlage hatte es hingegen die Möglichkeit, sie dem Papst in die Schuhe zu schieben, weil er nicht das nötige Charisma aufgebracht hatte, um die Ideen des Staatssekretariats durchzusetzen. Sollte man zusehen, wie er gedemütigt würde, sich immer wieder aus der Politik des Vatikans zurückzog? Ein Papst, der sich beugen musste, handeln musste, wie man es im Staatssekretariat von ihm verlangte?
Nimm einen anderen!
Joseph Kardinal Ratzinger spürte diese Blicke, und er ahnte, was auf ihn zukommen würde. Und es war durchaus wohlüberlegt, als er seine Wahl später drastisch beschrieb: als seine Hinrichtung. Den Moment, als seine Wahl näher kam, empfand er als den Augenblick, »als das Fallbeil auf mich fiel«.
Joseph Ratzinger flehte in der Stille der Sixtinischen Kapelle zu Gott: »Nimm einen anderen, nimm einen Jüngeren«, wie er sich später erinnern wird. Er weiß, dass ihm nicht nur eine Veränderung droht, sollte er zum Papst gewählt werde, sondern eine Katastrophe, wie für jeden Menschen der endgültige Untergang der eigenen Person ein Desaster ist. Wie eine elegante, bis ins kleinste Detail gepflegte alte Segelyacht glitt das Leben des Joseph Ratzinger fast lautlos durch die Zeit, und dieses Kunstwerk drohte gegen eine Betonmauer geworfen zu werden und in tausend Stücke zu zerspringen. Joseph Ratzinger hatte über Jahrzehnte dieses filigrane Kunstwerk seines Lebens geschaffen. Diese Leben war begleitet vom leisen Kratzen seiner Feder, während er mit den kleinen Buchstaben seiner Schrift Gedanken auf Papier festhielt. Allein schon eine Schreibmaschine zu benutzen, war ihm ein Greuel, erst recht ein seltsame elektronische Geräusche produzierender Computer. Damals, als er es noch gekonnt hätte, vor langer, langer Zeit, als er ein junger Priester war, hätte er die Stille der Studierstube gegen den Lärm der Arbeit mit den Gläubigen draußen in der Welt eintauschen können; statt seine Zeit den Büchern zu widmen, hätte er Kindertränen trocknen, verzweifelten Todkranken Trost spenden, den Schock der Väter lindern können, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten, er hätte also inmitten der Menschen und nicht inmitten der Bücher leben können. Sein Vorgänger war so ein Mann gewesen. Deswegen hatte er, obwohl gerade erst gewählt, sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, die Sedia Gestatoria abgeschafft, den altehrwürdigen Stuhl, auf dem sich die Päpste über fünfhundert Jahre lang durch den Petersdom hatten tragen lassen. Karol Wojtyla ließ ihn einmotten, er hatte nicht getragen werden wollen, er wollte nah bei den Menschen sein, er wollte die Menschen anfassen, umarmen und segnen, Millionen Hände schütteln, mit den Gläubigen reden.
Aber Joseph Ratzingers Bestimmung war eine andere gewesen: die Stille des Studiums, die Erforschung der ältesten, vielleicht in seinen Augen auch der vornehmsten Kirchenväter. Wenn Gott das nicht genauso gewollt hatte, dann hätte er ihn doch an die Front in eine Gemeinde schicken können. Gott hatte das nicht getan. Er hatte für Joseph Ratzinger ein Leben lang das ruhige und planvolle Nachdenken über Gott vorgesehen, und von dieser Insel drohte ausgerechnet dieser alte Mann in den Krach auf der Weltbühne der katholischen Kirche getrieben zu werden. Diese Stille, die der wesentliche Teil seines Selbst war, drohte jetzt zerschmettert zu werden, drohte in einen Wirbelsturm gesaugt zu werden. Dort, in Sichtweite seiner Glaubenskongregation, im Appartement des Papstes, herrschte ein pausenloses Kommen und Gehen, Telegramme gingen ein, Staatsbesuche standen an, erbitterte Diskussion mit Bischöfen mussten geführt werden, ganz ohne Härte konnte ein Monarch eine so große Organisation wie die Kirche mit mehr als einer Milliarde Mitglieder nicht führen, es sei denn, alle Priester wären perfekt gewesen. Wenige wussten so genau wie Joseph Ratzinger, dass sie es nicht waren. Mit Entsetzen und Erschütterung dachte die Weltkirche an das Gebet des Kardinal Joseph Ratzinger am Karfreitag im Kolosseum, vor wenigen Wochen erst, als er im Auftrag des Papstes das Kreuz durch die uralte Arena trug und auf dramatische Weise den »Schmutz« beklagte, der sich in der katholischen Kirche breitgemacht hatte.
Der Theologe Ratzinger wusste, dass ein Mann auf dem Thron des Papstes gebraucht wurde, der es nicht bei den leisen verständnisvollen Beiträgen des Theologieprofessors bewenden ließ, der eine starke Hand und einen eisernen Besen zu nutzen verstand, um kraftvoll ausmisten zu können. Aber niemals hätte jener Joseph Ratzinger, der damals im Kolosseum vor dem Schmutz in der Kirche gewarnt hatte, der Mann sein wollen, der diesen Schmutz würde auskehren müssen. Dort, in der Schaltzentrale der Päpste, gab es keinen Platz für einen stillen Theologen, der Zeit, Freiheit und Ruhe brauchte, um seine Gedanken zu formen. Dort wurde ein Mann gebraucht, der auf den Tisch hauen, harte, bittere Entscheidungen treffen konnte und sich gleichzeitig mit der Routine des gigantischen Kirchenapparates abmühen musste. Schon in der kurzen Zeit als Erzbischof von München und Freising hatte Joseph Ratzinger genau das gehasst, seine Zeit damit zuzubringen, sich über die Anpassung des Urlaubsgeldes, fehlende Stellen in Kindergärten und zu geringe Etats für den Umbau von Kirchengebäuden zu streiten. Aber was war schon der Verwaltungsapparat der Diözese München und Freising gemessen am Vatikan? In München wäre es noch möglich gewesen, alle Priester und Ordensleute persönlich kennenzulernen, wenn er genügend Zeit gehabt hätte. Als Papst musste er einen Apparat mit fünftausend Bischöfen und dreihundertausend Priestern beherrschen. Wie sollte ausgerechnet ein Theologe, der sich um die Feinheiten der christlichen Geistesgeschichte vor allem im frühen Christentum bemühte, mit einer solchen Aufgabe zurechtkommen? Der Mensch Joseph Ratzinger drohte zu verschwinden, weil er ein nachdenklicher, leiser Mensch war, ein Perfektionist, der es liebte, seine Reden akribisch vorzubereiten, mit sorgfältig in seiner Bibliothek herausgesuchten Zitaten zu spicken. Fast alle anderen Kardinäle im Vatikan hielten ihre Reden nahezu ausnahmslos aus dem Stegreif, in jedem Fall aber mit erheblich weniger Vorbereitungen als Joseph Ratzinger. Dieser Professor Ratzinger hasste es, in theologischen Fragen unter Zeitdruck zu arbeiten, gezwungen zu sein, Details zu vernachlässigen. Aber ein Papst musste improvisieren können, denn ein Papst hatte einfach keine Zeit für die Vertiefung aller Probleme. Ein Papst musste blitzschnell entscheiden, sich oft auf sein Gefühl und auf Gott verlassen, ohne alle Details zu kennen. Die ganze Welt ging ihn schließlich etwas an, das nicht enden wollende Drama im Heiligen Land, der drohende Krieg im Tschad, die Cholera-Epidemie in Lateinamerika.
Dieser Joseph Ratzinger fürchtete, ausgesogen zu werden, von einem Apparat, der dem Theologieprofessor Ratzinger keine Zeit mehr lassen würde, um nachzudenken und sein Lebenswerk zu vollenden. Joseph Ratzinger wusste, dass er noch etwas sagen musste, dass ihm etwas auf der Seele brannte, die Summe seiner lebenslangen Arbeit als Theologe. Sein Hauptwerk, das wollte er während langer Spaziergänge in den deutschen Wäldern im Kopf entwerfen, und in seinem Haus in Pentling würde er seine Studierstube aufschlagen, dort sollte sich die Ruhe um ihn herum ausbreiten, lediglich gestört durch das leise Kratzen seiner Feder auf dem Papier. Aber diese Summe seiner lebenslangen Arbeit war nun von der Wahl der Kardinäle bedroht. Wozu hatte er also dieses Haus in Pentling, auf das er so lange gespart hatte, so viele Jahre pflegen lassen, wenn er jetzt nie wieder dorthin zurückkehren würde? Wie würde er seine täglichen Ruhepausen, die der über Achtzigjährige dringend brauchte, um sich konzentrieren und arbeiten zu können, gegen den Machtapparat Vatikan verteidigen, in dem täglich Dutzende Dokumente auf ihn warten würden, die manchmal im Minutentakt, auf jeden Fall aber in rascher Abfolge Entscheidungen in komplizierten Fällen verlangten, die er manchmal ohne gründliche Überlegung würde treffen müssen?
Joseph Ratzinger wusste, was die Kardinäle ihm in der Sixtinischen Kapelle möglicherweise aufbürden würden, er kannte das Zimmer der Tränen an der linken Seite unter der Stirnwand der Kapelle, wo Michelangelo Buonarroti die Toten am Jüngsten Tag aus ihren Gräbern steigen ließ. Er wusste, dass ihm dort in dem Zimmer der größte Kraftakt abverlangt werden würde, der Abschied von dem Theologieprofessor Joseph Ratzinger, und er wusste in seinem tiefsten Inneren, dass ihm dieser Abschied nicht gelingen würde. Der Theologieprofessor war von Joseph Ratzinger nicht mehr zu trennen, der eine war der andere geworden und umgekehrt. Der Geist des Joseph Ratzinger würde sich nicht mehr in den notwendigen Macht- und Verwaltungsüberlegungen eines Papstes einsperren lassen, er würde die Gedanken des Theologieprofessors Ratzinger denken. Sein Geist würde entwischen, fortfliegen wollen, sein Denken würde wieder und wieder zu dem zurückkehren, was der heilige Augustinus vor 1600 Jahren gemeint haben könnte und Bonaventura vor 900 Jahren eigentlich sagen wollte, statt zu entscheiden, welche Stadt am strategisch günstigsten für den kommenden Weltjugendtag gelegen sei. Einen neuen Menschen zu schaffen, einen Papst Joseph Ratzinger, dessen Gedanken nicht immer wieder in die ruhige Welt des Theologen Ratzinger entwischen würden, war nicht möglich. Auch der künftige Papst würde der Theologieprofessor Joseph Ratzinger sein, dabei wusste dieser Joseph Ratzinger, was die wichtigste Aufgabe eines Papstes ist: sich neu zu erfinden.
Besser als Karol Wojtyla konnte man das eigentlich nicht machen. Ein mittelmäßiger Theologieprofessor aus Polen, der gern darüber scherzte, dass seine Habilitierungsschrift nicht so ganz gelungen war, explodierte geradezu vor Energie nach seiner Wahl zum Papst. Ab der ersten Stunde, ab seiner Vorstellung auf dem Balkon des Petersdoms, als er mit seinem Charisma und seinem fehlerhaften Italienisch schlagartig die Weltkirche für sich gewann, hatte Karol Wojtyla eine neue Persönlichkeit hervorgezaubert. Er hatte einen Mann geschaffen, der den Glauben der katholischen Kirche im Bezug auf die Papstwahl umzusetzen schien. Tatsächlich schien derjenige, den Gott vorgesehen hatte, zum Papst gewählt worden zu sein, ein Mann, der vorher in der Masse der Kardinäle kaum aufgefallen war, es in Polen nur zum zweiten Mann gebracht hatte. Aber nach seiner Wahl schien dieser Spatz die Schwingen auszubreiten und sich in einen stolzen Adler zu verwandeln, als könnte man mit ansehen, wie Gottes Entscheidung einen Menschen veränderte. Als habe er eine unfassbare Energie vom Himmel bekommen, verwandelte sich Karol Wojtyla in einen Wirbelsturm aus Aktivitäten, in einen Jahrtausendpapst, einen Mann, der ganz neu wurde und in seinem Herzen dennoch immer der Gemeindepfarrer blieb, der für den Kirchenbau in Nova Huta gegen die Kommunisten gekämpft hatte.
Die Freunde des Joseph Ratzinger wussten, dass so etwas nicht noch einmal geschehen würde. In Joseph Ratzinger schlummerte kein Mann, der die Welt als Papst faszinieren würde. Die Jahrzehnte des Dienstes in der Glaubenskongregation, die Jahrzehnte der Arbeit als Theologe und Gelehrter hatten einen Mann geformt, der sich am Ende eines langen Weges sah. Das war kein Mann, der seine Haut abstreifen und in einer neuen Gestalt die Welt verzaubern würde. Die Wahl zum Papst würde diesen Mann in ein gänzlich anderes Leben reißen, ein Leben, in dem ein neuer Joseph Ratzinger auftreten musste. Wer wollte es diesem vorsichtigen, leisen Herrn antun, von seiner Studierstube auf das Karussell geworfen zu werden, das sich ungeheuer rasch drehen würde, mit ihm, vor den Augen der Weltöffentlichkeit? Der scheue Joseph Ratzinger würde sich nicht mehr radikal verändern können. Die alles entscheidende Frage bestand also darin, wie viel Platz dieser alte Theologieprofessor dem neuen Papst lassen würde, um sich zu entfalten. Joseph Ratzinger wusste in dieser Stunde in der Sixtinischen Kapelle, dass es nicht seinem Wesen entsprach, eine Kirche mit strikten Anweisungen und einer klaren Vision zu regieren. Was er konnte und was er wollte, war, mit seinen Ideen, mit seiner Meinung etwas zu den großen Diskussionen der Theologen beizutragen, aber in Freiheit. Darunter verstand er vor allem die Freiheit seiner Gegner, Joseph Ratzingers Meinung und seine Ideen abzulehnen; aber genau das, diese Freiheit der Lehre, würde ihm der Vatikan abzunehmen versuchen. Es ging nicht anderes. Er würde ein Chef sein müssen, der nicht davor zurückschrecken durfte, andere zu enttäuschen im Interesse der Kirche, oder sie sogar anzuschreien, wie das Karol Wojtyla getan hatte. Es würde ihm nichts anderes übrig bleiben, als sich Platz zu verschaffen, Geltung gegenüber jenen, die ihn jahrelang in die Pfanne gehauen hatten. Die Angriffe oder Beleidigungen von Theologen-Kollegen hatte Joseph Ratzinger meist still hingenommen, aber jetzt ging es nicht mehr um den Ruf des Joseph Ratzinger, jetzt musste er die katholische Kirche verteidigen. Diese Aufgabe lag vor ihm, als Joseph Ratzinger am 19. April um 17.43 Uhr als Papst Benedikt XVI. auf den Balkon kam und sein Amt antrat.
Dein Gegner wird Papst
An diesem Dienstagabend, dem 19. April 2005, wenige Minuten nach der Wahl von Joseph Ratzinger zum Papst, lief ich. Ich rannte über den Petersplatz, auf dem Hunderttausende den neuen Papst feierten, und ich war froh, laufen zu können. Laufen hieß, nicht stillsitzen und in Ruhe nachdenken zu müssen über das ganze Ausmaß der Katastrophe, die mich ereilt hatte. Zu laufen vermittelte mir den trügerischen Eindruck, ich könnte so dem Schlag entgehen, dem vernichtenden Schlag, der mich bald treffen musste. Irgendwer hatte mir gesagt, dass es gleich eine Pressekonferenz der deutschen Kardinäle auf dem Campo Santo Teutonico links neben dem Petersdom geben würde. Dort lief ich hin. Das Adrenalin schien meinen Kopf taghell auszuleuchten, und in dem gleißenden Licht stand ein Name geschrieben: Ratzinger. Mein Handy klingelte die ganze Zeit, und ich wusste, wer das war: Meine Frau, die mir ihr Entsetzen darüber mitteilen wollte, dass jetzt alles vorbei war. Ich nahm ab, und wir redeten darüber, dass die lange Reise, die 1987 begonnen hatte, in ihrem alten, ein bisschen kaputten Honda Jazz über die Alpen, mit dem alten Fernseher ihrer Oma auf dem Rücksitz, dass diese Reise nun endgültig zu Ende war. Die Zeit in Italien hatte der Name Ratzinger beendet. Das Land, in dem unser Sohn in unserem ersten Haus über den Boden gekrabbelt war, in dem wir unseren Findlingskater Leo gesund gepflegt hatten, nachdem eine Fuchsfalle seinen Bauch aufgeschlitzt hatte, das Land, in dem wir Mischlingshund Nuvola aus einem zugerosteten Käfig geholt hatten, in einem von der Polizei beschlagnahmten illegalen Tierheim, um ihr für den Rest ihrer Tage unser Ledersofa anzubieten, dieses Land, das unser Zuhause geworden war, würden wir jetzt verlassen müssen, daran hatte ich keinen Zweifel. Ich hatte es kommen sehen, ich hatte es sogar im Fernsehen vorhergesagt, einem Team des Bayerischen Rundfunks, dass Joseph Ratzinger der nächste Papst werden würde. Aber jetzt, wo er es wirklich war, fühlte ich mich wie zerschmettert, und der Grund dafür war, dass ich einen Bestseller über Papst Johannes Paul II. geschrieben hatte, in dem auch der neue Papst vorkam. Die Taschenbuchversion erschien in diesen Tagen im April 2005. In meinem Buch hatte ich einen Helden gefeiert, Karol Wojtyla, und einen Mann übertrieben heftig kritisiert: Joseph Ratzinger.
Ich hatte ausführlich meine Enttäuschung über Ratzingers Schrift »Dominus Iesus« ausgebreitet. Mir lief der Schweiß den Rücken hinunter – nicht nur, weil ich mit der schweren Computertasche zum Campo Santo rannte, sondern auch, weil mir überdeutlich vor Augen stand, wie dieses Kapitel anfing: Ich hatte geschrieben, dass ich hunderte Male in den Pressesaal des Heiligen Stuhls gegangen war, aber nur einmal, ein einziges Mal, bitter enttäuscht worden war, und zwar von Joseph Kardinal Ratzinger, der der evangelischen Kirche, der Kirche meiner Frau, absprach, eine Kirche zu sein, sondern sie zur Glaubensgemeinschaft degradierte. Dass Joseph Ratzinger nur seinen Job gemacht und die Position der Glaubenskongregation geschildert hatte, ließ ich nicht gelten. Ich brauchte, um die Lichtgestalt Karol Wojtyla strahlen lassen zu können, einen Feind, ich brauchte an der Seite des Mannes, der die Mauern zwischen den Religionen niederriss, einen Gegner, um die Geschichte dramatischer zu gestalten, und dieser Gegner war ausgerechnet Joseph Ratzinger gewesen, der neue Papst. Meine Haltung zu »Dominus Iesus« musste mein Verhältnis zum neuen Papst zweifellos belasten, aber ein existenzbedrohendes Problem war sie nicht. Viel schlimmer war etwas anderes. Das, was ich über Fatima und Joseph Ratzinger geschrieben hatte. Das musste verheerende Auswirkungen haben und war ganz ohne Zweifel durch die Wahl Benedikts XVI. existenzbedrohend. Im Jahr 2000 hatte Papst Johannes Paul II. Fatima besucht und das seit Jahrzehnten gehütete dritte Geheimnis von Fatima verkünden lassen. Darin wurde ein Attentat auf einen Papst vorausgesagt. Papst Johannes Paul II. glaubte, dass die Prophezeiung das Attentat vorhersagte, das am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz ihn fast das Leben gekostet hatte.
Papst Johannes Paul II. hatte Joseph Ratzinger gebeten, über diese Erscheinung von Fatima ein Grundsatzwerk zu schreiben. Im Kern ging es um die zentrale Frage: Hatten die drei Seherkinder im Jahr 1917 ein inneres Erlebnis gehabt und nur geglaubt, die Mutter Gottes zu sehen und mit ihr zu sprechen, oder war in Fatima etwas geschehen, das ein für alle sichtbares Zeichen gewesen war, eben eine richtige Erscheinung? Genau genommen ging es in dem Streit um einen Ast, mehr nicht. Seit dem 13. Mai 1917 sahen die drei Seherkinder Lucia dos Santos, Giacinta Marto und Juan Marto einmal im Monat, jeweils am 13., die Muttergottes auf dem Ast einer Steineiche bei Fatima in Portugal. Sobald die Muttergottes zu ihnen kam, um mit ihnen zu sprechen, »bog sich der Ast nach unten«, als habe sich etwas Unsichtbares mit einem großen Gewicht auf dem Ast niedergelassen. Wenn das stimmte, wenn sich der Ast nach unten gebogen hatte, also etwas Unsichtbares darauf Platz genommen hatte, dann hatte es sich um eine für alle sichtbare Erscheinung gehandelt und nicht um ein inneres, nur für die drei Kinder sichtbares Erlebnis. Das zweite Problem betraf die Engel: Lucia dos Santos hatte beschrieben, dass sie den Körper Christi gesehen hatte, aus dem Blut strömte. Engel hatten das Blut in Gefäßen aufgefangen. Joseph Ratzinger schrieb, dass diese Beschreibung eine in Büchern der Zeit gängige Darstellung gewesen sei. Aber in dieser Aussage steckte eine Sensation: Joseph Ratzinger hielt es also für möglich, dass Lucia dos Santos die Muttergottes nicht wirklich gesehen, sondern ein starkes inneres Erlebnis verspürt hatte und Bilder, die sie woanders gesehen hatte, mit diesem Erlebnis in Fatima vermischte. Ich war enttäuscht, verstand die Vorsicht Kardinal Ratzingers nicht. Warum schrieb er in der Beurteilung nicht einfach, dass es sich um ein Wunder gehandelt hatte, das Wunder von Fatima, an das der Papst glaubte? Ich fragte in meinem Buch: Glaubt Joseph Ratzinger nicht an die Ereignisse von Fatima?
Die Konsequenz: Aus der ganzen Welt meldeten sich schlichte Gläubige, Gebetsgruppen, aber auch Fachleute und wollten empört wissen, ob es wirklich stimme, dass der Chef der Glaubenskongregation nicht an die Ereignisse von Fatima glaube. Joseph Ratzinger musste all diese empörten Anhänger der Ereignisse von Fatima beruhigen und erklären, dass ich ihn falsch verstanden hatte. Was blieb ihm anderes übrig?
Trotz aller Güte, zu der ein Kirchenmann nun einmal verpflichtet ist, musste ich zur Kenntnis nehmen: Joseph Ratzinger war zweifellos sauer auf mich, das wusste ich; und es gab daran leider keinen Zweifel, weil sein persönlicher Sekretär Georg Gänswein mir dies selber mitgeteilt hatte. Dieser Mann, den ich zum Teil zu Unrecht verurteilt hatte, war jetzt das Oberhaupt von einer Milliarde Katholiken, der Vikar Jesu Christi, und ausgerechnet mit diesem Mann hatte ich richtig Ärger.
Das Telefon klingelte erneut, während ich durch die Kolonaden des Petersdoms hastete, und ich erschrak, als ich an der Nummer erkannte: Es war Papstsprecher Joaquin Navarro-Valls. Ich stand verschwitzt vor den Schweizergardisten, die mich zum Campo Santo durchwinkten. Ich nahm ab. »Ciao, Joaquin«, sagte ich. »Ciao, Andreas, ich wollte dir nur zu deinem deutschen Papst gratulieren, das wird für dich jetzt ja hier im Vatikan ein Heimspiel«, meinte er lachend. »Ich weiß nicht«, antwortete ich lahm. »Alles Gute«, fügte er noch hinzu und legte auf.
Rauswurf in Zeitlupe?
Er hat keine Ahnung, dachte ich. Noch hat er keine Ahnung, aber lange wird es nicht mehr dauern. Ich hatte genug Katastrophen im Vatikan erlebt, um genau zu wissen, was passieren würde. Schon sehr bald würde der neue Papst seinen Sprecher Navarro-Valls zu sich rufen zu einem ersten Routine-Gespräch, beide kannten sich seit vielen Jahren. Irgendwann würde mein Name fallen, irgendwann würde Joaquin eine Geschichte erzählen aus den vielen Jahren, in denen wir zusammengearbeitet hatten – wie ich ihm ein paar Worte auf Deutsch beigebracht hatte, wie ausgerechnet ich ihn vor den TV-Kameras der Welt im Pressesaal des Heiligen Stuhls zum Weinen gebracht hatte, als der Papst im Sterben lag. So etwas würde Joaquin erzählen, und plötzlich würde er eine gewisse Kälte in der Stimme des neuen Papstes spüren. Das würde völlig ausreichen. Joaquin war seit vierundzwanzig Jahren am Hof des Papstes, er wusste jeden Zwischenton zu deuten; allein die Tatsache, dass der Papst bei der Nennung meines Namens wahrscheinlich gar nichts sagen würde, keinerlei Zeichen des Erkennens zeigen würde, dürfte Joaquin reichen, um die Lage zu verstehen. Danach war es nur noch eine Frage der Zeit bis zum öffentlichen Desaster. Irgendwann würde der Tag kommen, wahrscheinlich während der ersten Auslandsreise des Papstes nach Deutschland, wenn traditionell Joaquin die deutschsprachigen Journalisten zum Papst brachte, wie er die polnischen Journalisten während der Auslandsreisen nach Polen zu Karol Wojtyla gebracht hatte. Ich würde nicht auf der Liste stehen, ich wäre nicht in der Gruppe der Deutschen, die dem Papst die Hand schütteln, und in der päpstlichen Maschine würden das alle bemerken, das ließ sich gar nicht verhindern, und an diesem Tag würde der ganzen Kurie klar sein, dass es besser war, einen Bogen um mich zu machen. Dann käme das Ende: Alte Freunde in der Kurie, die ich anriefe, um ein Treffen vorzuschlagen, ein Hintergrundgespräch, würden plötzlich Termine und Verpflichtungen vorschieben, um eine Begegnung mit mir zu vermeiden. Zunächst würde ich von den entscheidenden Menschen, dann von den Informationen abgeschnitten werden, schließlich blieb mir nichts anders übrig, als zu gehen. All die Mühen der vergangenen Jahre, der lange Weg, um zum am meisten gelesenen Vatikan-Experten aufzusteigen, waren dann umsonst gewesen.
Völlig verschwitzt kam ich am diesem Abend in den Saal, in dem der damalige Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Karl Kardinal Lehmann sowie Joachim Kardinal Meisner, Walter Kardinal Kasper, Kardinal Wetter und Kardinal Sterzinsky über den dramatischen Moment der Papstwahl berichteten. Ich dachte: Eigentlich hat es keinen Sinn mehr, dass du dich hierher setzt, zuhörst, Fragen stellst und so tust, als könntest du normal weiterarbeiten. In Wirklichkeit war es aus. Ich wollte aufstehen und gehen, wenigstens wieder in Bewegung sein, nicht da sitzen und grübeln müssen, als ich endlich das Gesicht von Kardinal Lehmann sah. Er saß da, vornübergebeugt, seine Worte genau abwägend; der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz an diesem Tag, an dem der einzige Kardinal, mit dem er je in der Kirchenregierung einen heftigen Streit ausgetragen hatte, Papst und damit auch sein neuer Chef geworden war: Joseph Kardinal Ratzinger. Das Licht in diesem Konferenzsaal auf dem Campo Santo, die Neonleuchten und die dunklen, fast fensterlosen Wände, die Schaukästen lassen jeden in diesem Saal grau aussehen. Es ist kein Raum für eine freudige Veranstaltung, selbst an den Tagen, an denen hier während eines Jubiläums oder während der Weihnachtsfeier Sekt gereicht wird. Auch Lehmann sah grau aus. Man sah ihm an, dass er seit 1994 erfolglos versucht hatte, den Präfekten der Glaubenskongregation Joseph Ratzinger von seiner Meinung zu überzeugen, die katholische Kirche müsse am System der Schwangerenkonfliktberatung festhalten, auch wenn sie dabei das Risiko einginge, dass sich Frauen nach der Beratung durch die Kirche doch für eine Abtreibung entschieden. Joseph Ratzinger war immer gegen die Haltung Lehmanns gewesen, aber Lehmann hatte nicht aufgegeben. Er entschied sich für den Kampf gegen Joseph Ratzinger in der Hoffnung, der Papst würde anders denken als sein Präfekt der Glaubenskongregation, – und das Gewicht dieses verlorenen Kampfes lastete an diesem Abend sichtbar auf seinen Schultern. Ich erinnerte mich genau, dass immer dann, wenn Lehmann wieder einmal erfolglos seine Position in Rom vertreten hatte, wenn Ratzinger ihn wieder hatte abblitzen lassen, er in der Hoffnung, im Vatikan dennoch Unterstützung zu finden, mehr als einmal trotzig gesagt hatte: »Aber Ratzinger ist nicht der Papst.« Nun war Ratzinger der Papst.
An diesem Abend traf ich noch einen Mann, der in einer ähnlichen Lage war, Walter Kardinal Kasper. Auch der quirlige Ex-Bischof von Rottenburg-Stuttgart befand sich in einer angespannten Situation. Kardinal Kasper hatte nie in seinem Leben ernsthafte Schwierigkeiten mit der Kirchenregierung, der Kurie, gehabt, bis auf einmal und das ausgerechnet mit Joseph Kardinal Ratzinger. Im Jahr 1993 hatte Kasper in einem Hirtenbrief dazu aufgerufen, nach »ernsthafter Gewissensprüfung«, geschiedene Frauen und Männer, die wieder geheiratet hatten, nicht mehr kategorisch von den Sakramenten auszuschließen. Der Hirtenbrief war von der Glaubenskongregation und deren Präfekten Joseph Ratzinger heftig bekämpft worden, bis Kasper den Vorstoß zurückziehen und sich entschuldigen musste. Von diesem heftigen Streit hatte sich das Verhältnis zwischen Kasper und Ratzinger nie wieder erholt.
Als die freudlose Konferenz der deutschen Kardinäle vorbei war, stand ich in dem ebenfalls düsteren Eingang zum Versammlungsraum des Campo Santo Teutonico, neben den von Neonlicht angeleuchteten Schaukästen mit antiken Öllämpchen, die irgendwo auf dem Campo gefunden wurden. Ich wollte noch mit Kardinal Lehmann sprechen, der war aber in ein Gespräch vertieft. Er schilderte, wie seine erste Begegnung mit dem Papst verlaufen war. Ich hatte die Fernsehbilder gesehen von jenem Moment, in dem Kardinal Lehmann Joseph Ratzinger gratulierte. Er kniete vor ihm und redete auf ihn ein. Ich hatte das Gefühl, er redete um sein Leben, er versuchte, in einer Minute das Porzellan zu kitten, das in zehn Jahren Streit mit Joseph Ratzinger zerschlagen worden war. Was hätte er tun sollen? Wie tritt man vor einen Papst, mit dem man sich als Kardinal ein gutes Jahrzehnt lang erbittert gestritten hatte? Ich sah durch die Glastür auf die uralten Gräber auf dem berühmten Friedhof der Deutschen im Schatten des Petersdoms. Diese grüne, mit hohen Mauern umgebene Oase inmitten der Steingebirge des Vatikans war seit zwei Jahrzehnten einer meiner Lieblingsorte im Kirchenstaat. Ich meinte ihn noch sehen zu können, den zierlichen Mann mit den weißen Haaren und der selten fehlenden Baskenmütze, den bayerischen Kardinal Joseph Ratzinger, wie er jeden Donnerstag aus dem Wohnhaus des Campo Santo kam, gegen 6.40 Uhr, auf dem Weg zur Frühmesse in die Kirche des Campo Santo, Santa Maria della Pietà, und sah auch mich selbst, vor langer Zeit, vierundzwanzig Jahre jung, als ich zum ersten Mal Josef Kardinal Ratzinger begegnete.
Das erste Treffen mit Joseph Ratzinger
Ich gebe gern zu, dass ich keine Ahnung von Italien hatte, als ich 1987 als Auslandskorrespondent in dem hässlichen Büro mit der schicken Adresse an der Via Borgognona anfing. Von der Politik verstand ich nichts, aber von der Kirche verstand ich noch viel weniger, ich hatte keinen blassen Schimmer, außer meinen sorgsam gehüteten Erinnerungen aus der Zeit als Messdiener und Gruppenleiter in der Pfarrkirche Sankt Walburga in Werl. Doch den Namen Joseph Ratzinger kannte sogar ich. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was Joseph Ratzinger machte, wer er war, aber dass er böse sein musste, das wusste ich ganz sicher und zwar dank der Buchladenkette 2001. Eine der Kultfiguren der Kette war der Autor Ernesto Cardenal, der im Jahr 1980 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hatte. Ich schäme mich ein bisschen für meinen blinden Eifer von damals, denn im Grunde hatte ich keine Ahnung, was Ernesto Cardenal wollte, ich wusste aber, dass er Kulturminister der sandinistischen Regierung in Nicaragua gewesen war; ich hatte keine Ahnung von seiner Haltung zur Theologie, mir reichte es völlig, zu wissen, dass Ernesto Cardenal ein Kämpfer für den Frieden war und dass er einen fiesen Gegenspieler hatte: Josef Kardinal Ratzinger. Dass Joseph Ratzinger ein finsterer Geselle sein musste, schloss ich aus einer einzigen Tatsache. In den Büchern über den Helden Ernesto Cardenal hatte ich gelesen, dass er ein Anführer der Theologie der Befreiung war und dass Joseph Ratzinger dieser Theologie der Befreiung an den Kragen wollte. Theologie der Befreiung, das klang nach Robin Hood, der gegen den bösen Sheriff von Nottingham Forest kämpfen musste. In meinem Fall wirkte sich das Wort »Befreiung« verhängnisvoll für mein Urteil über Joseph Ratzinger aus. Wer gegen Befreiung war, der musste ein schlimmer Finsterling sein. Mich empörte die Vorstellung, Versuche der Befreiung könnten durch Theologen niedergeschlagen werden, was immer die Befreier auch wollten, wo immer die auch kämpften, worum immer es auch ging.
Damals war die Meinung verbreitet, dass nach Freiheit strebende Menschen in Lateinamerika von konservativen Bischöfen und allen voran von Joseph Kardinal Ratzinger im Vatikan unterdrückt und geknechtet würden. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich in den zwei Jahrzehnten danach, im Gefolge von Papst Johannes Paul II., in Klöstern auf Kuba, in Mexiko, Brasilien, in Guatemala und auf St. Lucia mit vielen klugen Priestern und Nicht-Priestern über die Zeit der großen Diskussion um die Theologie der Befreiung sprechen konnte. Ich machte damals vor allem eine Erfahrung, die heute noch viele Kirchenkritiker gern ignorieren: Die Kritiker Ratzingers gingen davon aus, dass die Kirche Lateinamerikas eine sozial orientierte, stark verkürzt also eine progressive, »links«-gerichtete Kirche war, die gegen das konservative Rom aufbegehrte. Das erste der zahlreichen Vorurteile, die ich über Bord werfen musste während meiner Reisen mit Johannes Paul II. nach Lateinamerika, war, dass diese Grundvoraussetzung nicht stimmte. Die Kirche Lateinamerikas war und ist konservativer als Rom. Die große Mehrheit der Kirchenmänner auf dem lateinamerikanischen Kontinent gehörten der konservativen Personalprälatur Opus Dei an, so der Kardinal von Lima (Peru) Juan Luis Cipriani. Die Opposition Lateinamerikas gegen das konservative Rom, verkörpert in der Glaubenskongregation des Joseph Ratzinger, hat es so nie gegeben. Die Auseinandersetzung war viel komplexer, und der wahre Gegenspieler des kommunistisch orientierten Zweigs der Theologie der Befreiung war auch nicht Joseph Ratzinger, sondern der Papst Johannes Paul II., der persönlich stark unter einem kommunistischen Regime gelitten hatte. Als ein Teil der Theologie der Befreiung den Slogan prägte »Ubi Lenin, ibi Jerusalem« (Wo immer Lenin ist, also ein kommunistisches Regime existiert, da ist auch Jerusalem), wollte Johannes Paul II. mit aller Macht einschreiten, schließlich hatten die Kommunisten in Polen ihm als Erzbischof den ersten großen Kampf aufgezwungen: Sie wollten verhindern, dass er in der idealisierten Arbeiterhochburg Nova Huta eine Kirche baute. Die Wirklichkeit wie auch die Rolle Joseph Ratzingers und das, was ich mir als Vierundzwanzigjähriger zusammengereimt hatte, klafften leider sehr, sehr weit auseinander. Meine blinde Bewunderung für »Helden« wie den Ideologen der Theologie der Befreiung, den Brasilianer Leonardo Boff, dem Joseph Ratzinger ein Jahr Predigtverbot erteilte, ist arg zurückgegangen. Selbst meine Ur-Überzeugung, dass die Kirchenmänner Lateinamerikas gegen den vom Vatikan verteidigten Kapitalismus aufbegehrten, erwies sich als falsch. Ich musste irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass in Rom ein Papst regierte, Johannes Paul II., dessen Kapitalismuskritik beißender war als alles, was aus Lateinamerika kam, und dass es nicht Boff, sondern Johannes Paul II. war, der sich entschlossen gegen die Interessen der USA stellte.
Worum es in der Auseinandersetzung zwischen Ratzinger und Cardenal wirklich ging, wusste ich damals natürlich nicht. Es war mir auch egal. Mir reichte der geniale Begriff »Befreiungstheologie«, den übrigens Gustavo Gutierrez aus Peru geprägt hatte. Wer dagegen war, musste böse sein. Es dürfte einer meiner ersten Aufträge im Jahr 1988 gewesen sein, zu versuchen, mit Joseph Ratzinger zu sprechen. Ich erfuhr von Kollegen, dass es eigentlich ganz einfach war, den damals schon legendären Joseph Ratzinger kennenzulernen, den die Italiener als »Panzerkardinal«, die Deutschen als »Großinquisitor« verspotteten. Jeden Donnerstag, pünktlich um sieben Uhr morgens, las er auf dem Campo Santo neben dem Petersdom, in der schlichten alten Renaissance-Kirche, die Messe. Ich rüstete mich für das Treffen mit dem Inquisitor, dem Unterdrücker, zog also meine älteste Lederjacke an, die hatte mein Vater auf dem Weg aus der Gefangenschaft in Russland irgendwo am Straßenrand gefunden. Ich war damals genauso beschränkt wie viele meines Jahrgangs. Wir trugen immer wieder militärische Kleidung, der Bundeswehr-Parka mit der Deutschlandfahne war ein Klassiker, die Zweite-Weltkriegs-Klamotte, die ich bevorzugte, ebenfalls, aber natürlich hielten wir uns für glühende Pazifisten. Dass hier was nicht zusammenpasste, merkten wir aber nicht. Wir schienen militärische Attribute zu brauchen, um in den Krieg für den Pazifismus ziehen zu können. Auch dafür, wie ich damals herumgelaufen bin, geniere ich mich heute ein wenig. Ich sah aus wie ein rebellischer junger Mann aus der deutschen Provinz, und ich dachte auch so. Ich wollte mich der schicken Welt in Rom nicht anpassen. Es machte mir offenbar nichts aus, dass viele Gesprächspartner mich allein wegen meines unkonventionellen Aussehens, in abgewetzter Zweiter-Weltkriegs-Lederjacke statt in Anzug und Hemd, ziemlich seltsam finden mussten. Ich bestieg an jenem Morgen im Winter 1988 dann auch in genau diesem Outfit meine Vespa, um zur ersten heiligen Messe von Joseph Kardinal Ratzinger zu fahren.
Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen, denn genau diese Klamotten hatten mich einmal in eine wirklich gefährliche Lage gebracht. Jedes Kind in Italien weiß, dass es riskant ist, mit einem Motorradhelm, einem Integralhelm, der das ganze Gesicht verdeckt, herumzulaufen, es sei denn, man sitzt gerade auf einem Motorrad. Ich glaube, dass eine Testperson, die sich einen Integralhelm aufsetzt und quer durch die Camorra-Hochburg in Neapel, das Spagnoli-Viertel, geht, nicht lebendig herauskommen würde; ich fürchte, die Testperson würde erschossen: von der Polizei. Profikiller in Italien, alle Schwerverbrecher, tragen am Tatort grundsätzlich einen Helm. Der Grund dafür ist einfach: Eine Person, die auf einem Motorrad sitzt und einen Integralhelm trägt, ist nicht erkennbar, aber auch nicht verdächtig. Die meisten Täter fahren auf Motorrädern zum Tatort, ermorden eine Zielperson oder rauben eine Bank aus, und die Überwachungskameras zeichnen immer nur eine unkenntliche Person mit einem Helm auf.
Im Februar 1988 bekam ich gleich einen sehr wichtigen Auftrag, ich sollte den italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti in seiner Wohnung an der Engelsburg interviewen. Ich setzte mir meinen Helm auf und knatterte auf meiner 50-Kubikzentimeter-Vespa von der Spanischen Treppe zum Tiber. Ende der 80er Jahre, bevor die Europäische Union das Leben erleichterte, war es sehr kompliziert, als Deutscher in Italien zu leben. Das Hauptproblem bestand darin, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ein langwieriges Verfahren. Da ich noch keine Aufenthaltsgenehmigung hatte, konnte ich kein Bankkonto eröffnen, ich bunkerte das Bargeld unter meinem Kopfkissen, und ich konnte auch keine Versicherung abschließen. Ich hatte natürlich bei meiner Versetzung von Hamburg nach Rom von einer Vespa geträumt, wusste aber, dass ich in Rom erst nach etwa einem halben Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten würde, um sie versichern zu können. Was ich nicht wusste, war, dass die Italiener damals gar keine Versicherung verlangten, jeder konnte mit einer 50-Kubikzentimeter-Vespa herumfahren, wie er wollte. Ich kaufte mir also in Hamburg eine Vespa, versicherte sie und brachte sie zum Bahnhof Altona; für nur 68 Deutsche Mark fuhr die Bahn meine Vespa nach Rom.
Was ich auch nicht wusste, war, dass in Italien damals die Fahrer von 50-Kubikzentimeter-Mofas keinen Helm tragen mussten; da ich mich im chaotischen Straßenverkehr von Rom absolut unsicher fühlte, fuhr ich immer mit Helm. An diesem Tag also fuhr ich auf der einzigen versicherten 50-Kubik-Vespa von Rom mit einem Integralhelm auf dem Kopf bei der Wohnung des italienischen Ministerpräsidenten vor. Es regnete, deswegen setzte ich den Helm nicht ab; ich wollte nicht, dass meine Haare nass wurden. Also lief ich in den Hauseingang und rief den Fahrstuhl, der Ministerpräsident wohnte im vierten Stock. Statt den Helm jetzt abzusetzen, wühlte ich nervös aus meiner Tasche das Aufnahmegerät, den Block, um Notizen zu machen, und als der Fahrstuhl im vierten Stock anhielt, dachte ich mir immer noch nichts Böses und verließ den Fahrstuhl. Mir war überhaupt nicht bewusst, was ich da tat. Ich war vor der am besten bewachten Wohnung Italiens vorgefahren, mit einer seltsamen, offenbar im Ausland gestohlenen Vespa, die eine deutsche Versicherungsmarke trug, und vor allem trug ich als einziger Mofafahrer der Stadt Rom einen Integralhelm. Und den auch noch im Fahrstuhl zu Andreottis Wohnung. Ich machte nur einen Schritt aus dem Fahrstuhl, da wurde ich schon zu Boden gestoßen, drei Beamte knieten sich auf meinen Rücken, traten mir gegen Beine und Arme, und zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich das knackende, beunruhigende Geräusch einer Pistole, die entsichert wurde. Dann ging die Tür zur Wohnung des Ministerpräsidenten auf.
Als sich das Missverständnis aufklärte, der Sekretär des Ministerpräsidenten bestätigte, dass man tatsächlich auf mich gewartet hatte, lachten sich die Beamten kaputt. Sie konnten nicht verstehen, dass jemand sich so danebenbenehmen konnte, sich so verdächtig machen konnte. Ich dagegen verstand überhaupt nicht, was ich eigentlich falsch gemacht hatte.
Die Schweizergardisten müssen mich ähnlich befremdet angesehen haben, als ich in der Dunkelheit der Morgenstunden im Winter 1988 darum bat, auf den Friedhof der Deutschen im Vatikan vorgelassen zu werden. Wie ganze Generationen von Rom-Urlaubern vorher und hinterher hatte auch ich brav in Büchern den uralten Trick recherchiert, wie man in den Vatikan kommt. Man müsse, so die allseits bekannte »Geheiminformation«, den Schweizergardisten vorgaukeln, einen Verwandten zu betrauern, der auf dem Friedhof der Deutschen im Vatikan begraben sei. Dieser vermeintliche Geheimtipp hatte schon in so vielen Reiseführern, so vielen Zeitschriften und Zeitungen gestanden, dass die Schweizergardisten am Arco delle Campane, einem der Grenzübergänge in den Vatikan, sich jedes Mal zusammenreißen mussten, um nicht schallend loszulachen, wenn wieder einmal ein Urlauber vor ihnen auftauchte und ihnen mit konspirativer Miene, aufgeregt, weil er oder sie schließlich einen Schweizergardisten anlogen, das Märchen auftischten, er oder sie wollten das Grab des Anverwandten auf dem Friedhof der Deutschen besuchen.
Ich tat das Gleiche, parkte die Vespa am Petersdom, ging in meiner Lederjacke über den Petersplatz und versuchte, den Schweizergardisten die Geschichte zu verkaufen, ich wollte am Grab eines in Rom verstorbenen und auf dem Friedhof der Deutschen beigesetzten Angehörigen beten. Ich hatte beabsichtigt, mein Anliegen forsch vorzutragen; als ich aber die Schweizer in den bunten Uniformen sah, brachte ich die Lüge nur verzagt hervor. Ich hatte Angst, denn ich wusste auch, dass die Sache mit dem Geheimtipp schiefgehen konnte. Ich hatte gelesen, dass die Schweizergardisten Listen mit den Namen der bestatteten Personen besaßen, es bestand also die Gefahr, dass ich mein Begehr vorbrachte und dann mit der Frage konfrontiert wurde: Wie heißt denn eigentlich ihr Verwandter? Da ich ja keine Ahnung hatte, wer da begraben war, drohte ich, wie ein ertappter Lügner mit roten Ohren unverrichteter Dinge gehen zu müssen. Ich wusste damals ebenfalls nicht, dass dieser Nervenkitzel und die Lügen unnötig waren; wenn ich schlicht die Wahrheit gesagt hätte, dass ich an der Frühmesse des Joseph Kardinal Ratzinger teilnehmen möchte, so hätte man mich problemlos durchgelassen. Weil ich nicht die Wahrheit sagte, erregte ich Verdacht, und der Schweizergardist ließ mich zwar durch, gab aber den Gendarmen einen Wink, sie mögen mich doch bitte im Auge behalten und kontrollieren, ob ich tatsächlich im Eingang zum Friedhof der Deutschen verschwand und nicht versuchte, in den Sicherheitsbereich des Vatikans zu gelangen.
Der Friedhof war still und wirkte wie verzaubert, weit mehr Menschen, als ich erwartet hatte, huschten zu der frühen Stunde in die Kirche. Dann sah ich ihn – und war maßlos enttäuscht. Joseph Kardinal Ratzinger, der Inquisitor, der Panzerkardinal, begrüßte vor der Messe Bekannte, die in der Kirche auf ihn gewartet hatten. Er trug einen schlichten Priesterkragen, schwarzen Pulli, schwarze Hose. Ich hatte einen in Kardinalsrot gekleideten grimmigen Mann erwartet, stattdessen stand dort ein bescheidener Herr mit weißen Haaren, der leise und freundlich sprach, bevor er in der Sakristei verschwand, um das Messgewand anzuziehen. Diesem Mann fehlte vor allem eines, was mich vollkommen überraschte: An ihm war nicht eine Spur von Aggressivität zu entdecken. Das also sollte der grausame Unterdrücker und Verfolger der Theologie der Befreiung sein? Ich konnte es nicht fassen. Ich reihte mich ein in die Gruppe der Menschen, die ihm die Hand geben wollten, er grüßte mich freundlich und lächelte. »Eminenz«, brachte ich so selbstsicher wie möglich vor, »ich würde gern ein Interview mit Ihnen machen.« Er lachte mich an: »Aber ich eigne mich einfach nicht für Interviews. Ich habe Sie noch nie gesehen, wo kommen Sie denn her?«
»Ich bin ganz neu in Rom, ursprünglich komme ich aus Werl.«
»Ach, da gibt es doch die Franziskaner.«
»Ich gehörte aber zur Sankt-Walburga-Gemeinde, ich war da Messdiener.«
»Na dann: Willkommen in Rom«, sagte er.
»Und das Interview mit Ihnen?«
»Ach, junger Mann, melden Sie sich bei meinem Sekretär«, schloss er; schon war das erste Treffen mit Joseph Kardinal Ratzinger vorbei und ich weiter denn je von einem Interview mit ihm entfernt. Aber der Eindruck, den er auf mich gemacht hatte, war völlig anders, als ich erwartet hatte. Ich kannte bereits einige Kirchenmänner, die durchaus laut werden konnten, die auch schon mal auf den Tisch hauten, wie der energische Papstsprecher Joaquin Navarro-Valls, aber Joseph Ratzinger fehlte jede Spur von Angriffslust. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser leise Herr der Mann war, der als Chef der Glaubenskongregation ungehorsame Kirchenmänner in die Pfanne haute. Er schien mir viel zu weich für einen solchen Job. Ich konnte mir eher vorstellen, dass sein Brief, in dem er ein Predigtverbot oder eine andere Strafe verhängte, einen entschuldigenden Ton haben würde. Ein Mann, der draufhauen wollte, sah nicht so aus wie Joseph Ratzinger, er sprach nicht so, bewegte sich nicht so vorsichtig und rücksichtsvoll.
Beichtstuhl statt Fitnessstudio
Ich erinnere mich nicht, über welches Thema Joseph Ratzinger an diesem Morgen gepredigt haben mag, aber ich erinnere mich daran, dass in den kommenden Jahren eine Besonderheit dieses Mannes mich immer mehr interessierte. Er schien sich nach der Kirche seiner Kindheit zu sehnen. Wenn er predigte, dann predigte er über eine Welt, in der es für alle Familien in einem Dorf oder einer Stadt vollkommen normal war, an jeder Fronleichnamsprozession teilzunehmen, die Fastenzeit streng einzuhalten, dem Weißen Sonntag der katholischen Kirche entgegenzufiebern und selbstverständlich an jedem Sonntag die Messe zu besuchen. In der Welt des Joseph Ratzinger gab es keine Eltern, die nackt zur Love Parade gingen und den Buddhismus bewunderten. In der Welt des Joseph Ratzinger lasen Väter mit ihren Kindern am Tisch im Wohnzimmer in der Bibel, statt mit der Playstation zu spielen. Die Mütter gingen mit ihren Töchtern zur Beichte statt ins Fitnessstudio. Ich weiß nicht, ob Joseph Ratzinger sah, dass diese Art zu leben in weiten Teilen der Welt untergegangen ist, und ob er sich danach zurücksehnte. Ich glaube, ja. In seinen Predigten malte Joseph Ratzinger Bilder, wie Buben in der Küche ihren Müttern beim Backen halfen und sie dabei gemeinsam Kirchenlieder sangen, wie Mädchen sich auf den Kirchenbasar und das Pfarrgemeindefest vorbereiteten. Joseph Ratzinger beschrieb die Kirche seiner Kindheit, und das muss eine glückliche Kirche und eine glückliche Kindheit gewesen sein, eine häusliche Idylle, die Joseph Ratzinger noch umso idyllischer vorgekommen sein musste, als sie durch den Ausbruch der Hölle des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Für diesen gesunden, unspektakulären Teil der katholischen Kirche, den Joseph Ratzinger wie kein Zweiter repräsentiert, interessiert sich die Öffentlichkeit normalerweise überhaupt nicht. Kein Mensch kommt mit der Geschichte, wie er sein erstes Gebetbuch geschenkt bekommen hat, ins Fernsehen, aber genau das waren die Geschichten, die Joseph Ratzinger erzählte. Ratzinger sprach am liebsten über den unspektakulären Teil des Glaubens, über das normale kirchliche Leben, über die Bedeutung der Dreieinigkeit, den tieferen Sinn des Todes Christi am Kreuz, die Würde des Aschermittwoch, alles das sind Themen, die sich in der Öffentlichkeit nicht verkaufen lassen. Was die Öffentlichkeit interessiert, der Streit in der Ökumene, Einzelheiten sexuellen Missbrauchs jeder Art, Aufstände gegen den Papst, alles das waren Themen, die Joseph Ratzinger meidet, wenn er nicht darüber sprechen muss. Ihm ging es immer um die Kirchenwelt, in der Familien selbstverständlich zur ewigen Anbetung gingen und zusammen vor der Monstranz mit der Hostie knieten.
Was ich nicht verstehen konnte und immer weniger verstand, je häufiger ich dem sanften Joseph Ratzinger in den Frühmessen auf dem Campo Santo zuhörte, war, wie ausgerechnet dieser Mann es hatte schaffen können, so berühmt zu werden unter Menschen, die sich normalerweise nicht für die Kirche interessierten. Auf den ersten Blick erschien an diesem älteren Herrn nichts außergewöhnlich. Er schien dazu geschaffen, einer der vielen Theologen und Kirchenmänner zu sein, die die Öffentlichkeit ignoriert, denn er kümmerte sich meistens um etwas, das in der modernen Welt nur einen Bruchteil der Bevölkerung erreichte: komplizierte Sachfragen des Glaubens der katholischen Kirche. Er galt als Experte für mittelalterliche Kirchenlehrer, als Fachmann für die Entstehungsgeschichte der Bibel, ein Star in der Forschung zum heiligen Augustinus – aber welchen normalen Menschen kümmerte das? Ratzinger vereinigte alle Attribute, um sicherzustellen, dass sich die breite Öffentlichkeit auf gar keinen Fall um ihn scherte. Doch ausgerechnet der schüchterne Fachmann für antike Kirchenlehrer hatte es geschafft, eine unglaubliche weltweite Bekanntheit zu erreichen, allerdings die Popularität eines Bösewichts. Ratzinger glich an Popularität einem global gehandelten Anti-Helden, dem schwarzen Darth Vader aus »Star Wars«, dem finsteren Killer-Kardinal von Dan Brown, dem absoluten Bösen.
In meinen vierundzwanzig Jahren in Rom ist mir nur ein anderer Mann begegnet, der weltweit für die Inkarnation des Bösen gehalten wurde, Muammar al-Gaddafi, der schillernde libysche Revolutionsführer. Aber Gaddafi hatte nachweislich hunderte Menschen durch seine Terror-Kommandos in den Tod reißen lassen, Josef Kardinal Ratzinger hatte keiner Fliege etwas zuleide getan. Ich sah damals immer wieder zum Altar in der Kirche am Friedhof der Deutschen und fragte mich, wie es sein konnte, dass ein stiller, schüchterner Kirchenmann es geschafft hatte, zu einem weltweit bekannten Anti-Helden zu werden, zu einem Mann, den Millionen Menschen verabscheuten wie den Mafia-Boss Don Vito Corleone aus Francis Ford Coppolas Meisterwerk »Der Pate«. Mein damaliger Chef, aber auch meine Kolleginnen im Sekretariat, die Kollegen im Textarchiv, die Fotografen, Kollegen der Telefonzentrale, völlig egal, mit wem ich sprach, alle wollten von mir, der ich nun einmal in Rom war, vor allem eins wissen: Wie schrecklich ist dieser schreckliche Kardinal Joseph Ratzinger wirklich? Für die zahllosen deutschen Kirchenmänner, die in Rom Karriere gemacht hatten, wie der Cor-Unum-Chef Paul Josef Kardinal Cordes oder eben Walter Kardinal Kasper, interessierte sich in Deutschland fast niemand, die meisten Menschen wussten gar nicht, dass es diese Kirchenmänner gab, aber Joseph Kardinal Ratzinger hatte eine geradezu unermessliche Popularität als Bösewicht. Wenn ich ehrlich war, hatte auch ich dieses Gefühl, diese Vorurteile gegen Joseph Ratzinger ausgenutzt, ihn zum Gegenspieler des strahlenden Karol Wojtyla gemacht – und jetzt musste ich dafür bezahlen.
Alles verloren?
Rom, Stadtteil Trastevere, 19. April 2005. Ich kam an diesem Abend spät nach Hause, es muss so gegen 22 Uhr gewesen sein. Ich wohnte damals noch in Trastevere, einen Steinwurf entfernt vom dem weltberühmten Flohmarkt an der Porta Portese, jeden Sonntag verwandelten sich diese Plätze um unser Haus in einen gigantischen Basar. Der größte Fehler, den man machen konnte, war, eben diesen Markt zu vergessen und das Auto nicht rechtzeitig von den Straßen wegzustellen, auf denen die Händler ihre Stände aufbauen durften. Dann musste ich am nächsten Tag zusehen, wie ein Antiquitätenhändler aus Neapel oder ein chinesischer Ein-Euro-Händler meine Motorhaube, das Dach und das Heck des Wagens, mit dem ich eigentlich einen Ausflug geplant hatte, als Verkaufstand benutzte.