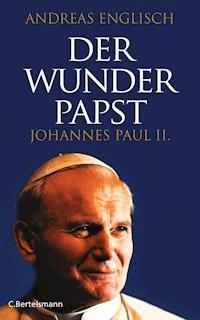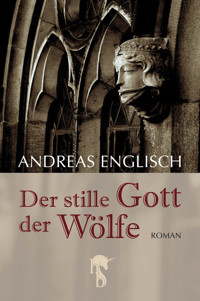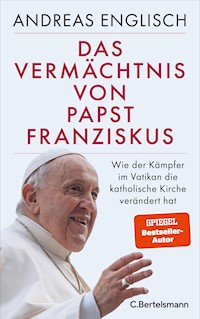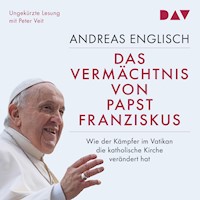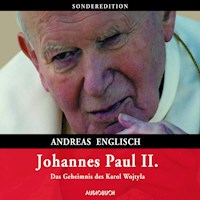9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie gefährdet ist Franziskus? Bestsellerautor Andreas Englisch auf den Spuren der geheimen Gegner des Papstes
In geheimen Zirkeln haben Feinde der mutigen Reformen von Papst Franziskus einen Pakt geschmiedet, der bis in die Spitzenämter der katholischen Kirche reicht und nur ein Ziel hat: den Papst zum Rücktritt zu zwingen. Deutschlands bekanntester Vatikan-Insider und Bestsellerautor Andreas Englisch hat die Hintermänner dieser Verschwörung getroffen. Seine packende Recherche zeigt, wer die Gegner des Papstes sind, mit welchen Mitteln sie gegen den Heiligen Vater kämpfen – und wie unbeirrt Franziskus seinen Weg verteidigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Im Vatikan herrscht Krieg. Mächtige Männer aus dem Inneren der Kurie fühlen sich von Franziskus bedroht. Sie werfen ihm vor, dass er durch seine mutigen Reformen der katholischen Kirche schadet. In geheimen Zirkeln haben Franziskus’ Feinde deswegen einen Pakt geschmiedet, der bis in die Spitzenämter der katholischen Kirche reicht und nur ein Ziel hat: den Papst zum Rücktritt zu zwingen. Vatikan-Insider und Bestsellerautor Andreas Englisch hat die Hintermänner dieser Verschwörung getroffen. Seine packende Recherche zeigt, wer die Gegner des Papstes sind, mit welchen Mitteln sie gegen den Heiligen Vater kämpfen – und wie Franziskus sich wehrt.
Autor
Andreas Englisch lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Seine Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sind Bestseller, darunter Franziskus – Zeichen der Hoffnung (2013), Der Kämpfer im Vatikan – Papst Franziskus und sein mutiger Weg (2015) sowie die Bildbiografie Franziskus (2016). Zuletzt begeisterte Andreas Englisch seine Leser mit dem Bestseller Mein Rom. Die Geheimnisse der Ewigen Stadt (2018).
ANDREAS ENGLISCH
DER
PAKT
GEGEN
DEN
PAPST
Franziskus
und seine
Feinde im
Vatikan
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2020 Andreas Englisch
© 2020 C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt
durch die AVA International GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München,
www.ava-international.de
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt
Covermotive: © picture alliance/Stefano Spaziani, © Musacchio & Ianniello
Bildredaktion: Annette Baur
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-23525-3V003
www.cbertelsmann.dewww.penguinrandomhouse.de
Wie gefährlich lebt der Papst im Vatikan? Wer steckt eigentlich hinter den pausenlosen Angriffen auf ihn? Immer wieder haben mir meine Zuhörer bei Lesungen diese Fragen gestellt. Deswegen habe ich beschlossen, mich im Vatikan auf die Suche nach seinen Feinden zu machen.
Dabei stieß ich stets auf das gleiche Problem: Ich sprach mit Bischöfen und Priestern, die zwar bereit waren, mir die manchmal schockierende Wahrheit ungeschminkt zu erzählen. Aber sie alle beklagten eine Atmosphäre der Angst, Angst vor den Gegnern des Papstes, die einflussreiche Persönlichkeiten sind. Viele meiner Gesprächspartner bestanden deshalb darauf, in diesem Buch nicht mit Namen genannt zu werden. Ich habe deshalb ihrem Wunsch nach Anonymität entsprochen und ihre Namen verändert. Viele Dialoge, die das Buch wiedergibt, habe ich aus meinem Gedächtnis nach bestem Wissen rekonstruiert.
Mein besonderer Dank gilt Papst Franziskus für die sehr offenen Gespräche mit ihm während seiner Reisen an Bord des päpstlichen Flugzeugs. Ihnen verdanke ich meine wichtigsten Informationen.
Inhalt
I Ärger am Tiber
II Mit dem Rücken zur Wand
III Der Anfang der Revolte
IV Zurück an die Front
V Das Erbe von Assisi
VI Dialog mit dem Islam
VII Der Kampf von Abu Dhabi
VIII Der Papst am Massengrab
IX »Das ist nicht mehr mein Papst!«
X Die Karten werden neu gemischt
XI Ohrfeigen für zwei Päpste: Franziskus schlägt zurück
XII Explosion Tebartz-van Elst
XIII Das Rätsel Georg Gänswein
XIV Die Provokation Kasper
XV Der römische Adel und der Papst
XVI Der Papst, der Adel und die Johanniter
XVII Fake News im kalten Krieg der Päpste
XVIII Die Legionäre Christi und die Jungfrau von Guadalupe
XIX Begegnung der unheimlichen Art mit Monsignore F.
XX Franziskus und die Kardinalpatrone
XXI Ausgehorcht von Father H.
XXII Der Streit um »Amoris Laetitia«
XXIII Päpste auf der Abschussliste
XXIV Die neuen Feinde des Papstes
XXV Der Vatikan und die Homosexualität
XXVI Die beiden Professoren und das Mittelzimmer
XXVII Nachts am Monte Caprino
XXVIII Auf der Jagd nach homosexuellen Priestern?
XXIX Auftakt zu einer Hexenjagd?
XXX Wer steckt dahinter?
XXXI Argentinische Tragödie
XXXII Die Schuld des Jorge Mario Bergoglio
XXXIII Der Papst und die »Götzen«
XXXIV Die Lobbys im Vatikan
XXXV Franziskus in Zeiten von Corona
XXXVI Hüpfburg statt Beichtstuhl im Vatikan
XXXVII Wer will dem Papst schaden?
XXXVIII Der Kampf ist nicht vorbei
Epilog
Bildteil
I
Ärger am Tiber
Ich ging ihm seit Langem aus dem Weg, und ich hatte allen Grund dazu. Es war so gegen 19 Uhr, im Winter, und stockdunkel, als ich mit dem Fahrrad wie üblich am Tiber entlang nach Hause fuhr. Ich hatte ihn von Weitem nicht erkannt. Da war nur ein großer Schatten am Ufer des Flusses zu sehen gewesen, neben dem Fahrradweg. Er sah mich zuerst, einen Augenblick bevor ich ihn erkannte. Anzuhalten und umzudrehen wäre grob unhöflich gewesen. Einfach grußlos an ihm vorbeizufahren ebenso. Also bremste ich, als ich ihn erreicht hatte, und stieg ab.
Er ist ein großer Mann, um die 60, weiße Haare, Brust und Arme wie ein Boxer, ungewöhnlich für einen Priester. Er war etwa zur gleichen Zeit wie ich nach Rom gekommen, Ende der 80er-Jahre, und er empfand viel mehr als nur Abneigung gegen mich, sondern eine regelrechte Abscheu. Zunächst hatte er mich einfach nur nicht gemocht, und damit musste ich leben, aber sein Groll gegen mich wuchs von Jahr zu Jahr. Seine ganze Abscheu ließ er mich spüren, als mein erstes Buch über Franziskus im Jahr 2013 erschien. Es hieß Zeichen der Hoffnung. Er war außer sich. Ich hatte ihn zufällig auf dem Weg zum Petersdom getroffen, und er stoppte mich. »Wie können Sie ein solches Machwerk über Papst Franziskus Zeichen der Hoffnung nennen? Was soll das heißen? Wie sehr wollen Sie den großen Papst Benedikt denn noch beleidigen? Wenn wir jetzt angeblich Hoffnung schöpfen sollen, was haben wir denn dann unter Ihrem großen Landsmann erlebt? Gründe für Verzweiflung? Warum sollten wir nach der herausragenden Leistung von Papst Benedikt Hoffnung nötig haben? Hoffnung worauf? Was bitte sollen wir denn erhoffen? Mit diesem Titel unterstellen Sie dem Papst, ein Desaster verursacht zu haben, sodass die Menschen nach seinem Rücktritt endlich Hoffnung schöpfen können. Sie sollten sich schämen.«
Ich wusste, dass Papst Benedikt Monsignore A. gerettet hatte. Er war kurz davor gewesen, seinen bequemen und angenehmen Job im Vatikan aufgeben zu müssen, um sich in einem Heim mit schwer erziehbaren Jugendlichen herumzuschlagen. Die Leute um Benedikt XVI. hatten nach einem Hilferuf von Monsignore A. eingegriffen und dafür gesorgt, dass dieser in Rom bleiben und seinen Posten behalten konnte. Deswegen war der Monsignore dem Papst zutiefst dankbar und lobte die Qualitäten Joseph Ratzingers über den grünen Klee. Ich konnte verstehen, dass er sauer auf mich war, dass er alles angriff, das auch nur im Entferntesten nach einer Kritik an Joseph Ratzinger roch.
Das zweite Mal gab es Krach mit ihm, als mein zweites Buch über Papst Franziskus mit dem Titel Der Kämpfer im Vatikan herauskam. Ich traf ihn kurz nach dem Erscheinungstermin, als ich den Pressesaal des Heiligen Stuhls verließ.
»Was bilden Sie sich eigentlich ein?«, hatte er mich angeblafft. »Gegen wen sollte der Papst bitte kämpfen müssen? Sie erwecken den Eindruck, als gäbe es im Vatikan entschlossene Gegner dieses Papstes. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Alle im Vatikan, und zwar restlos alle, lieben diesen Papst, wie sie auch Benedikt verehrt und geliebt haben. Die Feinde von Papst Franziskus, von denen Sie faseln, gibt es nur in Ihrer Fantasie.«
Jetzt in der Dunkelheit sah er mich ziemlich boshaft an, zumindest schien es mir so.
Ich sagte so höflich, wie ich konnte: »Guten Abend, Monsignore.«
»Dass ich Sie hier treffe«, brummte er. »Ich wollte Sie schon lange sprechen, denn das, was Sie da machen in Deutschland, das geht so nicht. Das sage ich Ihnen!«
»Was meinen Sie?«
»Sie wissen ganz genau, was ich meine. Ich habe aus Dutzenden deutschen Städten gehört, was Sie machen. Sie treten sogar in Kirchen auf und verunsichern die Gläubigen zutiefst. Sie wagen es, darüber zu sprechen, dass es eine Kirchenspaltung geben könnte, ein Schisma. Haben Sie denn jeden Anstand verloren? Das ist doch die absurdeste Räuberpistole überhaupt! In zweitausend Jahren gab es ganze zwei große Kirchenspaltungen. Das erste Mal um das Jahr 1000, da trennten sich die Ostkirchen ab, und das zweite Mal durch Martin Luther, und jetzt verbreiten Sie in Dutzenden von Städten in Deutschland, dass die Gegner des Papstes so stark seien, dass Franziskus eine Kirchenteilung fürchten müsse. Ja, sind Sie denn noch bei Trost? Der Papst hat noch keine einzige Sekunde lang an eine Kirchenteilung gedacht. Was denken Sie sich eigentlich dabei, solche Lügen zu verbreiten, und dann auch noch in katholischen Kirchen?«
Mir zitterten jetzt die Knie, und ich überlegte fieberhaft, was Monsignore A. im Vatikan tun könnte, um mir massiv zu schaden. Leider fiel mir dazu eine ganze Menge ein. Hatte ich tatsächlich maßlos übertrieben, wenn ich immer wieder gesagt hatte, dass der Papst mit einer Spaltung der katholischen Kirche rechnen müsse?
»Der Papst mag ja mit allem Möglichen rechnen, aber sicher nicht mit einer Spaltung der katholischen Kirche, die seine Gegner erzwingen könnten. In Deutschland posaunen Sie überall herum, dass der Papst sich mit den Chefs des internationalen Großkapitals anlege, vor allem mit den USA. Das ist doch nur eine Ihrer Erfindungen. Niemals würde ein Papst die USA oder den Kapitalismus als Gegner sehen. Dass der Papst und die Amerikaner Feinde sind, spielt sich nur in Ihrem kranken Kopf ab.«
Ich biss mir auf die Lippen. Wenn der Papst in Zukunft nicht so mutig sein würde, offen über Unangenehmes zu sprechen, würde es wahrscheinlich verdammt schwierig werden zu beweisen, dass der Papst die USA oder das Großkapital als Gegner sah und dass diese ihn bekämpften. Ich war mir absolut sicher, dass es so war, aber konnte ich das auch beweisen?
»Hören Sie auf, solchen Unsinn zu verbreiten! Das tun Sie ja sogar im Fernsehen. Und hören Sie auf, im Vatikan herumzuschnüffeln auf der Suche nach Feinden des Papstes. Die gibt es nämlich gar nicht.«
Ich versuchte, cool zu bleiben. Ich hatte schon oft erlebt, dass mich Funktionsträger im Vatikan beschimpften. Auch der Exchef von Radio Vatikan hatte mir mitteilen lassen, dass ich keine Ahnung von dem hätte, was Papst Franziskus wolle.
»Wenn ich das noch einmal aus Deutschland höre, dass Sie in einer Kirche den Leuten auftischen, dass der Papst eine Kirchenspaltung fürchte und in den USA einen Gegner sehe, dann werde ich handeln. Verlassen Sie sich darauf.« Dann drehte er sich um und ging. Ich gebe zu, ich brauchte eine ganze Weile, bis ich mich gefangen hatte und nach Hause radeln konnte.
Am 4. September 2019 auf dem Flug nach Mosambik zeigte Papst Franziskus den Mut, den ich nicht für möglich gehalten hatte. Er sagte wenige Schritte vor mir im päpstlichen Flugzeug ins Mikrofon: »Es ist mir eine Ehre, wenn die Amerikaner mich angreifen.«
Am 10. September 2019 auf dem Rückflug bewies er, wiederum in der päpstlichen Maschine, in der ich auch saß, den gleichen unglaublichen Mut, als er zugab, wie sehr es innerhalb der Kirche kracht: »Ich habe keine Angst vor Kirchenspaltungen, vor Schismen.« Beides hatte ich geahnt, doch das war jetzt der Beweis. Der Papst hielt tatsächlich eine Spaltung der katholischen Kirche für möglich und stritt sich tatsächlich mit den Amerikanern. Aber warum wollten Kirchenmänner im Vatikan wie Monsignore A. vermeiden, dass ich darüber etwas schrieb oder dass ich »herumschnüffelte«? Warum war ihnen das so wichtig? Warum bekämpften so viele den Generaloberen der Jesuiten, Pater Arturo Marcelino Sosa Abascal, der 2019 in Rimini gesagt hatte: »Sie wollen den Papst zum Rücktritt zwingen. Es gibt Verschwörungen innerhalb und außerhalb des Vatikans.«
II
Mit dem Rücken zur Wand
Das eigenartigste Hauptquartier der Welt, in dem ein Mann lebt, der sich Stellvertreter Gottes auf Erden nennen darf, liegt direkt neben der etwas heruntergekommenen Tankstelle mitten im Vatikan. Da dort keine Steuern anfallen, kostet der Sprit etwa ein Viertel weniger als in Italien. Einen Steinwurf weit entfernt liegt das Gästehaus des Vatikans, das den Namen der heiligen Martha trägt und in das Franziskus nach seiner Wahl zum Papst im Jahr 2013 zum maßlosen Entsetzen der alten Garde einzog.
Wenn sich die Glastüren zum Gästehaus der heiligen Martha öffnen und die Büste Papst Johannes Pauls II. die Gäste begrüßt, weht immer auch der Geruch von Benzin in die Zentrale der katholischen Kirche herein wie ein böser Geist. Bis zu dem Tag, an dem Papst Franziskus seinen Wohnsitz hierher verlegte, war das Haus der heiligen Martha nur eines der nichtssagenden, langweiligen Gästehäuser des Vatikans. Wer hier abstieg, wollte vor allem dem noch weit weniger luxuriösen Priesterwohnheim an der Via della Traspontina entgehen, das gleich um die Ecke an der Kreuzung zur Via della Conciliazione liegt. Doch wer etwas zu sagen hatte, der kam nicht ins Haus der heiligen Martha, sondern ging durch einen der Haupteingänge des Vatikans, das pompöse Portal Portone di Bronzo, das von salutierenden Schweizergardisten bewacht wird, oder ließ sich gleich in den überdimensionierten, gleichwohl sehr schönen Innenhof des Vatikans, den sogenannten Damasus-Hof fahren, um zu einem Gespräch mit dem Papst vorgelassen zu werden.
Welche Besucher der Papst empfing, war in einem Wochenplan genau geregelt. Am Montag durfte der Kardinalstaatssekretär erscheinen, am Dienstag der Präfekt der Glaubenskongregation, am Mittwoch der Chef des Klerus, am Donnerstag der Präfekt für die Selig- und Heiligsprechungen und am Freitag wieder der Kardinalstaatssekretär. Ganze vier Männer durften also regelmäßig zum Papst, und jetzt saß Papst Franziskus in der Mensa des Gästehauses und ließ Abend für Abend Selfies mit sich machen, mit Familienmüttern und -vätern, die neuerdings in dem Haus absteigen dürfen. Das alles hat aus der Sicht der Gegner des Papstes nur ein einziges Ziel: die ehemaligen Herrscher des Vatikans, die übrig gebliebenen Kardinäle aus der Amtszeit Papst Johannes Pauls II. und Benedikts XVI., vor den Kopf zu stoßen. Denn sie hatten ein ganz anderes Bild von einem Papst – und dass Franziskus diesem Bild nicht entsprechen will, das zeigt er ihnen jeden Tag.
Sie können ihm nicht verzeihen, dass er die Grundfesten der katholischen Kirche angreift, das von Gott gelegte Fundament zum Wanken bringt. Denn Franziskus schreckt ihrer Ansicht nach nicht einmal davor zurück, den Anspruch der katholischen Kirche aufzugeben, die allein selig machende religiöse Instanz auf Erden zu sein. Was seinem Vorgänger Joseph Ratzinger so wichtig war, dass es nämlich für einen Gläubigen »objektiv besser« sei, katholisch zu sein, um ins Paradies zu kommen, lehnt Franziskus ab. Der erste Papst vom amerikanischen Kontinent verzichtet sogar auf den alles entscheidenden Anspruch der Päpste: der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Vikar Jesu Christi, zu sein. Franziskus ließ vielmehr lapidar durch eine Änderung im vatikanischen Jahrbuch klarstellen, dass dieser Titel eben nur eine Tradition darstelle, ähnlich wie der Titel »Nachfolger des heiligen Petrus«. Damit ist aber im Grunde auch das Ende der unumschränkten Autorität des Papstes eingeleitet, kraft derer er als Nachfolger des Apostelfürsten in allen Streitfragen des Glaubens, wo immer auf der Welt sie in der katholischen Kirche zutage treten, das unfehlbare letzte entscheidende Wort spricht.
Die Gegner des Franziskus glauben aber nicht nur, dass er das Amt des Papstes zerstört, sondern auch das Heiligste der Kirche, die Sakramente. Seine Schreiben sollen das Sakrament der Ehe wie das der Beichte vernichtet haben durch seinen ständig wiederholten Wahlspruch: Gott vergibt immer. Aber wenn Gott immer vergibt, wozu brauchen die Gläubigen dann noch eine Kirche, die ihnen helfen soll, Gottes Vergebung zu erlangen und ins Paradies zu kommen? Das fragen sich seine Gegner. Deshalb also, weil ein Papst jetzt Anstalten macht, nach ihrer Auffassung den inneren Kern der von Gottes Sohn gegründeten Kirche zu zerstören, bleibt Franziskus’ Gegnern keine andere Wahl, als diesen Papst im Namen Gottes zum Rücktritt zu zwingen.
Allerdings ist der Zeitpunkt, den Papst zu bekämpfen, schlecht gewählt. Gerade jetzt müsste die Kirche Geschlossenheit zeigen, weil sie am Boden liegt.
Franziskus hat das geruhsame Gästehaus mittlerweile in seine persönliche Kommandozentrale verwandelt. Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, was für eine Art Befehlsstand das hier ist. Einer der einflussreichsten Bischöfe der Ära Ratzinger verglich die Atmosphäre im Haus der heiligen Martha mit derjenigen im Hauptquartier einer eingekesselten Armee, die dort unter einem Kommandanten, den sie für selbstzerstörerisch und unfähig hält, auf den Vernichtungsschlag des Gegners wartet. Wer immer das Haus betritt, kommt mit gesenktem Kopf, verbitterter Miene und schlechten Nachrichten von draußen herein, denn überall in der Welt brechen die Verteidigungslinien der römisch-katholischen Kirche in atemberaubendem Tempo zusammen. Die Welt will nicht mehr annehmen, was die Kirche im Angebot hat. Statt einer Fronleichnamsprozession bevorzugen junge Frauen Buddhismus-Meditationsseminare, Männer gehen nicht mehr zur Beichte, sondern auf den Himalaya, um zu sich selbst zu finden. Die Welt wendet sich von der Kirche ab, und gleichzeitig begehen die Männer Gottes Verfehlungen und Verbrechen am laufenden Band und beschleunigen so den Untergang ihrer Institution.
Auf Platz eins der Negativ-Rangliste stehen mit weitem Abstand die Missbrauchsskandale. Die ersten vereinzelten Fälle wurden in den 1980er-Jahren aufgedeckt, mittlerweile brennt es jedoch in der gesamten kirchlichen Welt. Alle Kontinente, alle Länder, alle Bischofskonferenzen sind betroffen – doch jetzt geht die Welt da draußen mit den Fehlern der Kirche anders um, als das in der Vergangenheit der Fall war. Mochte die Kirche jahrhundertelang noch so unbegreifliche Fehler und Verbrechen begehen, sie konnte das immer wieder überspielen, die Gläubigen schluckten es ohne Murren, und die Welt verzieh es ihr, egal, ob sie die Demokratie verdammte und verbrecherische Regime unterstützte oder etwa bei Strafe der Exkommunikation die Lektüre bestimmter Zeitungen verbot, wie es Papst Pius XII. noch nach dem Zweiten Weltkrieg tat.
Aber jetzt ist Schluss mit der Nachsicht. Die Welt scheint nicht geneigt, der Kirche sexuellen Missbrauch zu vergeben. Der sexuelle Missbrauch von Kindern, Jugendlichen, jungen Priestern und Ordensfrauen sowie die Vertuschung dieser Verbrechen hat die Christen so entsetzt, dass sie die Nase voll haben von hilflosen Beteuerungen. Sie wollen Köpfe rollen sehen. Jeder Priester auf der Welt bekommt das mittlerweile zu spüren. Die Kirche steht zweifellos mit dem Rücken zur Wand.
III
Der Anfang der Revolte
Unmittelbar nach der Wahl von Jorge Mario Bergoglio zum Papst im Frühjahr 2013 gab es im Vatikan keinerlei Zweifel daran, dass sich einige Kardinäle und Bischöfe gegen den neuen Papst stellen würden. Natürlich wusste niemand, wie viele Kirchenmänner daran beteiligt sein würden, wie stark diese Streitmacht sein würde, ob sie einen Frontalangriff wagen oder ob sie es mit Sabotage versuchen würde. Die Tatsache aber, dass es Bestrebungen irgendeiner Art gab, bestritt in den eingeweihten Kreisen im Vatikan niemand. Der neu gewählte Papst war keineswegs ein stiller Frömmler gewesen, sondern ein Kämpfer, der sich seit Jahrzehnten mit der Hierarchie im Vatikan herumgeschlagen hatte. Zwei entscheidende Schlachten, die der neue Papst einst geschlagen hatte, waren vielen noch in Erinnerung. Dabei hatte es erheblichen Ärger gegeben, der noch immer nachwirkte.
Im Jahr 1992 hatte in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, der Lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM) getagt. Aus Sicht des damaligen Papstes Johannes Paul II. waren die lateinamerikanischen Bischöfe von Kommunisten unterwandert. Die Theologie der Befreiung mit ihren Forderungen nach einer Umverteilung des ihrer Ansicht nach durch Ausbeutung erwirtschafteten Reichtums in Lateinamerika war für ihn nichts anderes als ein Vorstoß der Kommunisten. Und Karol Wojtyła hasste bekanntermaßen alles, was mit Kommunismus zu tun hatte. Um die Teilnehmer in die Schranken zu weisen und die Konferenz eventuell sogar aufzulösen, entsandte Johannes Paul II. den schlimmsten Scharfrichter, den er hatte, Kurienkardinal Alfonso López Trujillo, nach Santo Domingo. Der sollte dort den Bischöfen Lateinamerikas ihre Befugnisse nehmen und sie enger an Rom binden. Sie sollten auf ihrem eigenen Kontinent in ihren Selbstbestimmungsrechten beschnitten und ihre angeblich sozialistischen und kommunistischen Umtriebe ausgemerzt werden.
Zur Gruppe der Scharfmacher gehörte auch Joseph Ratzinger, damals der Präfekt der Glaubenskongregation. Ihnen gegenüber standen die einflussreichsten Männer des Lateinamerikanischen Bischofsrats, denen es an den Kragen gehen sollte, so der spätere Präsident des Bischofsrats, Óscar Maradiaga aus Honduras, und dessen enger Freund Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien. Wie durch ein Wunder misslang die Attacke, weil López Trujillo überraschend erkrankte und an der Konferenz nicht teilnehmen konnte. Diese Auseinandersetzung, im Kirchenjargon »Verpasste Schlacht von Santo Domingo« genannt, hatte dazu geführt, dass vor allem die glühendsten Verehrer von Papst Johannes Paul II. ein energischeres Durchgreifen gegen die rebellischen Bischöfe Lateinamerikas forderten. In der Folge war Bergoglio bei seinen Besuchen in Rom so offen geschnitten oder zusammengefaltet worden, dass er sich häufig weigerte, zum Rapport nach Rom zu kommen. Doch genau die Männer im Vatikan, die ihn damals genüsslich in die Pfanne gehauen hatten, fürchteten ihn jetzt natürlich, und die Mutigeren von ihnen würden wohl versuchen, sein Pontifikat abzukürzen.
Der zweite große Knall kam 2006. Der brasilianische Kardinal Cláudio Hummes wurde im selben Jahr von Papst Benedikt XVI. zum Präfekten der Kongregation für den Klerus und damit zum Chef aller Priester ernannt. Noch bevor er seinen neuen Job in Rom antrat, erklärte er gegenüber Zeitungen, dass die Ehelosigkeit der Priester, der Zölibat, durchaus abgeschafft werden könnte, weil das kein Gesetz Gottes, sondern nur eine Regel sei. Kaum in Rom angekommen, stauchte Papst Benedikt XVI. Kardinal Hummes zusammen. Hummes galt im Vatikan als unfähig. Wie hatte der Chef des Klerus den Zölibat auch nur in Zweifel ziehen können, wo er hätte wissen müssen, dass sein Vorgesetzter, Papst Benedikt XVI., unbedingt daran festhalten wollte?
Ausgerechnet diesem Kardinal Hummes erwies Papst Franziskus den maximalen Beweis seiner Wertschätzung. Er holte ihn unmittelbar nach seiner Wahl zu sich auf den Balkon des Petersdoms, als er sich zum ersten Mal der Menge zeigte. Für viele im Vatikan bedeutete das einen gewaltigen Schock. Der neue Papst war offensichtlich eng befreundet mit dem Mann, den sie einst gedemütigt und fertiggemacht hatten. Auf Dankbarkeit oder Wohlwollen des neuen Papstes konnten sie jetzt nicht hoffen. Sie mussten damit rechnen, dass Franziskus sie angesichts ihrer Attacken auf Cláudio Hummes für ungeeignet halten würde, was sie und ihre Seilschaften den Job im Vatikan kosten konnte. Aber natürlich nur dann, wenn der Papst lange genug regierte, um die gesamte Kirchenregierung umbauen zu können, und er nicht wegen irgendeiner Intrige zurücktreten musste.
Es gab also mindestens zwei Gruppen, die ein starkes Interesse daran hatten, dass der Papst so rasch wie möglich sein Amt aufgab. Wer die übrigen Feinde von Papst Franziskus sein könnten, ließ sich nicht so einfach ausmachen. Jorge Mario Bergoglio passt in keine Schublade.
Er hatte sich als Hochschullehrer geweigert, die Theologie der Befreiung zu lehren, was in der Logik der Kirche als »rechts« galt. Gleichzeitig hatte er sich aber immer für die Ärmsten der Armen engagiert und Priester angewiesen, in Garagen bei den Armen die Messe zu lesen, was innerhalb der Kirche wiederum als äußerst »links« galt. Was war er denn nun? Im rechten Spektrum hatte Bergoglio durchaus Anhänger, die es ihm hoch anrechneten, dass er wegen seiner antikommunistischen Haltung von den linken Ideologen in seinem Orden hart abgestraft worden war. Aber auch im linken Spektrum hatte er seine Gefolgschaft, die sein persönliches Engagement in den Slums Argentiniens bewunderte.
Es gab nur sehr wenige klare Feinde des neuen Papstes. Zu ihnen gehörte vor allem die in Lateinamerika stark vertretene Personalprälatur Opus Dei, die Vorbehalte gegen Bergoglio hegte. Ich beschaffte mir einen Termin beim Sekretär eines der erbittertsten Gegner des neuen Papstes, der seit der Konferenz in Santo Domingo gegen ihn gewesen war und gleichzeitig auch Hummes attackiert hatte. Es gibt im Vatikan nur zwei Arten von Sekretären, die einem Kardinal oder einem Bischof dienen. Die einen schätzen ihren Chef und kommen gut mit ihm zurecht. Oft entsteht daraus eine enge Freundschaft, manchmal wegen des Altersunterschieds auch eine Art Vater-Sohn-Verhältnis. Die zweite Art von Sekretären verabscheut ihren Chef oder hasst ihn gar abgrundtief. In manchen kirchlichen Würdenträgern entsteht durch ihre Erhebung zum Bischof oder Kardinal ein Gefühl der Überlegenheit, was zu Überheblichkeit führen kann und das Zusammenleben und -arbeiten äußerst schwierig macht.
Einer der klassischen Konflikte zwischen Sekretär und Chef ist das Dauerthema Buch. Kirchliche Würdenträger wollen gehört werden, sie wünschen sich, dass ihre Ideen, welche die Basis ihrer Predigten und Ansprachen bilden, ein möglichst großes Publikum finden, kurz: Sie wollen Bücher schreiben. Leider kommt es häufig vor, dass der ein oder andere kirchliche Würdenträger sein Talent zum Schreiben überschätzt und nicht verstehen kann, dass seine Ausführungen wie etwa über die Konflikte des Athanasius von Alexandria niemanden wirklich interessieren. Der Würdenträger zwingt dann seinen Sekretär, seine Schriften wie sauer Bier bei Verlagen anzubieten. Selbst wenn eine Publikation gelingt, ist der Würdenträger meist maßlos enttäuscht, wenn sich herausstellt, dass sein Werk nur in einer winzigen Auflage gedruckt wird.
Die nächste Pein für den Sekretär besteht darin, dass die Eitelkeit des Würdenträgers erst dann befriedigt ist, wenn sein Buch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. So muss der Sekretär Dutzende Verlage abklappern, die Fähigkeiten seines Chefs anpreisen, an die er selbst nicht glaubt, und sich immer wieder anhören, dass das, was sein kirchlicher Boss geschrieben hat, von keinerlei Interesse ist. Diese Tatsache aber, also die Wahrheit, kann der Sekretär seinem Chef natürlich nicht zumuten, also muss er ihm schonend beibringen, dass man sein Werk schnöde und unverständlicherweise verschmäht. Das alles endet in der Regel damit, dass der kirchliche Würdenträger fest davon überzeugt ist, dass sein Sekretär nicht geschickt und hartnäckig genug versucht hat, sein bedeutendes Werk unterzubringen, was zu einer ständigen Verstimmung und nachhaltigen Vergiftung des Verhältnisses führt.
Der Sekretär, mit dem ich mich im Herbst des Jahres 2013 traf, wurde von genau so einem Chef bereits seit Jahren getriezt.
Ich lud ihn in eine Kaffeebar ein, und er grinste mich an, sobald wir saßen.
»Es wundert mich nicht wirklich, dass du kommst.«
»Wieso?«, fragte ich.
»Wieso wohl. Mein Chef hasst Bergoglio, und das weißt du ganz genau.«
»Und jetzt?«, fragte ich. »Was wird er jetzt machen?«
»Gute Frage«, sagte er. »Vielleicht duckt er sich einfach weg und hofft auf ein kurzes Pontifikat oder …«
»Oder er beteiligt sich an dem Versuch, den Papst zu stürzen.«
»Könnte sein. Ich habe auch schon gehört, dass es organisierten Widerstand gegen den Papst geben soll.«
»Und gibt es den?«
»Keine Ahnung. Aber nach all den Kübeln Unrat, die mein Chef über Kardinal Bergoglio vor seiner Wahl zum Papst ausgekippt hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass alles weitergeht wie bisher.«
»Der neue Papst wird seinen alten Feinden verzeihen.«
»Aber mein Chef wird ihm nicht verzeihen, dass er zum Papst gewählt wurde.«
»Glaubst du, dass sich bereits etwas tut?«
Diese Frage ist im Vatikan in einem solchen Gespräch die Kernfrage, weil sie bedeutet: Hat dein Chef in letzter Zeit versucht, dich herauszuhalten, also mit Leuten gesprochen und gleichzeitig dafür gesorgt, dass du nicht mitbekommst, mit wem und worüber er redete.
»Lass mich mal nachdenken«, antwortete er.
Er blätterte in einem alten, fleckigen Terminkalender.
»Nee«, sagte er. »Da ist nichts, alles wie immer, bis auf, warte mal. Da ist etwas Seltsames am Ostersonntag und dann noch einmal im Juni. Er hat mich zweimal an einem Sonntag angerufen und mich gezwungen, die Termine für den Montagnachmittag abzusagen, obwohl er da eigentlich jedes Mal etwas Wichtiges vorhatte.«
»Vielleicht musste er einfach plötzlich zum Friseur.«
»Du verstehst mich nicht. Am Sonntag hat er mich in all den Jahren noch nie angerufen, weil im Vatikan der Sonntag heilig ist. Das darf keiner verletzen. Irgendwas muss an diesen beiden Montagen für ihn so verdammt wichtig gewesen sein, dass er sich dazu herablassen musste, mich an einem Sonntag anzurufen, damit ich noch absagen konnte.«
Ich fuhr mit der Vespa zurück zum Büro, setzte mich aber unterwegs in die Sonne an die Treppe, die von der Via di San Teodoro hinauf zum Kapitol führt, um ein wenig nachzudenken.
Was wusste ich eigentlich sicher? Ein hoher Würdenträger, von dem ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen konnte, dass er den Papst verabscheute, hatte seinen Sekretär zweimal auf ungewöhnliche Weise Termine absagen lassen, und zwar immer einen Termin am Montag. Aber warum ausgerechnet an einem Montag? Was hatte er so plötzlich an diesen beiden Montagen, Ostermontag und 24. Juni 2013, vorgehabt? Gab es so etwas wie einen sich formierenden Widerstand gegen den Papst auf höchster Ebene? Aber wer waren die Männer, die sich gegen Papst Franziskus in Stellung bringen wollten? Und hatten die tatsächlich vor, sich zusammenzuschließen, oder war das alles nur ein Hirngespinst? Sicher wusste ich, dass maßgebliche Männer der Polnischen Bischofskonferenz den Papst offensichtlich nicht schätzten und ihn vermutlich bekämpfen wollten. Papst Johannes Paul II. hatte nach seiner Wahl einige polnische Landsleute als seine engsten Mitarbeiter berufen. Waren sie also die Keimzelle einer Organisation, die den Papst aus Argentinien aus dem Amt drängen wollte?
Viele der engen Mitarbeiter und Freunde von Papst Johannes Paul II. waren nach dem Ende des Pontifikats von Papst Benedikt XVI. schlicht und einfach nicht mehr da. Allen voran dachte ich an Kardinal Andrzej Maria Deskur. Er hatte an einer Unzahl von Mittag- und Abendessen mit Papst Johannes Paul II. teilgenommen, sie waren sehr eng befreundet gewesen. Beide pflegten eine für viele andere Priester kaum nachvollziehbare unendliche Verehrung der Jungfrau Maria. Kardinal Deskur hatte sich sogar zu einer Geste hinreißen lassen, die dem Chef der Glaubenskongregation, Präfekt Joseph Ratzinger, zutiefst peinlich gewesen war. Als eine Familie ein Wunder aus der Hafenstadt Civitavecchia bei Rom meldete, wo eine Muttergottesstatue Blut geweint haben sollte, wurde Deskur aktiv.
Als die Polizei die angeblich wundersame Statue wegen des Verdachts der Volksverhetzung beschlagnahmte und obwohl Kardinal Joseph Ratzinger seine Skepsis gegenüber dem vermeintlichen Wunder nicht verbarg, schickte Deskur eine von ihm und dem Papst gemeinsam gesegnete Muttergottesstatue als Ersatz zu der Familie nach Civitavecchia. Aber Deskur war im Jahr 2011 verstorben.
Blieb noch Kardinal Zenon Grocholewski. Ich kannte Grocholewski ganz gut, er war der Chef der Kongregation für das Katholische Bildungswesen im Vatikan gewesen, sein Büro lag nur einen Steinwurf weit entfernt von meinem im Vatikan. Er war ein knallharter Verfechter der Ideen Karol Wojtyłas, und ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass Grocholewski alles tun würde, um das Andenken an Papst Johannes Paul II. in Ehren zu halten. Ich hatte auch keinen Zweifel daran, dass Grocholewski gegen alles gnadenlos anrennen würde, was Papst Franziskus durchsetzen würde, aber gegen die Überzeugung von Papst Johannes Paul II. verstoßen hätte.
Ich ging zurück ins Büro und beschloss, es mit einem alten Trick zu versuchen. Zunächst überprüfte ich, welche Veranstaltungen an den beiden fraglichen Montagen stattgefunden hatten.
Ich telefonierte die Büros der Führungsriege im Vatikan ab und ließ mich immer nur mit den Sekretären verbinden. Ich stellte eine simple Frage, nämlich ob ihr Chef am Ostermontag und am Montag, dem 24. Juni, an den Empfängen der Urbaniana-Universität und an der Buchvorstellung im Gästehaus des Senats teilgenommen hatte.
»Ich will da keinen Fehler machen«, log ich am Telefon. »Wenn euer Chef da auch war, will ich ihn in meinem Artikel natürlich erwähnen.«
Am anderen Ende der Leitung löste eine solche Frage meist Panik aus, das wusste ich. Denn wenn der Chef dort gewesen war und wenn er dort vielleicht sogar eine Rede gehalten hatte und das Sekretariat es dann verschlampt hatte, mir zu ermöglichen, darüber zu berichten, dann war das ein ziemlich schweres Vergehen.
»Moment mal«, sagten fast alle Sekretäre, »ich muss nachschauen.«
Ich wartete geduldig. Bei etwa einem Drittel der 50 Telefonate kam die Antwort, dass die betreffenden Sekretariate nicht ganz sicher waren, ob der Chef dort gewesen war. Denn genau an den beiden Tagen, an diesen beiden Montagen also, habe er sich freigenommen, und niemand wisse so genau, wo er eigentlich gewesen sei.
»Bingo«, dachte ich. »Aber warum ausgerechnet zweimal ein Montag?«
Ein paar Tage später verbrachte ich einen angenehmen Abend auf einem Empfang von Unternehmern der römischen Textilindustrie. Ich kannte dort nur die seltsame, kleine Sparte der Bekleidungsindustrie, die das Outfit für Priester produziert. Diese Damen und Herren kennenzulernen ergab sich im Laufe der Jahre zwangsläufig. Es gab Bischöfe und Kardinäle, die nach Rom kamen und nach einem gemeinsamen Essen regelrecht um Einkaufstipps baten. Sollten sie ihre Ausstattung am Pantheon in den äußerst ehrwürdigen alten Bekleidungsgeschäften kaufen oder doch lieber in der Nähe des Vatikans? Wie beim weltlichen Shoppen ging es auch hier ums Geld. Konservative Bischöfe und Kardinäle kauften maßgeschneiderte liturgische Gewänder und Anzüge, linke Würdenträger kauften bei Euroclero in der Nähe des Vatikans von der Stange. Ich hatte einmal über preisgekrönte Designer von Priesterklamotten geschrieben und kannte deswegen einige der Damen und Herren der Branche. Damals hatte ich lernen müssen, dass auch das Messgewand, die Casula, modischen Entwicklungen unterliegt und keineswegs zeitlos ist. Der Kitsch machte auch vor der Casula nicht halt. Messgewänder, die mit den an Comics erinnernden Porträts von beliebten Heiligen wie Mutter Teresa oder Pater Pio verziert waren, zogen ebenso am Altar ein wie echte handbestickte Kunstwerke, die über 4000 Euro kosten konnten. Das Ganze ließ sich auch mit Rabatten von bis zu 50 Prozent im Internet etwa bei Holyart kaufen.
Ich gönnte mir auf der Feier ein gutes Glas Rotwein, als ich zufällig aufschnappte, wie ein Herr aus der priesterlichen Textilbranche voller Empörung sagte: »An diesem Montag nach Ostern habe ich sogar mit dem Kardinal gesprochen, denn so geht es nicht.«
Der Textilindustrielle schien offensichtlich außer sich zu sein. Ich machte kehrt und stellte mich zu dem Grüppchen. Ich konnte meine Neugier nicht im Zaum halten und fragte den Herrn: »Entschuldigen Sie, dass ich mitgehört habe. Sie sagten, an diesem Montag, also dem Ostermontag, haben Sie mit einem Kardinal gesprochen.«
»Ja, aber fragen Sie mich nicht nach seinem Namen, denn den würde ich Ihnen sicher nicht sagen.«
»Natürlich nicht«, beschwichtigte ich. »Aber was gab es an diesem Ostermontag denn so Interessantes mit dem Kardinal zu besprechen?«
»Er war außer sich über den neuen Papst.«
»Und warum, wenn ich das fragen darf?«
Er sah mich äußerst misstrauisch an.
»Haben Sie es etwa nicht gesehen?«
Jetzt fiel bei mir endlich der Groschen. Am Ostersonntag 2013 war Papst Franziskus in einer äußerst simplen Aufmachung, ohne rote Schuhe, ohne Hermelinumhang, ohne die protzige Ausstaffierung seiner Vorgänger, in den Petersdom gegangen. Es war eine unübersehbare Kritik an dem Pomp seiner Vorgänger.
Deswegen haben sie sich getroffen. Weil sie über den Affront des Vortages sprechen wollten. Aber wie passte der 24. Juni?
»Einen Augenblick«, entschuldigte ich mich und verzog mich in eine Ecke. Ich durchsuchte meinen Kalender auf dem Handy nach dem 23. Juni, dem Tag zuvor.
Kein Ergebnis. Der Papst hatte an diesem Tag nichts gesagt oder getan, was die Kurie hätte aufbringen können. Aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Einen Tag zuvor, am 22. Juni 2013, hatte er sie alle sitzen lassen und zwar in der großen Audienzhalle »Papst Paul VI.«, wo ein Konzert stattfand. Der Papst der kleinen Leute, der luxuriöse, mondäne Auftritte hasste, war einfach nicht hingegangen. Er hatte ausrichten lassen, dass er keine Zeit habe. Sein Platz war leer geblieben. Ich erinnere mich gut an die Kardinäle, die wie aufgescheuchte Hühner umherliefen und sich gegenseitig beruhigten mit der beschwörenden Formel: »Er wird schon noch kommen.« Dann hatte ein zutiefst enttäuschter Rino Fisichella, ehemals Rektor der Lateranuniversität und Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, die Grußbotschaft des Papstes verlesen, und damit war klar: Er hatte sie alle vor den Kopf stoßen wollen. All das, was vorher so seltsam gewirkt hatte, war also gar kein Zufall gewesen, sondern ein Plan.
Gut drei Monate vorher, am Abend des 13. März 2013, musste der 76-jährige Argentinier Jorge Mario Bergoglio damit fertigwerden, dass ihn die Kardinäle zum Papst gewählt hatten und er damit aller Voraussicht nach bis zum Ende seiner Tage nie wieder eine ruhige Minute haben würde. Es wäre nur natürlich und allzu verständlich gewesen, wäre Bergoglio, der längst über das Pensionsalter hinaus war, von der Tatsache, dass er das Oberhaupt von 1,1 Milliarden Katholiken geworden war, überwältigt gewesen. Vermutlich hätte die Tatsache, zum Vikar Gottes gewählt worden zu sein, weit jüngere Männer in einen Zustand der Konfusion versetzt. Was musste einem frisch gewählten Papst alles durch den Kopf gehen? Dass er nie wieder in sein normales Leben in Argentinien zurückkehren konnte? Dass eine ungeahnte Verantwortung auf ihm lastete? Dass er von einer Minute zur anderen vom weltweit kaum beachteten Erzbischof von Buenos Aires zu einem der bekanntesten Männer der Welt aufgestiegen war, dessen Leibwächter ständig mit einem Anschlag rechnen mussten? Musste in einem solchen Moment nicht jedem Menschen angst und bange werden?
Das Amt des Papstes ist weltweit das letzte Überbleibsel einer absolutistischen Wahlmonarchie. Es ist so angelegt, als wäre der Papst immer perfekt, als könnte er nie Fehler machen, dank des Dogmas der Unfehlbarkeit, das 1870 eingeführt wurde. Gibt es überhaupt jemanden auf der Welt, der im Moment der Wahl in ein solches Amt nicht den Kopf verlieren würde?
Das Amt des Papstes ist zudem nicht nur eines der ältesten, nahezu ununterbrochen besetzten Ämter der Welt, es ist auch auf eine besondere Art mit Gott selbst verbunden. Franziskus musste sich an den Gedanken gewöhnen, der Nachfolger jenes Petrus zu sein, der den Auftrag, dessen Schafe zu weiden, direkt von Gottes Sohn bekommen und den auferstandenen Christus mit eigenen Augen gesehen hatte. Der neue Papst würde eine Vielzahl von Entscheidungen treffen, die das Schicksal ganzer Erdteile berühren würden. Außerdem musste sich der neue Papst nun mit dem Gedanken anfreunden, dass der Vatikan jetzt nicht mehr eine Behörde war, mit der er als Erzbischof von Buenos Aires häufig im Streit lag. Nein, der Vatikan war jetzt seine Behörde. Wäre es da nicht selbstverständlich gewesen, dass der neue Papst sich in den ersten Tagen und Wochen seines Pontifikats so unauffällig wie möglich verhielt? Wäre es nicht logisch gewesen, dass ein neu gewählter Papst vor allem eines vermeiden wollte: Fehler zu machen im neuen Amt?
Doch Jorge Mario Bergoglio verhielt sich völlig anders. Ihm gelang, was eigentlich unmöglich scheint: Den Schock der Wahl steckte er augenblicklich weg. Obwohl die Kameras Hunderter TV-Sender auf ihn warteten, blieb Papst Franziskus cool und schaffte es trotz der Anspannung, sich auf eine Blitzaktion zu konzentrieren. Er wollte vom ersten Augenblick an, dass sein Anliegen, nämlich die katholische Kirche wieder kompromisslos an die Seite der Armen zu führen, schlagartig der ganzen Welt klar würde. Statt also zu tun, was nahelag, nämlich zunächst auf alle Experimente und Neuerungen zu verzichten, um ja nicht angreifbar zu sein in den ersten Tagen und Stunden, nahm er das Heft des Handelns sofort in die Hand.
Die Revolution begann mit einem Wort: Nein. Der Zeremonienchef Guido Marini kam zu ihm und wollte ihm ein Symbol der päpstlichen Macht geben, die Mozetta, den bis zum Ellbogen hinabreichenden, aus schwerer, karmesinroter Seide gefertigten Kurzmantel, den Johannes Paul II. und Benedikt XVI. nach ihrer Wahl trugen. Franziskus lehnte ab, und in seiner Not versuchte ihm der Zeremonienmeister die samtene, mit Goldbrokat bestickte Stola umzulegen, aber auch das wollte der neu gewählte Papst nicht. No, nein. Das ging eigentlich gar nicht, denn der neue Papst musste die Menge segnen, so war es Tradition. Und das konnte er nur, wenn er die Stola trug. Also versuchte es Marini ein weiteres Mal und erntete ein weiteres Nein.
Was dann auf dem Balkon vor dem Petersdom geschah, wertete der Vatikan als Sensation. Franziskus wandte sich als erster Papst der Geschichte an die Menge, und statt ihnen den päpstlichen Segen zu spenden, bat er sie darum: »Bitte segnet mich!« Erst danach sollte er die Stola anlegen, um die Gläubigen zu segnen. Der Bruch mit der Tradition der in ihren Pomp verliebten Päpste war jetzt unübersehbar. Als der Papst auf den Balkon kam, ohne Mozetta und ohne Stola, hofften die konservativen Kreise im Vatikan, dass es sich nur um einen Zufall gehandelt, dass aus irgendeinem Grund die Mozetta nicht bereitgelegen hatte. Doch dann kam der Abend des Karfreitags, des 29. März 2013, nur 16 Tage nach seiner Wahl zum Papst, und ein weiteres Mal dachten die Konservativen, das sei Zufall. Papst Franziskus stand zum ersten Mal vor dem Kolosseum, um den Kreuzweg zu beten und der Todesstunde Christi zu gedenken. Er schien tief ins Gebet versunken zu sein. Zeremonienchef Guido Marini versuchte mehrmals, ihm den eleganten Mantel umzuhängen, und immer wieder lehnte der Papst das unwirsch ab. Er wollte in der Kälte stehen, wie ein einfacher Pilger, nicht im warmen Mantel.
War das eine Laune? Oder sah er sich anders als seine Vorgänger? Nur einen Tag später, in der Osternacht vom Karsamstag, und wenige Stunden später am Ostersonntag wiederholten sich die beunruhigenden Zeichen. Wusste dieser Papst nicht, dass er als Papst etwas Besonderes war? Statt in eleganten liturgischen Gewändern kam er in einem alten, ausgefransten Priestergewand in den Petersdom. War das ein weiterer Zufall oder aber eine geplante Geste? Befürchtete er nicht, seine neuen Mitarbeiter zu verärgern, deren Mehrheit keine radikalen Veränderungen im Vatikan wollte?
War also dieser Mann aus Argentinien tatsächlich ohne jede Furcht vor dem über 1500 Jahre alten Apparat Vatikan, der fast ausschließlich von Männern aus dem Mittelmeerraum geprägt war, aber nichts mit Männern vom amerikanischen Kontinent zu tun hatte? War es das, was den neuen Papst auszeichnete und was sein Pontifikat so prägen sollte – dass er keine Angst hatte? Er würde nicht wie Benedikt XVI. einen regelrechten Hilfeschrei an die Welt senden, als er in seinem Brief an die Bischöfe im März 2009 eine Atmosphäre des Reißens und Zerreißens beklagt hatte.
Franziskus hatte keine Angst, und genau das war das Thema in diesen ersten Monaten seiner Amtszeit. Das also verband die beiden Montage, er hatte gezeigt, dass er sich nicht einschüchtern ließ. Ganz im Gegenteil. Zweimal hatte Franziskus die Herren im Vatikan brüskiert: am Ostersonntag 2013 und am Samstag, dem 22. Juni 2013, und ganz offensichtlich hatten danach einige Herren der Kurie Gesprächsbedarf gehabt. Ich hatte die Tage herausgefunden, an denen es angefangen hatte. Doch wie weit würden sie gehen?
IV
Zurück an die Front
Das nächste Mal, dass ich von einem organisierten Widerstand gegen den Papst hörte, war an einem seltsamen Abend im Haus der heiligen Martha. Mittlerweile ließ sich nicht mehr übersehen, dass sich etwas in der Kommandozentrale des Vatikans grundlegend geändert hatte. Etwas war passiert, doch ich hatte zunächst keine Ahnung, was das sein konnte. Wohl klangen die Nachrichten, die aus aller Welt im Haus der heiligen Martha eintrafen, immer deprimierender, ließen die Botschafter ihre Köpfe immer tiefer hängen, doch das war es nicht. Auch unter Johannes Paul II. und Benedikt XVI. hatte sich die Krise der Kirche bereits angedeutet. Es musste etwas anderes geschehen sein.
Was es war, das da nicht stimmte, erfuhr ich in besagtem Gästehaus im Juli 2013. Wenige Monate nach der Wahl von Papst Franziskus lud mich ein alter Bekannter in den Speisesaal des Gästehauses ein. Er gehörte zum mittleren Management im Vatikan, also zu der Gruppe Priester, die die Arbeit machen und die gebraucht werden, egal, welcher Papst gerade regiert. Ihre Chefs, die Spitzenmanager, Kardinäle und Bischöfe, ließen einen Großteil der Arbeit von diesen Leuten erledigen. Mein Bekannter wusste, dass er sich nur an eine Regel halten musste, um keinen Ärger zu bekommen: nie den Eindruck erwecken, schlauer oder besser informiert zu sein als der Chef, selbst wenn es stimmte.
Es ist nicht ganz einfach, in das Gästehaus der heiligen Martha zu gelangen, in dem der Papst wohnt. Man braucht eine Einladung. In der Regel holen mich meine Gastgeber am Grenzübergang zum Vatikan, links neben dem Eingang zum Petersdom am Arco delle Campane, ab. Sie müssen nichts weiter tun, als den ziemlich großen Schlüssel zu ihrem Zimmer im Haus der heiligen Martha aus der Tasche zu ziehen, um ihre Gäste über die Grenze in den Vatikan zu holen. Der Weg bis zum Gästehaus ist dann nicht mehr weit, nur einige Hundert Meter, vorbei an dem kleinen Park vor dem Hauptquartier der Gendarmen, wo sich auch das kleine Gefängnis des Vatikans mit zwei Zellen und das Gericht befinden.
Nachdem die Schiebetüren des Hauses der heiligen Martha sich hinter dem Gast geschlossen haben, geht man die Treppen hinunter, an der Rezeption des Hotels vorbei, in die Halle und von dort nach rechts in den Speisesaal. Wir waren früh dran, das Buffet noch gut bestückt. Als Erstes leeren die Gäste meist die Schalen mit Nudeln und diejenigen mit Mozzarella und Tomaten. Der Saal hatte sich schon ziemlich gut gefüllt, als Papst Franziskus in den Raum kam, allein. Er wirkte überhaupt nicht wie die Person, die er war, der Hausherr, der offizielle Herrscher des kleinen Staates. Er huschte in den Speisesaal, als wäre er lediglich einer der Gäste. Ich hatte ihn auf einer Lateinamerikakonferenz in Aparecida in Brasilien 2007 kennengelernt sowie während einer Synode in Rom. Ich erinnere mich, dass Pater Graulich, der die Briefings der Synode leitete, häufiger betonte, dass ihm Kardinal Jorge Mario Bergoglio außer durch sein niedergeschlagenes Wesen kaum aufgefallen sei. Was an Bergoglio so faszinierte, war sein Wandel. Kardinal Bergoglio war ein schmaler, mürrischer Mann, der wie ein Eigenbrötler wirkte, in sich gekehrt, eher übellaunig. Dass dieser Mann sich in einen strahlenden Papst verwandeln könnte, hätte ich nie für möglich gehalten.
Doch Jorge Mario Bergoglio ist ein Mensch mit zwei Gesichtern. Er hat etwas sehr Liebenswürdiges und überhaupt nichts Majestätisches an sich. Auch wenn man es unangemessen finden mag: Tatsache ist, dass fast alle Menschen, die zum ersten Mal auf Papst Franziskus treffen, das Gleiche sagen: »Mann, ist der süß.« Er hat etwas von einem herzlichen Opa, der eigentlich nur überall da helfen will, wo es brennt, und dem man sagen möchte: »Wir schätzen es sehr, dass du uns so unter die Arme greifen willst, aber du musst deine Kräfte einteilen, pass auf dich auf.« Seine beiden Vorgänger habe ich immer mit »Heiliger Vater« angesprochen, wie im Vatikan üblich, doch als ich das zum ersten Mal zu Jorge Mario Bergoglio sagte, antwortete er: »Wie geht es denn, Heiliger Sohn?« Er wirkt nicht herrisch, er befiehlt nicht, dafür bittet er und wirbt eher für das, was er für wichtig hält. Er scheint sich ständig dafür entschuldigen zu wollen, dass er der Papst ist.
Wenn Papst Franziskus durch den Speisesaal geht, schauen ihm die Priester mit einem gewissen Gruseln nach. Sie wissen ganz genau: Das ist der Mann, der von ihnen verlangt, dass sie Garagen mieten, um bei den Ärmsten zu sein, die nicht in die Kathedralen kommen. Das ist der Mann, der will, dass sie in die Slums gehen, dass sie sich um die Gläubigen kümmern wie um schwer Verwundete in einem Feldlazarett, denen nach einer brutalen Schlacht geholfen werden muss. Er nickt dem einen oder anderen zu, während er den Raum durchquert.
Die unnachgiebige Art kann man ihm ansehen, seine Intelligenz und die Erfahrung, die ihn schlau gemacht hat. Alle im Saal wissen: Das ist keiner, den man hereinlegen sollte. Ihn zu hintergehen kann übel enden. Und alle im Saal wissen auch, dass er anders vorgeht als seine Vorgänger. Er lässt die Kongregationen nicht einfach überprüfen, nein, er schickt seine Leute hinein. Sie sollen nicht von außen, sondern von innen berichten, was da vor sich geht, und zwar nur ihm allein.
Der einstige Asket hat im Vatikan einige unbeschwerte Kilo zugelegt. Doch sein Gang ist immer noch watschelnd, seine Plattfüße und sein angeschlagenes Becken machen ihm zu schaffen. Er kommt in ausgelatschten Straßentretern daher, die extravaganten roten Schuhe seines deutschen Vorgängers lehnt er ab. Wenn mich jemand fragte, wie er wirkt, habe ich immer gesagt: Es ist, als ob ein richtig guter Kumpel von Jesus von Nazareth im Vatikan eingezogen wäre.
Damals herrschte noch die Unsitte im Haus der heiligen Martha, dass die Gäste den Papst mit dem Handy fotografierten, sobald er in den Speisesaal kam. Er verbat es sich erst nach einiger Zeit, während des Essens fotografiert oder gefilmt zu werden.
Wir erhoben uns, als der Papst in den Speisesaal kam, dann bedienten wir uns an dem wirklich nicht üppigen Buffet und setzten uns zum Essen. Franziskus setzte sich an diesem Abend mit seinen Vertrauten in eine kaum einsehbare Ecke.
»Was ist eigentlich los im Vatikan?«, fragte ich. »Auch hier im Saal ist die Luft ja fast zum Schneiden.«
»Er hat Fabio über die Klinge springen lassen«, sagte mein Gegenüber im Flüsterton.
»Wer?«
»Der Papst.«
»Was heißt das: über die Klinge springen lassen? Und wer ist Fabio?«, wollte ich wissen.
»Fabio hat zeitweise in der Kongregation der Evangelisierung der Völker gearbeitet und muss jetzt an die Front.« Es war das erste Mal, dass ich dieses Wort im Haus der heiligen Martha während des Pontifikats von Papst Franziskus hörte.
»Was meinst du mit Front?«, fragte ich.
»Was wohl? Er muss aus Rom weg in eine Gemeinde.«
»Aber ich denke, das ist die Aufgabe eines jeden Priesters.«
Er sah mich mit echter Empörung an. Es war unübersehbar, dass ich in ein Wespennest gestochen hatte.
»Ich habe dich nicht eingeladen, damit du mich als Drückeberger beleidigst«, sagte er.
»Entschuldigung. Ich hatte nicht vor …«
Er trank einen Schluck Wasser, dann fuhr er fort: »Schon gut. Du kannst es nicht wissen. Es ist nicht deine Schuld. Also, pass auf: Es gibt im Vatikan einige, relativ wenige Fachleute, die der Papst wirklich braucht. Das sagt er ihnen auch. Sie machen oft einen heiklen Job, versuchen manchmal, verfahrene Situationen, schwierige Dialoge wieder hinzubekommen.«
»Ich glaube, ich kenne so einen«, sagte ich.
»Aber viele, die hier gelandet sind, braucht in Rom in Wirklichkeit kein Mensch. Diese Männer wissen aber, dass das Leben in einer Gemeinde für viele Priester die Hölle sein kann. Mal ganz abgesehen von den Erniedrigungen, die du erlebst, weil jede böswillige Schülerin im Unterricht dich wie einen degenerierten mutmaßlichen Sexualstraftäter behandeln kann, weil sie im Fernsehen mit Berichten über Missbräuche durch Priester bombardiert wurde. Abgesehen davon, dass du in Gotteshäusern Messen liest, in denen, wenn es hochkommt, ein paar schwerhörige Omas sitzen, und du stundenlang in Beichtstühlen sitzt, ohne dass jemals jemand kommt. Abgesehen von all dem: Weißt du, was ich am meisten fürchte an der Front?«
»Ich weiß es nicht. Was denn?«
»Am meisten fürchte ich – was regelmäßig geschieht –, dass ich behandelt werde, als wäre ich als katholischer Priester so etwas wie ein Pausenclown, ein Scharlatan. An der Front machen sie dich zu einem Spinner, wenn du ein katholischer Geistlicher bist, zu einer Art übrig gebliebener Staffage. Weißt du, wie das ist, eine Eheschließung zu zelebrieren, die nur deswegen stattfindet, weil die Braut so gern in einem weißen Kleid in einer Kirche gefeiert werden möchte? Weißt du, was dann in einem solchen Gottesdienst passiert?«
»Nein.«
»Dann steh ich da vor dem Altar, und vor mir stehen Menschen, denen der Glaube an Gott ebenso egal ist wie die Kirche oder ein Priester. Wenn ich dann den alten Wechselgesang ›Erhebet die Herzen!‹ singe, weißt du, was dann zurückkommt? Nichts. Stille. Es ist nicht einmal Bosheit. Sie wissen einfach nicht mehr, dass sie singen müssten, was das eucharistische Hochgebet vorsieht, einfach die Zeile: ›Wir haben sie beim Herrn …‹ Du musst ihren Teil, die für die Gemeinde vorgesehenen Gebete, mitsingen. Alles, was sie dir zu verstehen geben wollen, ist: Komm schon, du komischer Clown in deinen Frauenklamotten. Beeil dich mit deinen abgefahrenen Formeln, die du murmelst. Ein bisschen von deinem Brimborium ist ja ganz nett, aber jetzt reicht es. Das zu spüren zu bekommen, das macht mich fertig. Es gibt das Band nicht mehr, das dich mit den Gläubigen in der Kirche verbinden sollte. Es ist weg. Du bist ihnen zutiefst egal. Aus Höflichkeit muss ich dann zu diesen Hochzeitsessen gehen, und während des Essens wird mich garantiert ein angetrunkener Gast fragen: Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, sind Sie einfach nur schwul oder total verklemmt oder beides? Wenn ich dann nach Hause in das leere Pfarrhaus komme, dann frage ich mich: Was soll das alles eigentlich, und wie willst du die paar Wochen Vertretung überstehen?«
»Und dann?«
»Dann komme ich irgendwann in den Vatikan zurück, und wenn ich an den Schweizergardisten an der Grenze vorbeigehe, weißt du, was dann passiert? Ich habe dann wochenlang abschätzige Blicke, Beschimpfungen und regelrechte Beleidigungen hinter mir, nur weil ich mich als katholischer Priester kleide. Sobald ich an das Tor des Vatikans komme, salutieren junge Soldaten, sie begrüßen mich mit allen Ehren. Sie tun das nicht, obwohl ich als Priester gekleidet bin. Sie tun es, weil ich als Priester gekleidet bin. Wenn ich dann weitergehe und zum Kontrollposten der Gendarmen komme, begrüßen sie mich voll Aufmerksamkeit, gerade weil ich ein Priester bin. Weißt du, was das für mich heißt?«
»Nein.«
»Das heißt: Überall hat die moderne, Gott verachtende Welt gewonnen, die Welt, die sich nicht um die Beichte schert, die eine lebenslange Ehe für lachhaft hält und auf Tinder und Parship Lebensabschnittspartner sucht, die sich über eine Prozession ebenso lustig macht wie über die Verehrung von Heiligen. Diese allmächtige Welt beißt sich an diesem Ort hier, am Vatikan, die Zähne aus, und das sehe ich mit großer Begeisterung. Man sieht es plakativ jeden Morgen. Die Milliarden-Dollar-Tourismusindustrie, die Rom fest im Griff hat, die die Regeln macht und alles kauft, was sich kaufen lässt, die hat im Vatikan keine Chance. Seit Jahrzehnten wollen die multinationalen Reisekonzerne, die über zehn Millionen Menschen pro Jahr in die Peterskirche schicken, durchsetzen, dass der Vatikan endlich damit aufhört, die paar Spinner zu schützen, die morgens in der Kirche den Gottesdienst feiern wollen und damit den Touristikkonzernen das Leben schwer machen. Doch das Business muss etwas tun, was es nicht gewohnt ist: sich unterwerfen.
Das Gleiche gilt am Abend für die boomende Industrie der Kreuzfahrtschiffe. Ihr Problem ist, dass sie Tausende Urlauber von den Schiffen im Hafen von Civitavecchia nach Rom bringen müssen. Das dauert, deswegen wollen sie möglichst lange Öffnungszeiten für den Besuch von Touristen in der Peterskirche. Aber um 17 Uhr ist Schluss. Das ganze Geld und der massive Druck können nichts ausrichten gegen die Priester, die in ihrem ganzen Leben nicht einmal einen Bruchteil der Portokasse dieser Konzerne verdienen. Sie können durchsetzen, dass an einem der großartigsten Orte der Welt die Macht des internationalen Tourismus um Punkt 17 Uhr gebrochen wird, weil dann in der Kirche gebetet wird. Wir, die belächelten Scharlatane, haben hier das Sagen.
Der Mann, den Franziskus jetzt weggeschickt hat, war so einer. Er hatte hier seinen Frieden gefunden. Er machte seinen Job gut, wenn es etwas zu tun gab. Oft schlug er wie viele im Vatikan einfach die Zeit tot. Er ging jeden Tag Fahrrad fahren, liebte Konzerte, er war ein gern gesehener Gast auf den zahlreichen Feiern der Botschaften in Rom. Er war ein guter Schwimmer, und wir sind oft mit ihm ans Meer gefahren. Rom war sein Zuhause, und dann kam der Brief von seinem Bischof. An der Front wird es immer schlimmer. Es gibt immer weniger Kanonenfutter, immer schneller fallen die Priester, werden alkoholabhängig oder sind psychisch kaputt.«
»Hat er nichts getan, um sich gegen den Beschluss des Papstes zu wehren?«
»Natürlich hat er das. Er hat das getan, was alle tun. Er verfügte im Vatikan über ein Netzwerk für solche Fälle. Es gibt Bischöfe und Kardinäle, die wissen, wie schlimm es an der Front wirklich ist. Er hat sich an sie gewendet – und vor 50 Jahren wäre das ganz einfach gewesen. Sobald ein Kardinal aus dem Vatikan einem Bischof da draußen zu verstehen gab, dass sein Mann noch im Vatikan gebraucht werde, schickte der Bischof nur einen Brief zurück und dankte dafür, dass der Mann aus seiner Diözese im Vatikan solche Wertschätzung genieße. Aber das ist ein für alle Mal vorbei. Die Not an der Front ist so groß, dass selbst die zurückhaltenden, schüchternen, eher feigen Bischöfe um jeden Mann kämpfen, auch gegen den Vatikan. Es gibt deshalb nur eine sichere Rettung. Der Papst muss persönlich unterschreiben, dass der Betreffende in Rom gebraucht wird.«
»Und?«
»Er hat es nicht getan, er hat ihn ausgeliefert, hat ihm noch einmal erklärt, dass die Priester an der Front dringend gebraucht würden, und hat ihn in die Hölle geschickt. Er ist in einer Diözese, in der eine Unmenge Missbrauchsfälle aufgedeckt wurden und mit Sicherheit noch weitere aufgedeckt werden, denn das ist ja ein Teil des Horrors der Front.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Jeder von uns, also alle, die in den vergangenen 50 Jahren, nach der 68er-Revolution, in einem Priesterseminar studiert haben, wussten, dass es unter den angehenden Priestern ungeeignete, total verkorkste Typen gab. Als die Zahl der Kandidaten für das Priesteramt drastisch sank, nahmen die Bischöfe über Jahrzehnte einfach jeden, der sich präsentierte, und du weißt doch selber, dass es auch hier im Vatikan eine ganze Reihe von Priestern gibt, die sexuell viel zu gestört, intellektuell zu wirr und im menschlichen Miteinander unerträglich sind. Du weißt doch, von welchen Typen ich rede.«
Wir tauschten ein paar Namen aus. Es gab in der Tat eine längere Liste von Priestern, die im Laufe der Jahre immer tiefer im Vatikan versteckt werden mussten. Diese Priester waren schlicht und einfach sehr auffällig. Viele von ihnen galten als aggressiv, rasteten leicht aus, schienen unter einem total übersteigerten Gerechtigkeitssinn zu leiden oder bekamen ihre Wahnvorstellungen nicht in den Griff. Manche beschimpften aus nichtigen Gründen Touristen auf offener Straße, die sich ihrer Ansicht nach in der Nähe der Peterskirche nicht fromm genug benommen hatten. Manche murmelten bösartige Verse. Hinzu kamen die Kirchenmänner, die in äußerst heftige Eifersuchtsfehden im homosexuellen Spektrum verstrickt waren.
»Verstehst du? Ich begreife durchaus, dass Papst Franziskus meint, unser Platz sei an der Front. Damit hat er ja recht. Aber er schickt uns in einen ungleichen Kampf, in dem wir nur aufgerieben werden können. An deiner Seite sind im Gefecht nur viele dieser verkorksten Typen, von denen wir gerade sprachen. Würdest du dich in einem Krieg auf solche Gefährten verlassen?«
»Ich glaube, ich beginne zu verstehen«, sagte ich.
»Hinzu kommt etwas anderes, Russicum-Effekt nennen wir das im Vatikan.«
»Was meinst du damit?«
»Papst Pius XI. hatte sich in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Kopf gesetzt, in einem eigenen Seminar, dem Russicum an der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom, Priester auszubilden, die im bolschewistischen Russland, der UdSSR, den katholischen Glauben verbreiten sollten. Es war die mörderischste Idee, die je ein Papst hatte, weil ausnahmslos alle Priester, die im Russicum auf ihre Aufgabe in der Sowjetunion vorbereitet wurden, nach der Einreise früher oder später vom KGB aufgespürt und zum Sterben in Arbeitslager, in den Gulag, geschickt wurden. Kein Einziger kam lebend zurück. Wir nennen die Situation an der Front jetzt den Russicum-Effekt, weil Papst Franziskus das Gleiche will: uns in eine Schlacht schicken, die wir nur verlieren können. Die Kirche geht unter, in ein oder zwei Generationen wird sie in Europa, Teilen Amerikas und Ozeaniens keine Rolle mehr spielen. In Asien braucht sie nicht untergehen, da hat sie in Wirklichkeit nie Fuß gefasst. Wir haben schon seit Langem keine Chance mehr. Jetzt kommt es drauf an, am Leben zu bleiben während der Schlacht. Dafür verachtet uns der Papst. Es macht ihm zu schaffen, dass er weiß, dass wir Angst vor der Front haben und dass wir alles tun, um ihr zu entgehen. Aber er schickt jeden ins Feuer, dessen er habhaft werden kann. Für die Italiener ist das besonders dramatisch, denn die verdienen in ihrer Gemeinde noch viel weniger Geld als hier im Vatikan.
Letzte Woche erwischte es George, einen US-Amerikaner, der einen guten Job im Vatikan gemacht hat. Sein Bischof beorderte ihn zurück in die USA, in eine der Diözesen, die ihren Bankrott hatte erklären müssen, weil zwei- oder dreistellige Millionensummen an Hunderte von Opfern sexuellen Missbrauchs gezahlt wurden. Willst du in so eine Diözese, in der es von Priestern wimmelte, die Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchten? Was meinst du, wie die Menschen dich dort ansehen, wenn du als Priester gekleidet auf die Straße gehst? Es gibt Leute dort, die holen ihre Kinder von der Straße und zwingen sie, ins Haus zu kommen, sobald sie einen Priester sehen. Manche der Diözesen sind wegen des Missbrauchsskandals so pleite, dass sie dir nicht einmal mehr das Benzin für eine Fahrt in eine der Kirchen zahlen können, und die Kirchen selber entgingen nur wegen des Eingriffs des Staates der Beschlagnahme. Du wohnst in einer heruntergekommenen Bude, weil die Diözese so bankrott ist, dass sie sich keine vernünftigen Gebäude mehr leisten kann. Oder nimm den Fall von Pater Joe.«
»Was war mit dem?«