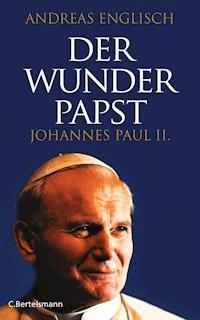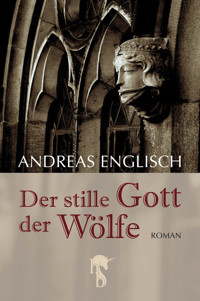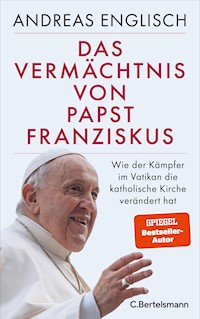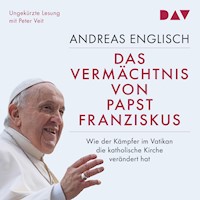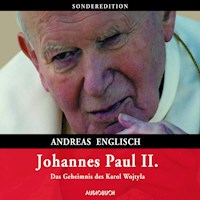16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Andreas Englisch über die verborgenen Orte der Ewigen Stadt
Erneut taucht Andreas Englisch mit seinem Sohn Leo als Begleiter in die Geheimnisse der Ewigen Stadt ein und nimmt uns mit zu ihren verborgenen Winkeln und versteckten Schätzen. Das Vermächtnis einer alten Dame veranlasst die beiden, rätselhafte Orte aufzusuchen, die eines gemeinsam haben: Bis heute sagt man ihnen nach, dass dunkle Mächte dort am Werk waren. Die spannende Recherche durch die Geschichte Roms spannt sich von der frühen Kaiserzeit bis in unsere Gegenwart, immer auf der Suche nach den Mächten der Finsternis und ihren Gegenspielern. Vater und Sohn erforschen unter anderem den Ursprung des Fegefeuers oder den Pakt der Päpste mit dunklen Mächten und gelangen bei ihrer atemlosen Spurensuche zu kaum bekannten Kirchen, Kapellen und Palästen. Ein Lesevergnügen für alle, die Rom einmal ganz anders entdecken möchten.
Durchgängig farbig bebildert und hochwertig ausgestattet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Bestsellerautor Andreas Englisch nimmt uns in seinem neuen Buch mit zu den geheimen Orten und versteckten Schätzen der Ewigen Stadt. Ob in verborgenen Winkeln oder an unvermuteten Orten: Jahrtausendealte Geschichte und faszinierende Geschichten stecken in Rom unter jedem Stein und an unzähligen Ecken. Man muss sie nur zu finden wissen! »Mein geheimes Rom« ist eine fulminant erzählte Geschichte der Heiligen Stadt, in der immer auch um die Zukunft der Kirche und um Gut und Böse gerungen wird. Ein Lesevergnügen für alle, die Rom zum ersten Mal oder noch einmal ganz anders entdecken möchten.
Autor
Andreas Englisch lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Er ist ein gefragter Talkshowgast und Interviewpartner, seine Bücher sind Bestseller und werden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter »Franziskus – Zeichen der Hoffnung« (2013), »Der Kämpfer im Vatikan. Papst Franziskus und sein mutiger Weg« (2015) sowie zuletzt »Der Pakt gegen den Papst. Franziskus und seine Feinde im Vatikan« (2020). In »Mein Rom. Die Geheimnisse der Ewigen Stadt« (2018) führte Andreas Englisch seine Leserinnen und Leser zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt. Auch dieses Buch stand monatelang auf der Bestsellerliste.
Andreas Englisch
Mein geheimes Rom
Die verborgenen Orte
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2021 by Andreas Englisch
© 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Coverfoto: © Musacchio, Ianniello & Pasqualini
Illustrationen: Alessandro Staccini
Gestaltung und Satz: Andrea Mogwitz
Repro: Helio Repro, München
E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-27419-1V004
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Prolog
Tag 1
Clivus Scauri
Santi Giovanni e Paolo
Forno
Santo Stefano Rotondo
Mysterien
Santi Andrea e Gregorio
Tag 2
San Marco
Angriffe
Unterwegs
Santa Cecilia
Santi Vincenzo e Anastasio
Santa Maria Antiqua
Santi Apostoli
Santa Maria Monserrato
Santa Maria in Vallicella
Tag 3
Via Lungara
Villa Farnesina
Palazzo Corsini
Tag 4
Das Böse aus dem Süden
San Clemente
Santi Quattro Coronati
Aracoeli
Bitteres Ende
Tag 5
Santa Francesca Romana
Santa Croce in Gerusalemme
Lateranbasilika
Bars und Romantik
Tag 6
Sacro Cuore del Suffragio
Suche
Palazzo Colonna
Santa Maria sopra Minerva
Tag 7
»Sie ist mir gefolgt«
Epilog
Nachwort
Register
© mauritius images/Bildarchiv Monheim GmbH/Alamy
Prolog
»Wo haben Sie meine Oma hingebracht, und was hat sie dort erlebt? Keine Ausflüchte mehr! Ich muss das jetzt einfach wissen!«
Ich brauchte eine Weile, um die radikale Veränderung dieser attraktiven jungen Frau zu verdauen, die mich jetzt ausgesprochen verärgert anschaute. Wir saßen in einem meiner Lieblingsrestaurants, dem »Da Cesare« an der Via Crescenzio. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie einfach ein Gast meiner Reisegruppe gewesen, zugegebenermaßen ein ungewöhnlicher Gast.
Für den Durchschnitt der Reisegruppe war Lena Steiner viel zu jung; ich schätzte sie auf höchstens Anfang zwanzig, und zudem war sie allein mit uns unterwegs. Es kam durchaus vor, dass junge Damen an meinen Reisegruppen teilnahmen, aber dann begleiteten sie stets ihre Eltern oder Großeltern. Mein Sohn Leo, der mir während der Führungen geholfen hatte, konnte seine uneingeschränkte Begeisterung für die Anwesenheit der einzigen Gleichaltrigen nicht im Mindesten verbergen. Er war in den letzten Tagen so gut wie nie von ihrer Seite gewichen, hatte sich angeboten, ihre Jacke zu tragen, und hatte ihr in einer Art Privatführung ausführlich die Fassade des Pantheons und des Petersdoms erklärt, während ich den Rest der Gruppe betreute. Heute war der letzte Tag, wir saßen zum Abschied zusammen beim Abendessen, und als die blonde junge Frau aufgestanden und zu uns herübergekommen war, hatte ich gesehen, wie meinem Sohn das Herz offensichtlich bis zum Hals schlug. Leo hatte schon angekündigt, dass Lena kurz allein mit uns sprechen wollte, und wir setzten uns ein wenig abseits an einen Tisch. Ich war gespannt.
Sie knetete nervös ihre Hände und sagte dann: »Ich muss mit Ihnen sprechen, weil meine Oma vor ein paar Jahren eine Reise bei Ihnen gebucht hat. Meine Mutter und ich konnten nicht herausfinden, wann genau das war. Es kommen zwei Jahre infrage.«
Lena strich ihr glattes blondes Haar hinter die Ohren und legte ein Foto auf den Tisch. Es zeigte eine ältere Frau mit einem fröhlichen Gesicht und einer Frisur, die meine Mutter als »flotten Kurzhaarschnitt« bezeichnet hätte. Sie trug eine sportliche Regenjacke einer teuren Outdoor-Marke, bequeme Hosen und farbenfrohe Wanderschuhe und sah absolut typisch aus für den Kreis der Kunden, die ich seit Jahren durch Rom führe.
»Erinnern Sie sich an sie?«, fragte die junge Frau.
Ich sah mir das Foto genauer an. In den letzten zehn Jahren hatte ich wahrscheinlich schon mehrere Hundert ältere Damen in meinen Gruppen betreut, mit ihnen an einem Tisch zu Abend gegessen und am Tag danach die Schätze Roms angeschaut.
»Nein, das tut mir leid«, sagte ich. »Ich kann mich nicht an sie erinnern. Aber was ist denn geschehen?«
»Sie ist tot.«
»Das tut mir sehr leid«, antwortete ich.
»Sie starb vor ein paar Monaten, sie war meine Lieblingsoma. Ich habe dann meiner Mutter geholfen, ihr Haus auszuräumen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Dabei haben wir auch eine Schublade gefunden mit ihren persönlichen Sachen, und darin war ein Brief an mich.«
»Was für ein Brief?«, fragte ich.
»Wissen Sie, nach der Reise hierher mit Ihnen hatte sich meine Großmutter sehr verändert. Sie war eine fromme Frau gewesen. Sie mochte den katholischen Gebetskreis, zu dem sie einmal in der Woche ging. Sie half in der Kirche aus und sorgte mit ihren Freundinnen für den Blumenschmuck. Für jedes Pfarrgemeindefest bereitete sie ungeheure Mengen von Kuchen und Salaten zu. Aber als sie aus Rom zurückkam, brach sie mit den besonders frommen Freundinnen, zog sich aus dem Gebetskreis und dem Unterstützerkreis für die Gemeinde und überhaupt von allem zurück, was mit der Kirche zu tun hatte. Sie hat damals auch ihr Testament geändert, sie wollte nicht mehr kirchlich begraben werden, sondern verlangte, dass ihre Asche in einem Friedwald ausgestreut werde. Ich habe das damals gar nicht so genau mitbekommen, denn mir gegenüber veränderte sich meine Großmutter überhaupt nicht. Im Gegenteil: Sie war lieb und warmherzig und gab mir eine Menge Ratschläge. Sie gab mir sogar Tipps, wie ich mit Männern umgehen sollte.«
Ich sah, dass mein Sohn jetzt knallrot wurde, während sich Lena verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wischte.
»Sie hat mit mir nie über diese Veränderungen gesprochen.«
Nun holte die junge Frau einen vergilbten Brief aus ihrer Tasche.
»Das ist der Brief, den ich nach ihrem Tod in ihrem Haus gefunden habe. Sie hat ihn mir im Krankenhaus geschrieben, als es ihr schon sehr schlecht ging. Sie muss ihn an einem der letzten Tage ihres Lebens formuliert haben. Hier steht: ›Sei ein starkes Mädchen! Ich werde von oben immer über dich wachen. Es gibt nur eine Sache, die ich zutiefst bereue. Ich hätte mit dir darüber sprechen sollen, was damals in Rom passiert ist, aber ich habe einfach nicht den Mut dazu gefunden. Ich glaube, ich hätte nicht gewusst, wie ich es in Worte fassen soll. Aber, Lena, ich habe damals das Böse gesehen!‹«
Sie schob mir den Brief hin, sodass ich die mit einer offensichtlich schwachen Hand geschriebenen Zeilen sehen konnte.
»Also?«, fragte die junge Frau mit einer Schärfe, die ich ihr gar nicht zugetraut hätte. »Was hat meine Oma gesehen? Wohin haben Sie sie gebracht? Was haben Sie ihr erzählt? Was kann das sein? Was meinte sie damit, sie habe das Böse gesehen?«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte ich. Ich versuchte mit aller Macht zu verbergen, dass Panik in mir hochschoss. Ich hatte immer geahnt, dass es eines Tages einen solchen Moment geben würde. Es hatte sehr viele Warnzeichen gegeben. Immer wieder hatten Menschen an den Führungen teilgenommen, die erschüttert waren über das, was ich ihnen erzählte. Was ich sagte, war immer ein Drahtseilakt. Es ging um Existenzielles, um Glauben und um Religion, und das konnte Menschen sehr viel nähergehen, als mir bewusst war.
Es hatte mehrfach unangenehme Zwischenfälle gegeben. Eine Frau war vorzeitig abgereist, nachdem ich der Reisegruppe erklärt hatte, dass Jesus nach dem Stand der Forschung vermutlich nie in Bethlehem gewesen war, dass die ganze Weihnachtsgeschichte nichts weiter ist als eine reine Erfindung. Ich weiß noch, dass diese Frau empört aus der Kirche stürmte, in der wir gewesen waren, und mir an den Kopf warf: »Sie glauben wohl an gar nichts, Sie haben nicht einmal Respekt vor Weihnachten.« Ein Mann hatte einmal die Reisegruppe empört verlassen, als ich über die sexuellen Ausschweifungen der Päpste der frühen Renaissance redete. »Dass man Sie überhaupt noch in eine Kirche lässt, verstehe ich nicht«, hatte dieser Mann entrüstet gerufen. Ich hatte erlebt, dass Menschen erschüttert waren, und ich hatte nie gewusst, wie ich damit umgehen sollte. Die große Mehrheit der Gruppen genoss meine flapsige Art, über die Geschichte der Kirche zu reden. Aber es gab auch eine kleine Minderheit, die sich dadurch in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlte, und ich hatte nie wirklich einen Weg gefunden, sie zu schützen. Ich hatte immer wieder mal gewarnt: »Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist nicht sehr katholisch, vielleicht hören Sie einfach weg!« Aber natürlich funktioniert das nicht. Dass ich dadurch einmal ein ernsthaftes Problem haben würde, war mir klar gewesen, und der Moment war jetzt gekommen.
»Es tut mir leid, Lena«, sagte ich. »Ich erinnere mich nicht an Ihre Großmutter. Was kann ich denn für Sie tun?«
»Mir lässt dieses Vermächtnis meiner Oma einfach keine Ruhe. Ich bin nur ihretwegen hierhergekommen. Ich habe extra an dieser Reise teilgenommen, weil ich hören und sehen wollte, was Sie sagen und wohin Sie die Menschen bringen. Aber ich habe nichts gesehen oder gehört, was meine Großmutter derartig hätte schockieren können, dass sie ihr Leben radikal veränderte. Also muss sie etwas erlebt haben, was mir verborgen blieb, und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, was das gewesen sein kann. Machen Sie immer die gleichen Touren? Gehen Sie immer an die gleichen Orte? War ich also überall dort, wo meine Oma auch war?«
»Nein«, sagte ich.
»Warum nicht?«, fragte sie.
»Während dieser Besichtigungen in Rom sind Pausen eingeplant. Die Gäste können dann einfach shoppen gehen oder etwas essen oder sich ausruhen. Aber es kommt immer wieder vor, dass einige Gäste der Gruppe sagen, wir wollen weder shoppen noch ins Hotel zurück, und wir wollen jetzt auch keinen Kaffee, sondern wir würden einfach gerne noch etwas mit Ihnen erleben. Ich nehme sie dann mit, wenn ich privat in den Pausen einfach irgendetwas anschauen gehe. Es könnte gut sein, dass Ihre Oma mit dabei gewesen ist, und dann hat sie etwas gesehen, was Sie in den vergangenen Tagen nicht gesehen haben.«
»Und was war das?«, fragte die junge Frau.
»Das können alle möglichen Orte gewesen sein. Es gibt Hunderte spannender Orte in Rom«, antwortete ich.
»Ach, kommen Sie!«, sagte Lena. »Es gibt doch nicht Hunderte Orte, an denen Ihre Gäste etwas Schockierendes erleben. Wenn meine Großmutter in einer Pause mit Ihnen an irgendeinem Ort in Rom gewesen ist, der sie traumatisiert hat, werden Sie doch wissen, welcher das war.«
Ich atmete tief ein. »Leider nicht«, erwiderte ich.
»Herr Englisch«, sagte Lena und sah aus, als wolle sie mich am liebsten schütteln: »Wo gibt es das Böse in Rom?«
»Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte«, erklärte ich.
Ich sah, dass sie anfing zu weinen: »Ich bin mir ganz sicher, dass meine Oma jetzt da oben ist und dass sie sich wünscht, dass ich herausfinde, was mit ihr passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass es nun meine Pflicht ist zu entdecken, was sie damals so schockiert hat. Und wissen Sie, warum?«
Ich schaute betreten auf meine Schuhe. Das konnte ich allerdings nicht ewig tun.
»Ich glaube, sie wollte, dass ich verhindere, dass so etwas einer frommen Frau, wie sie selber war, noch mal passiert.« Als ich den Blick wieder hob, sah sie mir in die Augen und sagte: »Ich glaube, dass Sie eine Schuld gegenüber meiner Oma haben. Sie haben ihr den Frieden genommen, und ich möchte, dass Sie mir helfen, die Ursache dafür herauszufinden und sie zu beseitigen.«
»Wir werden dir helfen«, sagte plötzlich mein Sohn, »und wir werden diesen Ort finden. Das verspreche ich dir. Wir werden nicht aufgeben, wir werden so lange weitermachen, bis wir diesen Ort entdeckt haben. Vielleicht können wir dann ein klein wenig von dem wiedergutmachen, was mein Vater angerichtet hat.«
»Ich muss morgen nach Florenz. Ich bin auch deswegen in Italien, weil ich in diesem Semester an einem Forschungsprogramm meiner Uni dort teilnehmen muss, aber in fünf Tagen bin ich wieder da und dann …«
Sie ließ die Worte eine Weile in der Luft hängen.
»Wenn du gefunden hast, wonach ich suche, dann lade ich dich zum Essen ein«, sagte sie und deutete auf meinen Sohn, der nicht verhindern konnte, wieder puterrot zu werden.
Tag 1
Der Autor auf einer seiner Lieblingsstraßen in Rom. Nur selten verirren sich Touristen hierher.
© privat
Clivus Scauri
»Es ist völlig aussichtslos«, sagte ich. Wir waren vom Kolosseum mit den Fahrrädern die Via San Giovanni in Laterano hochgeradelt und rechts abgebogen in die Via Celimontana bis zu dem Platz vor dem großen Militärkrankenhaus.
»Du hast es uns eingebrockt, also wirst du es jetzt auch wieder auslöffeln«, sagte Leo.
»Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt«, hielt ich dagegen.
»Selbstverständlich haben wir den. Sie hat gesagt, du hast sie zu dem Bösen geführt. Also, an welchem Ort in Rom redest du über das Böse?«
»Es sind Dutzende.«
»Dann klappern wir sie halt alle ab«, sagte Leo.
Wir fuhren durch den sogenannten Arco di Dolabella, den Dolabella-Bogen. Es ist einer der unglaublichsten Orte Roms. Wie durch Zauberhand führt diese kleine Straße in das Rom der frühen Kaiserzeit, und unter anderen Umständen hätte ich das sicher genossen. Auf dem Bogen lässt sich noch eingeritzt in den Travertinstein die originale Inschrift erkennen, die an Publius Cornelius Dolabella erinnert, der ab dem Jahr 10 in seinem Amt als Konsul diesen Bogen in der Stadtmauer restaurieren ließ.
Es war Mitte Mai, und der Frühling neigte sich dem Ende zu. Auch nach dreißig Jahren in Rom konnte ich nicht aufhören, mich darüber zu wundern, mit welcher Macht die Sonne den nahenden Sommer ankündigte. Wenn das Licht durch die Wolken brach, machte sich schon die Hitze breit, die bald die ganze Stadt einhüllen würde.
Ich sagte zu Leo, der neben mir radelte: »Nehmen wir an, wir würden wirklich den Ort besuchen, der diese alte Dame so beeindruckt hat. Woher sollten wir denn wissen, dass das dieser Ort war?«
»Du wirst dich schon erinnern«, sagte Leo. »Du wirst dich an diese fröhliche Rentnerin erinnern, denn wenn du sie an irgendeinen Ort gebracht hast, um dort über das Böse zu faseln, dann wird sie reagiert haben. Sie wird etwas gesagt haben, sie wird dich etwas gefragt haben. Vielleicht ist sie in Tränen ausgebrochen, was weiß ich. Aber du wirst dich schon erinnern.«
»Und wenn ich mich nicht erinnere?«, fragte ich.
»Du wirst dich erinnern.«
Ich zwang mich die ganze Zeit hinunterzuschlucken, was ich eigentlich sagen wollte, und das war: »Du hast diesem jungen Mädchen doch nur diese Versprechungen gemacht, weil du verknallt in sie bist. Deswegen sind wir hier.«
Aber ich wusste, dass das nicht fair war. Ich hatte ganz offensichtlich dieser alten Frau die letzten Jahre ihres Lebens ruiniert und wollte jetzt selbst herausfinden, wie mir das passieren konnte, damit sich so etwas nicht wiederholte.
Wir rollten durch den Bogen die sanft abfallende Straße hinunter. An der Straße sind noch Inschriften aus der Antike zu erkennen mit ihrem Namen. Sie hieß die Steigung der Familie Scaurus (auf Latein Clivus Scauri). Auf der rechten Seite liegt die wunderschöne Piazza, die an die Reste des Claudiustempels angrenzt und als Vorplatz der Kirche Santi Giovanni e Paolo dient. Dort ketteten wir unsere Fahrräder an einem Laternenmast an.
»Nee, Papa, du hast doch nicht ausgerechnet hier, an der schönsten Straße der Welt, deinen Gästen mit Schauermärchen über das Böse den Kopf verdreht?«, rief Leo.
Natürlich stieg Zorn in mir auf. Es gab keinen Zweifel, dass Leo mich provozieren wollte. Aber ich musste mich schon fragen, ob er recht hatte. Ich hätte meinen Gästen einfach ein paar Zahlen, Fakten und Daten nennen können. Wir setzten uns auf eine Bank vor der Kirche. »Du kannst die Stadt Rom ohne das Böse überhaupt nicht verstehen«, sagte ich trotzig.
Der Glockenturm der Kirche Santi Giovanni e Paolo steht auf den Grundmauern des Tempels des Kaisers Claudius, den seine Frau Agrippina vergiftet haben soll.
© Shutterstock/Valery Rokhin;
»Natürlich nicht. Huuuh«, grinste mein Sohn und ahmte ein Monster nach.
»Nein, jetzt mal im Ernst«, sagte ich. »Auch ich war vollkommen überrascht, als ich nach Rom kam. Ich hatte in Deutschland gelernt, dass die Welt aus konkurrierenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen besteht, aber zu kompliziert ist, um sie in Gut und Böse einzuteilen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mit einem Priester im Vatikan zum ersten Mal über das Böse redete. Ich sagte ungefähr das Gleiche, was du auch gesagt hast: Das Böse ist einfach Blödsinn. Weißt du, was er mir geantwortet hat? ›Haben Sie vergessen, was Gottes Sohn die Christen gelehrt hat und was wir seit zweitausend Jahren im Vaterunser beten? Wir beten: Erlöse uns von dem Bösen! Es gehört also zu den vordringlichsten Aufgaben Gottes, die Menschen vor der Bedrohung durch das Böse zu warnen. Die Zeile macht uns Christen klar: Daran, dass das Böse überhaupt existiert, gibt es keinerlei Zweifel. Gott ist gezwungen, seinen eigenen Sohn zu opfern, um das Böse zu besiegen.‹ Der Priester erklärte mir weiter: ›Wir wissen auch, wen oder was das Böse vor allem angreifen wird, den Vatikan, das Hauptquartier der von Christus gegründeten Kirche, und über diese heißt es im Matthäus-Evangelium: Et portae inferi non praevalebunt adversas eam – Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.‹«
»Ja, Papa, das ist Priestersprache, aber wir suchen nach Lenas Oma und dem, was sie erlebt hat«, sagte Leo.
»Wir werden diese Frau nicht finden, wenn wir uns nicht fragen, wieso das Böse ihr etwas bedeutet hat. Schau dir eine andere europäische Hauptstadt an, Paris oder meinetwegen London. Du wirst in beiden Städten Zeichen des Sieges sehen: den Arc de Triomphe in Paris, den Trafalgar Square in London. Auch in Rom gibt es zahlreiche Orte, an denen Siege gefeiert werden, aber es waren nie die Siege eines Papstes oder des italienischen Königreichs. Es ging um die Siege des Guten über das Böse. Die Päpste sind seit fast zweitausend Jahren davon überzeugt, dass Rom das Schlachtfeld der guten und der bösen Geister ist. Die Päpste nennen sich Vikare Jesu Christi, Stellvertreter Gottes auf Erden. Sie sehen sich als Kriegsherren gegen die Angriffe des Bösen auf die Welt. Was sieht du, wenn du in Rom zum Kapitol hinaufsteigst?«
»Die Statuen der Dioskuren«, sagte Leo.
»Volle Punktzahl! Aber wer sind die Dioskuren?«, fragte ich.
»Castor und Pollux, zwei Götter.«
»Und warum stehen die da, am wichtigsten Punkt der Stadt? Sie eilen den römischen Truppen zu Hilfe im Kriege gegen die Latiner, und die Römer gewinnen wie durch ein Wunder. Also schon die erste Entscheidungsschlacht der Stadt Rom wird durch die Hilfe zweier Götter entschieden. Und später retten Petrus und Paulus mit Schwertern und himmlischen Heerscharen diese Stadt vor dem Bösen. Verstehst du? Diese Stadt kann man nicht verstehen, wenn man das Böse nicht erzählt. In Paris kannst du sehen, dass die Siege Napoleons mit einer überlegenen Artillerie erfochten wurden, in London wirst du sehen, wie die Zeichen der Überlegenheit der britischen Seemacht zelebriert werden, aber in Rom kämpft Gott gegen einen Feind – und der steht immer mit dem Teufel im Bunde.«
»Das klingt mittelalterlich«, sagte Leo.
»Nein. Alle meine Besucher wollen auch heute noch so viel wie möglich darüber erfahren. Als ich anfing, als Korrespondent in Rom zu arbeiten, gehörte es zu meinem Job zuzuhören, wenn ein Papst über das Gute oder das Böse sprach. Johannes Paul II. war sich sicher, dass das Böse versucht hatte, ihm am 13. Mai 1981 durch das Attentat das Leben zu nehmen. Er glaubte nicht, dass es der Attentäter Ali Ağca war oder dass die Sowjetunion dahintersteckte. Er war davon überzeugt, dass es das ›Reich des Bösen‹ war. US-Präsident Ronald Reagan übernahm dann diese Formulierung und sprach 1983 vom »Evil Empire«, dem Reich des Bösen, dasWojtyła so oft beschworen hatte. Aber auch Papst Franziskus ist von der physischen Existenz des Teufels überzeugt und spricht über das Böse.«
»Und was hat das alles mit diesem Ort hier zu tun?«, fragte Leo.
»Aus der Sicht der Päpste kommt das Böse hierher. Dieser Ort spielt eine zentrale Rolle im ersten großen Krieg des Guten gegen das Böse. Im August des Jahres 410 wird Rom von Alarichs Truppen belagert. Alarich, der König der Westgoten, wartet vor den Toren der Stadt, da, wo der Fluss Anione in den Tiber fließt.«
»Ist das nicht da oben an der Via Salaria im Industriegebiet?«, fragte Leo.
»Genau da. Laut der Legende betrat ein Mann am Abend Alarichs Lager und ging unbehelligt an allen Wachen vorbei bis zum Zelt des Heerführers. Was dann geschah, schilderte Alarich später einem Mönch. Er sagte: ›Ein Dämon kam in mein Lager. Er befahl mir, Rom zu zerstören. Ich konnte nichts tun, ich musste gehorchen, obwohl ich wusste, dass der Dämon sich danach gegen mich wenden würde.‹ Diese Geschichte verbreitete sich unter anderem deshalb so erfolgreich, weil Alarich tatsächlich kurz nach der Plünderung Roms starb, als hätte ihn ein Fluch getroffen.«
»Und was hat jetzt dieser Ort mit dem Angriff zu tun?«, fragte Leo.
»Komm«, sagte ich. »Schau es dir an!«
Santi Giovanni e Paolo
Wir verließen den Platz und gingen die absteigende Straße parallel zu den Mauern der Kirche Santi Giovanni e Paolo hinunter. Hier kann man deutlich die vielen Stützmauern sehen, die offensichtlich nötig geworden waren, um die den Heiligen Johannes und Paulus geweihte Kirche vor dem Einsturz zu bewahren.
Die Kirche Santi Giovanni e Paolo liegt in einer verzauberten Idylle und dennoch im Zentrum von Rom, nicht weit vom Kolosseum entfernt.
© Shutterstock/LianeM
»Die Westgoten wagen es tatsächlich, Rom anzugreifen und plündern die Stadt. Weil sie selbst Christen sind, verschonen sie die Kirchen – bis auf diese hier. Siehst du die Stützpfeiler? Sie werden nötig, nachdem Alarich sie angegriffen hatte. Seit über 1500 Jahren schwören die Römer, dass das Böse diesen Ort hier zerstören wollte. Der Dämon soll den Angriff selbst befehligt haben, weil er etwas suchte.«
»Weil er etwas suchte?«, fragte Leo.
»Ja. Es gab einen Pater, einen gewissen Vincenzo Ruoppolo, der unter dem Ordensnamen Germano di San Stanislao bekannt wurde. Er hatte keinen Zweifel daran, dass unter diesem Kloster etwas sein musste, das der Dämon hatte zerstören wollen. Er gab nicht auf. Dieser Pater, der zum Orden der Passionisten gehörte, kam hierher in dieses Kloster. Er war in gewisser Weise ein Fachmann für das Böse, er diente dem Papst als Exorzist und bekämpfte den Dämon, der seine Schutzbefohlene Gemma Galgani angriff.«
»Moment mal. Ganz langsam. Was für ein Pater? Was für ein Dämon? Was für eine Schutzbefohlene? Wovon redest du?«
Gemma und das Böse
Wir gingen langsam den Clivus Scauri hinunter. An den Rändern der Straße waren noch die Reste der antiken römischen Läden zu erkennen. »Im Jahr 1878 wird im toskanischen Lucca ein Mädchen geboren. Sie heißt Gemma Galgani, und sie stammt aus einer ausgesprochen armen Familie. Über ihre Kindheit gibt es eine weitverbreitete Geschichte. Ihr Großvater war dagegen, dass die Mutter sie Gemma nannte. Denn es gebe gar keine Heilige mit diesem Namen. Der Priester in Lucca soll ihm geantwortet haben, dann werde sie halt die erste Heilige mit dem Namen Gemma im Paradies. Mit nur einundzwanzig Jahren ist sie bereits Vollwaise und lebt in äußerster Armut, häufig in vollkommen leeren Zimmern. Sie hat nicht einmal ein Bett. Lebensmittel muss sie erbetteln, und plötzlich erklärt das ungewöhnlich schöne Mädchen immer wieder, Visionen zu erleben. Niemand in ihrer Umgebung glaubt ihr. Schließlich will sie in einer Vision Jesus gesehen haben, der ihr einen weißhaarigen Pater empfahl. Es ist Vincenzo Ruoppolo. Die beiden treten in engen Kontakt, und sie berichtet ihm von ihren Visionen und von Angriffen des Teufels. Der Pater glaubt ihr und beschließt, ihre Biografie aufzuschreiben. Sie berichtet davon, Blut geschwitzt zu haben, vom Teufel gegeißelt und bespuckt worden zu sein, und schließlich will sie, wie der heilige Franziskus, die Stigmata der Passion Christi an Händen und Füßen erlitten haben.«
»Eine Irre?«, fragte Leo.
Die heilige Gemma Galgani. Sah sie wirklich Engel, oder betrog sie die Päpste mit selbst beigebrachten Wundmalen Christi?
© mauritius images/History and Art Collection/Alamy
»Ich glaube, das haben viele gedacht. Gleich zwei wichtige Kirchenmänner, Monsignore Giovanni Volpe und Monsignore Pietro Pfanner, klagen sie an, eine Betrügerin zu sein. Die angeblichen Stigmata seien nur ein Zeichen ihrer Hysterie. Die Kirchenmänner glauben etwas Naheliegendes: Das Mädchen aus ärmsten Verhältnissen soll sich eine Menge spiritueller Ereignisse ausgedacht haben, um sich wichtig zu machen und in Klöstern als eine Art religiöser Star versorgt zu werden, um nicht mehr hungern zu müssen. Aber dann passiert etwas Überraschendes. Alle kirchlichen Verfahren gegen sie wegen Betrugs verkehren sich in das Gegenteil. Die Kirche erkennt die Wunder an. Sogar die Erscheinungen der Engel, die sie gehabt haben will. Eine der eigenartigsten Erscheinungen hat mit diesem Pater Vincenzo Ruoppolo zu tun. Das Mädchen hat dem Pater berichtet, dass sie Engel sehe. Sie fürchtet aber, dass diese Erscheinungen in Wirklichkeit Erscheinungen des Teufels sind. Der Pater gibt ihr einen Tipp: Sie solle den Engel anspucken. Das macht sie auch, und daraufhin will sie an der Stelle, an der der Engel stand, eine weiße Rose gesehen haben. Gemma stirbt mit nur fünfundzwanzig Jahren im Jahr 1903, knapp dreißig Jahre später spricht Papst Pius XI. sie selig, und im Jahr 1940 spricht Papst Pius XII. sie heilig.«
»Die sind auf eine Verrückte hereingefallen«, meinte Leo. Wir schauten diese einzigartige Straße hinunter, die seit zweitausend Jahren nahezu vollkommen unverändert ist.
»Möglich. Auf jeden Fall muss sie gegenüber Männern, die für sie eine eindeutige Autorität dargestellt haben, sehr überzeugend gelogen haben. Der Pater wurde mit der Biografie des Mädchens richtig berühmt, vor allem, weil er einige durch ein Feuer beschädigte Seiten seiner Aufzeichnungen zeigte und behauptete, ein Dämon habe sie angezündet, um die Verbreitung der Geschichte der Heiligen zu verhindern.«
»Das heißt: Auch der Pater, der sicher war, dass das Böse hier unter der Kirche waltet, war ein Verrückter?«, fragte Leo.
»Vielleicht. Aber das Unglaubliche ist, dass er recht behält. Pater Vincenzo Ruoppolo suchte immer weiter unter der Kirche nach dem, was das Böse angeblich zerstören wollte, und er findet tatsächlich einen unglaublichen Schatz.«
»Ach, komm!«, feixte Leo.
»Ja, es ist einer der wichtigsten archäologischen Funde in Rom im ausgehenden 19. Jahrhundert. Unter der Kirche entdeckte Gemmas Beichtvater ein riesiges Wohnhaus, mit dessen Bau bereits etwa 110 vor Christus begonnen worden war, und darin das mutmaßliche Grab der beiden Heiligen Johannes und Paulus.«
»Johannes der Täufer und Paulus der Apostel?«, fragte Leo.
»Nein. Diese beiden, Johannes und Paulus, sollen zwei römische Soldaten gewesen sein. Angeblich arbeiteten sie beide für Constantia, die Tochter Konstantins. Als Julian, ein Verwandter von Constantia, Kaiser wurde, soll er befohlen haben, dass die beiden Soldaten hingerichtet werden, weil sie sich zum Christentum bekannten. Das ist ziemlich unglaubwürdig, weil es keinerlei Beweise dafür gibt, dass es um das Jahr 361 unter Kaiser Julian tatsächlich eine Christenverfolgung gegeben hat. Es heißt, die beiden seien enthauptet und in ihrem Wohnhaus begraben worden. Doch das ist angesichts des totalen Verbots, Tote innerhalb der Stadt Roms zu begraben, sehr unwahrscheinlich. Aber komm, lass es uns anschauen! Denn dank der Hartnäckigkeit dieses Paters kann man heute dieses unglaubliche römische Haus sehen«, sagte ich.
Ein Kleinod unter Rom
Der Eingang zu den sogenannten Case al Celio, den römischen Wohnhäusern unter der Kirche Santi Giovanni e Paolo, liegt direkt am Clivus Scauri. Es scheint, als würde man in den Keller unter der Kirche gehen. Heute ist es unglaublich, dass nahezu zweitausend Jahre verstreichen mussten, bis die antiken Häuser entdeckt wurden. Diese sagenhafte Schatztruhe war nur durch eine einzige Mauer von einer nie verschütteten Straße getrennt.
Ich löste zwei Tickets.
»Mir ist beim besten Willen nicht danach, jetzt eine Besichtigung zu machen«, sagte Leo. »Du vergisst, weshalb wir hier sind.«
»Wenn ich mit ihr hier war, dann war ich mit ihr auch da drin.«
Leo folgte mir schweigend, und wir reisten mit ein paar Schritten zurück in die Zeit des antiken Rom.
»Diese Gegend hier, der sogenannte Clivus Scauri, war schon zur Zeit von Julius Caesar dicht bewohnt. Der Ursprung dieses Baus waren einfache Ladenlokale, hinter denen später ein großes Mietshaus gebaut wurde. Ein sehr reicher Senator, der Byzantius geheißen haben soll, kaufte im 4. Jahrhundert den ganzen Komplex und baute die einzelnen Gebäudeteile zu einer einzigen großen Villa um. Du kannst noch die Pflastersteine der Straße sehen, die einmal zwischen den Gebäudeteilen hindurchführten. Byzantius ließ diese Straße und den ehemaligen Innenhof zu einer großen Thermenanlage umbauen«, erklärte ich.
»Schick, ein beheizter überdachter Pool mitten in Rom«, sagte Leo.
»Ja, der Mann muss sehr reich gewesen sein. Sein Sohn, ein gewisser Pammachius, soll schließlich das Wohnhaus in eine Art Kirche umgebaut haben, wahrscheinlich eine der ältesten der Stadt Rom. Dieser Pammachius war deswegen ein berühmter Mann, weil er Sprecher der christlichen Fraktion im Senat gewesen sein soll und einen berühmten Briefpartner hatte, nämlich den heiligen Hieronymus.«
Wir spazierten jetzt durch die Ausgrabungen der Villa.
»Das ist doch der Typ, der die Bibel ins Lateinische übersetzt hat, oder?«
»Genau. Hieronymus zog angeblich einem Löwen einen Dorn aus der Tatze, und der blieb daraufhin lammfromm immer sein Begleiter.«
»Kenn ich, hab ich schon oft gesehen«, sagte Leo.
Wir standen jetzt vor dem Fresko einer Frau, die ihre Hände zum Gebet hob.
»Wer ist das?«, fragte Leo.
»Keine Ahnung, das weiß wohl niemand. Aber es ist eine Frau, und sie betet. Die Frage ist: zu wem? Das uralte und so gut erhaltene Fresko gibt ein Rätsel auf. Es wurde in einem christlichen Haus an eine Wand gemalt, aber ob diese Frau eine Christin ist, woran diese ersten Christen genau glaubten, zu wem sie wirklich beteten, ist ein Rätsel. Es gibt keine klar erkennbaren christlichen Symbole auf diesem Fresko. Gehörte sie einer Sekte an? Was für eine Sekte mag das gewesen sein? Wir wissen es nicht. Welchen Gott mag sie angerufen haben? Wir werden es wohl nie erfahren.«
Wir spazierten durch die Räume, und Leo entdeckte schließlich das wunderschöne Fresko der Badenden. »Und diesen unglaublichen Schatz hat der verrückte Pater entdeckt?«, fragte er.
»Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, dass er verrückt war. Immerhin hat er recht behalten. Es gab unter dieser Kirche tatsächlich etwas absolut Einzigartiges, und der Exorzist hat es gefunden«, sagte ich.
Fast zwei Jahrtausende schlummerte dieser Schatz, die wundervollen Dekorationen eines römischen Hauses, im Untergrund der Kirche Santi Giovanni e Paolo.
© Krinaphoto/Cristina Annibali. Per la riproduzione fotografica effettuata nella Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo al Celio di Roma si ringrazia la Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, in qualità di Soggetto proprietario .
Christen und Extremisten
»Das stimmt, aber es ist doch Blödsinn, dass hier unten zwei gute Märtyrer verbuddelt wurden und das Böse in Form von Alarich deswegen diese Kirche zerstören wollte«, nörgelte Leo. »Alles, was du sagst, läuft immer auf das Gleiche hinaus: Das Böse will in gruseliger Weise die Christen angreifen. Aber das ist doch Schwachsinn. Du teilst die Welt ein in die Guten – das sind die Christen – und die Bösen – das sind alle anderen. Was hätten die Ureinwohner Lateinamerikas dazu gesagt, die zu Hunderttausenden von den christlichen Eroberern niedergemacht und versklavt wurden? Die hätten im entstehenden Christentum das Böse gesehen und in dem Dämon, der hier gewesen sein soll, eher einen Engel, der gegen eine entstehende, später weltweit vernetzte, mörderische Organisation vorgeht. Du weißt genau, dass die frühen Christen so etwas wie die Taliban Afghanistans waren, ausgesprochene Extremisten. Bei dem Streit um die Frage, ob Maria die Gottesmutter war, kam es in Ephesus zu bewaffneten Auseinandersetzungen in einer Kirche. Es war eine Extremistenbande, die denen unter ihnen nicht verziehen, die ihr Leben retten wollten. Die ersten Christen gingen gegen all jene vor, die sich nicht hatten ermorden lassen, sondern dem Kaiser huldigten, um ihr Leben zu retten. Sie wurden, weil sie am Leben bleiben wollten, wie Verräter behandelt. Also hör mit dem Quatsch auf, dass die Christen das reine Gute waren«, meckerte Leo.
»Das habe ich nie gesagt und auch nie sagen wollen. Ich habe nur gesagt, dass es unmöglich ist, den Clivus Scauri zu verstehen ohne die Idee des Bösen. Hier befand sich das Haus eines sehr berühmten Mannes, Quintus Aurelius Symmachus. Er starb kurz vor der Eroberung Roms durch Alarich, wahrscheinlich im Jahr 402. Er war ein Mann, der für seine religiöse Toleranz in diesen schwierigen Zeiten berühmt war und die Christen ermahnte, dass sie aufhören sollten, alle Menschen zum Glauben an ihren Gott zwingen zu wollen. Du hast ja recht damit, dass es unter den ersten Christen ausgesprochene Fanatiker und Extremisten gab, die Mord und Totschlag als Beweis für Glaubensstärke forderten. Ich werde diese Worte des Symmachus nie vergessen. Er schrieb: ›Zu denselben Sternen blicken wir empor, der Himmel ist uns gemeinsam. Auf einem Weg allein kann man nicht ein so erhabenes Mysterium erkennen. Lasst mich nach meiner Tradition leben, da ich frei geboren bin.‹ Er bittet die Christen um Religionsfreiheit und ist seiner Zeit weit voraus, weil er weiß, dass es den Christen nicht um religiöse Toleranz geht, sondern um Bekehrung. Hier am Clivus Scauri tobte deswegen über Jahrhunderte der Kampf des Guten gegen das Böse, wobei es genau so ist, wie du sagst. Keineswegs waren die Christen immer auf der Seite des Guten. Die Christen sind vom Bösen fasziniert. Sie stellen es immer wieder dar, in allen möglichen Formen der Kunst. Das Böse ist zwingend notwendig, es ist der Ritterschlag für das Gute in der frühen Kirche. Alarich ist für die Päpste das Böse. Sie stellen ihn als wilden Barbarenkönig dar, aber das ist Unsinn. Er war ein römischer Offizier und hatte sein ganzes Leben in der römischen Armee gedient. Er kannte die Art der Römer zu kämpfen in- und auswendig. Als Anführer der westgotischen Hilfstruppen der Römer hatte er immer wieder erlebt, dass seine Leute im Gefecht verheizt wurden. Die Römer setzten für besonders gefährliche Kämpfe vorzugsweise Hilfstruppen ein. Alarich war ein loyaler Soldat und glaubte lange an die Versprechungen Roms, seinem Volk Land zu geben, doch er wurde immer wieder getäuscht. Obwohl es viel zu riskant scheint, greift er Rom an«, sagte ich.
»Warum zu riskant?«, fragte Leo.
»Seine Truppen hatten noch nie länger eine große Stadt belagert, geschweige denn die Hauptstadt der Welt, Rom. Seitdem der Kelte Brennus mit seinen Senonen im Jahr 387 vor Christus Rom geplündert hatte, hatte nie wieder jemand gewagt, Rom anzugreifen. Der Plan der Belagerung und Plünderung schien ein aberwitziges Unterfangen zu sein. Trotzdem griff Alarich an, und die Päpste sahen dann den Dämon dahinter, der Alarich zu dem Angriff zwang. Der Ort hier galt ohnehin als von Dämonen bewohnt. Denn Agrippina die Jüngere ließ hier einen Tempel für ihren Ehemann und Onkel, den Kaiser Claudius, bauen, den sie vergiftet hatte. Das römische Gesetz musste extra geändert werden, um die Hochzeit zwischen Nichte und Onkel zu ermöglichen. Sie tötete anschließend ihren Mann, damit ihr Sohn Nero Kaiser werden konnte. Die Frau ist heute weltberühmt, weil ihr zu Ehren die Colonia Claudia Ara Agrippinensium gegründet wurde. Damit wurde aus einem einfachen Heerlager, einem Oppidum, eine Colonia, die Vorstufe zu einer Stadt, in der vor allem Veteranen der römischen Armee lebten. Aus dieser Colonia entwickelte sich die Stadt Köln.«
»Kannst du mir erklären, warum sich kaum mal ein Tourist hierherverirrt, wenn dieser Ort so faszinierend ist?«, fragte Leo.
»Das verstehe ich selbst nicht.«
Die Linie 3
Wir spazierten durch die Ausgrabungen des antiken Hauses. Da die Fresken so gut erhalten sind, scheint es, als könnten die Hausherren jederzeit zurückkommen.
»Wie bist du denn zum ersten Mal hierher zum Clivus Scauri gekommen?«, erkundigte sich Leo.
»Oh, das hatte mit meinem Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie 3 zu tun. Ich glaube, es war einer meiner ersten Arbeitstage, nachdem ich ans Kolosseum gezogen war. Es muss im April 1988 gewesen sein. Ich kam mit meiner Vespa aus der Via San Giovanni in Laterano und wollte in die Via dei Fori Imperiali einbiegen, um in das Büro an der Spanischen Treppe zu fahren. Die Straße war damals noch keine Fußgängerzone. Ich habe zwar auf die Autos geachtet, aber ich hatte noch nicht verinnerlicht, dass ja auch die Linie 3 von links kommen konnte, und knallte gegen den Waggon.«
»Du bist unter die Straßenbahn geraten?«, fragte Leo.
»Nein. Ich bin dagegengeprallt wie ein Tischtennisball gegen eine Wand. Zum Glück bin ich nur umgekippt, mir ist überhaupt nichts passiert. Ich hatte aber vermutlich als Einziger in der ganzen Stadt damals einen Helm auf, weil ich nicht wusste, dass es in Italien gar keine Helmpflicht gab, wenn man eine Vespa mit fünfzig Kubikzentimetern fuhr. Dann habe ich mich hochgerappelt und hatte erst mal Angst.«
»Angst? Wovor?«
»Leo, die Welt war damals anders als die Welt, die du kennst. Ich fürchtete, dass jemand meine Papiere sehen wollte. Ich hatte noch keine Aufenthaltsgenehmigung in Italien und deshalb auch keine Arbeitserlaubnis. Im Grunde war ich illegal dort, weil man nur sechs Wochen in Italien bleiben durfte, dann musste man ausreisen.«
»Unvorstellbar«, sagte Leo.
»Ja, ich weiß, ihr könnt heute in Paris oder Lissabon oder Budapest oder Wien einfach arbeiten, aber das haben Menschen für euch erkämpft, es ist nicht vom Himmel gefallen. Ich fürchtete, dass die Polizei meine Papiere kontrollieren würde und ich meinen Job verlieren könnte. Zumal ich ja schlecht verbergen konnte, dass ich Ausländer war: Mein Italienisch war grottenschlecht. Aber das Gegenteil passierte.«
»Wieso?«, fragte Leo, während wir durch das Labyrinth der Gänge streiften.
»Alle, die in der Straßenbahn gesessen hatten, standen auf einmal um mich herum. Sie wollten mir hochhelfen, schauten nach, ob die Vespa noch funktionierte, fragten mich, ob ich ein Krankenhaus brauchte. Sie gaben mir eine Unmenge guter Ratschläge, waren total interessiert daran, dass ich als Deutscher in Rom arbeitete, boten mir alle möglichen Hilfen an. Ich erinnere mich, dass eine Frau mir ein Glas Wasser und einen Kaffee brachte. Ich habe mich die ganze Zeit entschuldigt und gesagt: Ich habe einfach die Straßenbahn nicht gesehen. Dann kam der Fahrer der Straßenbahn zu mir, und ich fürchtete, dass er jetzt die Polizei rufen würde. Stattdessen drückte er mir ein Ticket in die Hand und sagte: ›Du solltest wirklich wissen, wenn du hier an der Ecke wohnst, aus welcher Richtung die Straßenbahn kommt. Also bitte, wenn du das nächste Mal Zeit hast, setz dich in die Linie 3 und fahr die Strecke einfach mal ab.‹ Ich konnte es nicht fassen, dass er mich gar nicht anzeigen wollte und so nett zu mir war. Ich habe mich dann bei allen bedankt. Die Passagiere sind, ohne über die Verzögerung zu schimpfen, in die Straßenbahn gestiegen, und ich bin erleichtert ins Büro gefahren. Es war auch das erste Mal, dass mir klar wurde, wie wahnsinnig zuverlässig und robust die Vespa war. Sie fuhr einwandfrei, obwohl wir ziemlich über die Straße geschlittert waren. Ein paar Tage später bin ich dann in die Linie 3 gestiegen. Schließlich hatte ich das ja versprochen. Ich bin zum Bahnhof Trastevere gefahren, wo die Linie 3 abfährt, und zockelte durch die Stadt. Es war fantastisch. Ich sah die Stadt vorbeigleiten, aber trotzdem hatte es nicht das Geringste mit einer Stadtrundfahrt in einem Touristenbus zu tun. Denn in der Straßenbahn saßen ganz normale Leute. Sie fuhren mit dem Einkauf nach Hause, brachten ihre Kinder in die Schule, wollten irgendjemanden besuchen. Aber eines einte alle, die in der Linie 3 saßen: Die Leute hatten Zeit. Wer in Rom schnell irgendwohin kommen will, würde niemals die 3 nehmen, weil sie viel zu langsam ist. Ich erinnere mich an viele Frauen und Männer, die in der Straßenbahn einfach genüsslich Zeitung lasen. Es gab andere, die sich intensiv unterhielten. Sie hatten genug Zeit, um sich für andere zu interessieren. Ich erinnere mich, dass ich mehrfach angesprochen wurde, woher ich denn käme, was ich in Rom so machte. Aber der Zauber des Clivus Scauri hat, glaube ich, mit dem Kontrast zu tun.«
»Was für ein Kontrast?«
Stützpfeiler gegen den Anführer der Westgoten Alarich. Als er zum Entsetzen der christlichen Welt Rom plünderte, drohte danach die Kirche Santi Giovanni e Paolo einzustürzen.
© Shutterstock/Stefano_Valeri
In die Zauberwelt
»Nun ja, die Linie 3 hält vor der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Rom sieht dort so aus wie Washington oder Hamburg oder irgendeine andere große moderne Stadt, und dann fährt sie am Circus Maximus vorbei und taucht plötzlich in eine ganz andere Welt ein. Sie keucht diesen Hügel hinauf. Es ist, als wärst du plötzlich in einem Fantasiepark. Du siehst traumhafte Gebäude, die wie aus dem Nichts auftauchen. Du weißt aber, dass du mitten im Stadtzentrum von Rom bist, und wenn du diesen Zauberhügel verlassen hast, rollt die Bahn hinunter ins Tal des Kolosseums, und du kannst einfach nicht verstehen, dass so nah an einer der wichtigsten Touristenattraktionen der Welt ein verlassener Zauberhügel liegen kann. Das nächste Mal, als ich die Straßenbahn genommen habe, bin ich am Clivus Scauri ausgestiegen. Erst da kapierte ich, dass der Clivus Scauri die einzige Straße auf der ganzen Welt ist, die seit der Zeit der römischen Republik nahezu unverändert blieb. Man kann wie in einer Zeitmaschine vom Kolosseum aus in wenigen Minuten den Hügel hinaufsteigen und dann über die gleiche Straße gehen, die Kleopatra während ihrer Jahre in Rom genutzt hat, ebenso wie ihr Mann Caesar oder später Kaiser Augustus. Der reiche Patrizier Marcus Aemilius Scaurus der Ältere soll sie im Jahr 109 vor Christus haben bauen lassen. Noch heute säumen die über zweitausend Jahre alten Häuser der Patrizier diese Straße, und noch immer kann man die Läden erkennen, die hier ihre Waren anboten. Auch die gewaltigen Reste des Tempels des vergöttlichten Claudius sind noch gut zu sehen.«
Wir verließen die Ausgrabungen. »Es gibt übrigens noch einen anderen faszinierenden Ort des Bösen: Santo Stefano. Es kann sein, dass ich dort mit ihr gewesen bin. Lass uns rübergehen! Vielleicht kann ich mich da an die Dame erinnern«, sagte ich.
»Nein.« Leo schüttelte den Kopf. »Ich möchte dir, bevor wir da reingehen, etwas sagen.«
»Schieß los!«, forderte ich ihn auf.
»Nicht hier«, antwortete er. »Wie wäre es mit einem Forno?«
»Okay«, sagte ich.
Forno
Wenn man sich in Rom eine Pause gönnen will und ein bisschen Hunger hat, also nicht richtigen Hunger, sondern Appetit, dann kann man natürlich in einen der zahllosen Fast-Food-Läden gehen, die mittlerweile überall in Rom entstanden sind. Es wimmelt wie in jeder anderen europäischen Großstadt auch von Kebab-Buden, Hamburger-Ketten oder mittlerweile auch Bio-Take-away-Shops. Aber wenn man länger in Rom gelebt hat, dann macht man das nicht. Das hat damit zu tun, dass das Gedächtnis voller Erinnerungen ist an diese glücklichen Momente, in denen man unterwegs in ein knuspriges Stück Pizza biss, das gerade eben aus dem Ofen gekommen war. Man geht in seinen Lieblingsforno.
Im Grunde ist ein Forno nichts weiter als eine Bäckerei. Durch den Druck der Supermärkte nahm ihre Zahl im Laufe der Jahre natürlich immer weiter ab, aber Gott sei Dank konnten sich die besten halten. Einige dieser Bäckereien haben schon vor dem Zweiten Weltkrieg damit begonnen, nicht nur Brot und Brötchen, also vor allem die in Rom so typischen »Rosette« zu verkaufen. Das sind Brötchen, die innen fast leer sind, ein bisschen aussehen wie ein kleiner Fußball und ganz kross sein müssen. Allerdings halten sie auch nicht länger als einen Tag. Neben den Rosette und dem römischen Brot, dem knackigen Casareccio, das in großen Laiben gebacken wird, bieten diese Forni auch Pizza zum Mitnehmen an. Sie gehören natürlich keiner Kette an, haben mit Pizza Hut oder Domino’s Pizza absolut nichts zu tun. Touristen sind nicht ihre Zielgruppe, dafür Bauarbeiter, die gerade eine Pause haben, Römerinnen und Römer, die schon allein zum Quatschen gerne in einen Forno gehen, oder Jugendliche, die nach der Schule Lust auf ein Stück Pizza haben. Einen richtigen römischen Forno erkennt man daran, dass es wirklich nur Brot gibt und eben sehr schlichte Pizza. Sobald ein Forno Dutzende Sorten Pizza anbietet, ist es kein Forno mehr. In einem echten Forno gibt es Pizza bianca (weiße Pizza) mit und ohne Oliven oder Pizza rossa, also nur mit Tomatensoße, mit oder ohne Mozzarella. Selbstverständlich gibt es sie nur »alla pala«, also in langen Stücken, von denen man sich etwas abschneiden lässt. Zudem muss das Stück Pizza in braunes Papier eingewickelt sein, das sich langsam mit den Spuren des Olivenöls vollsaugt und genau so lange davor schützt, sich die Hände schmutzig zu machen, bis die Pizza aufgegessen ist. Wenn ich nach einem langen Tag am Meer zurück nach Rom fuhr und es noch zu früh zum Abendessen war, dann parkte ich meine Vespa mit den sandigen Füßen vor meinem Lieblingsforno und freute mich auf ein kleines Stück knuspriger Pizza mit Tomatensoße, das wunderbar schmecken, aber eben doch nicht den Appetit für das Abendessen verderben würde.
Noch verfügt jeder Stadtteil in der Innenstadt über einen guten alten Lieblingsforno, vor dem sich lange Schlangen bilden können. Es gibt die stadtbekannten Superstars unter den Forni. Es gibt die Geheimtipps, und es gibt die Dauerbrenner, die seit Jahrzehnten beste Qualität garantieren.
Forno del Ghetto
Wir radelten rüber zum Ghetto, denn der Forno in der Via del Portico d’Ottavia, der seit 1927 existiert, gehört zu den absoluten Top-Adressen. Durch das starke Interesse vor allem US-amerikanischer Touristen am jüdischen Ghetto stiegen die Preise dort in den Restaurants gewaltig an. Die traditionellen Artischockengerichte, die im Ghetto angeboten werden, sind hervorragend, die Restaurants wunderschön, aber man muss schon eine gut gefüllte Brieftasche haben, um dort tafeln zu können. Das genaue Gegenteil ist der »Forno del Ghetto«. Die Pizza mit Tomatensoße, die dort angeboten wird, ist vor allem deswegen so gut, weil sie so unglaublich dünn ist, und ein ordentliches Stück kostet nur zwei Euro.
Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass die Spitzenposition dieses Forno auch der Tatsache zu verdanken ist, dass man mit dem Stück Pizza in der Hand an einem der schönsten Orte der Welt herumspazieren kann. Der Forno befindet sich in der Nähe des Portikus der Octavia, der Säulenhalle, die Augustus für seine Schwester Octavia anlegen ließ. Dort standen zahlreiche Statuen, und es gab eine Bibliothek. Der Weg vom Portikus hinunter zum Marcellus-Theater gehört sicherlich zu den schönsten Ecken Roms.
Zu meinen absoluten Lieblingsforni gehört auch »La Renella« in Trastevere. Er ist ganz einfach zu erreichen. Wer auf dem Ponte Sisto, der Fußgängerbrücke, den Tiber überquert, dann die Piazza Trilussa rechts liegen lässt und in die Via del Moro einbiegt, steht nach ein paar Hundert Metern vor dem Forno, der sich auf der rechten Seite befindet. Ich mache mir allerdings ein bisschen Sorgen angesichts seines enormen Erfolgs. Für meinen Geschmack ist die Anzahl der Pizzasorten, die sie anbieten, schon zu groß. Dennoch muss ich ehrlich zugeben, dass die krosse Margherita aus diesem Forno, vor allem wenn man mit ihr in der Hand in Richtung Piazza di Santa Maria in Trastevere spaziert, einem Urlaub gleichkommt. Der Forno am Campo de’ Fiori wiederum gehört natürlich zu den Superstars der Szene. Der Platz ist wunderschön, aber man muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Ich mag auch den absoluten Klassiker, »ll Fornaio« in der Via dei Baullari. Ich fühle mich dort in die Vergangenheit zurückversetzt, denn dort sitzt immer noch ein Mitglied der Besitzerfamilie an der Kasse, wie es vor dreißig Jahren üblich war. Und nach wie vor wirbt eine Riesenmortadella im Eingang für die frisch zubereiteten belegten »panini«.
Santo Stefano Rotondo
Wir knabberten im Ghetto an unserer Pizza, dann sagte Leo: »Ich nehme mal an, du hast verstanden, dass dieses Mädchen mir etwas bedeutet.«
»Ich bin ja nicht blind«, sagte ich.
»Ich möchte, dass wir das schaffen. Verstehst du? Ich möchte, dass wir finden, was diese Frau so erschüttert hat.«
»Ja, ich verspreche dir, wir werden es wenigstens versuchen«, sagte ich. Dann schwangen wir uns wieder auf die Fahrräder und fuhren die Strecke am Kolosseum vorbei, zurück zum Militärkrankenhaus, ketteten die Fahrräder an und schlenderten in der Via di Santo Stefano Rotondo bis zu dem verwunschenen Garten, in dem diese unglaubliche Kirche gleichen Namens steht.
»Ich weiß noch, wie du mich zum ersten Mal mit hierhergenommen hast«, sagte Leo. »Ich war noch in der Grundschule und habe mich damals ganz schön gegruselt. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da wurden Menschen aufgeschlitzt, Köpfe abgehackt, Brüste abgeschnitten, Leute zerquetscht oder mit Pfeilen erschossen. Ich fand es damals unglaublich, dass diese schrecklichen Bilder an den Wänden tatsächlich mit Bildunterschriften versehen sind wie in einem richtigen Comic. Da konnte ich lesen, dass auf dem Bild a) der heilige Soundso gerade in Stücke gehackt wird oder b) der heiligen Soundso gerade die Brüste abgeschnitten werden. Besonders heftig fand ich den Mann, der mit einer Art Harke auf eine Frau losgeht, während ein fieser Römer ihr ein Götzenbild hinhält, das sie anbeten soll. Und dann der Typ, der wie Vieh in Stücke gehackt wird. Kaum zu glauben, dass diese Kirche nicht erst für Jugendliche ab achtzehn Jahren zugänglich ist.«
Der Autor an einem seiner Lieblingsorte in Rom, der fantastischen und rätselhaften Kirche Santo Stefano Rotondo.
© privat
Das einzigartige Gemetzel von Rom: der Freskenzyklus der Hinrichtung der Märtyrer in Santo Stefano Rotondo.
© privat
Wir gingen durch den Vorraum in die Kirche. Leo sah sich fasziniert die Darstellungen der Gemetzel auf den Fresken an den Wänden an.
»Dass du hier über das Böse reden musst, das leuchtet mir ein.«
Er deutete auf eines der Fresken. »Da wird einer im Topf gekocht.«
»Wahrscheinlich ist das der Evangelist Johannes, der laut der Legende nach Rom gebracht und an der Porta Latina in heißes Öl getaucht wurde.«
»Du meinst, der wird frittiert?«, fragte Leo.
»Er soll in dem heißen Öl sterben, aber das klappt nicht. Der Evangelist steigt vollkommen unbeschadet aus dem Topf, und der römische Kaiser Domitian gibt daraufhin auf und schickt ihn ins Exil nach Patmos, wo er die ›Apokalypse‹, das letzte Kapitel der Bibel, schreibt. Diese Darstellungen der Folter wurden erst im 16. Jahrhundert an die Wände der Kirche gemalt. Die Kirche ist aber viel, viel älter. Sie gehört zu den interessantesten Sakralbauten der gesamten Spätantike, vielleicht die interessanteste überhaupt neben der Hagia Sophia, der Kirche der heiligen Sophia in Istanbul. Die Kirche wurde als Rundbau nach einem neuen Konzept errichtet, und auch das Böse feiert hier sein Debüt.«
»Ich denke, die Fresken sind viel jünger als die Kirche«, sagte Leo
»Das Böse beginnt nicht mit den Fresken. Die Kirche wurde benannt nach dem heiligen Stephanus. Mit ihm betritt das Böse sozusagen die Bühne. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass die Apostel sich auf eine gewisse Art und Weise zu fein dafür sind, sich um die Verteilung von Lebensmitteln an die Ärmsten zu kümmern. Sie interessieren sich nicht für das Los der besonders armen Witwen. Deswegen beauftragen sie damit einige Diakone, einer von ihnen ist Stephanus.«
»Und was hat das Böse damit zu tun?«, fragte Leo.
Als Friedich Wetter, Erzbischof von München und Freising, 1985 ins Kardinalskollegium aufgenommen wurde, erhielt er Santo Stefano Rotondo als Titelkirche.
© mauritius images/age fotostock/Stefano Ravera
»Er ist der Erste, der sein Leben für Christus opfert. Deswegen nennt man ihn auch den Protomärtyrer, also den ersten Märtyrer. Die Szene seines Todes in der Apostelgeschichte wirkt sehr seltsam. Er wird angeklagt, weil er angeblich behauptete, dass Christus den Tempel abreißen wollte. Dann hält er den längsten Monolog, den es im Neuen Testament gibt. Er erzählt im Grunde die Geschichte seiner Religion von Abraham an, und zum Schluss erzürnt er seine Richter, offensichtlich absichtlich, so sehr, dass sie ihn verurteilen. Er wird gesteinigt vor Jerusalem.«
»Das steht in der Apostelgeschichte?«, fragte Leo. Wir setzten uns auf eine Bank in der Nähe des Altars in diesem faszinierenden Raum. Die hohen Säulen, das Licht, die ungewöhnliche runde Form der Kirche vermitteln das Gefühl, in eine längst vergangene Welt eingetaucht zu sein.
»Diese Geschichte der Märtyrer wird sich als fatal und extrem gefährlich erweisen. Denn es geht im Grunde darum, dass es nicht reicht, dass du einfach ein guter Christ bist. Erst wenn das Böse auftaucht und dich angreift, dich verletzt und sogar tötet, dann bist du der Größte. Stephanus sieht, während sie ihn steinigen, schon den offenen Himmel, in den Christus ihn aufnehmen will.«
»Ein bisschen wie bei den muslimischen Extremisten«, sagte Leo.
»Genau, es ist die gleiche Idee. Du wirst in einem Paradies belohnt werden, wenn du für deinen Glauben in den Tod gehst. Wenn man so will, fängt mit Stephanus eine lange Kette von Unheil an. Die Päpste werden später denen, die an Kreuzzügen teilnehmen und somit ihr Leben riskieren, das Paradies versprechen, sollten sie im Krieg mit Muslimen getötet werden.«
Unsere Blicke glitten über die Wände und die Abbildungen der Gemetzel.
»Ich verstehe«, sagte Leo, »das ist ziemlich Taliban-mäßig, oder?«
»Stephanus hält diese lange religiöse Rede, aber eigentlich hat er kein Problem. Es hätte gereicht, wenn er seine Richter nicht dermaßen gereizt hätte, dass sie ihn umbringen wollten. Aber genau darum geht es. Man spricht in der katholischen Kirche auch von der Krone des Märtyrertums oder der Siegespalme des Märtyrers. Das Böse adelt Gutes. Erst wenn du fürchterliche Qualen erlitten hast und gestorben bist, weil das Böse dich angegriffen hat, dann bist du wirklich ein guter Christ. Das suggeriert diese Geschichte von Stephanus. In den Geschichten der Märtyrer geht es immer um das Gleiche. Sie wollen zeigen, dass ihr Glaube ihnen wertvoller ist als ihr Leben, und benehmen sich dabei tatsächlich wie religiöse Fanatiker. Zum Beispiel der heilige Theodor Tiro.«
Der seltsame Heilige
»Was war denn mit dem?«
»Er ist ein sehr seltsamer Heiliger, weil er als Soldat in der römischen Armee ein Experte für entlaufene Sklaven der Christen gewesen sein soll. Wer auf seinem Grab schlief, soll im Traum gesehen haben, wo sich der entlaufene Sklave aufhielt. Er soll im religiösen Eifer den Tempel der Magna Mater in Brand gesteckt haben, weil er es für ein heidnisches Heiligtum hielt.«
»Wie die Taliban, die im Jahr 2001 in Bamiyan die riesigen Buddha-Statuen sprengten?«, fragte Leo.
»So in etwa. Die Römer waren sauer und haben den christlichen Extremisten hingerichtet.«
»Das alles klang in meinem Religionsunterricht aber ganz anders. Da ging es die ganze Zeit darum, dass die armen Christen jahrhundertelang von den bösen Römern verfolgt und ermordet wurden und heldenhaft an ihrem Glauben an Jesus Christus festhielten.«
»Ja, ich weiß, das ist immer noch so in einigen Religionsbüchern. Aber die Geschichte, dass die Christen die verfolgten und gepeinigten Opfer waren, stimmt so nicht. Du weißt ja, es sind immer die Sieger, die dazu neigen, die Geschichte umzuschreiben. Es wimmelt von Beispielen rabiater christlicher Fanatiker, die den Glauben an Christus durchsetzen wollten. Es gab einen gewissen Furius Maecius Gracchus, der im Jahr 377 ein christlicher Stadtkommandant war und antike Heiligtümer zerstören ließ. Das bedeutete vor allem deswegen einen so herben Schlag, weil der Stadtpräfekt eigentlich die Aufgabe hatte, die Tempel zu schützen und zu erhalten«, sagte ich und fuhr fort: »Die Christen verbreiteten Angst und Schrecken unter den Anhängern der alten Religionen. Rom muss damals eine seltsame, aber auch faszinierende Stadt gewesen sein. Die riesigen Tempel der alten Götter standen ja noch, aber sie wurden nur mehr heimlich besucht.«
»Moment mal«, sagte Leo. »Wie reagierten ältere Frauen, wie Lenas Oma, auf solche schrecklichen Bilder, die hier an der Wand zu sehen sind, und deine Geschichten von rabiaten Christen?«
»Ich erzähle dir und mir diese ganzen Geschichten über Gut und Böse noch einmal, weil ich genau das verstehen will. Können solche Orte und solche Geschichten Menschen wie Lenas Oma Schaden zufügen, und welcher Ort, welche Geschichte waren es genau, die sie so verstört haben? Denn dann werde ich nie wieder mit einer Gruppe dorthin gehen und diese Geschichte nie wieder erzählen.«
»Gab es denn keinerlei Anzeichen, dass das, was du da machst, sensibel veranlagte fromme Katholiken massiv verstören könnte?«
Die Frage war mir peinlich, und ich brauchte eine Weile, um nachzudenken. Wir setzten uns auf eine Bank in der Kirche genau gegenüber dem Eingang. Die Wirkung des runden Raumes verbreitete eine regelrechte Magie.
»Ja, gab es«, räumte ich ein. »Aber, was sollte ich denn tun, die meisten Gäste wollten auch die Dämonen von Rom sehen.«
»Und du hast dich nie gefragt, ob einmal so eine Frau wie Lenas Oma kommen könnte, der das einfach zu viel war?«
»Doch, das habe ich. Das ist auch passiert. Es gab Gäste, die mich hier in dieser Kirche beschimpft haben, weil ich die Verehrung christlicher Märtyrer in den Dreck zöge. Das gab es. Es ist immer ein Drahtseilakt, wenn gleichzeitig sehr fromme und sehr neugierige, weltliche Gäste zu mir kommen. Aber es gibt auch sehr schöne Ort, die ich den Menschen gezeigt habe. Zum Beispiel eine andere wundervolle Kirche in Rom, die dieser hier sehr ähnlich sieht und die fast nie von Touristen besucht wird. Dort zeigt Kaiser Konstantin, der das Christentum toleriert, dass er die Römer, die an die alten Götter glauben, nicht vor den Kopf stoßen wird«, meinte ich.
Die wundervolle Kapelle am Rand der Innenstadt
»Du meinst Santa Costanza in der Nähe der Via Nomentana?«
»Ja«, antwortete ich.
»Du hast recht, das ist auch so ein mystischer Rundbau«, sagte Leo. »Vielleicht gibt es keinen anderen Ort als diese beiden Kirchen, in denen man in Rom den Geist der späten Antike noch so deutlich spüren kann. Ich erinnere mich, dass an den Wänden diese fantastischen, vermutlich ältesten Mosaiken des frühen Christentums zu sehen sind.
Und auf dem Sarg der Constantia sind diese kleinen Putten, die den Wein ernten. Immer wenn ich da bin, denke ich, dass es sehr viel besser gewesen wäre, den Sarg nicht in die Vatikanischen Museen zu schaffen, sondern dort zu belassen, wo er in der Kapelle gestanden hat. Denn die Putten auf den Mosaiken an den Wänden setzen sich auf dem Sarkophag fort. Es ist, als spielten sie miteinander in dem unglaublichen Gebäude«, sagte Leo.
»Ja, aber vielleicht wäre dieser wunderschöne Sarkophag dann zerstört worden, und immerhin haben sie eine Kopie hineingestellt.«
»Da hast du recht. Aber heute könnte man ihn doch zurückbringen?«
»Ich verstehe, was du meinst. Ein Teil der Familie von Konstantin dem Großen und sicher auch seine Tochter Constantia waren Christen, aber sie wussten, dass sie zu einer sehr kleinen Minderheit gehörten. Nicht einmal jeder Sechste im Römischen Reich war damals ein Christ. Sie wollten deswegen die Bewohner des Reiches, die noch an die Religionen ihrer Väter glaubten, nicht vor den Kopf stoßen. Sie hatten nicht vor, ihnen auf die Nase zu binden, dass die Familie des Kaisers christlich war. Das Mausoleum gehörte schließlich nicht der Kirche, es war ein Teil des Palastes der Familie Konstantins in Rom, ein Gebäude, das hohe Beamte des Römischen Reiches besuchen würden, die sicherlich nur zu einem sehr geringen Teil Christen waren. Deswegen vermied die Familie eindeutige christliche Symbole wie den Fisch«, sagte ich.
Die frühere private Grabkapelle für Constantia, die Tochter von Kaiser Konstantin, ist der älteste Rundbau einer Kapelle in Rom.
© mauritius images/Nicola Messana Photos/Alamy
Wundervoll erhaltene Mosaiken, die zu den ältesten Darstellungen christlicher Symbole der Welt zählen.
© Shutterstock/Isogood_patrick
»Wieso eigentlich war der Fisch so wichtig?«, fragte Leo.