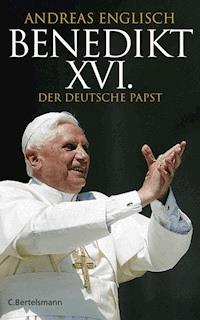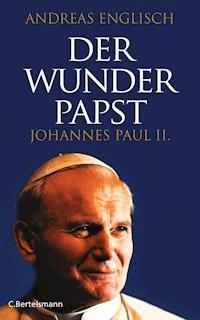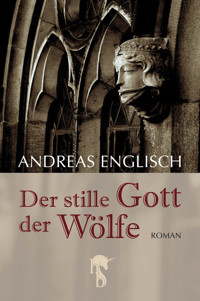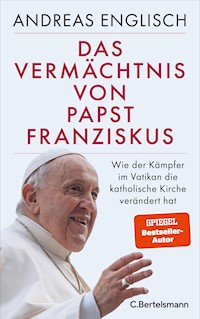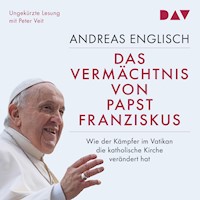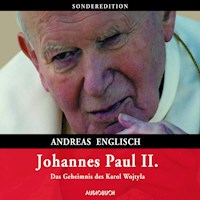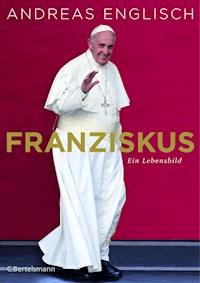22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Buch zum Heiligen Jahr von Bestsellerautor Andreas Englisch
Mit Highspeed über den Pilgerweg: 11 Rätsel führen auf verschlungenen Wegen nach Rom – und tief in die Geschichte Italiens
Ob Pilger oder Plünderer, Kaiser oder Bettelmönche, ob die Suche nach Macht, Reichtum, Erlösung oder Liebe – seit Jahrtausenden zieht es Reisende nach Rom. In seinem neuen Buch erzählt Italienexperte Andreas Englisch von diesen Menschen und von einer rasanten Reise, die ihn mit Sue, einer ungewöhnlichen Begleiterin, zusammenspannt: Auf dem Weg der beiden von Meran in Südtirol über den Gardasee, Verona und die Toskana bis nach Rom, dem Sehnsuchtsort aller Pilger, gilt es dabei etliche Rätsel zu lösen und Hinweise zu entschlüsseln.
»Alle Wege führen nach Rom« ist eine schwungvoll erzählte Schnitzeljagd durch die Kultur und Geschichte Italiens und zugleich eine Liebeserklärung an das Land, das Andreas Englisch nun schon seit fast vier Jahrzehnten begeistert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Ob Pilger oder Plünderer, Kaiser oder Bettelmönche, ob die Suche nach Macht, Reichtum, Erlösung oder Liebe – seit Jahrtausenden zieht es Menschen nach Rom. Viele ihrer Spuren finden sich noch heute an zahlreichen Orten in der Region zwischen den Alpen und dem Tiber. In seinem neuen Buch erzählt Italienexperte Andreas Englisch von diesen Menschen und von einer rasanten Reise, die ihn mit einer ungewöhnlichen Begleiterin zusammenspannt: Auf dem Weg von Meran in Südtirol über den Gardasee, Verona und die Toskana bis nach Rom, dem Sehnsuchtsort aller Pilger, gilt es dabei etliche Rätsel zu lösen und Hinweise zu entschlüsseln. Andreas Englischs Buch ist eine schwungvoll erzählte Schnitzeljagd durch die Kultur und Geschichte Italiens und zugleich eine Liebeserklärung an das Land, das ihn nun schon seit fast vier Jahrzehnten begeistert.
Autor
Andreas Englisch lebt seit fast vierzig Jahren in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Seit der Amtszeit von Johannes Paul II. trifft er alle amtierenden Päpste regelmäßig und begleitet sie auf ihren Reisen. Als Vatikanexperte und Italienkenner ist er ein gefragter Talkshowgast und Interviewpartner, seine Bücher sind Bestseller und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter »Franziskus – Zeichen der Hoffnung« (2013), »Der Kämpfer im Vatikan. Papst Franziskus und sein mutiger Weg« (2015), »Der Pakt gegen den Papst. Franziskus und seine Feinde im Vatikan« (2020) sowie zuletzt »Das Vermächtnis von Papst Franziskus« (2023). Zudem begeistert Andreas Englisch als kenntnisreicher Reiseführer durch Rom. Die Geschichte und Geschichten der Ewigen Stadt hat er in seinen Bestsellern »Mein Rom. Die Geheimnisse der Ewigen Stadt« (2018) sowie »Mein geheimes Rom. Die verborgenen Orte der Ewigen Stadt« (2021) aufgeschrieben.
ANDREAS ENGLISCH
Alle Wege führen nach Rom
11 Rätsel und ein Minivan – eine turbulente Pilgerreise von Südtirol in die Ewige Stadt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
In dankbarer Erinnerung an die wundervolle Atmosphäre im Hermitage-Komplex in Ansedonia, wo dieses Buch entstanden ist.
© 2025 by Andreas Englisch
© 2025 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA International GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München, www.ava-international.de;
www.andreasenglisch.de
Stoffentwicklung und Beratung: Kerstin Englisch
Vorsatzgrafik: Alessandro Staccini
Lektorat: Brigitte Wormer
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildungen: © shutterstock; Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello (Autorenfoto)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32343-1V001
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Tag 1
Deutschland
Der Weg nach Südtirol
Südtirol
Tag 2
Südtirol
Trient
Tag 3
Verona
Gardasee
Tag 4
Verona
Auf dem Weg nach Mantua
Mantua
Tag 5
Mantua
San Benedetto Polirone
Bologna
Tag 6
Arezzo
Sansepolcro
Der Weg nach Florenz
Der Weg nach Florenz
Florenz
Tag 7
Florenz
Tag 8
Arezzo, Florenz
Tag 9
Florenz
Tag 10
Florenz
Siena
Pienza
Monte Oliveto Maggiore
Pitigliano
Tag 11
Orvieto
Rom
Epilog
Eine Woche später
Wie dieses Buch entstand
Register
BILDTEIL
TAG 1
Deutschland
Ich hatte an jenem Samstagnachmittag gründlich die Nase voll von dieser jungen Frau. Ich hätte das angeblich so »witzige« Experiment niemals akzeptieren sollen, das Ingo Wolfram, der Veranstalter, mir vorgeschlagen hatte. Am Telefon hatte er geradezu verschwörerisch geflüstert: »Sie ist so eine Art Managerin von InfluencerInnen. Da geht’s um Leute, die Millionen von Followern haben. Sie ist die Moderne, und ein Gespräch mit dir könnte reizvoll werden.«
»Weil dann die Moderne auf einen alten Sack trifft, der mit etwas aus der Mode Gekommenem wie dem Vatikan zu tun hat?«, fragte ich.
»Du musst das doch nicht gleich so negativ sehen. Da sollen einfach zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Es geht natürlich um Inhalte wie Religion, den Vatikan, den Papst, also alles, womit diese jungen Menschen überhaupt nichts mehr anfangen können. Überleg doch mal, wie spannend es sein kann, wenn du mit dieser jungen Frau debattierst.«
»Damit sie herausarbeiten kann, dass ich zu doof und zu alt bin, um ihre tolle neue Welt zu verstehen?«
»Du wirst sie mögen, du wirst sehen. Sie hat als Influencerin angefangen, pries Müslis und Yogaklamotten an, sogar Mixer. Dann schaffte sie den Sprung eine Stufe nach oben, und jetzt managt sie die Celebritys unter den Werbeträgern.«
»Die was? Celebritys? Werbeträger? Kannst du das mal übersetzen?«
»Na, die Stars unter den Influencern. Das machen die doch: Werbung für alles Mögliche, auf Instagram oder TikTok, eben auf den Kanälen, die die jungen Menschen den lieben langen Tag lang konsumieren, seitdem sie nicht mehr fernsehen.«
»Aber was habe ich damit zu tun?«
»Du bist der perfekte Sparringspartner. Außerdem weißt du ja, dass ich geschäftlich Pech hatte. Ich habe viel Geld verloren. Du kannst mir schon ein wenig unter die Arme greifen. Win-win, du weißt schon.«
Ich hatte mich also auf diesen Plan eingelassen. Der ganze Saal war voller Fans dieser jungen Frau gewesen, die sich Sue nennen ließ. Als sie auf die Bühne kam mit ihrer zierlichen Figur, in einer knallengen Lederhose, zu der sie eine weiße Rüschenbluse wie für den Opernball trug und dazu eine etwas punkige, aber vermutlich sündhaft teure Lederjacke, musste ich daran denken, dass ihre ganze Gestalt, vor allem aber der Haarschnitt, sie wirken ließ wie eine moderne Variante von Mireille Mathieu. Ich war allerdings sicher, dass sie zu jung war, um zu wissen, wer das ist.
Die jungen Zuschauer hingen an ihren Lippen, was nicht so schlimm gewesen wäre. Das Problem war, dass die junge Dame mit dem perfekten Make-up immer wieder zum Ausdruck brachte, dass sie keine Ahnung hatte, wer ich war und worüber ich eigentlich sprach, wenn ich die Worte »Kirche«, »Gott« oder »Papst« in den Mund nahm. Das Ganze wirkte so, als träfe ein Mann, der am Ewiggestrigen festhielt, ein finsterer Hinterwäldler, auf eine moderne Frau, der die Zukunft offenstand, die aber leider mit langweiligem Gelaber aus der Vergangenheit belästigt wurde. Ich erinnere mich, dass ich zu ihr sagte: »Der Tag, an dem Paul VI. die Krone auf dem Altar der Peterskirche ablegte, war schon ein wichtiger Einschnitt in der Kirchengeschichte.«
»Paul der Wievielte?«, fragte sie. »Der hatte eine Krone auf? Ich hatte mal eine Kundin, die in den Clubs auch immer eine Krone trug. Das war ihr Brand, ihr Markenzeichen, falls Sie verstehen«, sagte sie.
»Ich sprach von Papst Paul VI., und der trug als Letzter die Tiara, die Krone der Päpste.«
»Wie schade, dass es die nicht mehr gibt! Wann hat er die denn zurückgegeben?«
»Er hat sie nicht zurückgegeben, er hat sie abgesetzt, auf dem Altar, um zu zeigen, dass die Kirche sich modernisieren muss.«
»Wieso sollte das modern sein, ohne Krone? Ich freu mich jetzt schon auf die Krönungsfeier von William und Kate, und die wird ja wohl kaum ohne Krone stattfinden.«
Und so ging es immer weiter. Als die Veranstaltung vorbei war, wollte ich nur noch weg. Vor Sue hatte sich eine lange Schlange von Menschen gebildet, die Selfies, »Storys« oder sonstige Werbefilmchen mit ihr machen wollten. Niemand beachtete mich, und ich eilte zu meinem Mietwagen, um zum Flughafen zu fahren und nach Hause nach Rom zu fliegen.
Der Veranstalter Ingo Wolfram lief hinter mir her. Er stoppte mich an meinem Wagen.
Abgehetzt schnaufte er: »Sie will unbedingt noch mit dir sprechen.«
»Ich aber nicht mit ihr«, sagte ich. »Mir reicht es für heute.«
»Komm!«, sagte er. »Tu mir den Gefallen: Sprich noch mal kurz mit ihr!«
»Danke, kein Bedarf«, sagte ich.
»Bitte!«, insistierte er.
Ich zögerte einen Augenblick, statt ihn einfach stehen zu lassen, denn unerklärlicherweise war er grundsätzlich ein angenehmer Mensch. Seine schlanke Gestalt, die er sich trotz seiner 50 Jahre erhalten hatte, sein unaufdringlicher, aber eleganter Kleidungsstil, seine Art, an Gesprächen teilzunehmen, ohne aufzufallen, sorgten dafür, dass er auf eine gewisse Art und Weise unsichtbar war. Wenn er an Abendessen teilnahm, tat er einfach nie etwas Falsches. Er roch nie unangenehm nach Schweiß, trank nie zu viel und mied kontroverse Debatten. Sein Auftreten war stets so perfekt, dass fast alle anderen Männer neben ihm unangenehm auffielen. Wenn er zu einem Treffen kam, war er einfach da, und es war gut. Deswegen war dieser Abend auch so untypisch verlaufen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir je aneinandergeraten waren. Da ich also nicht unhöflich sein wollte, drehte ich mich wieder um und ging zurück in die Halle. Als Sue mich sah, entschuldigte sie sich bei der Menge, die sie umringte, und kam auf mich zu.
Ingo Wolfram öffnete eine Tür zu einem Nebenraum und ließ uns in einen kleinen Saal eintreten. Tischkärtchen mit den Namen der Damen und Herren, die hier am nächsten Tag in einer Konferenz sitzen würden, waren schon aufgestellt worden. Ich wollte dieser Sue die Hand geben und gehen.
Sie sah mich an und sagte etwas, was mich sprachlos machte.
»Ich habe da ein Problem. Es ist leider ein sehr großes Problem, deswegen kann ich es mir nicht leisten, lange zu zögern. Sie kommen ja aus Rom und kennen sich in Italien aus, mit Religion und so. Verstehen Sie auch was von Pilgern?«
»Aber selbstverständlich kennt er sich damit aus«, antwortete Ingo Wolfram für mich.
»Das dachte ich mir«, sagte sie. »Also passen Sie auf! Das läuft jetzt so: Sie begleiten mich nach Rom. Sie helfen mir, sagen wir mal so, etwas besser zu verstehen. In Rom trennen sich unsere Wege, Ihr Honorar kenne ich, in der Größenordnung ist das in Ordnung. Warten Sie einfach an meinem Wagen auf mich.«
Ich war so perplex, dass ich schwieg und diese junge Frau nur anstarrte. Sie wandte sich bereits ab, um zu ihren Fans zurückzukehren, als ich herausbrachte: »Das läuft ganz sicher nicht so. Schönen Abend noch.«
Ich wollte aus dem Raum stürmen, ziemlich gekränkt, wenn nicht sogar beleidigt.
Sie blieb vollkommen ruhig, sagte nur: »Ich hatte mich auf das Wort unseres Veranstalters verlassen. Ich wusste nicht, dass Sie das Honorar verhandeln wollen, aber okay. Wie viel wollen Sie?«
»Du hast ihr das zugesagt?«, fragte ich Ingo Wolfram empört. Er lächelte etwas verlegen.
»Deinen Rückflug habe ich storniert. Ich war mir sicher, dass du mir und natürlich auch Sue diesen kleinen Gefallen tun würdest. Sie hat eine bequeme Limousine und einen Fahrer.«
»Ich habe jetzt nicht viel Zeit«, warf Sue ein. »Ich zahle Ihnen, was immer Sie verlangen. Aber jetzt muss ich wieder raus. Ich bin in 30 Minuten am Wagen.«
Mir reichte es jetzt. »Ich bin kein Produkt von Amazon. Sie können mich nicht am Smartphone shoppen. Ich werde mir jetzt einen neuen Flug buchen und nach Hause fliegen. Auf Wiedersehen.«
Sue verschränkte die Arme vor der Brust und taxierte mich mit einem kühlen Blick. »Ich habe jetzt verstanden«, sagte sie. »Sie sind beleidigt, weil es da draußen nicht gut für Sie lief. Aber das rechtfertigt nicht Ihre völlig unprofessionelle Haltung. Ich habe mich vorher selbstverständlich über Ihre Sperrtermine erkundigt, Sie haben keine dringenden Verpflichtungen in den kommenden Tagen, nicht einmal Ihre Familie ist da, das hat mir Dr. Wolfram versichert.«
»Was soll das jetzt?«, fragte ich.
»Was das soll? Ein solches Engagement, wie von mir angeboten, auszuschlagen, nur weil Sie beleidigt sind, ist von einer geschäftlichen Basis aus gesehen kindisch. Wenn ich mich je so verhalten hätte, dann wäre ich nie so weit gekommen, wie ich gekommen bin, dann würde ich noch an Papas Imbissstand stehen. Sie sollten sich mal mit den Ursachen Ihrer Unzufriedenheit auseinandersetzen. Ihr Geschäftsmodell ist veraltet, es stammt aus einer Zeit, in der in Metzgereien noch Plakate an die Tür geklebt wurden, um Ihre Veranstaltungen zu bewerben. Sie haben die Entwicklung der Zeit verschlafen und sich auf Bücher als wichtigstes Leitmedium konzentriert, und das war ein Fehler. Eine moderne Show funktioniert so, wie ich sie heute Abend vor meinen Fans abgezogen habe. Diese Sue, die Sie dort auf der Bühne sehen, ist eine Kunstfigur. Sie sollten mal darüber nachdenken, wer Sie eigentlich sind, wenn Sie auf die Bühne kommen. Ich habe Sue erfunden, und ich kann sie spielen, aber Sie sollten nicht den fatalen Fehler machen, mich mit der Sue von der Bühne zu verwechseln. Möglicherweise wäre eine kurze gemeinsame Zeit mit mir eher in Ihrem Interesse als in meinem, weil ich Ihnen eine ganze Menge darüber sagen könnte, wie das heute vor Publikum läuft.« Ich war sprachlos. Es kam mir vor wie in dem Moment vor vielen Jahren, als mein äußert unzufriedener Lateinlehrer mich in der Schule heruntergeputzt hatte. Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich antworten sollte, und stapfte aus dem Raum. Auf dem Parkplatz dachte ich, mich trifft der Schlag. Ein junger Mann stand neben meinem Mietwagen und sagte höflich: »Können Sie mir bitte den Schlüssel geben? Ich bringe den Wagen für Sie zurück.« Er hielt mir etwas hin, das ich unterschreiben sollte, dann öffnete er mit einem Zweitschlüssel das Auto, nahm meinen Trolley heraus, und ich gab ihm völlig verblüfft meinen Wagenschlüssel. In dem Augenblick tauchte Ingo Wolfram neben mir auf.
»Ich war mir sicher, dass du Sue begleiten würdest, also habe ich auch den Wagen storniert.«
»Dann wirst du mich eben zum Flughafen fahren. Und zwar jetzt sofort«, schnaubte ich.
»Natürlich, gern, aber dann musst du warten, bis alle gegangen sind. Ich muss die Abrechnungen abzeichnen und die Halle abschließen lassen, das dauert noch ein Weilchen.«
»Dann warte ich eben«, schnauzte ich zurück.
Wir gingen erneut zurück, und ich sah, dass Sue immer noch dabei war, die Schlange ihrer Fans abzuarbeiten.
Ich schüttete eine Cola hinunter und setzte mich auf meinen Trolley.
Als Sue fertig war, kam sie zu mir geschlendert. Ein junger, erschreckend dünner Typ mit Stoppelhaar, der in seiner schwarzen Hose und dem Kapuzenpullover wie ein schlecht gelaunter Abiturient aussah, begleitete sie. »Das ist unser Fahrer«, sagte sie. »Er heißt Doc.«
»Doc?«, fragte ich. »Ist er Mediziner?«
»Quatsch«, sagte Sue mit einem Lächeln. »Ich nenne ihn Doc, weil er so dünn ist, dass ich denke, dass er mal zum Doktor gehen sollte.« Der nahezu glatt rasierte Kopf des Typen, aus dem zwei dunkle Augen schauten, erinnerte an einen kahlen unbewohnten Planeten. Sein Gesicht und seine Figur ließen sich im Grunde nur erahnen, weil der sehr weit geschnittene Hoodie ihn wie ein Sack umschloss. Er wirkte, als wolle er auf keinen Fall angesprochen werden, schaute auf den Boden und schien sich danach zu sehnen, hinter das Steuer seines Autos zurückzukehren. Am meisten fiel mir an ihm auf, dass er offenbar in erster Linie und ausschließlich Sue zu Diensten sein wollte. Ich kenne viele Fahrer. Nahezu alle hätten neben Doc wie ein Felsbrocken neben einem Besenstiel gewirkt. Die anderen konnten vier Reisetaschen gleichzeitig in den Kofferraum ihrer Vans hieven. Doc hätte dazu einen Gabelstapler gebraucht. Außerdem strahlten alle aus, dass sie sich in den schwarzen Anzügen, in die man sie gesteckt hatte, absolut unwohl fühlten. Sie schienen geradezu aus ihnen herauszuplatzen. Doc hingegen versank förmlich in seinem Hoodie. Zudem betonten alle Fahrer, die ich kannte, dass sie diesen Job nur des Geldes wegen machten, zur Höflichkeit gegenüber ihren Passagieren also gezwungen waren. Doc hingegen wirkte voller Ergebenheit.
Sue strahlte neben ihm noch viel heller. Ich hatte im Publikum eine seltsame Reaktion auf Sue bemerkt. Es gab eine gewaltige Mehrheit junger Frauen, die ohne jeden Zweifel Sue bewunderten und an ihren Lippen hingen. Ihre Blicke und ihre Haltung kennzeichneten sie als echte Fans. Vor allem aber war klar, dass sie am liebsten auch so wären wie Sue.
Manche dieser jungen Frauen hatten allerdings Freundinnen mitgeschleppt, die völlig anders reagierten. Diese Frauen stellten nur eine kleine Minderheit, aber sie waren dort gewesen. Sie hatten Sues zur Schau getragene Schönheit, ihre plakative sexy Weiblichkeit, ihr enormes Tempo, mit dem sie sprach und über die Bühne flitzte, ihr geradezu überbordendes Selbstbewusstsein mit einem abschätzigen Blick quittiert. Sue war nun einmal das komplette Gegenteil von »beste Freundin«. Sie beherrschte alles und würde sich nie damit zufriedengeben, irgendwo nicht die Nummer eins zu sein.
»Offenbar kann ich Sie nicht umstimmen«, sagte Sue. »Der Weg zum Flughafen München liegt auf meiner Strecke. Wenn Sie wollen, nehmen wir Sie jetzt mit. Es wird noch eine Weile dauern, bis Dr. Wolfram fertig ist.«
»Okay«, sagte ich, »fahren wir!«
Noch auf dem Weg zu dem schwarzen Mercedes-Luxus-Van, den Doc aufschloss, checkte ich die Flugverbindungen für diesen Samstagabend. Es gab nichts mehr, was halbwegs bezahlbar war. Ich saß in der Falle.
Der Weg nach Südtirol
Der Van erwies sich als unglaubliche Ansammlung luxuriöser eingebauter Extras. Als Doc die Tür zur Seite gleiten ließ, sah ich, dass er ursprünglich für sechs Sitze gedacht war. In diesem Modell gab es aber nur zwei Ledersitze, die nebeneinander montiert waren und sich elektrisch komplett in eine Liegefläche verwandeln ließen. Ich gab dem schmächtigen Fahrer meinen Trolley, den er stöhnend im Kofferraum verstaute, während Sue schon einstieg und die Lehne herunterfahren ließ, als bereite sie sich auf einen Nachmittag am Pool vor. Ich setzte mich neben sie und bewunderte den gewaltigen Bildschirm, der in dem Wagen montiert war. Das Innere des Autos fühlte sich an, als nehme man in einem Luxus-Ledersessel in einem Kinosaal Platz.
Sue ließ einen Kanal laufen, der alle möglichen Videoclips abspielte, und ich dachte nach.
Es gab definitiv keinen Flug mehr, den ich an diesem Abend ab München nehmen konnte. Ich würde den ersten Morgenflug nehmen. Sue konnte mich an einem der Hotels am Flughafen absetzen. Es gab da eines in der Nähe des Long-Term-Parkplatzes.
»Dann fliegen Sie morgen?«, fragte Sue.
»Es bleibt mir nichts anderes übrig.«
»Wir fahren heute Abend bis Meran.«
Meran klang gut in meinen Ohren, Meran klang sogar sehr gut. In München musste ich mir eine Nacht in einem überteuerten Hotel um die Ohren schlagen, dann am nächsten Morgen zum Flughafen gelangen und einen immer noch sehr teuren Flug nach Rom nehmen. Von Meran aus konnte ich morgen früh nach Bozen fahren und dort den komfortablen Super-Schnellzug nehmen. Ich wäre rascher zu Hause, und noch dazu fahre ich grundsätzlich lieber mit dem Zug. Außerdem schien mir ein Abend in Meran verlockender als in einem Flughafen-Hotel.
Ich beschloss, meine Selbstachtung ein wenig herunterzuschrauben, und fragte kleinlaut: »Könnte ich bis Meran mitfahren? Es würde mir den Rückweg nach Rom erleichtern.«
Sue grinste, ganz offensichtlich hocherfreut darüber, dass der zickige alte Mann sie um etwas bitten musste. »Doc!«, rief sie. »Du brauchst nicht am Flughafen anzuhalten, wir fahren direkt nach Meran.«
Sie stöpselte sich Kopfhörer in ihre Ohren, was mir ausgesprochen entgegenkam, weil ich nicht daran interessiert war, ein Gespräch zu führen. Der Wagen glitt fast geräuschlos über die Autobahn und erreichte zügig das Teilstück, das zur österreichischen Grenze führte. Die ersten Berge tauchten auf. Der Sommer hatte gerade begonnen. Noch ächzte die Natur nicht unter der Hitze. Es war einfach nur angenehm warm.
Nach einer Weile hatte Sue offensichtlich die Nase voll von dem, was sie über die Kopfhörer beschallte. Sie nahm sie von den Ohren und schaute mich zum ersten Mal an, seitdem wir losgefahren waren. Es war ein seltsamer Blickwinkel, weil ich saß und sie lag. Ich musste daran denken, dass Königin Christina von Schweden, nachdem sie nach Rom gezogen war, es vorgezogen hatte, am Vormittag die Untertanen an ihrem Bett zu empfangen. So in etwa kam ich mir vor.
»Da Sie jetzt schon mal hier sind, darf ich Sie doch auch was fragen, oder? Wenn Sie wollen, auch gegen Cash.«
»Fragen Sie einfach, die Antwort gibt es ganz umsonst, soweit ich überhaupt antworten kann«, sagte ich.
»Wenn Sie jemanden auf eine Pilgerreise nach Rom schicken würden, damit er Buße tut, wo würde die Reise beginnen?«
»Es gibt zahllose Möglichkeiten. Die Pilgerreisen nach Rom orientierten sich seit Beginn an dem bestehenden Straßennetz des Römischen Reiches. Pilger aus dem Norden kamen über die Via Aurelia, die an der Küste entlang von Genua nach Rom führt, über die Via Cassia, die durch das Binnenland verläuft und die Toskana durchquert, sowie über die Via Salaria und die Via Aemilia, die Rom mit den Straßen im Norden an der Adria verbinden. Der bekannteste Pilgerweg des Mittelalters, der sogenannte Frankenweg, die Via Francigena, begann in England, in Canterbury, und verläuft durch Frankreich, die Schweiz, das Aostatal und dann durch die Lombardei. Der Weg folgt weiter der Via Aurelia bis Lucca, biegt hier ins Landesinnere ab und verläuft über die Via Cassia nach Rom. Der Frankenweg heißt so nach dem Frankenkönig Karl dem Großen. Er hatte nach der Zerschlagung des Römischen Reichs durch die Langobarden im Jahr 774 die Strecke zwischen Pavia und Rom befestigen lassen. Es gibt aber auch die Via Imperiale, die Kaiserroute, die auch Via Romea Germanica hieß. Ein gewisser Abt Albert von Stade in Norddeutschland beschrieb diesen Weg im 13. Jahrhundert ziemlich genau, weil er ihn auf seiner Heimreise selbst nahm. Er folgt ab den Alpen etwa der heutigen Autobahnroute nach Rom«, dozierte ich und bemerkte erfreut, dass Sue mir zum ersten Mal aufmerksam und ohne Stirnrunzeln zuhörte. »Martin Luther hat übrigens auch diesen Pilgerweg benutzt, auf dem Rückweg von Rom.«
»Also genau den Weg, auf dem wir jetzt sind?« Sie setzte sich auf. »Nehmen wir an, jemand pilgert heute noch nach Rom: Werden dem Pilger dann seine Sünden vergeben?«
»Wie meinen Sie das denn?«
»Ich meine, wenn jemand nach Rom pilgert, weil er irgendwas zu bereuen hat. Wie sicher kann er dann sein, dass ihm auch vergeben wird? Ist das eine 100 Prozent sichere Sache oder eher 50 Prozent?«
Ich dachte, ich höre nicht richtig. »Was das Pilgern angeht, läuft das nicht so, dass Sie auf einen Knopf drücken, und dann wird Ihr Wunsch erfüllt. Als Erstes müssen Sie sich die Frage stellen, ob Sie an Gott glauben, denn nur wenn Sie an einen Gott glauben, kann der Ihnen auch vergeben.«
»Das ist ja der Mist bei allem, was mit Religion zu tun hat. Du kriegst nie eine klare Antwort.«
»Was Schuld angeht, klärt man das nicht mit einem Tutorial auf YouTube«, warf ich ein. »Wie stellen Sie sich das vor? Statt ›So entferne ich einen Fettfleck aus dem Sofa‹ ein Anweisungsvideo: ›So befreie ich mich von meiner Schuld‹?«
»Wieso denn nicht?«, fragte sie. »So löst man Probleme. Damals und heute. Die Pilger hatten ein Problem, deswegen sind sie nach Rom gewandert, und dann war es weg. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Wenn das damals klappte, warum soll das heute anders sein? Mir geht es vor allem um Menschen, die nach Rom aufbrachen, damit ihnen vergeben wurde. Gab es das?«
»Na ja, so in etwa gab es das schon: Vor allem römische Kaiser deutscher Nation pilgerten andauernd nach Rom, um ihren Streit mit dem Papst zu bereinigen. Sie kamen, weil sie um Vergebung bitten wollten.«
»Und wurde ihnen vergeben?«
»Manchmal.«
»Der Abt, der aus Stade bis nach Rom gepilgert ist: Was wollte er dort?«, fragte Sue.
»Er wollte den Segen von Papst Gregor IX., um sein Kloster zu reformieren.«
»Ach, der war ein Progressiver?«
»Im Gegenteil: Er wollte strengere Sitten einführen. Er fand, die Benediktinermönche in seinem Kloster seien verweltlicht, sie lebten wie Maden im Speck und ließen andere für sich arbeiten. Er wollte, dass die Mönche wieder von ihrer Hände Arbeit lebten, sich in Askese übten und stündlich beteten.«
»Wie langweilig. Aber ich habe da noch eine Frage: Was kann Schuld mit Meran zu tun haben?«
»Wie bitte?«, fragte ich.
»Nehmen wir mal an, Sie hätten etwas verbrochen, und jemand anders wollte Ihnen vor Augen führen, dass Sie über das Thema Schuld nachdenken sollten, was könnte das mit Meran zu tun haben?«
»Na ja«, sagte ich, »es ist ein Landstrich, in dem Sie spüren können, wie einfach es ist, einen Konflikt auszulösen, und dass es Generationen dauern kann, bis dieser Konflikt auch nur teilweise überwunden wird.«
»Was für Konflikte?«, fragte sie »Meine Kollegin hat hier mal eine Tour von DJ Ötzi organisiert. Ich erinnere mich nicht an Konflikte, sondern an coole Partys im Schnee.«
»Natürlich ist Südtirol traumhaft. Viele Menschen halten Südtirol für das Paradies auf Erden. Aber diese Gegend hat das Pech gehabt, an der Schnittstelle zwischen zwei Sprachen zu liegen: Deutsch und Italienisch. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Tirol Bayern zugeschlagen, dann kam es zu Österreich. Und schließlich tritt Kaiser Franz Joseph den Ersten Weltkrieg los, der Europa in eine Katastrophe unfassbaren Ausmaßes stürzt. In den Schützengräben wurden Millionen Menschen für nichts und wieder nichts abgeschlachtet.«
»Moment mal, Franz Joseph, war das nicht Sissis Ehemann?«
»Ja, klar.«
»Waaas? Der Typ war doch total nett. Ich habe die Neuverfilmung gesehen. Eigentlich war ich ja dagegen, die Sissi-Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm anzutasten. Aber dann fand ich, dass es doch ein großartiges Projekt war, Sissi noch mal zu verfilmen. Nur: Was hat der nette Franz Joseph mit den Schützengräben zu tun?«
»Franz Joseph war der Kaiser eines riesigen Reiches: Österreich-Ungarn war so groß, dass nur das Russische Reich in Europa noch größer war. Franz Joseph herrschte über knapp 53 Millionen Menschen. Ein Attentäter aus Bosnien mit serbischen Wurzeln tötet den Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo. Der Kaiser sieht darin einen Angriff auf die Monarchie, erklärt Serbien den Krieg und löst den Ersten Weltkrieg aus, der zehn Millionen Soldaten und sieben Millionen Zivilisten das Leben kostet. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das riesige Reich Österreich-Ungarn zu einen Zwergstaat geschrumpft. Das heutige Österreich mit etwa neun Millionen Einwohnern ist nur ein Sechstel so groß wie das ehemalige Kaiserreich.«
»Aber das ist doch total lange her. Das interessiert doch keinen mehr.«
Ich wurde ungeduldig: »Wenn sich kein Mensch mehr für das interessiert, was so ›total lange her‹ ist, dann lernt auch keiner aus den Fehlern der Vergangenheit, die das Alltagsleben bis heute beeinflussen, obwohl die meisten Leute gar nicht mehr wissen, woher ihre Ressentiments stammen.«
»Na, dann sagen Sie mir, was die Partywelt von DJ Ötzi mit Sissi und dem Ersten Weltkrieg zu tun hat«, maulte Sue.
»Waren Sie schon einmal in einem österreichischen Supermarkt in Südtirol? Wissen Sie, was ich da häufig erlebt habe, als ich dort wohnte? Ein italienischsprachiger Kunde will mit einer Kreditkarte bezahlen. Ich hatte in dem gleichen Markt schon Dutzende Male mit meiner Kreditkarte bezahlt, aber die Kassiererin verlangt von ihm seinen Ausweis, weil man den Italienern, die sie abfällig ›die Walschen‹ nennt, nicht trauen könne. Obwohl die Auseinandersetzungen um Südtirol so lange her sind, brodelt es dort immer noch unter der Oberfläche des Alpenparadieses, während Besucher selig Sissis Spazierweg ablaufen und ihre Aufenthaltsräume im Schloss Trauttmansdorff besichtigen.«
»Ich habe immer noch nicht verstanden, warum«, sagte Sue.
»Die Italiener traten gegen Österreich in den Ersten Weltkrieg ein und bekamen 1919 Südtirol sozusagen als Beute zugesprochen. Die Italiener besetzten das Land und versuchten, die deutschsprachigen Alpenbewohner auf Biegen und Brechen ins Königreich Italien zu integrieren. Sie verboten den Menschen, ihre Muttersprache zu benutzen, die Kinder lernten in den Schulen nur noch Italienisch. Überall installierten italienische Beamte ihre Macht im deutschsprachigen Gebiet, das plötzlich zu Italien gehörte.«
»Ja und?«, sagte sie jetzt. »Das ist 100 Jahre her, das schert doch keinen mehr.«
»Im Gegenteil: Die Vergangenheit bestimmt noch heute das ganze Leben in Südtirol, in dem die Hälfte der Einwohner bei jeder Gelegenheit deklariert: ›Südtirol ist nicht Italien!‹ Inzwischen gilt ein Autonomiestatus, und der ist den Südtirolern heilig. Jeder Einwohner muss sich praktisch von Geburt an einer Sprachgruppe zugehörig erklären. Schulen und Sportvereine teilen sich nach Sprachen auf, Posten und Ämter werden danach besetzt. Im öffentlichen Dienst darf niemand arbeiten, der nicht per Sprachprüfung nachgewiesen hat, dass er Deutsch kann. Die deutschsprachige Bevölkerung will auf diese Weise ihre Kultur und Sprache schützen. Es gibt viele Familien, die lehnen es grundsätzlich ab, dass ihre Kinder überhaupt Italienisch lernen. Allein der jahrzehntelange Streit um das Denkmal am Waltherplatz in Bozen illustriert den tiefen Graben zwischen den Einwohnern der nördlichsten italienischen Provinz.«
»Walther? Ich kenne nur Walter White«, sagte Sue schmunzelnd.
»Wer soll das denn sein?«, fragte ich.
Jetzt richtete sie sich von ihrem Luxusbett plötzlich auf, und ihre Sätze schossen regelrecht aus ihrem Mund.
»Sie belehren mich hier die ganze Zeit und haben absolut keine Ahnung von der Welt.«
»Was für eine Welt?«
»Walter White ist eine der bekanntesten Figuren der Moderne, ein Gesamtkunstwerk aus Breaking Bad.«
»Aus was?«
»Breaking Bad! Die Serie. Mann, Sie haben aber auch gar keine Ahnung. Walter White ist ein braver Chemielehrer, der entdeckt, dass er sterben muss, und einen Drogenring aufbaut. Das kennen Sie natürlich nicht. Das ist so, als würde ich in Ihrer Welt Leonardo da Vinci nicht kennen. Ihre Von-oben-herab-Tour geht mir auf die Nerven. Sie faseln die ganze Zeit über die Vergangenheit, aber die Gegenwart ist Ihnen egal.«
»Das stimmt nicht. Ich sage nur, dass man die Gegenwart nicht versteht, wenn man die Vergangenheit ignoriert.«
»Sie verstehen die Gegenwart schon mal gar nicht. Aber ich habe hier und heute ein echtes Problem«, schimpfte sie.
Eine Weile schwiegen wir uns an.
Südtirol
Es war mittlerweile vollkommen dunkel geworden, und wir rasten über die Autobahn in Richtung Süden.
»Also los, jetzt erzählen Sie mir schon was über Ihren Walther auf dem Waltherplatz in Bozen.«
»Walther von der Vogelweide.«
Sie prustete los, immer noch aufrecht sitzend: »Ach der! An den kann ich mich erinnern. Das musste ich mal in der Schule kurz vor dem Abitur interpretieren. Ich habe mich kaputtgelacht. Die treiben es da draußen auf einer Wiese, und dann schreibt der immer Tandaradei. Ich habe mich gekringelt vor Lachen. Komm, machen wir mal Tandaradei, sagte damals mein Lover, weil ich das so lustig fand.«
»Das ist ein sehr berühmtes Gedicht.«
»Warten Sie!«, sagt Sue. »Ich lade das mal eben runter.« Sie las vor: »›Unter der Linde, an der Heide, wo unser beider Bette war, da könnt ihr schön gebrochen finden Blumen und Gras vor dem Walde in einem Tal, tandaradei, schön sang die Nachtigall.‹ Ich lach mich kaputt«, höhnte Sue.
Jetzt war ich sauer. »Das ist ein mittelalterliches Meisterwerk. Dieser Dichter hat die deutsche Sprache und Literatur über Jahrhunderte geprägt, bevor die von Ihnen so gelobte junge Generation sie versaut hat, weil sie keine Präpositionen mehr verwendet, vom Genitiv ganz zu schweigen.«
»Und wenn schon. Tandaradei.« Sie prustete schon wieder vor Lachen und ließ sich auf die Liege fallen. Plötzlich wurde sie still. »Ich habe jetzt sogar gelacht«, sagte sie leise, »dafür sollte ich Ihnen eigentlich dankbar sein. Seitdem, na, seit dem Problem, habe ich keine einzige Sekunde mehr gelacht.« Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie: »Ich habe einen Fehler gemacht, einen Fehler, der so groß ist, dass er mein ganzes Leben zerstören kann, und ich muss mich jeden Tag aufs Neue zusammennehmen und mir sagen: Mach einfach weiter, denk nicht zu viel nach, du musst aus der Sache irgendwie herauskommen. Kämpfe und lass den Kopf nicht hängen.«
»Ich nehme an, Sie wollen mir nicht sagen, was Sie so bedrückt«, sagte ich.
Sie schwieg eine Weile, dann entgegnete sie: »Ich werde wohl allein damit fertigwerden müssen, schätze ich. Meine Versuche, Sie zu engagieren, sind ja offenbar gescheitert. Aber dennoch würde ich gern wissen, was jetzt mit Walther von der Vogelweide los war.«
»Okay«, sagte ich. »Die Südtiroler stellten 1889 das Denkmal für Walther von der Vogelweide als Symbol für alles Deutsche und Bollwerk gegen Italien auf ihren schönsten Platz. Dass der Dichter übrigens niemals in Südtirol war – zumindest gibt es dafür keinen einzigen Beweis –, spielte keine Rolle. Dann verlor wie gesagt das österreichische Kaiserreich den Ersten Weltkrieg, und Italien marschierte in Südtirol ein. Seitdem gibt es einen erbitterten Streit zwischen Deutschen und Italienern um das Denkmal. 1933 wurde der marmorne Walther von den italienischen Faschisten an eine unauffällige Stelle im Roseggerpark versetzt und durfte erst 1981 auf den Waltherplatz zurückkehren.«
»Ich kapier das nicht: Was ist so strittig an einem, der Liebesgedichte deklamiert?«
»Die Sprache, die Menschen sprechen, steht für Identität – und hier in Südtirol für Abgrenzung. Auch wenn die Sprache ja dafür erfunden wurde, Menschen zu verbinden, haben die Südtiroler hier einen eisernen Sprachvorhang errichtet. Ich kann mich an Abendessen bei mir zu Hause erinnern, zu dem deutsch- und italienischsprachige Freunde aus Südtirol kamen. Das war mühsam. Das fing schon damit an, dass die deutschsprachigen Südtiroler am liebsten um 18 Uhr am Abendbrottisch saßen und die Italiener erst nach 20.30 Uhr kamen. Die Gespräche waren zäh, weil es den Italienern schwerfiel, ein wenig Deutsch zu sprechen, und die deutschsprachigen Südtiroler sich schwertaten, sich auf Italienisch zu unterhalten. Dabei hatten alle mindestens neun Jahre Sprachunterricht gehabt. Damals begriff ich zum ersten Mal, wie tief dieser Graben zwischen den Sprachgruppen ist.«
»Da war auch was mit diesem Freiheitskämpfer Andreas Hofer. Von dem gibt es doch auch Denkmäler.«
»Dieser Andreas Hofer wurde allerdings Mitte des 18. Jahrhunderts geboren und stand gar nicht für Freiheit, wie Sie sie sich vorstellen. Er war stockkonservativ und wollte, dass vor allem die Kirche und der Kaiser in Österreich ihre Macht behielten. Dem passte es nicht, dass die bayerisch-französischen Herrscher Südtirol modernisieren wollten, dass der Einfluss der Priester beschränkt werden sollte und dass es eine obligatorische Pockenimpfung geben sollte.«
»Mann, ist das cool: Der war Impfgegner. Das ist ja der Hammer. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe immer gedacht, dass erst Covid Impfgegner hervorgebracht hat.«
»Nein, Andreas Hofer war zweifellos ein Impfgegner, er war gegen die Pflicht zur Pockenimpfung, weil er glaubte, den Menschen würde ›bayerisches Gedankengut‹ eingeimpft, was absolut unsinnig war. Er zettelt einen militärisch völlig sinnlosen und wirkungslosen Aufstand an. Aber im Nachhinein wird er zum Freiheitshelden der deutschsprachigen Mehrheit Südtirols hochstilisiert, der angeblich gegen die italienischen Besatzer kämpfte, da er ja in Italien, in Mantua, hingerichtet wurde. Das glauben noch heute viele Südtiroler, aber Andreas Hofer hat nie gegen Italiener gekämpft, und dass er in Mantua hingerichtet wurde, hat nur damit zu tun, dass Mantua damals unter französischer Kontrolle stand. Hofer ist gegen die Modernisierungsversuche der Franzosen vorgegangen, die später von seinem geliebten Österreich genau so übernommen wurden.«
»Ich finde das aber toll, dass die an Traditionen festhalten. Die Trachten sind klasse, das Dirndl ist cool. Ich war mal auf dem Traubenfest, und meine TikTok-Videos im Dirndl haben mir jede Menge Klicks gebracht. Da kommt mir eine Idee«, sagte sie. »Ich mache noch einen Videoclip im Dirndl, der wird heißen Unite: Hört auf zu streiten, steht zusammen!«
»Das würde ich nicht tun«, sagte ich. »Das bugsiert Sie in die Extremistenecke.«
»Wieso das denn?«
»Es gibt eine ziemlich rechte Bewegung, die nennt sich ›Ein Tirol‹, die wollen den Wiederanschluss an Österreich. Ich glaube nicht, dass Sie mit denen was zu tun haben wollen.«
»Kann man hier nichts sagen, ohne dass es gleich Ärger gibt?«, fragte Sue und fuhr dann fort: »Wissen Sie, was Südtirol für mich ist? Eine Oase, ein wundervoller Ort zum Leben. Morgens einen Kaffee im Hotel Imperialart in Meran, dann entspannen in den wunderschönen Thermen. Dieser Glaspalast ist phänomenal. Im warmen Wasser zu relaxen, mitten im Winter, ist doch wunderschön. Im Dezember über den romantischen Weihnachtsmarkt zu schlendern, ist cool. Ein richtig uriges Abendessen auf der herrlichen Aussichtsterrasse des Schlosses Thurnstein über Meran: herrlich! Ganz zu schweigen davon, dass man mit dem Snowboard Meran 2000 runterbrettern kann, während in den Hütten auf der Piste die Post abgeht.« Sie schwieg eine Weile. »Aber das war in meinem vorherigen Leben, als ich noch lachen konnte«, sagte sie plötzlich leise. »Jetzt steuere ich auf mein möglicherweise von mir selbst vollkommen verpfuschtes Leben zu. Da passe ich gut zu eurer Generation, ihr habt die ganze Welt kaputt gemacht. Wir werden die verschneiten Gipfel der Alpen sowieso nicht mehr sehen und auf Kunstschnee angewiesen sein, weil eure Generation alles versaut hat.«
»Sie wollen mir doch nicht ernsthaft vorwerfen, dass ich für den Kunstschnee verantwortlich bin«, sagte ich.
»Na klar sind Sie das.«
»Wie bitte? Wir haben die Partei der Grünen in Deutschland groß gemacht, wir haben gegen Atomkraft, das Endlager in Gorleben, die Startbahn West demonstriert.«
»Was für eine Startbahn?«, fragte Sue.
»Die Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Wir haben mit über 100 000 Menschen dagegen demonstriert.«
Sie fummelte an ihrem Handy herum. Das verdammte Ding wusste einfach immer alles besser.
»Ja, und dabei habt ihr glorreichen Protestierer sogar zwei Polizisten erschossen. Super! Uns beschuldigt ihr, Terroristen zu sein, wenn sich ein paar Aktivisten an einem Bild festkleben.«
Wir schwiegen jetzt beide. Draußen war es mittlerweile stockdunkel geworden. Wir hatten die österreichisch-italienische Grenze überquert und fuhren auf Bozen zu.
»Sie haben recht«, sagte ich nach einer Weile. »Damals war die Gewaltbereitschaft viel höher. Viele, die eine bessere Welt wollten, sind schuldig geworden.«
»Und woran erkennt man Schuld? Wer ist schuld an dem eisernen Sprachvorhang, von dem Sie sprachen? Kaiser Franz Joseph?«
»Ohne den Ersten Weltkrieg wäre Südtirol vielleicht noch ein Teil des Kaiserreiches, wenn es das noch gäbe. Aber wäre das wirklich besser?«
»Was macht man gegen Schuld?«, fragte sie plötzlich.
»Die Katholiken haben Wallfahrten nach Rom oder an andere Heilige Stätten unternommen, um Buße zu tun und einen Ablass zu erringen«, sagte ich.
»Aber man muss zu Fuß gehen, oder? Sonst ist es kein Pilgern«, wollte Sue wissen.
»Quatsch! Das Wandern dabei ist eine neue Mode. Ein Pilger darf jedes Transportmittel benutzen. Der ›pelegrinus‹ ist im Kirchenlatein einfach nur ein Mensch, der aus Glaubensgründen in die Fremde zieht.«
»Und klappt das mit der Sühne und dem Schulderlass an Wallfahrtsorten?«
»Keine Ahnung. Es gibt Menschen, die ihre Schuld regelrecht ablegen können an einem heiligen Ort. Die können danach befreit weiterpilgern.«
»Ich glaube, ich habe keine andere Wahl …«, sagte sie plötzlich ernst, »als es auszuprobieren. Ich könnte Ihre Hilfe wirklich gut brauchen, und ich würde Sie gut bezahlen.«
»Wobei soll ich überhaupt helfen?«, fragte ich.
»Das weiß ich noch nicht«, sagte sie.
»Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich mitgenommen haben, aber ich glaube, Sie werden sehr gut ohne mich zurechtkommen.«
»Dann eben nicht«, sagte sie.
Wir schwiegen jetzt beide wieder.
Der Wagen bog mittlerweile auf die Schnellstraße ab, die von Bozen nach Meran führt.
»Trotz allem sind Sie heute Nacht mein Gast«, sagte sie.
»Auf keinen Fall«, sagte ich.
»Das Zimmer ist schon bezahlt, es ist nichts Besonderes, liegt aber mitten in Meran, und um diese Zeit bekommen Sie in der Nähe sowieso nichts mehr. Ich habe Sie aufgehalten, also warum wollen Sie jetzt so unhöflich sein und meine Gastfreundschaft ausschlagen?«, sagte Sue in einem ziemlich anklagenden Ton.
»Gut«, sagte ich, »dann nehme ich dankend Ihre Gastfreundschaft an.«
Als der Wagen hielt, dachte ich, das sei ein Irrtum, aber Sue stieg aus. Wir standen direkt an dem Fluss Passer vor einem der schicksten Hotels der Gegend, dem sündhaft teuren Thermenhotel im Stadtzentrum von Meran.
»Sie hatten gesagt, es sei nichts Besonderes«, stotterte ich.
»Sie haben auch nur ein Standardzimmer«, sagte sie und stürmte zum Eingang. Ich nahm meinen Trolley und lief hinter ihr her.
Offensichtlich kannte die Belegschaft sie, gab ihr, ohne lang zu fragen, an der Rezeption eine Zimmerkarte, während sie nur bemerkte, dass ihr Fahrer alle Angelegenheiten, wie das lästige Registrieren, erledigen würde.
»Ich muss noch ins Fitnessstudio«, ließ sie mich wissen, und ich konnte gerade noch sagen: »Vielen Dank fürs Mitnehmen.« Dann verschwand sie im Fahrstuhl. Eine lächelnde junge Dame ließ mich wissen, dass ich einen Welcome Drink an der Bar bekommen würde, weil ich die Ehre hatte, in Sues Gefolge unterwegs zu sein. Ich nahm meine Zimmerkarte und ging in die in der Tat beeindruckende Bar. Die zahllosen Geweihe an den Wänden sind nicht unbedingt mein Geschmack, aber dieser Palmengarten-Stil der Bar hat wirklich Charme. Ich bestellte ein Weißbier, und der freundliche Kellner stellte mir alle möglichen Knabbereien auf die Theke. Ich hatte keine Lust, allein essen zu gehen, wollte aber auf keinen Fall den Rest des Abends mit Sue verbringen, also beschloss ich, die Nüsse zu verschlingen und daran zu denken, welche hervorragenden Restaurants in Meran ich heute Abend nicht besuchen würde.
Ich erinnerte mich an Dutzende Telefonate, in denen ich vergeblich versucht hatte, einen Tisch im Rametz zu bekommen. Ich kannte Gäste des Weinguts, die, nur um einen einzigen Abend dort zu verbringen, den Weg aus Deutschland auf sich nahmen. Die Lackner Stubn in Algund hatte ich ebenfalls in bester Erinnerung, allerdings bevor das gewaltige Einkaufszentrum in deren unmittelbarer Nähe den Charakter des Dorfs völlig veränderte. Ich kaute an meinen Kartoffelchips und dachte auch an meine Freunde im Schloss Thurnstein, an deren hervorragende Tafel ich mich heute Abend ebenfalls nicht setzen würde. Um meine Stimmung noch ein wenig düsterer zu gestalten, schaute ich mir den Hotelprospekt an, um zu erfahren, was ich alles verpassen würde.
Der Spa-Bereich sah fantastisch aus, aber ich hatte nicht einmal eine Badehose dabei. Ich hatte eine Menge Erfahrung darin, in Prospekten von Luxushotels nachzusehen, was ich alles verpassen würde. Während der Papstreisen war ich häufiger von Regierungen in schicke Hotels eingeladen worden. Aber das dichte Programm des Vatikans hatte es nie möglich gemacht, die luxuriösen Angebote der Hotels zu nutzen. Mir anzuschauen, was ich verpasste, hatte mir immer eine Art masochistisches Vergnügen bereitet. Plötzlich fiel mir wieder ein, dass ich in dieser Bar im Thermenhotel einmal eine Lesung veranstaltet hatte. Es war die typische gediegene Runde gewesen. Sue hatte recht. Ich war das Alte, Durchgekaute. Sie fing gerade erst an. Ich bemerkte, dass ich auf dem Weg war, in tiefes Selbstmitleid zu schlittern, was nach dem verkorksten Tag kein Wunder war, obwohl der Barmann sein Bestes gab, mich aufzuheitern. Nach einem zweiten Drink und noch mehr Nüssen beschloss ich, einfach schlafen zu gehen.
TAG 2
Südtirol
Ich verstand nicht, warum Sue in meinem Zimmer stand. Ich verstand nicht, warum es so hell war. Ich verstand auch nicht, wieso mir ihr Fahrer meine Hose zuwarf. Ich schaute auf meine Uhr. Verschlafen. Es war schon neun. Warum hatte ich den Wecker nicht gehört?
»Los, machen Sie schon, ziehen Sie sich an!«, rief Sue. Sie hatte den Vorhang weggerissen, das grelle Sonnenlicht blendete mich. Doc hatte meine Zahnbürste und eine Tube Zahnpasta in der Hand und bugsierte mich sanft ins Bad.
Ich putzte mir automatisch die Zähne. Als ich mir den Mund ausgespült hatte, schaffte ich es, endlich die naheliegendste Frage zu stellen: »Was soll das?«
Sue antwortet nur: »Für Ihre Dusche reicht die Zeit nicht mehr.«
Doc hielt mir zum zweiten Mal meine Hose hin, und erst in diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich außer einem Slip nichts anhatte. Ich streifte meine Hose über, allein schon aus einem Gefühl von Anstand, und zog mir ein Poloshirt über den Kopf. Dann drückte mir Doc einen Pappbecher mit Kaffee in die Hand.
»Das wird Sie wecken. Kommen Sie!«
Doc hatte meinen Trolley gepackt, Sue winkte mit meiner Zimmerkarte in der Hand, das Licht ging aus.
»Es ist wirklich ein Notfall. Kommen Sie!«
»Was für ein Notfall?«, fragte ich.
Wir liefen über den Flur.
Deinen Zug bekommst du sowieso nicht mehr, dachte ich, du musst heute Nachmittag fahren.
Als wir den Fahrstuhl erreicht hatten, war ich endlich wach genug, um mich zu wehren. Ich blieb einfach stehen, als der Fahrstuhl kam.
»Jetzt ist Schluss«, sagte ich. »Geben Sie mir sofort die Zimmerkarte zurück.«
Sue sah mich entsetzt an. »Das geht nicht. Nur dieses eine Mal. Sie müssen uns helfen. Bitte!«, sagte sie.
Doc schaute auf die Uhr. »Es ist Viertel nach neun«, sagte er mit einem Unterton, der bedrohlich klang.
»Was gibt es hier in der Nähe, das mit dem Volk der Frau zu tun hat, die aus dem Schädel trinkt und Gottes Boten auf die Schaukel setzt?«
»Wie bitte?«, fragte ich.
»Das Volk der Frau, die aus dem Schädel trinkt und Gottes Boten auf eine Schaukel setzt.«
»Was ist das? Wissen Sie es?«, fragte Sue. Und der ihr ergebene Doc fügte hinzu: »Wenn Sie uns helfen, fahre ich Sie nach Trient, da bekommen Sie noch den Anschlusszug nach Rom.«
Das klang gut, mehr verstand ich in dem Moment allerdings nicht.
Sue rief erneut den Fahrstuhl. »Das Hotel liegt ja Gott sei Dank mitten in der Stadt, alles ist von hier aus leicht zu erreichen. Wahrscheinlich müssen wir zum Dom. Da wird es ja wohl sein, wenn es um Gott geht.«
»Nein«, sagte ich, »wir brauchen das Auto, und Sie sagen mir endlich, was hier eigentlich gespielt wird. Ich dachte, Sie wollten eine Schuld loswerden, geht das nur im Expresstempo?«
Als wir unten angekommen waren, schob Sue mich sanft in den Van, und Doc raste aus der Tiefgarage.
»Wohin?«, brüllte er.
»Nach Naturns«, sagte ich.
Doc gab das Ziel ins Navi ein und sagte erleichtert: »Das sind nur 25 Minuten, das schaffen wir.«
Er donnerte mit einem Tempo, das ihn definitiv den Führerschein kosten konnte, durch Meran und bog in die Straße ein, die ins Vinschgau führte. Der Ort Rabland flog vorbei.
»Wir müssen zur Kirche des heiligen Proculus.«
Nach weniger als 25 Minuten standen wir vor dem kleinen Bau. Sue stieg aus und war kreidebleich. Dann brüllte sie: »Fuck, fuck, fuck! Das kann es nicht sein. Was für ein Mist! Wo haben Sie uns hingebracht? In eine miese kleine Kapelle. Es soll etwas absolut Einzigartiges sein. Jetzt ist es eh zu spät, die Zeit ist fast um«, schimpfte sie.
»Gehen wir hinein«, sagte ich.
Der kleine Raum war leer. Wir waren die einzigen Besucher.
»Das hier soll etwas Einzigartiges sein?«
Ich zeigte ihr die Proculus-Fresken. »Sehen Sie, dass der Heilige auf einer Schaukel sitzt? Das ist beispiellos, zufällig bei Restaurierungen entdeckt. Es stammt aus der Zeit vor den Karolingern, wahrscheinlich sind es Langobarden gewesen, die diese Fresken vor 1400 Jahren in Auftrag gegeben haben. Sehr wahrscheinlich sind es die ältesten Fresken im kompletten deutschsprachigen Raum. Das ist der Bote Gottes, ein Bischof, der auf der Schaukel sitzt.«
»Und was hat das mit einer Frau zu tun, die aus dem Schädel trinkt?«
»Der langobardische König Alboin zwingt seine Frau Rosamunde zu etwas Furchtbarem: Er lädt sie zu einem Gelage ein und gibt ihr eine Trinkschale, die aus dem Schädel ihres ermordeten Vaters geschaffen wurde. Rosamunde rächt sich, nimmt sich einen Geliebten, den Diener ihres Mannes, und flieht nach Ravenna. Es ist im Mittelalter das berühmteste Beispiel dafür, dass sich eine Frau keineswegs schämen muss, wenn sie sich einen Liebhaber nimmt. Rosamunde ist ein so gemeiner Akt zugemutet worden, dass ihre Wahl, mit einem Liebhaber durchzubrennen, vollkommen gerechtfertigt scheint.«
»Noch 20 Minuten«, drängte Doc.
»Das rätselhafte Volk der Langobarden verließ vor 1500 Jahren seine Heimat an der Elbe und tauchte im heutigen Ungarn auf, um dann in einem gewaltigen Tempo weite Teile Italiens zu erobern.«
»Schneller!«, befahl Sue. »Reden Sie schneller!«
»Ihre Sprache ist untergegangen. Nur ein paar Namen sind erhalten, die Liste ihrer Könige zum Beispiel, aber keine Texte. Nichts. Karl der Große zerstörte das Reich der Langobarden, und nach dem Untergang schrieb ein gewisser Pater Paulus Diaconus, der selbst langobardische Wurzeln hatte, die Geschichte dieses Volkes auf, aber auf Latein. Er erzählte von einer Höhle im Norden Deutschlands, in der römische Soldaten einen ewigen Schlaf schlafen und den Langobarden ihre Kraft geben würden. Es sind sehr seltsame Geschichten. Auf dem Weg nach Süden werden die Langobarden christlicher. Aber sie sind noch tief verstrickt in den Streit, wer oder was Gott ist.«
»Schneller, was hat das mit Gott zu tun?«
»Das ist im Grunde ganz einfach. Die Christen glauben an einen Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist. Das ist aber nicht ein Gott, sondern es sind drei. Deswegen ging es die ganze Zeit darum, was jetzt stimmt. Die einen sagten, dass Gott eine Dreieinigkeit sei, also zwar drei, aber doch eins.«
»Verstehe ich nicht.«
»Das verstanden die Langobarden auch nicht. Deswegen erklärten sie, dass es nur einen Gott gibt, Gott Vater, dass aber Jesus menschlich sei, was ja auch klar sei, weil man einen Gott nicht kreuzigen könne. Es muss also eine Zeit gegeben haben, als Gott noch allein war, also ohne Sohn. Die Menschen dieser Zeit haben überall in der christlichen Welt darum gestritten.«
»Wer ist der Typ auf der Schaukel?«
»Der heilige Proculus. Der war Bischof von Verona und überlebte die Christenverfolgung des römischen Kaisers Diokletian. Er starb um das Jahr 320 in Verona. Das ist alles bekannt. Aber warum wollten die langobardischen Künstler, dass er auf einer Schaukel sitzt? War das ein Code? Ein Zeichen? Es sollte den Pilgern auf jeden Fall etwas sagen, aber was? Wir werden es nie erfahren, auch die seltsame Darstellung der Schaukel wird ein Geheimnis der Langobarden bleiben. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Bild entstand, ahnten die Langobarden noch nicht, dass ihre Sprache verschwinden und ihre Herrschaft untergehen würde.«
»Wie kam das?«
»Sie griffen das Territorium des Papstes rund um Rom immer wieder an. Deswegen rief der Papst Karl den Großen zu Hilfe. Das Ergebnis war die Entstehung des Römischen Reiches des Mittelalters. Karl der Große wurde am Weihnachtstag des Jahres 800 in der Peterskirche zum römischen Kaiser gekrönt. Dieses Reich existierte bis zum letzten römisch-deutschen Kaiser, Franz II., im Jahr 1806. Der war Österreicher, deswegen liegt der Reichsschatz der deutschen Kaiser in der Hofburg in Wien.«
»Es ist kurz vor zehn«, schaltete sich Doc ein.
Sue verschwand durch die Kirchentür, wie von einer Tarantel gestochen. Plötzlich war es sehr still, und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal an diesem Morgen zur Besinnung zu kommen. Ich setzte mich in den Kirchenraum und wartete.
Nach etwa zehn Minuten tauchte Sue wieder auf, starrte aber auf das Display ihres Handys. Plötzlich tauchte eine WhatsApp auf, die aus einer einzigen hellen Seite in hellgrüner Farbe bestand.
Sue machte einen Luftsprung und rief: »YEEEEEES!«
Doc nahm sie in den Arm, und sie küsste ihn auf die Wange, dann bekam ich eine der heftigsten Umarmungen meines Lebens durch diese zierliche Frau und ebenfalls einen Kuss.
»Sie haben es geschafft! Den Ort hätten wir nie und nimmer gefunden.«
Ich machte mich los, aber Sue war nicht zu bremsen. Sie verkündete: »Doc fährt uns jetzt nach Meran ins Imperial. Da spendiere ich Ihnen das beste Frühstück Ihres Lebens. Sie haben es sich verdient.«
Ich wollte mich auf keinen Fall so abspeisen lassen. »Sie schmeißen mich aus dem Bett und benutzen mich zum Rätselraten, ohne mir zu sagen, was das Ganze soll?«, meckerte ich.
»Ich bezahle Sie dafür«, entgegnete Sue.
»Hören Sie endlich auf, mich so zu behandeln, als könnten Sie mich kaufen. Was bedeutet dieses grüne Display auf dem Handy?«
»Dass ich am richtigen Ort bin. Mein Pilgerstempel. Das ist Ihr Verdienst. Es heißt, dass ich den richtigen Startort für die Pilgerreise nach Rom gefunden habe.«
»Pilgerstempel sind auch so eine moderne Erfindung«, stöhnte ich. »Wer schickt Ihnen diese Rätsel?«
Sue druckste herum. Doc griff ein. »Sie weiß es nicht. Aber es gibt da einen ziemlich unangenehmen Verdacht. Es könnte von jemandem kommen, dem sie etwas Übles angetan hat und der sie jetzt in der Hand hat. Es gibt irgendwo ein Handy, von dem diese Nachrichten abgeschickt werden.«
Dieser Satz traf mich wie ein Schlag. Wie ein Blitz aus meiner Vergangenheit tauchte das Bild dieses verdammten Handys auf, das auf dem verrauchten Kaminsims in der Kälte gelegen hatte, hoch oben in den Bergen Mittelitaliens. Lag es immer noch dort? Hatte es sich plötzlich nach Jahren von allein zum Leben erweckt und dieses Rätsel abgeschickt, um mich an mein Vergehen zu erinnern? Unsinn, dachte ich, völliger Blödsinn. Was für ein Irrsinn geht dir da durch den Kopf?
»Ich will mich nicht länger zum Narren halten lassen«, sagte ich. »Ich möchte jetzt wissen, welchen Dreck Sue am Stecken hat.«
»Es geht Sie nichts an. Die Fragen stelle ich, denn ich zahle Sie ja auch«, erwiderte Sue.
Ein paar Augenblicke standen wir uns gegenüber wie festgefroren. Der Erste, der sich bewegte, war Doc. Er kam mit baumelnden Armen zu mir, wie ein kleiner Junge, der seinem Vater gestehen muss, dass er sich sein teures Fahrrad hat klauen lassen.
»Sue hätte das jetzt nicht sagen dürfen. Kommen Sie!«, sagt er. »Ich fahre Sie jetzt, wohin Sie wollen.«
Ich wollte mich zuerst brüsk abwenden, aber da ich nicht wusste, wie ich sonst von Naturns zu einem Bahnhof kommen sollte, folgte ich Doc zum Wagen. Sue blieb einfach stehen. Er wechselte einen Blick mit ihr, aber sie winkte ab. Offensichtlich wollte sie nicht mitkommen.
Ich stieg ein und sagte: »Bring mich zum Bahnhof in Trient.« Doc nickte. Wir schwiegen eine ganze Weile, dann sagte er: »Es tut mir leid. Sue hätte Sie nicht so …«
»… wie einen Callboy behandeln sollen?«, fragte ich. »Aber nichts für ungut: In ein paar Stunden bin ich in Rom. Dann ist das Kapitel abgeschlossen.«
Trient
»Die Braut im Meer trägt zum ersten Mal Weiß.«
Wir waren schon auf die Straße abgebogen, die nach Meran führte, als Docs Telefon klingelte und er den Anruf über die Anlage des Autos annahm. Es war Sue: »Du musst zurückkommen. Heute sind es zwei. Ich dachte, an jedem Tag ist es nur eins, aber heute sind es zwei. Wir haben vier Stunden Zeit. Sie sagt, dass es etwas Einzigartiges ist: Die Braut im Meer trägt zum ersten Mal Weiß.«
»Wie bitte?«, fragte Doc.
»Hör doch zu! Es geht um eine Braut im Meer, und die hat weiße Klamotten an. Das Ganze ist der komplette Schwachsinn. Jede Braut hat weiße Kleider an. Wieso soll diese Braut ausgerechnet im Meer zum ersten Mal weiße Sachen anhaben? Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber offensichtlich ist es irgendwas am Meer. Der nächste Punkt am Meer ist an der Adria. Da fahren wir jetzt hin«, sagte sie.
Ich weiß nicht, warum, aber in diesem Moment gewann der Besserwisser in mir wieder die Oberhand: »Es ist nicht am Meer«, sagte ich.
»Was?«, rief sie ins Telefon. »Es ist nicht am Meer? Woher wissen Sie das?«
»Das müssen Sie schon selbst herausfinden«, brummte ich.
»Habe ich längst gegoogelt: Wenn ich das Wort ›Braut‹ eingebe, kommen jede Menge Wedding-Planer heraus.«
»Sie sollten mal nachdenken, statt zu googeln.«
»5000«, sagte sie. »Wenn Sie mir helfen, 5000 Euro, jetzt sofort.«
»Ich bin nicht käuflich«, sagte ich.
Es war eine Weile still am Telefon. Dann legte sie auf.
Doc schnaufte hörbar und dachte offensichtlich über etwas nach.
»Sie ist kein schlechter Mensch«, sagte er. »In ihrer Welt ist es eben so. Du zahlst, und du bekommst, was du willst. Sie wollte Sie nicht beleidigen.«
»Mir ist das jetzt einfach zu kindisch: Solange ihr mir nicht erklärt, worum es hier wirklich geht, müsst ihr allein zurechtkommen.«
»Ich kann es Ihnen nicht erklären. Aber ich weiß, dass sie jetzt Ihre Hilfe braucht.«
Ich schwieg und versuchte herauszufinden, was schwerer wog: meine Gereiztheit oder mein aufkommendes Schuldgefühl, weil ich eine junge Kollegin im Stich ließ. »Wir fahren dort sowieso vorbei«, sagte ich schließlich.
»Wo?«
»An der Braut in Weiß. Es ist in Trient. Drehen Sie um: Wir holen sie ab.« Doc tippte Sues Telefonnummer in das Display des Autos. Er klang erleichtert, als er ihr ankündigte: »Wir holen dich ab, warte bitte, wir sind gleich da.« Sie saß in Naturns in einem Café. Als wir davor hielten, machte sie gerade Selfies mit einem Apfelstrudel. Sie ließ den Kuchen, der unter einem Berg Sahne begraben war, ohne Bedauern mit einem 20-Euro-Schein auf dem Tisch liegen, stieg in den Van, vertiefte sich in ihr Handy und postete eine Instagram-Story.
»Sorry, ich muss halt auch hart arbeiten für mein Geld«, erklärte sie mir, als sie wieder aufschaute. Ich sagte nichts dazu. Sue legte plötzlich ihre Hand auf meinen Arm. »Ich weiß, dass Sie auf eine Erklärung warten, aber ich darf es Ihnen nicht sagen«, flüsterte sie in dem Ton, mit dem sie vermutlich als kleines Mädchen ihren Vater um den Finger gewickelt hatte: »Es würde alles kaputt machen.«
»Passt schon. Ich habe kapiert, dass Sie mich ausnutzen. Aber ich muss sowieso nach Süden«, sagte ich so schnippisch, dass es mir gleich wieder leidtat.
»Woher wissen Sie das alles?«, fragte sie.
»Was?«, fragte ich.
»Na, die Antworten auf die Rätsel.«
»Italien war mein Leben lang mein Job. Es ist so, als würden Sie einen Bäcker fragen, warum er backen kann.«
Wir schwiegen jetzt beide. Die riesigen Apfelplantagen Südtirols flogen an uns vorbei. Frauen und Männer auf Fahrrädern sausten durch das satte Grün an der Etsch. Ich dachte daran, dass viele Menschen aus den überfüllten Metropolen Mittel- und Süditaliens von einem solchen Idyll träumten, von der sauberen Luft und der malerischen Landschaft, die nicht überall zubetoniert worden war. Ich dachte an eine römische Freundin, die immer wieder erzählte, dass kaum etwas sie so beeindruckte wie die Weihnachtsmärkte in Südtirol. Für viele Italiener war das der Inbegriff der Romantik.
Plötzlich sagte Sue: »Ich habe da eine Frage. Was würden Sie über jemanden denken, der Sie zunächst nach Naturns zum heiligen Proculus schickt und dann nach Trient?«
»Dass er sich für Religion interessiert?«
»Und wieso?«
»Die Proculus-Kirche ist ein Kleinod der Religion, und in Trient fand eines der wichtigsten Kirchenkonzile der Geschichte statt.«
»Wieso in Trient und nicht in Rom?«
»Der deutsche Kaiser wollte eine gewisse Kontrolle über das Konzil behalten, und es sollte deswegen in der südlichsten Stadt, die unter deutschem Einfluss stand, und der nördlichsten Stadt des Papst-Imperiums stattfinden. Heute hat sich die Grenze zwischen dem deutschen und dem italienischen Sprachraum verschoben. Im Trentino gibt es, anders als in Südtirol, kaum mehr einen deutschsprachigen Einfluss, obwohl Trient jahrhundertelang, wenn auch mit Unterbrechungen, erst unter bayerischem, dann österreichischem Einfluss stand.«
»Das heißt, wenn ich jemanden auf eine Pilgerreise schicke, die in Naturns beginnt, muss er auf dem Weg nach Rom über eine Sprachgrenze.«
»Ja sicher!«
»Also wird der Pilger jemanden brauchen, der Italienisch kann und sie oder ihn begleitet.«
»Das wäre sicher besser.«
»Wieso haben Sie an dem Abend mit mir eigentlich teilgenommen?«, fragte Sue.
»Das wissen Sie doch«, antwortete ich überrascht. »Dr. Wolfram hat mich engagiert.«
»Und da haben Sie zugesagt?«, fragte Sue jetzt mit einem seltsamen Unterton. »Obwohl Sie wussten, dass Sie keine Chance gegen mich haben würden? Das wundert mich. Es ist doch ein seltsamer Zufall, dass mir der Berater, den ich in Italien brauchen würde, sozusagen vor die Füße geschubst wird«, sagte Sue.
Die Ausfahrt Trento Nord tauchte jetzt auf. »Sie müssen hier herunter«, sagte ich zu Doc. »Zum Castello del Buonconsiglio.«
»Ein Schloss?«, fragte Doc.
»Ja, aber nicht irgendein Schloss. Ich habe keine Ahnung, welches Spiel Sie da spielen und wer Ihnen diese Rätsel aufgibt, aber ich glaube, da sollen Sie hin.«
Doc setzte uns am Eingang ab, während er einen Parkplatz suchte. Sue schaute sich den imposanten Bau an. »Hat hier ein König gewohnt?«
»Nein, meistens ein Bischof.«
»Echt? Der ließ es aber krachen. Ich habe mir mal die Residenz angeschaut, die der Luxusbischof aus Limburg sich gebaut hat. Gemessen an dem hier, war das aber sehr bescheiden. Und wo ist jetzt die Braut im Meer?«
Eigentlich hatte ich gleich hinüber zum Bahnhof gehen wollen, aber jetzt bekam ich doch Lust, das Castello zu besichtigen. Ich war lange nicht hier gewesen, und zu Hause wartete außer meiner Arbeit am Laptop nichts und niemand auf mich. Meine Frau und mein Sohn waren für drei Wochen bei Verwandten in den USA.
»Kommen Sie«, sagte ich versöhnlich, »ich zeige es Ihnen.«
Es war ein ganz normaler Werktag, und das Schloss war so gut wie leer. Ich konnte Tickets bekommen, inklusive für den Adlerturm. Die wenigen Touristen verloren sich in dem weitläufigen Gebäude. Wir stiegen die Treppen hinauf und hatten Glück, dass wir nicht warten mussten: Der Adlerturm wurde gerade aufgeschlossen. Sue und Doc blieben in dem Zimmer mit dem berühmten Zyklus der Monate stehen.
»Wow«, sagte Sue. »So etwas habe ich noch nie gesehen.«
»Kein Wunder: Dieser Freskenzyklus ist wirklich beispiellos. Denn die Bilder beschreiben das Alltagsleben der Menschen, über das wir nur sehr wenig wissen. Nahezu alle anderen Maler dieser Zeit zeigten immer nur religiöse Motive.«
»Maria und Josef, gekreuzigter Christus, gefolterte Heilige?«, bemerkte Sue grinsend.
»Genau. Aber dann kommt etwa um das Jahr 1400 ein Künstler nach Trient, über den man fast nichts weiß, außer dass es sich wahrscheinlich um den sogenannten Meister Wenzeslaus handelte, der mit dem Bischof Georg von Liechtenstein, der den Turm hier umbauen ließ, nachweislich in Verbindung stand. Diesem Maler verdanken wir einen einmaligen Blick in das ganz normale Leben von Adel und Bauern vor über 600 Jahren.«
»Das sind ja gemalte Videoclips. Eigentlich war der Typ eine Art Kollege von mir, oder?«, fragte Sue.