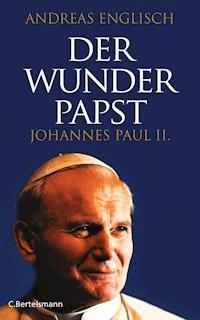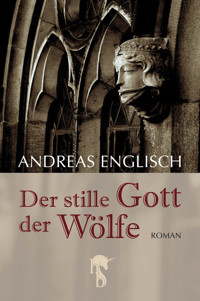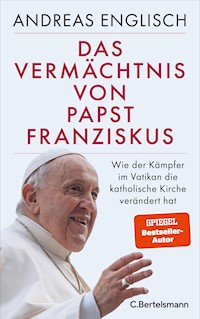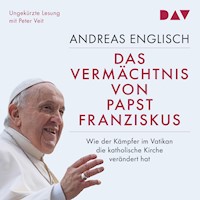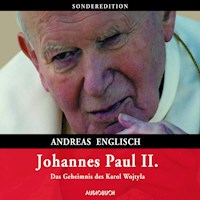9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Andreas Englisch auf der Suche nach Wundern, Marienerscheinungen, Seligen und Heiligen
Gibt es Wunder wirklich? Vatikanexperte Andreas Englisch hat sich auf die Suche gemacht nach den Spuren des Unerklärlichen in unserer Welt. Auf eigene Faust oder mit Päpsten wie Johannes Paul II. oder Benedikt XVI. ist er an zahlreiche Orte gereist, an denen sich Wunder manifestieren und von denen besondere Kraft auszugehen scheint: Pilgerstätten wie Lourdes, Fátima, Medjugorje, Guadalupe, La Salette oder Civitavecchia. Er hat beobachtet, wie vermeintliche Wunder vom Vatikan wissenschaftlich untersucht werden, und überrascht verfolgt, wie Exorzisten für ihren Einsatz gegen den Satan gelobt werden. Aber vor allem hat Andreas Englisch mit Menschen gesprochen, die Wunder erlebt haben wollen, die Madonnenstatuen Blut weinen sahen und die Auferstehung von Toten bezeugen können. Sein Buch zeigt, dass wir immer wieder von Wundern überrascht werden können, wenn wir für die Spuren Gottes in unserer Welt empfänglich bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Englisch
Gottes Spuren
Die Wunder der katholischen Kirche
Buch
Gibt es Wunder? Hinterlässt das unerklärliche Wesen, das wir Gott nennen, auf der Erde Spuren? Beweisen diese Wunder, dass Gott existiert? Andreas Englisch nimmt den Leser mit auf eine Reise an die Grenzen des Vorstellbaren. Neugierig und skeptisch zugleich traf sich der Autor mit Zeugen, die Wunder erlebt haben wollen, sprach mit Menschen, die Madonnenstatuen Blut weinen sahen oder die Auferweckung einer Toten bezeugen, begegnete Teufelsaustreibern und Menschen, die als Heilige gelten. Andreas Englisch beobachtete, wie Papst Johannes Paul II. vermeintliche Wunder wissenschaftlich untersuchen ließ, und verfolgte erstaunt, wie Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz die Exorzisten der katholischen Kirche empfing und sie für ihren Einsatz gegen den Satan lobte. Doch was sein Buch über die profunde Recherche an Orten wie Lourdes, Fátima, Medjugorje, Guadalupe, La Salette und Civitavecchia hinaus zu etwas Besonderem macht, ist seine persönliche Haltung, bei der er sich eine offene Wahrnehmung für Signale Gottes bewahrt – auch an ihn selbst.
Autor
Der Journalist Andreas Englisch arbeitet seit 1987 als Korrespondent im Vatikan. Er stand in engem Kontakt zu Papst Johannes Paul II., den er auf vielen seiner Auslandsreisen begleitete. Auch seit der Wahl des deutschen Papstes Benedikt XVI. gehört er dank seiner exzellenten Verbindungen zu den am besten informierten Journalisten im Vatikanstaat. Seine Biografien »Johannes Paul II.« (2003) und »Habemus Papam« (2005) standen monatelang auf den Bestsellerlisten.
Im Goldmann Verlag ist von Andreas Englisch außerdem erschienen:
Habemus Papam (15415)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Hinweis
Sämtliche Bibelstellen in diesem Buch werden nach der Einheitsübersetzung zitiert, die im Neuen Testament und in den Psalmen »ökumenischer Text« und für den Gebrauch beider Konfessionen bestimmt ist. Auch die Schreibweise biblischer Orts- und Eigennamen folgt der Einheitsübersetzung.
Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright © der Originalausgabe 2006 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt unter Verwendung eines Motivs von buchcover.com/E Rothe Redaktion: Robert Fischer (www.vrb-muenchen.de) KF · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-24136-0V003
www.goldmann-verlag.de
»Für die, die mit echtem Glauben beten, wirkt der Herr auch heute noch Heilwunder.«
Johannes Paul II.
»Der Glaube an Gott und sein Wort unterscheidet sich von allem menschlichem Glauben, Vertrauen, Meinen. Die Gewissheit, dass Gott redet, gibt mir die Sicherheit, dass ich der Wahrheit selbst begegne, und damit eine Gewissheit, die in keiner menschlichen Form von Erkenntnis sonst vorkommen kann. Es ist die Gewissheit, auf die ich mein Leben baue und der ich im Sterben traue.«
Benedikt XVI.
Inhalt
Buch und Autor
Copyright
Widmung
Prolog
1 Die höchste Schule der Liebe
2 Gibt Gott dem Bösen eine Chance?
3 Der Bischof, der mit dem Satan sprach
4 Der Papst als Exorzist
5 Nimmt der Teufel einen Auftrag an?
6 Wirken Päpste Wunder?
7 Maria im Industriegebiet: »So sieht es also aus, wenn Gott eingreift?«
8 Medjugorje: Verlogenes Komplott um Maria?
9 Die dunkle Seite der Wunder
10 Das Wunder von Fátima: Wie grausam ist die Muttergottes?
11 Papst Pius IX., das Mädchen Bernadette und die rätselhafte »Dame«
12 Wunderhauptstadt Lourdes
13 Die Jungfrau und der Indio
14 La Salette und die Grenze zwischen Wunder und Betrug
15 Wer Gott berührt
16 Die Waffe Gottes
17 Spuren Gottes am Golf von Neapel?
18 Das Haus der Heiligen Familie
19 Das Kreuz Christi
20 Der Leib Christi
21 Das Phantom des Klosters
22 Eine unerwartete Begegnung
23 Eine Spur Gottes?
Epilog
Danksagung
Register
Bildteil
Bildnachweis
»Spuren sind verheißungsvoll, denn wenn wir entdecken, dass sie uns wirklich zu Gott, dem Herrn, führen, wenn wir entdecken, dass sie von ihm kommen, dass es Winke sind in unser Leben hinein, in den Alltag unseres Lebens hinein, dann schauen wir mit anderen Augen in die Welt und blicken auch mit anderen Augen unsere Mitmenschen an. Dann entdecken wir plötzlich, wie schön die Welt ist, auch wenn wir durch manche Verkrustungen hindurchschauen müssen. Dann sehen wir im Lachen eines Kindes Spuren Gottes, auch in der Schönheit eines menschlichen Antlitzes. Ein solches Antlitz kann auch – und gerade deshalb – eine eigene Schönheit haben, wenn es alt ist, Runzeln hat und Falten wirft. Man muss lernen, die Augen aufzumachen, Spuren zu sehen, Spuren zu lesen. Dann entdecken wir immer wieder im Leben ganz unscheinbare Dinge, die wir sonst achtlos übergehen – Signale Gottes an uns.«
Kardinal Karl Lehmann
Prolog
Ich kann mich genau an den Tag erinnern, an dem die Geschichte dieses Buches beginnt, denn ich war damals mit meinem Sohn Leonardo von Papst Johannes Paul II. zu einer Privataudienz empfangen worden. Auf dem Rückweg versuchte ich ihm im Auto zu erklären, wer Petrus war – ein guter Freund von Jesus, der Kranke heilen und andere Wunder wirken konnte.
Mein Sohn war damals fünf Jahre alt. Der Besuch in dem großen Haus bei dem Papst in Weiß hatte ihn ganz aufgewühlt. Er hörte sehr genau zu und sagte dann: »Ach so, Petrus konnte also zaubern? So wie Glöckchen?«
»Glöckchen? Wer ist noch mal Glöckchen?«
»Na, Glöckchen, die Fee von Peter Pan. Sie kann zaubern.«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, aber ich spürte, dass er damit im Grunde genau das gefragt hatte, was auch mich mein ganzes Leben lang beschäftigt hatte:
Wirkt Gott in dieser Welt Wunder?
Greift das unerklärliche Wesen, das wir Gott nennen, in unser Leben ein, immer wieder und überall auf der Welt?
Kann man durch diese Wunder beweisen, dass Gott existiert?
Rettet uns Gottes Schutz manchmal das Leben?
Ist es ein Eingreifen Gottes, das Sterbenskranke doch überleben und unfruchtbare Paare dennoch ein Kind bekommen lässt?
Nichts hat mich je so gefesselt wie die Frage nach dem konkreten Wirken des Überirdischen in dieser Welt. Nichts fand ich je so spannend wie die Frage, ob es Wunder gibt, denn Wunder scheinen mir nichts anderes als eine Spur Gottes zu sein: Mit jedem Eingriff in das irdische Geschehen hinterlässt dieses rätselhafte Wesen so etwas wie einen Fingerabdruck des Unerklärlichen.
In meiner Kindheit und Jugend hielt ich Wunder für seltsame Ereignisse, die sich vor unvorstellbar langer Zeit zugetragen hatten: damals, als Jesus von Nazaret noch auf der Erde lebte, und vielleicht auch noch einige Zeit unmittelbar danach. Ich wuchs auf mit der Vorstellung, dass die Zeiten, in denen Wunder geschehen, endgültig vorbei seien. In meinem Alltag war ein Wunder für mich schlicht nicht mehr vorstellbar. Wer sollte noch heute über das Wasser gehen sowie mit drei Broten und zwei Fischen fünftausend Menschen speisen können?
Doch meine Meinung änderte sich schlagartig, als ich im Jahr 1987 nach Rom kam, um meinen neuen Job als Auslandskorrespondent anzutreten. Auf den ersten Blick schien Rom eine ganz normale Stadt zu sein. Zwar mochte es hier mehr Sehenswürdigkeiten geben als anderswo, mehr Touristen, mehr Hotels – aber ansonsten war es doch eine ganz normale Stadt. Tatsächlich dauerte es einige Monate, bis ich begriff, dass dieser Eindruck völlig falsch war. Die Wahrheit versteckte sich nämlich gut: Rom gab sich alle Mühe, um mit seinen Bürohäusern und den Staus auf den Straßen wie eine ganz normale Großstadt auszusehen, aber anders als in Lissabon oder Paris etwa war das hier alles nur Fassade. In Wirklichkeit bestand die komplette Innenstadt aus einem einzigen gigantischen Kloster, und hinter den Mauern war noch immer das Mittelalter lebendig. Immer noch gehörten der katholischen Kirche fast alle Gebäude – die moderne Stadt Rom hatte nur versucht, sich dazwischenzuquetschen und mit ihren Geschäften und Mietshäusern die wenigen Lücken auszufüllen, die das seit Ewigkeiten betende Rom der Moderne ließ. Ja, Rom glich mehr einer Zauberstadt als einer richtigen Metropole: Es kam mir so vor, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Die Menschen wirkten seltsam gebannt von der Allgegenwart unvorstellbar geheimnisvoller Schätze: In der ganzen römischen Innenstadt schienen seit Jahrhunderten Menschen vor dem Unerklärlichen zu knien. Ich entdeckte Mönche, die die Reliquien des Heiligen Kreuzes Jesu Christi in der Basilika Santa Croce in Gerusalemme eifersüchtig hüteten und für viele Jahrhunderte nur am Karfreitag zuließen, dass Menschen staunend davor standen in der Hoffnung, geheilt zu werden. Ich sah betende Kranke, die auf Knien die Heilige Stiege am Lateranspalast hinaufrutschten, und sprach mit Menschen, die meinten, tatsächlich geheilt worden zu sein. Ich entdeckte Patres, die am Tiber die Spuren von dem Fegefeuer entronnenen und auf die Erde zurückgekehrten Menschen bewahren wollten, und ich fand schließlich die vatikanische Behörde für Wunder, die Congregatio de Causis Sanctorum, in der unerklärliche Wunder daraufhin untersucht werden, ob sie tatsächlich ein Einwirken Gottes bezeugen. Und wenn ich mit Bischöfen sprach, die die Kongregation davon überzeugen wollten, dass sie selbst ein Wunder erlebt hatten – weil sie etwa eine Muttergottesstatue in der Hand gehalten hatten, die blutige Tränen weinte –, dann lag das Unfassbare für mich vor allem darin begründet, dass es sich nicht um Wunder handelte, die vor langer Zeit geschehen waren, sondern um solche, die heute geschehen: Wunder, die derjenige, der davon berichtete, selbst gesehen und bestaunt haben wollte.
Meine Aufgabe am Hof der Päpste brachte mich plötzlich und ohne dass ich etwas davon geahnt hätte, in einen direkten, unmittelbaren Kontakt mit Wundern. Ich wusste natürlich, was ein Papst ist – dass er den für einen Menschen schier unbegreiflichen Titel »Vertreter Gottes auf Erden« trägt. Aber ich hatte mir bis dahin nur wenig Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten sollte. Als ich in Rom anfing, regierte Johannes Paul II. im Vatikan, und ich erlebte immer wieder, dass dieser Mensch Karol Wojtyla absolut sicher war, mit dem ewig unerklärlichen Gott – dessen bloße Existenz von Milliarden Menschen auf der Erde bestritten wird – in einen direkten Kontakt treten zu können. Es gab viele Episoden, die das belegten, aber an einem Tag erklärte Johannes Paul II. deutlicher denn je, was er meinte. Da war er schon alt, der Mann aus Wadowice, und von der Parkinson-Krankheit gezeichnet, aber bezwungen hatte ihn das Leiden noch nicht. Er kämpfte, und er war ärgerlich an diesem Tag, dem 29. Mai 1994, an dem er nach dem Angelusgebet mit entschlossenem Gesicht der Welt entgegenschrie: »Versteht das doch endlich; versteht, warum der Papst so leiden muss.«
Mir lief damals ein Schauder über den Rücken, denn der alte Mann meinte damit klipp und klar, dass er gerade selbst ein Wunder erlebte: dass Gott beschlossen hatte, ihn, den Menschen Wojtyła, leiden zu lassen, weil die Menschen nicht nach den Gesetzen Gottes lebten.
Aber war das wirklich so? Spürte Karol Wojtyła den allmächtigen Gott? Konnte er mit ihm sprechen? Können Päpste im Vatikan Wunder nachweisen lassen? Gab es so etwas überhaupt, oder war das nichts weiter als eine gewaltige Lüge, eine Scharlatanerie, eine Illusion?
Dann wurde ein neuer Papst gewählt, und vor den überraschten Augen der Welt bestieg ein Deutscher den Thron Petri.
Ich hätte angenommen, dass der eher intellektuell veranlagte Joseph Ratzinger sehr viel vorsichtiger und nüchterner an die ganze Sache herangehen, dass er Wundern und Erscheinungen, den Spuren Gottes also, mit einiger Skepsis begegnen würde, doch dann kam es ganz anders. Ausgerechnet dieser Papst aus Deutschland entschloss sich zu einem spektakulären Schritt, der die ganze Welt in Fassungslosigkeit stürzte: Als erster Papst der Geschichte empfing Benedikt XVI. die Exorzisten der katholischen Kirche auf dem Petersplatz und bestärkte sie in ihrer Arbeit.
Was hatte das zu bedeuten?
Glaubte dieser bedeutende Theologe und herausragende wissenschaftliche Lehrer wirklich an die Macht der Gebete über das Böse? An den Fluch und die konkrete Gefahr, die von Satan auf der Erde ausgeht? An Dämonen und Besessenheit? An das Wunder der Befreiung von bösen Geistern und somit an die Macht des Exorzismus?
Nur wer ihn näher kannte, wunderte sich nicht über die Haltung des neuen Papstes. Familien, die im Borgo Pio jahrzehntelang zu seinem direkten Lebensumfeld gehört hatten, berichteten in diesem Zusammenhang, dass Joseph Ratzinger selbst von einem ganz bestimmten Wunder zutiefst beeindruckt worden sei – von einem Wunder, das sich in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zugetragen habe und über das man nur hinter vorgehaltener Hand sprach.
Und so war es auch Papst Benedikt XVI., der mich darin bestärkte, mich weiter mit jener Frage nach dem Unerklärlichen zu beschäftigen, die mich schon als jungen Korrespondenten in Rom bewegt hatte und die mich schließlich zu so etwas wie einem Detektiv in Sachen Wunder werden ließ. Das Ergebnis meiner Spurensuche halten Sie mit diesem Buch in den Händen. Und nicht zuletzt war ich auch meinem Sohn Leonardo noch eine Antwort schuldig auf seine Frage, ob Petrus tatsächlich so zaubern könne wie die Fee von Peter Pan.
1
Die höchste Schule der Liebe
Wirklich wichtige Treffen oder Konferenzen im Vatikan haben immer etwas Rührendes. Wenn die Mächtigen der Welt in den Vatikanstaat kommen, um die globale Ordnung zu diskutieren, wenn etwa der Präsident der US-Regierung sich mit dem Papst über Krieg und Frieden im Nahen Osten berät oder die Meinung des Vatikans in der Frage der Entwicklung Chinas gefragt ist, geschieht immer das Gleiche: Die Mitglieder solcher Gesprächsrunden können es einfach nicht fassen, wie winzig der Vatikan ist.
Oft habe ich dabei zugesehen, wie die langen, gepanzerten Autokolonnen durch die Pforten des Vatikanstaates verschwanden und deren Fahrer sich wunderten, dass es hinter den hohen Mauern nicht einmal genug Parkplätze für die Staatschefs gab. Mitglieder von Delegationen, die es gewöhnt sind, wie selbstverständlich die modernste Technik heutiger Kongresszentren zu nutzen, erlebten verständnislos, wie im winzigen Kongressgebäude von Radio Vatikan noch vierzig Jahre alte Projektoren sowie krächzende Lautsprecher und Mikrofone aus den 1970er-Jahren eingesetzt wurden.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Gespräch mit Jan Eliasson, dem damaligen Präsidenten der UN-Generalversammlung, am 17. Juni 2006. Nach seiner Unterredung mit Papst Benedikt XVI. zeigte er sich beeindruckt von genau diesem Gegensatz: dem Zwergstaat Vatikanstadt auf der einen Seite und der internationalen Dimension des päpstlichen Einflusses auf der anderen Seite.
Die katholische Kirche vertritt ihre Interessen nahezu überall auf der Welt. Noch die entlegensten Winkel der Erde – ob in den Wüsten Afrikas oder im Urwald von Sumatra – gehören zu irgendeiner Diözese. Die katholische Kirche hat den kompletten Globus in Kirchenbezirke aufgeteilt. Mit zwei Ausnahmen – dem Nord- und dem Südpol – gibt es überall auf der Welt, wo ein Mensch geboren wird, auch ein Bistum, das sich um ihn kümmern kann.
Diese internationale Dimension beeindruckt vor allem die Organisatoren von Großveranstaltungen. Denn mit dem Vatikan ist es wie mit der Geschichte vom Hasen und vom Igel: Er ist immer schon vor Ort, überall auf der Welt.
Was das für einen Unterschied macht, lässt sich an einfachen Beispielen verdeutlichen: Wenn etwa Tom Cruise einen neuen Action-Film wie »Mission: Impossible III« im italienischen Caserta dreht, dann muss der komplette Apparat aus Hollywood nach Italien verschifft werden. Die US-amerikanische Produktionsfirma bringt ihre eigenen Kameraleute mit, die eigenen Handwerker, Köche, Stuntmen und dergleichen. Es ist, als würde eine ganze Kleinstadt hinter Tom Cruise herziehen. Nötig ist der Aufwand, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass sich erfolgreiche Hollywoodfilme nur mit solchen Leuten bewerkstelligen lassen, die zur Produktionsmaschinerie von Hollywood gehören. Vor Ort wird dann meist nur der Lkw für die Stromproduktion gemietet.
Das Gleiche gilt für Rockkonzerte. Wenn die Rolling Stones auf Welttournee gehen, fliegen Hunderte von Bühnenarbeitern vor und hinter den Stones her, um das ganz besondere Gefühl eines Stones-Konzerts technisch zu ermöglichen.
Der Vatikan aber – und nur der Vatikan – kann bei seinen Großveranstaltungen wie den durchschnittlich 1,5 Millionen Besucher anziehenden Weltjugendtagen auf ein eingespieltes organisatorisches Netzwerk überall auf der Welt vertrauen. Päpste könnten sich einfach vor die riesige Weltkarte stellen, die im dritten Stock des apostolischen Palastes die Wand des Staatssekretariats schmückt, und mit dem Finger auf den Ort tippen, an dem das Event organisiert werden soll: Buenos Aires oder Denver, Paris, Sydney, Köln oder Toronto, kein Problem. Das dortige Bistum baut dann mit einem ganzen Heer von Freiwilligen die Kulisse für ein gigantisches Ereignis auf, zu dem aber nicht die Diözese selbst, sondern der Papst in Rom eingeladen hat.
Dieses weltumspannende Netzwerk kommt aber nicht nur der Planung und Organisation von Großveranstaltungen zugute. Die katholische Kirche betreibt eigene Krankenhäuser, Schulen, Kliniken oder Altenheime. Überall auf der Welt bekommen täglich Hunderte von Millionen Menschen kirchliche Hilfeleistungen in Form von Nahrungsmitteln oder Medikamenten, Ausbildung oder Heilung – nicht zuletzt aber auch in Form von Trost und Beistand. Das alles hat natürlich einen enormen Effekt: Es bindet eine Milliarde Katholiken an ihre Kirche, und diese Bindung ist trotz aller kirchlicher Krisen in der Regel viel enger als die Bindung eines Wählers an seine Partei oder eines Bürgers an seinen Staat.
Diesen gigantischen Einsatz für das Gute könnte sich kein anderer Staat auf der Welt leisten. Aus einem ganz simplen Grund: Er wäre unbezahlbar. Aber das System der katholischen Kirche funktioniert. Und zwar deshalb: Fast alle Mitarbeiter arbeiten gratis. Die Krankenschwestern und Kindergärtnerinnen der Kirche, die katholischen Ärzte und all diese Abermillionen Menschen, die direkt oder indirekt für die katholische Kirche arbeiten, machen das in der Regel ohne Rücksicht darauf, was das für ihren Lebensstandard bedeutet. Sie alle haben, wenn überhaupt, die kleineren Häuser und kleineren Autos; sie wohnen, wenn sie das Ordensleben gewählt haben, in winzigen, meist schlecht geheizten (oder, in heißen Ländern, schlecht gekühlten) Zimmern, und der Grund dafür, dass diese Leute das alles auf sich nehmen, das ist das wahre Wunder.
Warum freut sich eine Ordensfrau, die als Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus arbeitet, wo sie von Patienten herumkommandiert wird und nach zwölf Stunden unbezahlter Schicht todmüde in ihr Bett fällt, auf den nächsten Arbeitstag? Sie freut sich, weil sie gesehen hat, wie es Kranken allmählich wieder besser ging – weil eine Kranke zum ersten Mal wieder etwas gegessen hat, weil ein Kind zum ersten Mal nach einer Operation wieder aufstehen konnte –, und weil sie diese Menschen liebt. Und genau das ist das Erstaunliche an der katholischen Kirche: Sie basiert auf dem Prinzip Liebe.
Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so erstaunlich: Menschen sind eben nicht dann am glücklichsten, wenn sie in einem Sportwagen an einer Traumküste entlangfahren zu einem Galadiner, wo sie den Nobelpreis bekommen werden – sondern dann, wenn sie lieben. Jeder, der wirklich verliebt ist oder es einmal war, weiß, dass man nicht einmal eine Parkbank braucht, dass man auf dem nackten Boden sitzen und unendlich glücklich sein kann, weil der geliebte Mensch neben einem sitzt. Menschen können unendlich glücklich sein, wenn sie einen geliebten Menschen nur ansehen. Oft genügt es auch schon, an den geliebten Menschen zu denken. Aber keine Traumvilla, kein Luxusurlaub kann so glücklich machen wie der Blick eines geliebten Menschen. Natürlich stockt Menschen der Atem, wenn sie etwa beruflich befördert werden, sich ein Traumauto leisten können oder im Lotto gewinnen – aber das alles ist nichts, verglichen mit jenem Moment, in dem Menschen aus einem ganz anderen Grund der Atem stockt: weil nach längerer Zeit ein glühend vermisster, wirklich geliebter Mensch endlich anruft oder an der Tür klingelt. Viele Menschen warten hartnäckig darauf, dass sie sich endlich das Traumhaus, den Traumurlaub oder das Traumkleid leisten können – aber was ist das für eine Hartnäckigkeit, verglichen mit jener, mit der Liebende auf einen Geliebten warten: jahr-, ahrzehnte-, manche ihr ganzes Leben lang?
Ja, das größte Wunder der katholischen Kirche ist die Liebe.
Ich habe viele Reden von Staatschefs oder Präsidenten großer Organisationen an den Papst gehört, und bis zu diesem Punkt, dass die katholische Kirche auf selbstloser Liebe beruht, können eigentlich alle noch folgen. Was zu tiefster Verunsicherung führt, ist der Schritt danach: Es geht der Kirche nämlich um die Liebe Gottes. Wenn die katholische Kirche recht hat, dann liebt der unerklärliche Gott seine Geschöpfe, die Menschen, und jetzt sind wir bei dem Punkt, um den es eigentlich geht: Ist es vorstellbar, dass der unerklärliche Gott aus Liebe zu seinen Geschöpfen direkt in das, was auf der Erde geschieht, eingreift? Die katholische Kirche glaubt, ja, und hier unterscheidet sich der Vatikan vollständig von allen anderen großen Organisationen: Päpste glauben, dass an der Seite der Kirche nicht eine Ideologie oder eine Botschaft steht, sondern ein unermesslich mächtiges Wesen, von dem wir keine Ahnung haben, was es wirklich ist.
Als ich im Jahr 1987 nach Rom kam, umgab eine seltsame Aura den Vatikan. Gott schien ein tätiger Gott zu sein, der auf der ganzen Welt in rascher Folge eingriff und Wunder wirkte. Ein Grund für diese eigenartige Atmosphäre war die Zahl der Selig- und Heiligsprechungen durch Papst Johannes Paul II., die jede bis dahin vorstellbare Rekordmarke übertraf. Bis zum Ende seines Pontifikats sollte Johannes Paul II. in 198 Zeremonien 1338 Verstorbene selig- und 482 Kandidatinnen und Kandidaten heiligsprechen, und sofern es sich nicht um Märtyrer handelt, muss nach der Rechtsprechung der katholischen Kirche für jede Selig- oder Heiligsprechung ein Wunder zwingend nachgewiesen werden.
Das klingt genauso unglaublich, wie es ist: Der Vatikan überprüft in solchen Fällen tatsächlich mit aller ihm gebotenen Sorgfalt, ob der unerklärliche Gott in die Welt eingegriffen hat oder nicht. Konkret bedeutet das, dass eine Gruppe anerkannter Wissenschaftler unabhängig von der katholischen Kirche attestieren muss, dass etwas geschehen ist, das sich mit dem Kenntnisstand der Wissenschaft weder vereinbaren noch erklären lässt. Oft rufen – für unheilbar erklärte – Kranke in ihrer Not einen der verstorbenen Seligsprechungskandidaten um himmlische Hilfe an, und wenn sich später eine unerklärliche Heilung einstellt, wird der Vorfall daraufhin untersucht, ob es sich dabei wirklich um ein Wunder gehandelt haben könnte. Tausende solcher Vorkommnisse prüfte die katholische Kirche unter Johannes Paul II.; in kilometerlangen Gängen bogen sich die Regale unter den Akten der geprüften, der verworfenen und der anerkannten Wunder. Dieser Papst schien wirklich davon überzeugt gewesen zu sein, dass Gott dank der Fürsprache von Seligen und Heiligen eine Vielzahl von Wundern bewirkt.
Um die oben erwähnten Zahlen einordnen zu können, muss man sie in das richtige Verhältnis setzen: Seit der Schaffung des Verfahrens für Heiligsprechungen durch Papst Sixtus V. am 22. Januar 1588 bis zum Amtsantritt Papst Johannes Pauls II. am 16. Oktober 1978 waren insgesamt 302 Verstorbene heiliggesprochen worden. Johannes Paul II. allein fügte mit den 482 Heiligen seiner Amtszeit also mehr Heilige hinzu, als zuvor in fast 400 Jahren dazu erklärt worden waren. Tatsächlich hatten die meisten Päpste während ihres gesamten Pontifikats vielleicht zwei Kandidaten heiliggesprochen – Johannes Paul II. aber war dem Unerklärlichen mit unermüdlichem Eifer auf der Spur.
Dort oben im dritten Stock des päpstlichen Palastes an der nördlichen Ecke des Petersdoms lag damals also eine Wohnung, deren Bewohner sich in einer direkten Verbindung mit Gott stehen sah. Johannes Paul II. betonte das sogar immer wieder: Er glaubte tatsächlich, dass Gott vor seinen Augen und auch durch ihn, den Papst, wirkte.
Johannes Paul II. zelebrierte Teufelsaustreibungen, versuchte Menschen zu heilen, sah in einem kräftigen Wind, der am 25. Januar 1998 über Kuba wehte, das Eingreifen des Heiligen Geistes, der seine Pilgerreise auf die Insel unterstützte. Doch dann kam der 19. April des Jahres 2005. Johannes Paul II. war gestorben, ein neuer Papst wurde gewählt, und ich hielt es für sicher, dass Joseph Ratzinger sehr viel rationaler und kühler an diesen Aspekt der katholischen Kirche herangehen würde. Ich hielt den neuen Papst Benedikt XVI. für einen in erster Linie wissenschaftlich denkenden Theologen, für den dieser Teil der Geschichte des Christentums, in dem immer wieder einmal unerklärliche Vorfälle geschehen konnten, längst abgeschlossen war. Und meine Einschätzung schien sich zu bestätigen, als Benedikt XVI. wissen ließ, dass er viel weniger Menschen selig- und heiligzusprechen gedenke als sein bewunderter Vorgänger. Außerdem wolle er selbst keine Seligsprechungen im Petersdom zelebrieren – das sollten von nun an Kardinäle oder Bischöfe übernehmen –, sondern nur noch Heiligsprechungen.
Diese Entscheidungen schienen in Einklang mit jenem Joseph Ratzinger zu stehen, der sich sein ganzes Leben lang mit theologischen, historischen und philosophischen Fragen auseinandergesetzt hatte. Musste jemandem, der sich vor allem an Fakten und Begriffen orientierte, nicht allein schon die Vorstellung »unerklärlicher« Ereignisse befremdlich erscheinen? Mussten ihm Spekulationen über ein direktes Eingreifen Gottes auf Erden nicht suspekt vorkommen? Wie ein Rückfall in mittelalterlichen Zauberglauben?
Doch dann sagte ein Bekannter zu mir: »Papst Benedikt XVI. verteidigt Wunder, die selbst für andere Päpste Humbug waren. Denn Joseph Ratzinger hat etwas Seltsames erlebt. Unmittelbar in der Nähe seiner alten Wohnung erfuhr er durch einen Nachbarn von einem unglaublichen Wunder: der Wiedererweckung einer Toten. Das muss ihn stark geprägt haben.«
Ein Nachbar des langjährigen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, der die Wiedererweckung einer Toten erlebt hatte?
Ich hatte nie davon gehört und nicht den blassesten Schimmer, um wen es sich dabei handeln könnte.
Meine Spurensuche begann.
Mir war klar, dass ich sehr vorsichtig vorgehen musste und möglicherweise auch überhaupt nichts herausfinden würde. Denn es war gut möglich, dass dieser Mann aus der Nachbarschaft des Joseph Ratzinger, wer immer es auch war, die Einzelheiten dieses Wunders, die er ihm bereitwillig erzählt hatte, nicht vor einem Unbekannten wie mir ausbreiten würde. Es war also gut möglich, dass ich eventuell sogar den richtigen Mann finden, mir dieser aber nichts sagen würde – vielleicht auch nichts sagen durfte. Wenn für den heutigen Papst dieses Wunder ganz persönlich so wichtig war, dann hatte er möglicherweise darum gebeten, Stillschweigen zu bewahren – auch sein Vorgänger Johannes Paul II. hatte häufig so gehandelt.
Joseph Ratzinger wohnte vor seiner Wahl an der Piazza delle Mura Leoniane. Direkt unten im Haus befindet sich eine stadtbekannte Bar, die einstmals eine wahre Goldgrube war. Jahrzehntelang lag sie unmittelbar an der Endhaltestelle der wichtigsten Buslinie von Rom, der Linie 64, die vom Bahnhof Termini zum Petersdom und zurückfuhr. Generationen von Pilgern stärkten sich in dieser Bar, um danach von hier aus den Bus zurück zum Bahnhof zu nehmen, doch im Jahr 1999 wurde die Bushaltestelle verlegt, um den Platz für das Heilige Jahr 2000 neu und schöner zu gestalten. Damit blieben die Heerscharen, die bisher in die Bar gepilgert waren, aus, und Kardinal Joseph Ratzinger konnte hier relativ ungestört frühstücken. Ich sprach mit einer reizenden jungen Frau, die ihm immer einen Cappuccino zubereitet hatte, doch als ich sie danach fragte, ob sie einen Mann aus der Nachbarschaft kenne, der mit dem Papst bekannt gewesen sei und mit ihm über ein außergewöhnliches Ereignis, ein Wunder, gesprochen habe, sah sie mich an, als zweifelte sie an meinen geistigen Fähigkeiten. Damit war erst mal Schluss, weiter kam ich nicht.
Daraufhin beschloss ich, einfach den Weg nachzugehen, den der Kardinal Joseph Ratzinger so viele Jahre lang eingeschlagen hatte. Wenn er aus dem Haus kam, ging er zuerst nach links über die Straße, unter dem sogenannten Passetto hindurch (jahrhundertelang konnten die Päpste über diesen auf hohen Stützmauern von der Straße aus unerreichbar errichteten Fluchtweg vom Petersdom aus in ihre Festung, die Engelsburg, gelangen). Am Passetto gibt es eine internationale Buchhandlung, die Joseph Ratzinger regelmäßig besucht hatte, doch das Ergebnis meiner Nachforschungen enttäuschte mich: Joseph Ratzinger war zwar regelmäßig vorbeigekommen, hatte Neuerscheinungen in zahlreichen Sprachen bestellt – doch an dem Büchertisch gleich am Eingang, auf dem jene Werke auslagen, in denen es um Wunder ging, war er nicht ein einziges Mal stehen geblieben. Auch von einem Mann aus der Nachbarschaft, der ein Wunder erlebt haben wollte, wusste hier keiner etwas. Deshalb befragte ich andere Priester, die diesen Buchladen ebenfalls besucht und Kardinal Joseph Ratzinger gekannt hatten – aber auch von ihnen wusste niemand etwas über diese Geschichte. Daraufhin verlagerte ich meine Spurensuche auf die anderen Läden, an denen der Kardinal Joseph Ratzinger unterwegs vorbeigekommen war.
Alle wichtigen Geschäfte, die man braucht, wenn man am oder im Vatikan wohnt, befinden sich in der Fußgängerzone des Borgo Pio. Täglich pünktlich um 17.00 Uhr ging Kardinal Ratzinger hier vorbei. An der Ecke liegt ein Optiker. Ich fragte nach, und tatsächlich hatte Ratzinger hier seine Brillen reparieren lassen. Er brachte sie entweder selbst vorbei oder ließ sie von seiner Haushälterin Ingrid Stampa vorbeibringen – das war aber auch schon alles, was ich hier erfuhr.
Auf seinem weiteren Weg kam er bei einem Gemüsehändler vorbei, der ihm immer die besten Äpfel für seinen geliebten Apfelstrudel beiseitelegte. Aber von einem Wunder wusste man hier ebenso wenig wie in seinem Lieblingsrestaurant »Cantina Tirolese«, wo er in einer mit alten Geschirrtüchern dekorierten Nische auf einer Holzbank gesessen und das einfache Mittagessen genossen hatte. Auch in seinem zweiten Lieblingslokal – »Quattro Mori«, ein sardisches Restaurant, in dem der Besitzer noch heute zu bedauern scheint, dass Ratzinger meist Fleisch bestellte, obwohl man doch auf Fisch spezialisiert sei – erfuhr ich nichts Näheres. Dann aber, an einem heißen Sommertag im Jahr 2005, fand ich endlich die richtige Spur …
Zuletzt hatte ich noch die Kaffeebars ohne jeden Erfolg abgeklappert, die auf Ratzingers täglichem Weg lagen, als ich plötzlich vor einem Elektroladen stand. Allerdings schien es sich eher um die Sammlung eines Liebhabers von Elektroschrott zu handeln als um einen richtigen Laden – die Vitrinen waren mit unterschiedlichstem elektronischem Gerät vollgestopft, Teile von Lampen und kaputte Leuchtstoffröhren lagen auf dem Boden; der ganze Laden hatte etwas Chaotisches und passte somit überhaupt nicht zu dem systematisch-akribischen, stets »aufgeräumt« wirkenden Joseph Ratzinger.
Hinter der Theke saß ein schlanker, weißhaariger Mann und reparierte irgendetwas, als ich ihm die übliche Frage herunterratterte, ob er denn zufällig Kardinal Ratzinger gekannt und mit ihm über Wunder geredet habe. Danach wartete ich auf den üblichen Blick, mit dem ich daraufhin von oben bis unten gemustert wurde wie jemand, von dem man annahm, er habe wohl seinen Verstand verloren. Aber diesmal kam alles ganz anders. Der Mann stand auf, gab mir freundlich die Hand und meinte: »Ja, sicher. Ich kenne Benedikt XVI. Ich habe ihm von dem großen Wunder erzählt.«
»Was ist das denn für ein Wunder?«, fragte ich weiter, und der Mann erwiderte: »Eine seltsame Geschichte. Kommen Sie mit mir nach hinten, wenn ich sie Ihnen erzählen soll.«
Mit diesen Worten stand er auf, ging zur Tür und pfiff einen Jungen herbei, der auf den Laden aufpassen sollte. Dann führte er mich an den vollgestopften Regalen vorbei nach hinten, wo wir uns inmitten des Elektrogerümpels auf zwei Stühle setzen und in Ruhe unterhalten konnten.
Dort stellte er sich als Angelo Mosca vor. Dass er bereits neunundsechzig Jahre alt war, sah man ihm, der in seiner Freizeit die Kinderfußballmannschaften der Pfarrgemeinde am Vatikan trainierte, nicht an. Er machte noch immer einen muskulösen, durchtrainierten Eindruck und wirkte auf mich wie ein etwas in die Jahre gekommener Schauspieler, der sich auf die Rolle von Collegelehrern und Leichtathletiktrainern spezialisiert hatte. Als ich in sein offenes Gesicht sah, lief in meinem Kopf ein Film ab, in dem Mosca die Rolle eines zu Unrecht verurteilten Marathonläufers übernommen hatte, der im Gefängnis wieder trainiert und nach der Entdeckung seiner Unschuld den wichtigsten Lauf seines Lebens gewinnt. Tatsächlich aber hatte er sein Leben lang als Elektriker gearbeitet und vor vierzig Jahren einen pleitegegangenen Elektroladen am Vatikan übernommen, ohne zu ahnen, dass er dort eines Tages Nachbar des zukünftigen Papstes werden würde.
»Kardinal Ratzinger kam öfter zu mir«, begann Angelo Mosca jetzt zu erzählen. »Ich sehe ihn noch in der Tür stehen. Eines Tages, ich glaube, es war 1999, bat er mich, in seiner Wohnung ein paar Glühbirnen auszutauschen. Dabei habe ich ihm alles erzählt. Ich habe ihm auch alle Unterlagen gegeben, und er hat mir sehr aufmerksam zugehört. Ich glaube, ich habe ihn überzeugt.«
»Wovon?«, fragte ich.
»Von dem Wunder, das ich selbst erlebt habe, dank Pater Pio.«
Bei der Nennung dieses Namens zuckte ich zusammen. Ausgerechnet Pater Pio, dachte ich und erinnerte mich an den Geruch modriger Wohnungen, der mir viele Male in die Nase gestiegen war, als ich 1987/88 auf der Suche nach einem Zimmer Dutzende römischer Adressen abgeklappert und dabei den oft erstaunlichen Gegensatz zwischen äußerem Schein und innerer Wirklichkeit in der schönen Stadt Rom kennengelernt hatte. So herrlich die Fassaden dieser Stadt in der Regel auch sind, so schön noch die Außenmauern der hässlichsten Mietshäuer im römischen Licht leuchten können, so schrecklich düster sind oftmals die Wohnungen dahinter. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Römerinnen und Römer erst einmal alle Fenster verriegeln – je dunkler es in ihrer Wohnung ist, desto besser finden sie es –, und zum anderen liegt es an der Wahl des von ihnen bevorzugten Mobiliars, zu dem neben wuchtig-soliden dunkelbraunen oder schwarzen Schränken, denen man zutraut, dass sie sich des Nachts in alles verschlingende Ungeheuer verwandeln könnten, an Gefängnisfilme erinnernde Drahtgestellbetten gehören. Die Wohnungen reicher Römerinnen und Römer unterschieden sich damals, als Ikea in Italien noch nicht wirklich Fuß gefasst hatte, nur unwesentlich von denen der Mittelschicht – außer dass die Wände der vornehmeren Behausungen mit dunklen Stoffen bespannt waren und die Lichter hier auch tagsüber brannten (die Fenster blieben selbstverständlich auch hier stets geschlossen, um das offenbar als feindlich empfundene Sonnenlicht nur ja nicht ins Innere der Wohnung zu lassen). Und nie hatte ich eine Wohnung betreten, in der nicht das Bild von Pater Pio hing: das Bild eines Kapuzinermönchs mit grauem Bart und ebensolchen Haaren, dessen Hände mit Lappen umwickelt waren. Ich wusste, dass wegen Betrugs gegen ihn ermittelt worden war, dass er womöglich nichts anderes als ein Scharlatan war; trotzdem hatte er es irgendwie geschafft, in Italien wie ein Heiliger verehrt zu werden. Dieser rätselhafte Volksheilige aber und der seriöse Joseph Ratzinger – das passte beim besten Willen nicht zusammen.
Angelo Mosca sah mich scharf an, als witterte er meine Skepsis, und sagte: »Ich habe Pater Pio selber kennengelernt, wissen Sie. Es war im Februar 1964. Das Schicksal muss uns zusammengeführt haben. Vor Aufregung zitternd betrat ich am frühen Nachmittag dieses Tages den Beichtstuhl und ahnte natürlich nicht, dass ich eines Tages einem künftigen Papst erzählen würde, wie ich diesen Heiligen mit eigenen Augen gesehen und erlebt habe.«
Ein Augenzeuge, dachte ich, natürlich: Das war es, was Joseph Ratzinger interessiert haben musste. Wenn Angelo Mosca wirklich Pater Pio noch zu dessen Lebzeiten gesehen und gesprochen hatte, konnte er vielleicht etwas zur Aufklärung der Frage beitragen, ob Gott tatsächlich in dem apulischen Dorf San Giovanni Rotondo, wo Pater Pio in seinem Kloster lebte, ein Wunder bewirkt hatte oder ob die katholische Kirche dort nur das Opfer eines aufsehenerregenden Betrugs geworden war.
Ich stellte mir vor, wie Angelo Mosca den Beichtstuhl betrat, wie er auf die von schmutzigen Lappen umhüllten Hände des alten Mönchs blickte und an das Geheimnis dachte, das unter diesen blutigen Stofffetzen verborgen lag. Saß hier einer der seltsamsten Betrüger in der Geschichte der katholischen Kirche vor ihm? Ein Mann, der seit Jahrzehnten konsequent alle Gläubigen, Mitbrüder und Äbte belog? Oder war dies ein echter Heiliger? Einer, der in direktem Kontakt mit Gott stand?
Hatte sich dieser Mönch in der Nacht des 20. September 1918 so lange mit einem Messer und groben Hölzern die Hände aufgekratzt, bis sie nur noch ein blutender Brei waren? Hatte er Jodtinktur hineingerieben, damit die Wunde noch auffälliger schien? Oder hatte Gott selbst sich entschlossen, die Handflächen dieses Mannes in Erinnerung an den Kreuzestod seines Sohnes Jesus von Nazaret zu verwüsten?
Immer wenn ich über diese Frage nachdachte, konnte ich mich nicht entscheiden, was mir noch unwahrscheinlicher erschien: dass ein einfacher Mönch die ganze katholische Welt mit einem gefälschten Wunder jahrzehntelang hereingelegt haben soll oder dass ein Wesen, das wir Gott nennen, sich dazu entschieden haben könnte, die fünf Wundmale Christi auf dem Körper des armen Mannes erscheinen zu lassen, ihn aus der Seite, den Händen, den Füßen bluten zu lassen und erst im Augenblick des Todes diese Wunden für immer zu schließen.
Angelo Mosca schien ein entschiedener Verfechter der Heiligkeit des Paters zu sein, deshalb beschloss ich, ihn nicht allzu sehr zu provozieren.
»Pater Pio machte auf Sie wahrscheinlich einen nachhaltigen Eindruck«, sagte ich zu ihm. »Es heißt, er sei ein ungewöhnlich sanfter Mensch gewesen.«
»Nein, nein«, sagte Angelo Mosca. »Er war alles andere als sanft an diesem Tag, als ich ihn besuchte. Ich hatte einen ganz anderen Eindruck. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, weil mir so viele Menschen davon erzählt hatten, wie erschüttert sie bei ihrem ersten Zusammentreffen mit dem Kapuzinermönch waren. Aber als ich den Beichtstuhl betrat und ihn dort sitzen sah, spürte ich davon wenig. Ich war nur ein wenig aufgeregt, aber aus einem ganz anderen Grund: In Wirklichkeit ging es mir nämlich gar nicht darum, mir die Beichte abnehmen zu lassen. Das war nur ein Vorwand, und ich hatte Angst vor dem Augenblick, in dem der Pater das merkte. Irgendwann würde ich ihm reinen Wein einschenken und ihm sagen müssen, dass ich in Wirklichkeit nicht gekommen war, um zu beichten, sondern um seinen Segen zu erbitten. Ich wusste, dass der Pater nur sehr selten seinen Segen gewährte, aber ich brauchte Hilfe – ich war schon seit vier Jahren verheiratet, und immer noch hatten wir keine Kinder.«
So war es also gewesen. Angelo Mosca, dessen kleiner Elektroladen zufällig in der Nachbarschaft des deutschen Präfekten der Glaubenskongregation lag, stand damals unter einem enormen Druck. Zu seiner eigenen Enttäuschung und der seiner Frau kam noch die der ganzen Familie, die auf den ersehnten Nachwuchs wartete. Deshalb hatte er also die weite Reise nach Apulien unternommen zu jenem Mönch, der im Ruf stand, entweder ein großer Heiliger oder ein großer Scharlatan zu sein. Deshalb hatte er sich eingereiht in eine jener langen Menschenschlangen, die damals die Klosterkirche Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo füllten. Täglich zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr standen die Menschen hier an, um sich von Pater Pio die Beichte abnehmen zu lassen. Alle hofften natürlich, dass Pater Pio wirklich derjenige war, der er vorgab zu sein: ein Heiliger, der im direkten Kontakt mit dem ewigen Gott stand und Wunder wirken konnte. Und wie sie alle kannte auch Angelo Mosca in groben Zügen die Geschichte von Pater Pio, der am 25. Mai 1887 als Francesco Forgione, Sohn von Grazio Forgione und Maria Giuseppa De Nunzio, in Pietrelcina bei Benevent (Süditalien) geboren worden war.
Am 6. Januar 1903 trat der Sohn einer einfachen Bauernfamilie im Alter von erst sechzehn Jahren als Novize in den Kapuzinerorden (ein Reformorden der Franziskaner) in Morcone ein, wo er am darauffolgenden 22. Januar eingekleidet wurde und den Ordensnamen »Bruder Pio« erhielt. Nach dem Noviziatsjahr legte er die einfachen Gelübde ab und am 27. Januar 1907 die ewigen Gelübde. Damit verband er sein Leben definitiv und für immer mit den Kapuzinern. Am 10. August 1910 wurde er in der Kathedrale von Benevent zum Priester geweiht. Während des Ersten Weltkriegs zog ihn die italienische Armee als Feldgeistlichen ein, aber wegen seiner angeschlagenen Gesundheit – Pio litt an Tuberkulose – war er meist ans Bett gefesselt und lebte zu Hause bei seinen Eltern in Pietrelcina. Aufgrund dieser Krankheit gab ihm der Orden eine Sondererlaubnis, sodass er auch als Kapuzinermönch meist bei seiner Familie bleiben durfte. Erst im September 1916 wurde er dann in das Kloster San Giovanni Rotondo geschickt, wo er bis zu seinem Tod blieb.
Pio war ein besonders frommer junger Mann, der sein Armutsgelübde sehr ernst nahm. Um seine Schuhe zu schonen, lief er im Sommer fast immer barfuß über die Felder, auch wenn er sich auf dem steinigen Kalkboden die Füße blutig aufriss. Von seiner Krankheit abgesehen unterschied ihn wenig von den anderen jungen Mönchen dieser Zeit, doch dann geschah etwas, das sein Leben von Grund auf verändern sollte: In der Nacht vom 5. auf den 6. August 1918 wurde der fromme Mann von einer Serie schrecklicher Albträume geplagt. Unter anderem träumte er mehrmals, von Lanzen durchbohrt zu werden, und als er dann am Morgen des 6. August erwachte, entdeckte er an seinem Körper eine Wunde, als sei er tatsächlich von einer Lanze versehrt worden.
Diese Wunde entzündete sich nicht, aber sie wollte sich auch nicht schließen. Noch Jahre später rätselte eine ganze Ärztegeneration darüber, was in dieser Nacht tatsächlich geschehen war. Hatte sich dieser kränkelnde Mönch etwa selbst mit einem spitzen, scharfen Messer in die Brust gestochen? Hatte er sich das Messer bis auf die Rippenknochen in das Fleisch gebohrt und anschließend Chemikalien in die Wunde gerieben, um zu verhindern, dass sie sich wieder schloss? War die Wunde ein Symptom seiner Krankheit, eine zufällige Verletzung, oder hatte tatsächlich der ewige Gott im Himmel in dieser Augustnacht beschlossen, an diesem Mönch ein Wundmal erscheinen zu lassen, in Erinnerung an seinen Sohn?
Das Johannes-Evangelium (Kapitel 19, Verse 33 und 34) beschreibt, wie einst dem toten Körper des Jesus von Nazaret diese Wunde zugefügt wurde: »Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus.«
Die Ärzte fanden keine Erklärung für die Wunde an Pater Pios Seite. Ihre Form deutete darauf hin, dass die Haut mit einem relativ klobigen metallischen Gegenstand verletzt worden war – nicht mit einem scharfen Messer also, sondern mit einem unförmigen, aber scharf geschliffenen Stück Metall. Spürte Pater Pio in dieser Nacht vom 5. auf den 6. August 1918 wirklich das kalte Metall einer grob geschliffenen Lanzenspitze auf seiner Brust, wie römische Soldaten diese vor zweitausend Jahren im Kampf benutzten? Spürte er wirklich den Ruck, mit dem die Lanzenspitze in sein Fleisch eindrang? Ist es also vorstellbar, dass Gott in dieser süditalienischen Sommernacht im August 1918 dieses Wunder vollbrachte? Eine Stigmatisation, wie das sich jeglicher ärztlicher Therapie entziehende plötzliche Auftreten der Leidensmale (Stigmata) Jesu am Leib eines lebenden Menschen genannt wird, die zuerst beim heiligen Franz von Assisi aufgetreten sein sollen? (Nach vierzigtägigem Fasten auf dem Berg La Verna soll dem Ordensgründer im Jahr 1224 der Gekreuzigte in Gestalt eines Seraphs, eines himmlischen Wesens mit sechs Flügeln, Händen und einer menschlichen Stimme, erschienen sein. Daraufhin, so die erste bezeugte Stigmatisation der Kirchengeschichte, sei Franziskus vom Leidenserlebnis Christi durchdrungen gewesen und habe die Wundmale an Händen, Füßen sowie an der Seite gehabt. Allerdings verheimlichte er diese, sodass sie erst bei seinem Tod erkannt wurden.) Sein Ordensnachfolger Pater Pio aber hielt sich am Vormittag des 20. September 1918 im Chor der zu seinem Kloster gehörenden Kirche Santa Maria delle Grazie auf, um vor einem Kruzifix aus dem 16. Jahrhundert zu beten, als plötzlich auch seine Hände und Füße zu bluten begannen. Erneut sahen die Wunden so aus, als stammten sie von einem relativ groben Metallgegenstand, der mit großer Kraft in das Fleisch des Paters getrieben worden war. Gemahnten sie also wirklich an die Hammerschläge längst verstorbener römischer Soldaten, die grobe Nägel in die Hände und Füße Jesu getrieben hatten? Spürte Pater Pio quasi am eigenen Leib, wie seine unsichtbaren Peiniger das kalte Metall auf seinem Fleisch ansetzten und dann zuschlugen, sodass er aufschrie vor Schmerz? Oder zerschnitt er sich unbemerkt von den Mitbrüdern mit Glassplittern und alten Messern die Hände und Füße? Sicher ist nur, dass Pater Pio seine unaufhörlich blutenden Wunden bis zum Tag seines Todes behielt und dass er sie anders als der heilige Franz von Assisi vor seinem Tod nicht verheimlichen konnte. Vor diesem Gezeichneten saß also im Februar 1964 ein aus Rom angereister Elektriker und gestand seine Sünden.
Angelo Mosca wohnte im Nordosten von Rom, an der Pineta Sacchetti, in der Nähe des gewaltigen Krankenhauskomplexes des Vatikans, der durch Johannes Paul II. weltberühmt wurde. Als erster Papst der Geschichte ließ sich der am Parkinson-Syndrom leidende Johannes Paul II. mehrmals dort einliefern. Jedes Mal, wenn der Papst ins Krankenhaus kam, bauten die Fernsehteams aller großen Sender ihre Übertragungswagen davor auf, weshalb die Römer den sich vor dem Hospital erhebenden Hügel bis heute »Antennenhügel« nennen. Von seinem Krankenzimmer aus betete Johannes Paul II. an Sonntagen vor laufenden Kameras das Angelusgebet und sandte Grußbotschaften. Der Papst sagte immer, dass es drei Vatikane gebe – den Vatikan selbst, den Sommersitz der Päpste, Castelgandolfo, und das Gemelli-Krankenhaus. Der Arzt Agostino Gemelli aber, nach dem dieses Krankenhaus benannt ist, spielte eine entscheidende Rolle in der Leidensgeschichte von Pater Pio.
Doch bevor Gemelli dem Stigmatisierten zum ersten Mal begegnete, untersuchte am 15. und 16. Mai 1919 ein anderer Arzt Pater Pio: Professor Luigi Romanelli fand keine Erklärung für die Wunden des Paters. Mittlerweile pilgerten Hunderttausende zu dem Mönch nach San Giovanni Rotondo, der im Ruf stand, ein Heiliger zu sein. Benedikt XV. (eigentlich Giacomo della Chiesa, Papst zwischen den Jahren 1914 und 1922), den diese Ereignisse beunruhigt hatten, ordnete weitere medizinische Untersuchungen an – zunächst durch Amico Bignami, dann durch Giorgio Festa. Im Jahr 1920 machte sich dann Pater Agostino Gemelli auf den Weg nach Süditalien. (Pater Gemelli war von Kardinal Merry del Val auch deshalb für diese Reise vorgeschlagen worden, weil der angesehene Arzt und Psychologe als Experte für übersinnliche Phänomene galt.) Doch als Pater Gemelli darum bat, Pater Pio genauer untersuchen zu dürfen, lehnte dieser ab. Daraufhin stellte Pater Gemelli klar, dass ihn das Sanctum Ufficium,1 Kardinal Merry del Val und der Papst persönlich entsandt hatten, doch Pater Pio ließ sich nicht umstimmen. Pater Gemelli schrieb einen empörten Brief an das Sanctum Ufficium mit Kopie an den Papst, in dem er feststellte: »Es ist ein Bluff. Pater Pio besitzt die Charakteristiken eines hysterischen Psychopathen. Die Verletzungen, die er am Körper hat, fügt er sich selbst zu. Es handelt sich um Wunden, die durch Zerstörung der Haut und der Sehnen entstehen. Pater Pio ist ein selbstzerstörerischer Psychopath und ein Betrüger.«
Zu dieser Diagnose passte das Urteil des neapolitanischen Arztes Vincenzo Tangaro, der meinte, die »angeblichen Stigmata« seien »ganz oberflächliche Wunden«; sie sähen »größer aus, als sie sind, durch den Gebrauch von Jodtinktur«.
Damit stand für den Vatikan fest: Pater Pio ist ein Betrüger. Als der Nachfolger des am 22. Januar 1922 gestorbenen Papstes Benedikt XV., Achille Ratti, ein enger Freund von Pater Agostino Gemelli und vom 12. Februar 1922 bis zum 10. Februar 1939 Papst Pius XI., den Thron Petri bestiegen hatte, beschloss man einzugreifen. Ab dem 2. Juni 1922 war Pater Pio untersagt, die Gläubigen zu treffen und zu segnen. Am 31. Mai 1923 ließ das Heilige Uffizium verlautbaren, dass die Verletzungen des Paters Pio nicht auf übernatürliche Ereignisse zurückzuführen seien. Der Vatikan beschloss, den Pater regelrecht auszuspionieren – vermutlich wurde er sogar im Beichtstuhl abgehört. Am 17. Juni 1923 wurde der Pater angewiesen, nur noch allein im Kloster die Messe zu lesen, ohne Gläubige. Am 23. Mai 1931 verbot der Papst Pater Pio, den Gläubigen die Beichte abzunehmen sowie Hochzeiten oder Taufen zu zelebrieren. Von nun an waren ihm jegliche öffentliche Auftritte untersagt. Doch als der Vatikan den Pater in ein Kloster nach Ancona versetzen wollte, verhinderten Gläubige die Umsetzung dieser Anweisung aus Rom. Den Massen galt Pater Pio als »Apostel des Beichtstuhls«, seine prophetische Gabe wurde weithin gerühmt, und nun widersetzte er sich dem Verbot: Am 16. Juli 1933 kam Pater Pio zum ersten Mal wieder in die Klosterkirche von San Giovanni Rotondo, um verbotenerweise die Messe zu lesen. Von jetzt an war er ein Rebell.
Welchen persönlichen Eindruck hatte Angelo Mosca, als er Pater Pio gegenübersaß, von diesem Mann? War er ein Heiliger oder ein Betrüger? »Was glaubten Sie?«, fragte ich ihn.
»Ich habe zuerst einmal gar nichts geglaubt«, antwortete Mosca. »Ich war entsetzt. Ich hatte endlich meine Sünden gebeichtet und bat um seinen Segen. Da geschah etwas Schreckliches: Er weigerte sich, mir die Sünden zu vergeben. ›Kinder sind ein Geschenk Gottes, um so etwas kann man einen Priester nicht bitten‹, blaffte er mich an.«
Noch immer stand Angelo Mosca der Schreck ins Gesicht geschrieben, als er sich daran erinnerte, wie Pater Pio ihn behandelt hatte. Damit entwickelte sich die Reise nach Apulien zu einem Desaster: Weder würde er mit der erhofften guten Nachricht nach Rom zurückkehren können, noch hatte er auch nur den Segen des Paters erhalten. Was sollte er jetzt zu Hause erzählen? Gab es irgendeine Hoffnung für ihn und seine Frau, doch noch Kinder zu bekommen?
»Ich war verzweifelt«, erzählte Angelo Mosca. »Aber nachdem mich Pater Pio weggeschickt hatte, geschah etwas sehr Seltsames. Zufällig hörte ich von einem anderen Mönch, der in der Region sehr verehrt wurde, einem gewissen Bruder Daniele. Ich fuhr in sein Kloster, und da geschah es: Bruder Daniele stand im Garten seines Klosters und arbeitete. Wir hatten uns noch nie gesehen, er musste mich für irgendeinen der Besucher des Klosters halten, für einen Touristen oder Pilger. Doch als ich vor ihm stand, blickte er auf, sah mir in die Augen, und auf einmal lief ein Lachen über sein ganzes Gesicht. Bevor ich auch nur ein Wort zu ihm sagen konnte, sprach er mich schon an: ›Bei dir hat Pater Pio den Stock benutzt. Aber keine Angst, hier kannst du beichten.‹ Während er das sagte, hatte er immer noch dieses verschmitzte Lächeln in seinem Gesicht, und ich fragte mich verdutzt, woher er wissen konnte, was geschehen und weshalb ich zu ihm gekommen war. Danach nahm er mir die Beichte ab, erteilte mir die Absolution, und dann gab er mir zum Abschied noch ein Kirschbonbon für meine Frau mit. Ich bedankte mich artig und wollte das Bonbon gerade entgegennehmen, da hielt er einen Moment in der Bewegung inne, als müsse er sich kurz besinnen. Gleich darauf steckte er es wieder ein und gab mir dafür ein anderes, eines mit Pfefferminzgeschmack (meine Frau hasst Kirschgeschmack, aber wie konnte Bruder Daniele das wissen?): ›Gib das deiner Frau‹, sagte er dazu, ›und mach dir keine Sorgen, sie wird bald schwanger werden.‹
Bevor ich den Beichtstuhl verließ, fragte er mich: ›Wann wirst du wiederkommen?‹
Ich erwiderte, dass ich sehr wenig Zeit hätte, doch er fiel mir empört ins Wort: ›Du wirst doch wohl kommen, um Pater Pio für die Geburt deines Kindes zu danken?‹
Verwirrt fuhr ich nach Hause. Und das Wunder geschah: Nachdem mein Sohn Daniele geboren worden war, fuhr ich nach San Giovanni Rotondo, um mich dafür zu bedanken. Ich ahnte nicht, dass ich Pater Pio noch um ein viel größeres Wunder würde bitten müssen: darum, eine Tote wieder zum Leben zu erwecken.«
Angelo Mosca stand auf, wühlte in einem Schrank, nahm eine Akte mit verschiedenen Unterlagen heraus und schlug sie vor mir auf: Es waren medizinische Befunde, Atteste, Schriftstücke aus dem Gemelli-Krankenhaus. »Am 12. März 1982«, erzählte er mir, während er mir diese Unterlagen zeigte, »war ich mit meiner Frau Wanda in Fregene bei Rom am Strand. Sie war damals 45 Jahre alt. Wir wollten spazieren gehen, doch plötzlich fiel sie hin und zuckte auf eine merkwürdige Weise am ganzen Körper. Zuerst dachte ich, dass sie einen epileptischen Anfall habe, und brachte sie, so schnell ich konnte, in die Gemelli-Klinik. Die Ärzte sagten mir gleich, dass Wanda in einer verzweifelten Lage war. Sie litt an einer Hirnblutung. Ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag, ich betete jeden Tag an ihrem Krankenbett, doch sie sprach nicht mehr, erkannte mich nicht einmal mehr. Am 19. März 1983 verschwanden die letzten Lebenszeichen von Wanda. Die Ärzte hielten sie für tot und brachten ihren Körper in einen besonderen Raum, in dem die Gestorbenen aufgebahrt wurden. Verzweifelt fuhr ich nach Hause und wusste, dass mir jetzt nur noch ein Wunder helfen konnte.«
Die Erinnerung an diese schrecklichen Tage setzten Angelo Mosca auch jetzt noch sichtlich zu. Er versuchte, betont ruhig und gleichmäßig zu atmen, und fuhr fort: »In diesem Jahr leitete der Heilige Stuhl das Verfahren zur Seligsprechung von Pater Pio ein, der mir schon einmal geholfen hatte. Jetzt betete ich unaufhörlich zu ihm: ›Pater Pio, du musst mir helfen. Ein Wunder muss geschehen.‹ In dieser Nacht fand ich keine Ruhe. Ich konnte nicht schlafen, bereitete mich in Gedanken schon auf die Beerdigung meiner Frau vor, und schließlich hielt ich es in meinem Bett nicht mehr aus. Kurz nach Mitternacht stand ich auf und fuhr zurück in das Krankenhaus, als hätte meine tote Frau nach mir gerufen. Ein Arzt kam mir gleich entgegen, nahm mich in den Arm und sagte: ›Etwas Unglaubliches ist geschehen. Eine Krankenschwester berührte zufällig die Füße Ihrer Frau, und daraufhin begann sie sich zu bewegen. Sie ist also gar nicht tot – oder ein Wunder hat sie wieder aufgeweckt.‹«
Im Koma hatte Moscas Frau schwere Schäden erlitten. Sie war gelähmt, und man erklärte ihm, dass nur eine Operation seine Frau retten konnte. Allerdings würde diese Operation sehr gefährlich sein.
Die Ärzte sprachen sehr offen mit ihm. Es bestand die Gefahr, dass seine Frau die Operation nicht überlebte oder dass sie danach zu einem Pflegefall werden würde: ein menschliches Wrack; unfähig, auch nur einen Finger zu bewegen, ein an den Rollstuhl gefesselter, betäubter, kaum mehr etwas erkennender Geist, eingesperrt in einen verfallenden Körper wie in einem Gefängnis.
Angelo Mosca stimmte der Operation dennoch zu. Am 10. April 1983 wurde seine Frau in den Operationssaal geschoben: »Wanda hatte nach Einschätzung ihrer behandelnden Ärzte eine Chance von eins zu hundert. Ich durfte mir keine Illusionen machen: Es war nur zu wahrscheinlich, dass sie diesen Tag nicht überlebte. Mehrmals sah ich Ärzte aus dem Operationssaal herauskommen, und jedes Mal gaben sie mir zu verstehen, dass es sehr schlecht um meine Frau stand. In meiner Verzweiflung versuchte ich mich abzulenken, griff mir eine Zeitschrift, die auf einem Tisch herumlag, und als ich sie aufschlug, sah ich ein Bild von Pater Pio, wie er Kranke segnete. Dabei machte er das Victory-Zeichen, als wäre das auch eine Botschaft für mich. Bald darauf kamen die Ärzte aus dem Operationssaal, und meine Frau wurde wieder vollkommen gesund. Bis heute danken wir Pater Pio jeden Tag dafür, denn die Krankenakte meiner Frau wurde schon mehrfach von Fachleuten untersucht, und sie kamen alle zu dem gleichen Ergebnis: Wissenschaftlich ist das nicht erklärbar. Schon damals haben die Ärzte zu mir gesagt: ›Was hier geschehen ist, können wir nicht verstehen. Wenn Sie an Gott glauben, dann beten Sie zu ihm.‹ Ich bin mir sicher, dass Pater Pio im Himmel mir geholfen hat.«
»Und diese Geschichte haben Sie Kardinal Joseph Ratzinger erzählt?«, fragte ich Angelo Mosca.
»Der Kardinal wollte nur ein paar Glühbirnen kaufen, als er in meinen Laden kam. Aber ich sagte ihm, dass ich selbstverständlich auch gern beim Auswechseln der Birnen behilflich sei. So kam ich in seine Wohnung, und als ich ihm erzählte, dass ich Pater Pio selbst kennengelernt hätte, bat er mich, in seinem Wohnzimmer Platz zu nehmen.«
Ich konnte mir gut vorstellen, wie Angelo Mosca da gesessen hat, zwischen all den Büchern über Gott, voller Respekt und sehr vorsichtig, nur ja nichts Falsches zu sagen – hier der einfache Elektriker und da der bedeutende Theologieprofessor und Kardinal: seine Eminenz, Joseph Ratzinger.
Angelo Mosca wusste durchaus, dass es vermutlich niemanden auf der Erde gab, der so viele Schriften über Jesus von Nazaret und das Christentum studiert hatte wie dieser Theologieprofessor Kardinal Ratzinger. Seine Schüchternheit war nur allzu verständlich, aber sie wäre gar nicht nötig gewesen. Denn das, was er über Gott zu berichten hatte, das stand in keinem der Bücher des Professors. Angelo Mosca hatte keinen wissenschaftlichen Aufsatz über den lieben Gott beizutragen, er hatte das Gefühl, er habe ihn erlebt.
Genau deshalb hörte ihm Kardinal Joseph Ratzinger in diesem Sommer des Jahres 1999 wohl auch so aufmerksam zu: Hier saß ein Mann, der etwas Licht in das Dunkel um den »Apostel des Beichtstuhls« bringen konnte; ein Mann, der Pater Pio selbst gesehen und erlebt hatte. Immer noch quälten viele offene Fragen die Spitze der katholischen Kirche. Wie war es möglich gewesen, dass ein so anerkannter Experte wie Agostino Gemelli sich dermaßen geirrt hatte? Warum hatte er nicht den geringsten Zweifel daran gelassen, dass der Kapuzinermönch sich die Wunden selbst beigebracht hatte? Agostino Gemelli muss sich seiner Sache vollkommen sicher gewesen sein, sonst hätte er Pater Pio kaum als Betrüger bezeichnet. Hätte er auch nur den geringsten Zweifel gehabt, wären seine Formulierungen vermutlich viel vorsichtiger ausgefallen. Und wie konnte es geschehen, dass auch andere untersuchende Ärzte zu dem gleichen Ergebnis kamen, dass Pater Pio ein Betrüger war? Gleich zwei Päpste mussten sich in ihrer Einschätzung getäuscht haben – Benedikt XV. und Pius XI. –, denn beide hatten den Bauernsohn aus Apulien schwer bestraft: Pater Pio wurde in seinem Kloster isoliert wie in einem gewaltigen steinernen Sarg, und während ihn manche schon damals für den größten Mystiker des 20. Jahrhunderts hielten, bezeichnete die Kirche ihn als Hysteriker, verbot ihm dreizehn Jahre lang, von 1922 bis 1934, das Lesen der Messe und sogar das Beantworten von Seelsorgebriefen. All das aber wäre doch sicher nicht geschehen, wenn die Kurie auch nur den geringsten Zweifel daran gehabt hätte, dass der angeblich stigmatisierte Mönch von Pietrelcina mit seiner angeblich prophetischen Gabe nichts als ein Scharlatan sei.
Nur die Menschen, die in Massen zum Kloster von San Giovanni Rotondo pilgerten, vertrauten ihm immer. Nicht einmal nach seinem Tod riss der Pilgerstrom ab, und als es so weit war, hatte ein gütiges Schicksal auch seine offizielle Rehabilitierung offenbar schon längst vorgesehen …
Weit weg von Apulien, hinter dem damals noch unüberwindlich scheinenden Eisernen Vorhang, erkrankte eines Tages die Mitarbeiterin des Erzbischofs von Krakau, Wanda Poltawska, sehr schwer. Die Mutter von vier Töchtern, die im Krieg vier Jahre lang in einem deutschen Konzentrationslager gewesen war, litt an einem unheilbaren Tumor im Hals. Deshalb bat der Erzbischof in einem lateinisch geschriebenen Brief vom 17. November 1962 Pater Pio, für sie zu beten, damit sie geheilt werde. Schon wenige Tage später, am 28. November 1962, stellten die Ärzte fest, dass der Tumor auf völlig unerklärliche Weise verschwunden war. Der Erzbischof aber, der sich an Pater Pio gewandt hatte, wurde später zum 264. Papst gewählt und nahm den Namen Johannes Paul II. an. Er war es auch, der den am 23. September 1968 verstorbenen Pater Pio am 2. Mai 1999 selig- und am 16. Juni 2002 heiligsprach. Wie wichtig ihm die Rehabilitierung des Kapuzinermönchs aus Pietrelcina war, erkannte man auch daran, dass noch nie in der neueren Kirchengeschichte ein Mensch so kurz nach seinem Tod heiliggesprochen worden war. Und wie sehr Papst Johannes Paul II. mit seiner Entscheidung auch die Herzen der Menschen erreichte, erkannte man an den – bei beiden Ereignissen – in Massen zum Petersplatz pilgernden Gläubigen: Bei der Heiligsprechung waren es fast eine Million Menschen.
In seiner Predigt am 2. Mai 1999 auf dem Petersplatz verriet Papst Johannes Paul II. auch etwas, das bis dahin nur wenigen bekannt gewesen war. Er sagte nämlich: »Als ich Student hier in Rom war, hatte ich selbst einmal Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, und ich danke Gott, der mir heute die Möglichkeit gibt, ihn in das Buch der Seligen einzutragen.«
Damit bestätigte er eine Geschichte, die er viele Jahre zuvor, 1981, zwei polnischen Kapuzinerbrüdern erzählt hatte und nach der er selbst im Jahr 1947 Pater Pio in San Giovanni Rotondo besucht haben soll.
Vor diesem Hintergrund bekommt die Schilderung des Mannes aus Apulien, wie sie Johannes Paul II. in seiner Predigt zur Seligsprechung auf dem Petersplatz gab, eine ganz besondere Note:
»Wer sich nach San Giovanni Rotondo aufmachte, um an seiner Messe teilzunehmen, ihn um Rat zu bitten oder bei ihm zu beichten«, sagte Johannes Paul II. an diesem Sonntag im Mai 1999, »erkannte in ihm ein lebendiges Abbild des leidenden und auferstandenen Christus. Im Gesicht von Pater Pio erstrahlte das Licht der Auferstehung. Sein von den Wundmalen gezeichneter Körper zeigte jene enge Verbindung zwischen Tod und Auferstehung, von der das Ostergeheimnis geprägt ist. Die Teilnahme an der Passion nahm für den Seligen aus Pietrelcina ganz besonders durchdringende Züge an: Die einzigartigen Gaben, die ihm zuteil wurden, und die innerlichen und mystischen Schmerzen, die diese Gaben begleiteten, ließen für ihn ein ergreifendes und ständiges Erleben der Leiden des Herrn in der unerschütterlichen Gewissheit zu, dass ›der Kalvarienberg der Berg der Heiligen ist‹.«
Gleich im nächsten Abschnitt dieser Predigt ging der Papst auch auf die Kritik ein, die dem Kapuzinermönch so lange von den Kirchenoberen entgegenschallte: »Nicht weniger schmerzlich, und in menschlicher Hinsicht vielleicht noch herber, waren die Prüfungen, die er – man würde fast sagen, infolge seiner einzigartigen Charismen – über sich ergehen lassen musste. In der Geschichte der Heiligkeit kommt es manchmal vor, dass der Auserwählte – aufgrund eines besonderen Zulassens Gottes – auf Unverständnis stößt.«