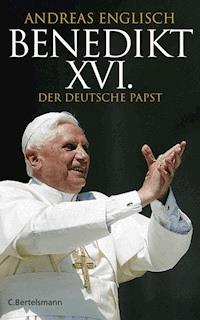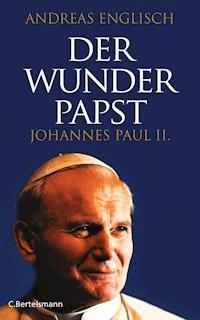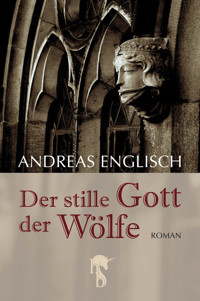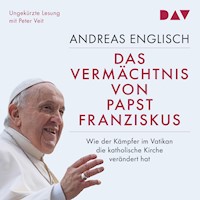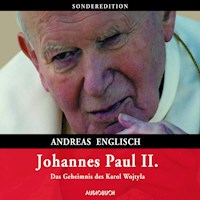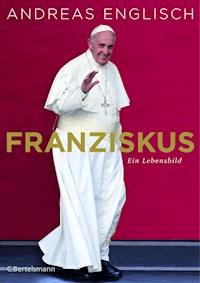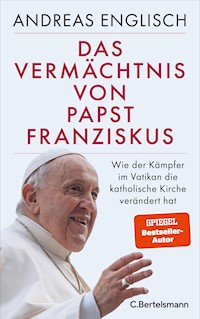
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre Papst Franziskus im März 2023: Bestsellerautor Andreas Englisch zieht Bilanz
Vor zehn Jahren überraschte die katholische Kirche die ganze Welt. Die Kardinäle brachen mit den Konventionen und wählten einen äußerst ungewöhnlichen Mann zum Papst: Jorge Mario Bergoglio, der sich als Papst »Franziskus« nannte, ist der erste Bischof von Rom, der vom amerikanischen Kontinent stammt, der erste Jesuitenpater und der erste radikale Reformer an der Spitze der katholischen Kirche seit Jahrhunderten. Seit seinem Amtsantritt hat Franziskus die Kirche, den Vatikan und das Amt des Papstes tiefgreifend verändert. Doch zugleich erlebt die katholische Kirche in seiner Amtszeit die wohl dramatischste Krise ihrer Geschichte. Die nicht enden wollende Enthüllung von Missbrauchsskandalen erzürnt Menschen weltweit, immer mehr Gläubige wenden sich enttäuscht von der Kirche ab.
Bestsellerautor Andreas Englisch, der Franziskus vielfach getroffen hat und auf seinen Reisen begleiten durfte, zeigt in seinem neuen Buch, mit welchen Herausforderungen der Papst während seiner Amtszeit konfrontiert war und welche Reformen ihm trotz aller Widerstände gelangen. Das Vermächtnis des Franziskus, so Englisch, ist dabei weit beeindruckender, als es auf den ersten Blick wirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
BUCH
Vor zehn Jahren überraschte der Vatikan die ganze Welt. Die Kardinäle brachen mit den Konventionen und wählten einen äußerst ungewöhnlichen Mann zum Papst: Jorge Mario Bergoglio, der sich als Papst »Franziskus« nannte, ist der erste Bischof von Rom, der vom amerikanischen Kontinent stammt, und der erste Jesuitenpater. Seit seinem Amtsantritt hat Franziskus die Kirche, den Vatikan und das Amt des Papstes tiefgreifend verändert. Doch zugleich erlebt die katholische Kirche in seiner Amtszeit die wohl dramatischste Krise ihrer Geschichte. Die nicht enden wollende Enthüllung von Missbrauchsskandalen erzürnt Menschen weltweit, immer mehr Gläubige wenden sich enttäuscht von der Kirche ab. Bestsellerautor Andreas Englisch, der Franziskus vielfach getroffen hat und auf seinen Reisen begleiten durfte, zeigt in seinem neuen Buch, mit welchen Herausforderungen der Papst während seiner Amtszeit konfrontiert war und welche Reformen ihm trotz aller Widerstände gelangen.
AUTOR
Andreas Englisch lebt seit mehr als drei Jahrzehnten in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten im Vatikan. Seit der Amtszeit von Johannes Paul II. trifft er die amtierenden Päpste regelmäßig und begleitet sie auf ihren Reisen. Er ist ein gefragter Talkshowgast und Interviewpartner, seine Bücher sind Bestseller und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter »Franziskus – Zeichen der Hoffnung« (2013), »Der Kämpfer im Vatikan: Papst Franziskus und sein mutiger Weg« (2015) sowie »Der Pakt gegen den Papst: Franziskus und seine Feinde im Vatikan« (2020).
ANDREAS ENGLISCH
DAS VERMÄCHTNIS VON PAPST FRANZISKUS
Wie der Kämpfer im Vatikan die katholische Kirche verändert hat
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2023 Andreas Englisch
© 2023 C.Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München,
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München. www.ava-international.de www.andreasenglisch.de
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Lektorat: Brigitte Wormer
Bildredaktion: Annette Baur
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30479-9V002
www.cbertelsmann.de
Inhalt
19. November 2022
Rom
25. Oktober 2022
Rom
25. Juli 2022
Vergebung
13. März 2013
Vatikan • Irak • Vatikan • Griechenland • Vatikan • Brasilien • Vatikan • Deutschland • Vatikan • Madagaskar • Vatikan • Abu Dhabi • Vatikan • Kanada • Vatikan • Italien • Vatikan • Italien • Vatikan • Zypern • Vatikan • Myanmar • Vatikan • Mosambik • Vatikan
2013
Ein anderer Papst • Der Umzug • Der erste Handy-Papst • Zwei Päpste • Schock zu Ostern • Des Papstes neue Kleider • Der Bruch des Paktes • Lumen Fidei – Licht des Glaubens • Massengrab Mittelmeer • Exkurs: Die Päpste und die Politik • Rio de Janeiro • Homosexuelle • Castel Gandolfo
2014
Die Israel-Reise • Kurienkrankheiten
2015
Heilige Jahre • Maria Faustyna Kowalska • Óscar Romero • Das Heilige Jahr 2015 – Eröffnung • Homosexualität
2016
Prophezeiung • Amoris Laetitia
2017
»Dubia« • Myanmar • Dhaka – Bangladesch • Donald Trump
2018
Franziskus und die Mafia
2019
Im Dialog mit dem Islam • Missbrauch • Mosambik • Madagaskar
2020
Im Schatten der Pandemie • Fratelli tutti
2021
Die Reise in den Irak
2022
Kanada • Iqaluit • Nur-Sultan
Winter 2022/23
Eine veränderte Welt • Ein Paukenschlag während der Audienz • Abschied • Das Ende einer Epoche
Bildnachweis
Bildteil
19. November 2022
Rom
Es ist 8.30 Uhr, als Georg Bätzing, der Chef der deutschen Bischofskonferenz, allein über den Petersplatz in Richtung des großen Synodensaals im Antonianum geht, dem modernen Gebäude in der Nähe des Palastes der Glaubenskongregation im Vatikan. Der Nieselregen taucht Rom an diesem Morgen in eine düstere Atmosphäre. Das sommerliche Wetter, das bis in den späten Herbst reichte und den Römern erlaubte, noch im November im Meer zu baden, ist endgültig vorbei. Der Nebel und die Kälte scheinen die Menschen nach sieben Monaten mit zum Teil sengender Sonne in ihre Wohnungen zu treiben. Die Besitzer der Cafés räumen an diesem Morgen keine Stühle mehr auf die Plätze von Rom. Bätzing weiß, dass er zu einem außergewöhnlichen Ereignis unterwegs ist, in einer für die katholische Kirche in Deutschland historischen Zeit. Die Auseinandersetzungen zwischen den Bischöfen aus Deutschland und dem Papst eskalierten derart, dass etwas Ungeheuerliches eintrat. Ein Ereignis, das jahrzehntelang bei niemandem Neugier weckte, der »Ad-limina-Besuch« der deutschen Bischöfe beim Papst, also der reine Routinebesuch an den Schwellen (ad limina) der Gräber der Apostel, der alle fünf Jahre fällig wird, schaffte es an diesem Samstagmorgen, die Weltpresse zu mobilisieren. Reporter aus den USA, aus England, Frankreich, Spanien, Italien und natürlich aus Deutschland warten drauf, dass sich Bätzing ihren Fragen stellt.
Es ist lange her, dass sich die internationale Presse brennend für einen Besuch der Bischöfe aus Deutschland im Vatikan interessierte. Das letzte Mal sorgte der erbitterte Streit zwischen Papst Johannes Paul II. und dem damaligen Chef der Bischofskonferenz Karl Lehmann über die Frage der Schwangerenkonfliktberatung für internationales Aufsehen. Das war vor 30 Jahren. Wenn es einen Gott gibt, scheint es ihm Spaß zu machen, die entscheidenden Erschütterungen in der römischen Kirche seit Martin Luther von Deutschland ausgehen zu lassen.
Diesmal geht es um die Frage: Will die deutsche katholische Kirche tatsächlich eine Kirchenspaltung, ein Schisma? Wollen die reformbereiten Katholiken in Deutschland, die sich eine offenere, modernere, demokratischere Kirche wünschen, wirklich gehen? Am ersten Advent des Jahres 2019 hatte die Deutsche Bischofskonferenz zusammen mit den Laien des Zentralkomitees der deutschen Katholiken einen »Synodalen Weg« beschlossen, erschüttert durch die Ausmaße des Missbrauchsskandals.
Lässt diese jahrelange Debatte in Deutschland über die Abschaffung des Zölibats, die Beendigung der Diskriminierung homosexueller Menschen, die Möglichkeit, Frauen zu Priestern zu weihen, überhaupt noch etwas anderes zu als die Trennung der katholischen Kirche Deutschlands von Rom, sollten alle diese Vorschläge einfach wieder sang- und klanglos vom Tisch gefegt werden?
Im Synodensaal warten nervöse Reporter. Sie gieren nach Nachrichtenfutter. Aus dem Umfeld der Kurienkardinäle gibt es klare Signale, dass es während der Treffen mit den deutschen Bischöfen gekracht hat. Wie angespannt dieser Morgen ist, zeigt allein die Liste der Journalisten, die eine Frage stellen wollen. Bei gewöhnlichen Ad-limina-Besuchen zeigen sich Pressesprecher der Bischofskonferenzen erfreut, wenn es überhaupt Fragen gibt. Diesmal muss Pressechef Matthias Kopp versuchen, die lange Liste der Anfragen mit dem geplanten Abflug von Bischof Bätzing vom römischen Flughafen unter einen Hut zu bekommen.
Georg Bätzing verneint natürlich die spektakulärste aller Varianten, dass die katholische Kirche auf eine Spaltung zusteuere. Darum gehe es nicht. Es gehe darum, dass die dramatischen Entwicklungen in Deutschland dazu führten, dass die Kirchenspitze in Rom einen »Flächenbrand« fürchtet. Bei der Pressekonferenz wird Georg Bätzing sagen, in den Gesprächen mit der Kurie sei zu spüren gewesen, dass Rom eine weltweite Eskalation fürchtet, ausgelöst von Deutschland.
Die Sorge scheint durchaus begründet. Im deutschen Kirchenvolk brodelt es. Hunderttausende verlangen eine regelrechte Revolution. Der Priester Oliver Lahl, Geistlicher Rat der deutschen Botschaft, legt während der Pressekonferenz den Finger in die Wunde. Wie es möglich sei, will er wissen, dass es in den Dokumenten, die während des Besuchs der Bischöfe erstellt wurden, heiße, dass das Volk Gottes »geduldig« auf Entscheidungen warte.
Bätzing muss einräumen, dass das eine eklatante Fehleinschätzung sei. Geduldig scheint das deutsche Gottesvolk beim besten Willen nicht mehr zu sein. Die katholische Kirche, die in Deutschland so drastisch an Bedeutung verliert wie nie zuvor, hat es seltsamerweise geschafft, zum heiß diskutierten Dauerbrenner-Thema in der öffentlichen Debatte zu werden und wieder einen »Fall« zu schaffen, den des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki.
Selbst gesellschaftliche Gruppen, die absolut nichts mit der katholischen Kirche zu tun haben, debattieren plötzlich den »Fall Woelki«. Fernsehsatiriker stürzen sich auf diese Personalfrage.
Im Kern geht es um Vertuschungsvorwürfe. Der Kardinal soll in Fällen, in denen es um sexualisierte Gewalt geht, nicht die Wahrheit gesagt haben. Die Staatsanwaltschaft entschloss sich nach anfänglichem Zögern im November 2022, gegen Kardinal Woelki zu ermitteln. Doch die umstrittenen Vorwürfe allein hätten vermutlich kaum das Potenzial gehabt, dass Millionen Menschen in Deutschland in einer aufgeheizten Debatte den Kopf des Kölner Erzbischofs fordern.
Es ist Woelkis extrem konservative Haltung, die die Debatte anheizt, vor allem seine Meinung über den Umgang mit Homosexuellen.
Im März 2021 hatte Rainer Maria Woelki das vatikanische Verbot der Glaubenskongregation, »Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen«, begrüßt. Kardinal Luis Ladaria Ferrer, der spanische Chef der Glaubenskongregation, geboren auf der Insel Mallorca, hatte am 15. März 2021 verlauten lassen:
»Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe (das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist) einzuschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist.«
Kardinal Ladaria hatte damit die erste ernsthafte Revolte homosexueller Menschen innerhalb der katholischen Kirche ausgelöst. An Kirchen hingen plötzlich die Regenbogenfarben der LGBT-Bewegung. Der Vorstoß entpuppte sich als kolossales Eigentor, vor allem wegen einer Formulierung in dem Verbot. Kardinal Ladaria hatte geschrieben:
»Das Vorhandensein positiver Elemente (…) in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung zu machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet ist.«
Kardinal Ladaria hatte sich also entschlossen, die härteste Keule aus dem Schrank der Theologie zu holen, denn der Satz bedeutet: Gott will keine homosexuellen Menschen. Sie sind im Plan des Schöpfers nicht vorgesehen. Diese Menschen leben gegen Gottes Willen.
Die Reaktion darauf war eine regelrechte Revolution in Deutschland. Mehr als 100 Mitarbeiter der katholischen Kirche outeten sich in einer TV-Dokumentation als homosexuell. Der Titel des Films schoss genau auf Ladarias Verbot. Er lautete: »Wie Gott uns schuf«. Die betroffenen gläubigen Katholikinnen und Katholiken, die sich in dem Film äußern, wehren sich dagegen, dass Gott sie in seinem Plan nicht vorgesehen habe, nur weil Kardinal Ladaria das so sieht.
In Deutschland erzielte die Dokumentation einen sensationellen Erfolg und räumte den Deutschen Fernsehpreis als beste Reportage ab. Aber nicht nur in Deutschland sorgte das Verbot, Homosexuelle zu segnen, für Widerstand, weltweit protestierten Priester und Ordensleute. Jetzt kam es darauf an, ob der Papst Kardinal Ladaria den Rücken stärken würde. Sollte er das nicht tun, würde er der Glaubenskongregation jede Glaubwürdigkeit nehmen.
Die Anhänger von Kardinal Ladaria verlangten, dass der Papst zuschlug, also konkrete Strafen verhängte für alle Priester und Bischöfe, die sich nicht an das Verbot hielten. Schließlich leitete Kardinal Ladaria nicht irgendeine Kongregation, denn seine Behörde ging auf die Inquisition zurück, deren erster Chef der spätere Papst Paul IV. war, der im Jahr 1556 in Rom einen Studenten in heißem Fett töten ließ, weil er Luthers Gedanken guthieß. Doch der Papst verweigerte sich. Es wurden keine Strafen verhängt, der Papst ließ zu, dass Ladarias Verbot ganz offen ignoriert wurde.
Kardinal Woelki musste hinnehmen, dass er ein Eigentor geschossen hatte, als er die Ablehnung, Homosexuelle zu segnen, offen als »Stärkung der Ehe« feierte. Der Papst sah es offenbar anders.
Während der Pressekonferenz hatte Bischof Georg Bätzing kein Problem damit, zuzugeben, dass Woelkis Freude über das Ladaria-Verbot einen tiefen Graben gerissen hatte, weil Woelki, obwohl Kardinal, mit seiner Meinung keineswegs die komplette Deutsche Bischofskonferenz vertrete. Bätzing bestätigte, dass er die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in seiner Diözese nicht verbieten werde. Gleichzeitig unterstrich er, dass die Situation in der Diözese Köln »unerträglich« geworden sei. Der Papst, der Kardinal Woelki ein Rücktrittsgesuch abverlangt hatte, das seitdem unbeachtet in seiner Schublade liegt, solle jetzt endlich entscheiden. Georg Bätzing räumte ein, dass er wohl wisse, der Papst wolle sich im Fall Woelki nicht drängen lassen, aber die Situation sei so angespannt, dass endlich eine Entscheidung hermüsse.
Rainer Maria Woelki hatte selbst den Streit um seine Person, ohne es zu wollen, bis nach Rom getragen. Am Montag, dem 3. Oktober 2022, kam es ausgerechnet in einer der römischen Hauptkirchen, in San Pietro fuori le mura, zu einem Eklat. Der Kölner Kardinal musste die Erfahrung machen, dass junge Menschen der LGBT-Bewegung nahestehen und die Herabsetzung homosexueller Menschen, denen Woelki den Segen verweigert, nicht hinnehmen. Während der Predigt von Rainer Maria Woelki in der Kirche standen zahlreiche der 2000 Ministranten auf und drehten dem Kardinal demonstrativ den Rücken zu. Später tauchten auch in Assisi, der nächsten Etappe der Wallfahrt unter den Ministranten, Symbole der LGBT-Bewegung auf.
Doch an diesem Morgen in Rom ging es Georg Bätzing nicht nur um den Fall Woelki. Es ging um viel mehr. Es ging darum, dass die Vorstellungen der Synodalversammlung in Deutschland und die Vorgaben des Vatikans sehr weit auseinanderliegen. Georg Bätzing spricht Klartext im Synodensaal in Rom. Für ihn sind die »Frauen in der Kirche« das wichtigste aller Themen des Synodalen Wegs.
Bätzing weiß, dass der Vatikan die Priesterweihe für Frauen kategorisch ablehnt. Drei Päpste hintereinander haben das unterstrichen. Aber Georg Bätzing bleibt dabei: Dass der Vatikan diese Frage beantwortet hat, heißt nicht, dass es diese Frage nicht mehr gibt. Georg Bätzing weiß, dass vor allem der massenhafte Rückzug der Frauen aus der katholischen Kirche eine Katastrophe ist. Denn die Umfragewerte zeigen, dass keineswegs nur Menschen die katholische Kirche verlassen, die Kirchensteuern sparen wollen, sondern auch engagierte Katholikinnen, die einfach die Nase voll davon haben, offiziell nicht von Belang zu sein.
An diesem Vormittag will Georg Bätzing vor allem eines sagen: So wie es zurzeit läuft, kann es nicht weitergehen. Wenn eine Kirche sagt, dass sie Frauen einfach nicht will, dann ist das für diese Frauen »auch nicht mehr ihre Kirche«, warnt Georg Bätzing. Mit jedem Satz, den Georg Bätzing spricht, mit jeder Frage, die er beantwortet, zeigt sich immer mehr die wahre Dramatik des zu Ende gegangenen Ad-limina-Besuchs. Es ist keineswegs so, dass die deutschen Bischöfe nur sehr wenig umsetzen konnten von dem, was sie gerne erreichen würden. Sie konnten absolut gar nichts umsetzen.
Trotzig antwortet Georg Bätzing auf die Frage, warum es in keinem einzigen großen Streitpunkt auch nur einen Millimeter weiterging: »Aber alle Fragen liegen noch auf dem Tisch, und wir haben sie nicht herunterfegen lassen.«
Als die Pressekonferenz zu Ende geht, ist die Enttäuschung von Georg Bätzing greifbar. Er muss diese Niederlage jetzt einer rebellischen deutschen katholischen Kirche verkaufen, die wieder einmal auf die Barrikaden gehen wird, weil in Rom natürlich keine Laien gehört wurden und die Würdenträger wieder einmal unter sich blieben.
Es gibt Probleme, die Papst Franziskus anpacken muss. Die deutsche katholische Kirche will wissen, wieso der Zölibat nicht abgeschafft wird und warum Frauen nicht zu Priestern, ja nicht einmal zu Diakoninnen geweiht werden dürfen. Diese Fragen sind drängend in Deutschland. Das Problem ist, dass es in dieser Kirche viele Probleme gibt und dass die katholische Kirche vor allem eines auszeichnet: Sie ist groß, sehr groß. Sie besteht nicht nur aus Deutschland.
25. Oktober 2022
Rom
Gegen 13.00 Uhr beginnen Polizisten, die Via dei Fori Imperiali am Kolosseum abzusperren. Sogar die Fußgängerwege werden mit gepanzerten Autos blockiert. Touristen wundern sich, dass an diesem herrlichen Herbsttag auch die U-Bahnstation am Kolosseum geschlossen ist. Währenddessen verkünden Anzeigetafeln, dass das Kolosseum erst am nächsten Tag wieder öffnen wird.
In der Via Labicana, nahe dem Eingang zur ehemaligen Villa des Kaisers Nero, stehen Sondereinheiten der besonders trainierten Grenzschutzgruppe des Zolls. Sie bewachen die Hauptzufahrtswege zum größten Amphitheater der Welt. Es herrscht höchste Alarmstufe.
Der Papst will mit Religionsführern aus der ganzen Welt, Muslimen, Juden, Hindus und Buddhisten, im Kolosseum für den Frieden beten. Die Veranstaltung genießt an diesem Tag absolute Priorität. Eine Einsatzgruppe der Polizei sammelt sich am Anfang der Via San Giovanni in Laterano gegenüber dem Kolosseum.
Hier liegt das römische Gay Village. Seit vielen Jahren haben sich hier Cafés und Lokale etabliert, die spezialisiert sind auf ein homosexuelles Publikum. Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle, die sogenannte LGBT-Gemeinde, haben hier einen geschützten Treffpunkt in Rom. Ganz am Beginn der Straße, nur einen Steinwurf vom Kolosseum entfernt, liegt das berühmteste LGBT-Café mit dem Namen »Coming Out«. Weil es in der Vergangenheit zu Übergriffen gegen Besucher des Gay Village kam, kontrolliert hier abends die Polizei die Umgebung, um die Gäste zu schützen.
An diesem warmen Nachmittag versammelt sich eine Gruppe Polizisten am Eingang der Straße. Einige der Beamten haben noch gut in Erinnerung, wie es im Juli 2000 zu Ausschreitungen zwischen Unterstützern und Gegnern der LGBT-Bewegung kam, nachdem Papst Johannes Paul II. versucht hatte, die römische Gay Pride Parade im Heiligen Jahr um jeden Preis zu verhindern. Den Demonstrationszug der LGBT-Gemeinde hatte der Papst als »eine Beleidigung« der Stadt Rom bezeichnet und Homosexuellen immer wieder vorgeworfen, gegen Gottes Gesetze zu leben.
Sein Nachfolger Papst Benedikt XVI. hatte den vollen Zorn der LGBT-Gruppen gespürt, als er im Januar des Jahres 2014 eine der ältesten Universitäten der Welt, die Sapienza in Rom, besuchen wollte. Der Papst aus Deutschland hatte homosexuelle Menschen als Frauen und Männer bezeichnet, denen Gott »eine schwere Prüfung« auferlegt habe. Der Zorn der LGBT-Gemeinde vermischte sich mit der Ablehnung einiger Wissenschaftler, die nicht akzeptieren konnten, dass Joseph Ratzinger der Meinung war, der Prozess der Kirche gegen Galileo Galilei sei vollkommen in Ordnung gewesen. Auf dem Universitätsgelände war es zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen.
An diesem Nachmittag am Kolosseum wartet eine Gruppe Polizisten auf die Anweisung, eine Barriere zu bilden, um zu erwartende Proteste der LGBT-Gemeinde gegen den Besuch des Papstes abzuwehren. Doch der Kommandant winkt ab. Die Zeiten haben sich geändert. Angesichts der Veränderungen im Vatikan, die Papst Franziskus durchgesetzt habe, sei von lauten Protesten im Gay Village nicht mehr auszugehen.
Die Cafés und Restaurants im Gay Village sind an diesem Nachmittag gut besucht. Die Menschen genießen das warme Wetter, und in der Tat gibt es noch nicht einmal einen Ansatz von Protest gegen diesen Papst, als er im Kolosseum eintrifft. Es ist ein leiser Erfolg für Franziskus, der in der Berichterstattung über das Friedensgebet jedoch keine Beachtung findet. Aber er hat etwas verändert, als er in der Papstmaschine vor Journalisten verkündete, dass die katholische Kirche sich bei homosexuellen Menschen entschuldigen müsse für das, was sie ihnen angetan hat. Er hatte etwas verändert, als er in der Botschaft in Washington einen ehemaligen Studenten segnete, der mit seinem Partner gekommen war. Er hatte etwas verändert, als er dem Chef der Glaubenskongregation seine Unterstützung verweigerte, als dieser das Segnen homosexueller Paare verbot. Welche Sünde, so wollte der Papst wissen, hätten Homosexuelle bitte schön begangen, dass man sie so schwer bestrafen müsse?
Natürlich gibt es viele Menschen, denen das, was der Papst für die LGBT-Bewegung getan hat, absolut nicht weit genug geht. Noch immer dürfen homosexuelle Menschen nicht in Kirchen heiraten. Noch immer wurde der Katechismus der katholischen Kirche, der von einer Unregelmäßigkeit bei homosexuellen Menschen spricht, nicht geändert. Das gehört zum Schicksal dieses Papstes. Das ist der Vorwurf, der ihn seit seiner Wahl im Jahr 2013 verfolgt: nicht genug getan zu haben.
Die Reformbewegung der deutschen Katholiken des Synodalen Wegs verlangt weit mehr, als dieser Papst gegeben hat. Noch immer gibt es keine Antwort darauf, wieso die Ehelosigkeit der Priester, der Zölibat, überhaupt nötig ist und warum man ihn nicht einfach abschafft. Noch immer gibt es keine Antwort auf die Frage, warum Frauen durch das System der katholischen Kirche diskriminiert und von Ämtern ausgeschlossen werden. Noch immer verärgern die Machtstrukturen der Kirche die Menschen, die den Synodalen Weg in Deutschland begleiten, und sie werfen dem Papst vor, die Reformbemühungen zu behindern oder einfach zu wenig zu tun.
Auch heute, an diesem Dienstag, dem 22. Oktober 2022, steht dieser Vorwurf im Raum. Ja, es würde ein Friedensgebet geben im Kolosseum. Der Papst würde einen eindringlichen Appell an die Welt richten:
»In diesem Jahr ist unser Gebet ein Schrei geworden, weil der Frieden auf das Schwerste gebrochen, verletzt, niedergetrampelt wurde, und das in Europa, also dem Kontinent, der im vergangenen Jahrhundert die Tragödie von zwei Weltkriegen erlebte, und jetzt sind wir im Dritten Weltkrieg, leider haben seitdem die Kriege nie aufgehört, die Erde in ein Blutbad zu verwandeln und verarmen zu lassen, aber dieser Moment, den wir jetzt erleben, ist ganz besonders dramatisch. Heute tritt ein, was wir befürchtet haben und von dem wir hofften, es nie zu hören. Ich meine die Nutzung von Atomwaffen, die nach Hiroshima und Nagasaki immer noch produziert und getestet werden und mit deren Nutzung nun offen gedroht wird.«
Natürlich sollte dieser Tag ein eindrucksvoller Appell werden. Papst Franziskus hatte die Forderung also erfüllt, die seit Beginn des Krieges in der Ukraine von verschiedensten Seiten an ihn gerichtet worden war: möglichst viele Religionsführer der Welt zu versammeln, um eindringlich den Frieden einzufordern. Doch gleichzeitig symbolisierte auch dieser Tag wieder das Drama dieses Papstes. Denn vielen war dieses Gebet absolut nicht genug.
Der Papst war nicht nach Kiew gefahren, obwohl der Vatikan das mehrfach angekündigt hatte. Die Kirche hatte auf diesen Krieg bisher nicht einwirken können, keinen Waffenstillstand erreichen, ihn nicht stoppen können.
Dabei hatte Papst Franziskus die Hände gar nicht in den Schoß gelegt. Er hatte am 25. Februar 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sofort seinen Staatssekretär im Vatikan darüber informiert, dass er auf der Stelle den russischen Botschafter sprechen wolle. Sie hatten ihm die übliche Antwort gegeben. Die Einberufung eines Botschafters dauert normalerweise Tage, vor allem, wenn der Botschafter eigentlich keine Lust hat zu kommen. Aber sie hatten den Papst falsch verstanden. Der Papst wollte den Botschafter gar nicht einberufen, er wollte hinfahren, und zwar sofort. Er wollte sein Auto nehmen, den Fiat 500, der in der Nähe des Gästehauses im Vatikan geparkt war, einsteigen, zwischen den ganzen Touristen die Via della Conciliazione hinunterfahren bis zu dem etwa 600 Meter entfernten Eingang der russischen Botschaft. Er wollte einfach hingehen, um es hinauszuschreien, dass ein Angriffskrieg die Missachtung alles dessen war, was dieser Jesus von Nazareth je gewollt hatte und auf den sich die russisch-orthodoxe Kirche mit ihren 150 Millionen Mitgliedern beruft.
Aber so etwas war noch nie passiert.
In der fast zweitausendjährigen Geschichte der Päpste gibt es eigentlich gar nichts, was nicht schon einmal passiert war. Päpste hatten selbst die außergewöhnlichsten Dinge schon einmal getan, sie hatten in Kampfmontur die Mauern einer Stadt überstiegen, um sie einzunehmen, oder persönlich Kriegsflotten befehligt, und einer hatte den deutschen Kaiser in Canossa im Schnee stehen lassen, aber dass ein Papst zum Botschafter fuhr, statt ihn kommen zu lassen, das war noch nie passiert.
Das Staatssekretariat informierte sofort die russische Botschaft, und die glaubte an einen Scherz. Dass der Papst persönlich spontan vorbeikommen könnte, schien so lange so vollkommen ausgeschlossen, bis er tatsächlich vor der Tür stand. Das Auto von Franziskus war nahezu unbemerkt zwischen den Tausenden von Touristen die Via della Conciliazione hinuntergefahren und in den Torbogen des Palastes der Botschaft eingebogen. Der vollkommen überraschte Botschafter beobachtete gerade vor dem Fernsehschirm die Entwicklung des Krieges, als Franziskus in sein Büro trat.
Der Papst forderte einen sofortigen Waffenstillstand. Der Botschafter antwortet lediglich, dass er ebenfalls »sehr besorgt sei« angesichts der Lage. Franziskus bot sich bei dem Treffen auch als Vermittler an, sofern das beide Seiten akzeptierten.
In den Jahren zwischen 1979 und 1984 hatte schon einmal ein Papst einen Krieg verhindert. Papst Johannes Paul II. hatte sich in den sogenannten Beagle-Konflikt eingeschaltet. Es war um die Inseln bei Feuerland gegangen und den Zugang zur Antarktis, was zu einem Krieg zwischen Chile und Argentinien zu führen drohte, den der Papst in zähen Verhandlungen verhindern konnte.
Franziskus hatte in dieser Botschaft gesessen, und der Botschafter wusste, dass er ihn vermutlich sehr ernst nehmen musste, denn Franziskus hatte zuvor einen sensationellen Erfolg zu verzeichnen gehabt. Deswegen schien die katholische Kirche in diesem so dramatischen Moment eines Krieges in Europa überhaupt mit im Spiel zu sein. Sie saß nicht am Rand als Zuschauer, handlungsunfähig und ohne dass sie überhaupt jemand wahrnahm.
Papst Franziskus hatte im Februar des Jahres 2016 ein Treffen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen auf Kuba erreicht. Es musste Kuba sein, denn noch immer sah der russisch-orthodoxe Patriarch Kuba als einen Teil des Sowjetstaates an und glaubte, dass dessen Einfluss noch existierte. Nur auf Boden unter russischem Einfluss wollte der Patriarch den Papst treffen.
Seit der Trennung zwischen der katholischen Kirche Roms und den orthodoxen Kirchen im Jahr 1054 hatte kein Papst je mehr das Oberhaupt dieser Kirche getroffen.
Franziskus hatte ihn damals überschwänglich als seinen »Bruder« begrüßt und davon gesprochen, dass dieses Treffen ein »Geschenk Gottes« sei. Es war das erste Mal, dass die Oberhäupter dieser beiden Kirchen ein friedliches Abkommen unterzeichneten. Ausgerechnet Raúl Castro, der Bruder Fidels, hatte seine Begeisterung für den Papst erklärt und angekündigt, dass er katholisch werden wolle, wenn dieser so weitermache.
Diesem herausragenden Erfolg hatte es der Papst zu verdanken, dass er jetzt als eine Figur der Hoffnung galt. Er hatte einen Kontakt aufgebaut zu einem der ganz wenigen Männer, auf die Wladimir Putin wirklich hörte, den Patriarchen Kyrill. Das wusste auch der Bürgermeister von Kiew, der ehemalige Box-Weltmeister Vitali Klitschko. Auch er setzte Hoffnung auf Papst Franziskus. Er wandte sich direkt per Telefon und in Videobotschaften an Journalisten, von denen er glaubte, dass sie im Vatikan Gehör finden würden. Er lud den Papst in einer flehentlichen Bitte ein, nach Kiew zu kommen. Zusammen mit anderen religiösen Oberhäuptern sollte er von dort aus einen Appell an Wladimir Putin richten, um diesen Krieg zu stoppen.
Der Papst hatte diesen Besuch nach Kiew vorbereiten lassen und gleichzeitig versucht, seinen Kontakt zu Kyrill in Moskau zu nutzen. Auf keinen Fall sollte die russische Seite verschreckt werden. Er wollte versuchen, so neutral wie möglich zu bleiben, um über Kyrill einen Waffenstillstand zu erreichen. Monatelang versuchte der Papst immer wieder, diese Reise nach Kiew durchzusetzen, aber sie musste immer wieder verschoben werden, bis es Zweifel daran gab, ob eine solche Reise überhaupt einen Nutzen haben würde. Es hatte sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass der Draht zu Kyrill überhaupt nichts gebracht hatte.
Aber wie hätte dieser Papst ahnen können, dass noch im Jahr 2022 ein religiöses Oberhaupt wie der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche auf die Idee kommen könnte, den Soldaten zu versprechen, dass sie, falls sie im Eroberungskrieg in der Ukraine fallen sollten, direkt ins Paradies gelangen würden. So etwas hatten die Oberhäupter der Religionen im Ersten und Zweiten Weltkrieg versprochen. Das schien alles längst überwunden und lange her. Wer hätte sich vorstellen können, dass es jemals wieder dazu kommen würde?
Jetzt nannte der russisch-orthodoxe Patriarch den Kriegsherrn Wladimir Putin, der ein Land überfallen hatte, ein »Wunder Gottes«. Wie hatte der Papst ahnen können, dass es noch im Jahr 2022 möglich sein würde, dass eine Kirche einen Angriffskrieg als eine patriotische Notwendigkeit in Gottes Namen segnen würde?
Der Papst weiß, dass seine Versuche, diesen Krieg zu stoppen, ein Fehlschlag waren. Aber die Kirche des Franziskus ist keine Kirche, die Erfolge erzwingen will mit Geld oder Macht. Es ist eine Kirche, die bettelt, die auf die Menschen guten Willens hofft, die versucht, den langen, schwierigen Weg des Dialogs und der Versöhnung zu gehen.
Das ist unspektakulär, schwierig und manchmal auch völlig aussichtslos. Das weiß auch Papst Franziskus, das bedeutet aber nicht, dass man es nicht immer und immer wieder versuchen muss, auf dem guten, dem schwierigen, dem steinigen Weg.
Er ist kein Mann, der alles beim Alten belassen will, und deswegen zählt für seine Gegner der Vorwurf nicht, er tue zu wenig.
Seine wahren Gegner haben ein massives Problem mit diesem Papst, nicht, weil er zu wenig reformiert, sondern zu viel. Sie hassen ihn dafür, das zeigte sich seit seiner Wahl, sie warfen ihm immer wieder Knüppel zwischen die Beine und verfolgten ihn mit einer regelrechten Abscheu, bekämpften ihn so sehr, dass er zugab, dass seine Gegner sich wünschten, »dass er sterbe«, dass »sie das nächste Konklave schon vorbereiten«, weil sie nur eines wollen: dass er verschwindet.
Sie wollen ihn weghaben, weil er etwas angefasst hat, das niemand anfassen durfte, weil er ein Siegel aufgebrochen hat, das für immer verschlossen bleiben sollte.
Das ist das Geheimnis seines Pontifikates.
25. Juli 2022
Vergebung
Drei Monate zuvor: 25. Juli 2022, Maskwacis, Kanada.
Es ist kalt an diesem Julivormittag. Die Wolken hängen tief über der weiten, mit Gras bewachsenen Ebene. Zusammengesunken sitzt Papst Franziskus in seinem Rollstuhl und schaut auf das Feld, auf dem sein Albtraum auf ihn wartet.
Mehr als 150 Jahre lang, von 1850 bis 2000, misshandelten, vergewaltigten und töteten Ordensleute und Priester der katholischen Kirche in Kanada Tausende indigener Kinder, die in ihrer Obhut waren. Mehr als 6000 Kindergräber wurden seit 2021 zufällig entdeckt. Die Kinderleichen wurden auf den Äckern rund um die katholischen Internate verscharrt, in denen 150 000 Schüler interniert waren, auf Äckern wie dem, vor dem der Papst jetzt schweigt. Wegen der gefrorenen Erde wurden die Kinder nicht allzu tief vergraben. Die Gräber wurden nie markiert. Es gibt nichts, was einem Grabstein ähnelt, keine Tafeln mit Geburts- und Todesdatum, nicht einmal ein einfaches Holzkreuz. Die Eltern bekamen nie eine Chance zu erfahren, wo ihre Kinder, die die Polizei ihnen weggenommen hatte, zur letzten Ruhe abgelegt worden waren. Die Entdeckung dieser Gräber hatte die ganze Welt schockiert.
Der Papst kennt die Geschichten der Kinder, die dort vor ihm in den Gräbern liegen. Da war dieses Mädchen, es floh durch das ganze Internat, wenn es wieder einmal in das Zimmer gezerrt werden sollte, wo es von einem Priester vergewaltigt wurde. Das Mädchen stürzte sich auf der Flucht vor den Nonnen, die es packen wollten, die Treppe hinunter und brach sich das Genick. Ein anderes Mädchen liegt in einem Grab irgendwo in der Nähe. Die Achtjährige wurde ausgesperrt, im Winter, bei minus 40 Grad, weil sie nicht richtig gebetet hatte. Sie erfror unter dem Busch, unter dem sie sich vor der Kälte verkrochen hatte.
Er ist einen weiten Weg gegangen, dieser Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien bis hierher auf dieses Feld in Kanada. Es kommt ihm jetzt wie Hohn vor, dass er zusammen mit anderen lateinamerikanischen Bischöfen darüber referierte, wie viel Gutes die katholische Kirche auf dem amerikanischen Kontinent in den Ländern getan hatte, in denen die Katholiken Politik und Gesellschaft dominierten, wie in Argentinien, Brasilien, den Ländern Mittelamerikas oder im französischen Kanada.
In den USA hatte die katholische Kirche viel weniger Einfluss gehabt. Es ist sehr bitter für den Papst, jetzt einzusehen, dass gerade die Tatsache, dass seine Kirche dort nicht viel zu sagen gehabt hatte, Tausenden Kindern der Ureinwohner unendliches Leid erspart hat.
So wird der Papst auf dem Rückflug nach Rom benennen, was hier in Kanada geschehen ist: »Völkermord durch die Mitglieder der katholischen Kirche«.
Dabei war die Triebfeder seines ganzen Lebens gewesen, dass er im Orden der Jesuiten, die sich als Soldaten Christi sehen, dafür kämpfen wollte, dass die katholische Kirche diese Welt in einen besseren Ort verwandelt.
Mit 85 Jahren sitzt er jetzt im Rollstuhl vor den Gräbern, die der eindeutige Beweis dafür sind, dass die katholische Kirche in diesem Teil der Welt gar nichts besser gemacht, sondern Kindern die Hölle auf Erden gebracht hat.
Oft hatte der Papst aus Argentinien gepredigt, dass Christus die Orientierungsrichtlinie für das ganze Leben sein müsse, dass er die Augen öffne. Aber hier hatte Christus kein Auge geöffnet und auch keine Orientierung geboten in der Frage, was mit den Kindern der Ureinwohner Kanadas geschehen solle, die die Polizei bei den Eltern abholte, damit sie in Internaten der katholischen Kirche erzogen würden. Statt sich von Christus die Augen öffnen zu lassen oder wenigstens das Offensichtliche zu sehen, nämlich dass es sich um wehrlose Kinder handelte, hatten die Ordensleute und Priester etwas ganz anderes gesehen: kleine Wilde, die mit aller Härte christianisiert werden mussten – sodass sie dabei ums Leben kamen.
Die Ureinwohner Kanadas, die an ihre eigenen Götter glaubten, hatten natürlich keine Chance gehabt, dass Gottes Sohn ihnen die Augen öffnete, aber sie wären nie auf die Idee gekommen, ihre Kinder umzubringen. Es waren die überzeugten Nonnen und Priester der katholischen Kirche, die hier jahrzehntelang Kinder misshandelten, und sie hatten geglaubt, das im Namen Gottes zu tun.
Papst Franziskus hat schon in viele Abgründe geschaut, die sich in der katholischen Kirche aufgetan haben, aber dieser hier ist wohl der tiefste. Natürlich hatte er gewusst, dass es Probleme in seiner Kirche gibt, und er wollte sie anpacken, als er im Frühjahr 2013 den Kardinälen signalisiert hatte: Ich würde es machen, ich traue mir das Amt des Papstes zu, ich kann der Nachfolger des so umstrittenen Benedikt XVI. werden.
Aber er hatte damals nicht geahnt, dass es so schlimm werden würde. Waren die Fälle sexuellen Missbrauchs durch Priester – so hatte sicher auch er einst gedacht – in Wirklichkeit nicht doch Einzelfälle, wie sie leider in allen großen Organisationen vorkommen? Er hatte als 21-Jähriger ein Jesuitenpater werden wollen, weil er für diesen Gott kämpfen wollte als sein Soldat. Aber was für eine schmutzige Schlacht war das geworden!
Er hatte begriffen, dass keineswegs die Guten gegen das Böse kämpften, gegen die Armut, die Ungerechtigkeit, die Gewalt der Mächtigen, sondern dass es viele Verbrecher in seinen eigenen Reihen gab, die sich nicht scheuten, sich an den Wehrlosesten zu vergehen.
Das Entsetzen über die Verbrechen der Priester und Ordensleute an Kindern und Jugendlichen hat die Kirche weltweit nicht in irgendeine Krise gestürzt: Sie steht vor einer Katastrophe.
Allein in Deutschland verlor die katholische Kirche im Jahr 2021 360 000 Mitglieder. Nur noch jeder vierte Bundesbürger gehört der katholischen Kirche an. 1990 war es noch mehr als jeder dritte gewesen. Auf jeden geweihten Priester kommen elf, die aufhören: Die Kirche blutet in einem sagenhaften Tempo aus. Um überhaupt noch Kandidaten zu finden, die sich zum Priester weihen lassen, wirbt die katholische Kirche in Deutschland inzwischen Quereinsteiger ohne Abitur an.
Die Menschen haben genug von dieser arroganten Kirche, die von oben herab bestimmt. Aber jetzt steht Papst Franziskus, der Rebell, der zum Entsetzen der Traditionalisten gefordert hatte, dass Schluss sein müsse mit der selbstverliebten und faulen Kirche, auf einmal auf der anderen Seite.
Er hat Reformen durchgepaukt, aber wenn er Änderungen zu schnell umsetzt, riskiert er die Kirchenspaltung. Und doch muss endlich etwas passieren, damit das, was hier geschehen ist, sich niemals wiederholt: Die kanadische Regierung hatte bei den Bemühungen, die indigenen Völker zu »zivilisieren«, entsetzliche Verbrechen begangen, und die katholische Kirche hat in all den Jahrzehnten nie gezögert, nicht nur mitzumachen, sondern die ausführenden Täter zu sein. Bis heute ist unklar, wie viele junge Menschen dabei ihr Leben durch Gewalt, Krankheiten und Hunger verloren.
Franziskus weiß, dass er handeln muss, um seinen Traum von einer Kirche an der Seite der Armen und Schwachen zu verwirklichen. Die Kirche muss aufhören, nur fromm zu sein, sie muss etwas tun. Und darum geht es diesem Papst, der versucht, seine Vision von einer besseren Kirche Schritt für Schritt umzusetzen.
Das beste Symbol dafür ist Kardinal Konrad Krajewski. Dieser Mann repräsentiert auf eine gewisse Art und Weise die neue Kirche des Papstes. Der Priester war nichts weiter gewesen als ein einfacher Zeremonien-Mitarbeiter, im Grund ein besserer Messdiener. Er war in der Amtszeit von Papst Johannes Paul II. aus seiner Heimat in Polen nach Rom gekommen. Er hatte an der erfolgreichen Papstreise des Jahres 1999 mitgearbeitet, sich in Rom eine bescheidene Wohnung in der Nähe des Vatikans gesucht. Dort kannten die Menschen den Polen mit dem betrübten Gesicht. Er war nicht glücklich gewesen während des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. Er hatte immer wieder darüber geredet, dass er am liebsten nach Polen zurückgehen würde. Viele rund um den Vatikan kannten sein Geheimnis. Er benutzte sein Gehalt dafür, in einem der edelsten Lebensmittelläden einzukaufen, die es in der Nähe des Vatikans gibt, dem Feinkostgeschäft Castroni, und morgens und abends die Obdachlosen rund um den Vatikan mit den Spezialitäten zu versorgen.
Wenn man ihn fragte: »Warum kaufst du ausgerechnet in diesem teuren Geschäft ein, du könntest viel einfachere Lebensmittel viel billiger woanders bekommen?«, dann pflegte er immer zu sagen: »Für mich sind diese Obdachlosen rund um den Petersplatz Christus, und die haben nur das Beste vom Besten verdient«.
Dass Krajewski sich jeden Tag um die Armen kümmerte, fiel der Chefetage um Papst Benedikt XVI. nicht auf. Krajewski galt als ein bisschen versponnen, ein Mann ohne große theologische Ausbildung, gerade gut genug dazu, Kerzenleuchter zu halten, während andere komplizierte theologische Theorien besprachen. Aber dann kam Papst Franziskus, und alles wurde anders. Er hatte davon hörte, dass dieser einfache Priester sich seit Jahren ganz klein gemacht hatte, ein Diener Gottes gewesen war.
Für Franziskus symbolisierte dieser Mann die neue Kirche, und er hatte ihn befördert. Nicht nur ein wenig. Er hatte ihm Macht gegeben, er hatte ihn zum Kardinal gemacht. Er sollte sein Macher werden. Krajewski bekam den Spitznamen »der Elektriker«, seitdem er in einen Schacht einer Halle geklettert war, in der Papst Franziskus Emigranten hatte unterbringen lassen. Aber in der Halle gab es keinen Strom, kein Licht, keine Heizung. Der Vermieter hatte alles abgestellt. Kardinal Krajewski war einfach in den Versorgungsschacht geklettert und hatte die Stromversorgung wieder eingeschaltet. Dafür hatte er sich eine Strafanzeige wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft eingefangen.
Zuvor hatte er in einem anderen Auffanglager, in dem der Betreiber die Türen für die Waschräume verschlossen hatte, einfach die Türen aufgebrochen, um den Migranten Zugang zu den sanitären Einrichtungen zu verschaffen. Auch da hatte es Ärger gegeben, aber der Papst hatte Krajewski gesagt: »Wir können es uns leisten«.
Zuletzt war Kardinal Konrad Krajewski in der Ukraine mit Krankenwagen und Lebensmittel-Transportern unterwegs. Natürlich ist seine Aktion nur ein Tropfen auf den heißen Stein und natürlich wäre es viel besser gewesen, wenn ihm, Papst Franziskus, gelungen wäre, einen Waffenstillstand zu erreichen. Aber dem Papst geht es darum, es immer wieder zu versuchen, diese Welt zum Besseren zu verwandeln, auch wenn alle anderen wegschauen, auch wenn alle anderen sagen, es hat keinen Sinn, wenn alle anderen sagen, das Problem ist so groß, dass man es gar nicht angehen kann.
In seiner Jugend hatte es nicht danach ausgesehen, dass er sich jemals um das würde kümmern müssen, was Päpste im weit entfernten Rom angerichtet hatten. Der Sohn aus einer Eisenbahnerfamilie hatte nur ein guter Schüler sein wollen. Er hatte sich verliebt, gern getanzt, die Ideen des so widersprüchlichen Politikers Juan Perón aufgesogen, in einer Bar als Rausschmeißer gearbeitet und am Wochenende die Tore seines Lieblingsfußballvereins San Lorenzo bejubelt. Er hatte es geschafft, eine Stelle als Chemielaborant zu bekommen, als das Schicksal seinem Leben bereits ein Ende setzen wollte. Mit 21 Jahren erkrankte er an einer lebensgefährlichen Lungenentzündung, ein Teil des rechten Lungenflügels musste entfernt werden. Noch viel später erinnerte er sich an die Angst in den Augen seiner Mutter. Als er wieder auf die Beine kam, war er ein anderer. Sein Glaube an Gott spielte auf einmal eine sehr große Rolle.
Er war nicht blauäugig gewesen, er war keiner dieser Bürokraten des Heiligen Stuhls, die er verachtete und während der Weihnachtsansprache an die Kurie im Jahr 2014 regelrecht fertiggemacht hatte. Er wusste, dass man sich die Hände schmutzig machen konnte, wenn es richtig schwierig wurde. Er hatte die erste große Katastrophe seines Lebens erlebt, als er erfahren musste, dass man in einer Diktatur nicht unschuldig bleiben kann, wenn man beschlossen hat, sich nicht wegzuducken. Die Mörder in Uniform hatten sich in Argentinien 1976 erneut an die Macht geputscht und leiteten die blutigste und brutalste Militärdiktatur in der Geschichte des Landes ein: Zwischen 1976 und 1983 starben mehr als 30 000 Systemgegner: Wer dem Regime nicht passte, wurde ermordet und verschwand. Viele wurden gefangen genommen und gefoltert und später von Flugzeugen aus ins Meer geworfen. Auf eine dramatische Weise hatte Bergoglio jetzt das Thema seines Lebens erlebt: Reich gegen arm. Es gab Patres, die ihm unterstanden und sich radikal auf die Seite der Armen stellten. Sie besuchten sie in den Slums von Buenos Aires. Das war lebensgefährlich, denn in den Slums versteckten sich auch die größten Feinde der Militärjunta: die Kämpfer der Stadtguerilla, die Montoneros. Sie beriefen sich auf Juan Perón, der auch von Bergoglio verehrt worden war.
Als Jesuitenchef wäre es Bergoglios Aufgabe gewesen, die Militärs darüber zu informieren, dass die Patres in den Slums nur die Armen, nicht die Guerillakämpfer, unterstützen wollten, aber die Soldaten schlugen zu, nahmen zwei seiner Mitarbeiter fest und folterten sie wochenlang. Bergoglio verhandelte mit der Junta, um seine Leute freizubekommen, wohl wissend, dass die Militärs Mörder waren. Die Patres kamen nach entsetzlichen Wochen tatsächlich frei und beschuldigten ihren Vorgesetzten Bergoglio, sie verraten zu haben. War er schuld? Hat er mit der Junta kollaboriert? Nie mehr hörte es auf, dass irgendjemand, oft er selbst, diese Frage stellte.
Das alles war schlimm gewesen, so schlimm, dass er in psychiatrische Behandlung musste. Aber selbst in diesem katastrophalen Fall war es nicht im Ansatz um ein solches Ausmaß des Verbrechens gegangen wie hier in Kanada. Nie zuvor hatte ein Papst in der Geschichte eine Auslandsreise angetreten und erklärt, dass diese Reise einen einzigen Zweck habe, nämlich Buße zu tun. Die Cree hatten auf dem Feld, in dem die Kinder ihres Volkes begraben lagen, ihre Tipis aufgestellt, neben dem Platz, an dem der Papst in seinem Rollstuhl kauerte. Sie hatten ihm angeboten, eine Rede zu halten, aber er hatte zu ihrer Verwunderung abgelehnt. Er konnte angesichts dieses Leids, das auch ein Papst niemals wiedergutmachen würde können, nur schweigen. Dieses Schweigen war ihm so wichtig gewesen, dass er den Plan der Reise hatte umwerfen lassen. Kein offizieller Besuch in der Hauptstadt, im Sitz des Staatsoberhauptes wie sonst immer und seit Jahrzehnten üblich. Nein, er war gekommen, um auf diesem Friedhof zu schweigen. Seine Kirche hatte diese Frauen und Männer ausgebildet, die zugesehen hatten, wie Kinder in katholischen Internaten verhungert waren und an Krankheiten starben, die die weißen Priester und Ordensleute aus Europa in den Internaten einschleppten und gegen die fast keine Indigenen Abwehrstoffe entwickelt hatten – die gar nicht nötig gewesen wären, wenn die Weißen ihnen nicht ihr Land und ihre Freiheit genommen hätten. Er ist jetzt ein sehr alter Mann, weltberühmt und täglich gefeiert, bemitleidet und angegriffen. Er kann keinen einzigen Schritt mehr ohne Hilfe gehen, ohne sich abzustützen. Er ist auf Hilfe angewiesen, wenn er aus dem Rollstuhl aufstehen will. Er ist seinem Gott über weite Strecken und viele Jahre gefolgt und hatte im Namen dieses Gottes wie ein verzweifelter Bettler gestritten, mit den Mächtigen und den Gleichgültigen, damit sie nicht einfach wegsehen, wenn Menschen leiden, wenn sie zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken oder einfach ermordet werden im Dschungel von Myanmar. Er hatte von Anfang an gestritten, und jetzt verließen ihn seine Kräfte immer schneller. Sein Körper war nach und nach zum Gefängnis geworden für den einst so hageren, agilen Jorge Mario Bergoglio, der mit 22 Jahren Pater werden wollte bei den Jesuiten.
Es war keineswegs so gewesen, dass er angesichts der Abgründe der Kirche, in die er hatte schauen müssen, aufgehört hätte zu kämpfen. In den Jahren seines Pontifikates hatte er immer und immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, war an Orte gereist, die die Welt am liebsten vergessen wollte, weil sie es satt hatte zu erfahren, wie sehr die Menschen dort litten. Er hatte nie gekniffen, selbst wenn es lebensgefährlich gewesen war. Er flog zusammen mit seiner Delegation in den Irak, obwohl die islamistischen Terroristen sogar den Flughafen mit Raketen angegriffen hatten, auf dem er landen sollte. Die Zeit der angenehmen Papstreisen war mit diesem Franziskus vorbei. Statt in den Pausen zwischen Messen und Andachten in Paris auf der Champs-Élysées shoppen zu können oder während eines Papstbesuchs in New York über die Fifth Avenue zu schlendern, schleppte sich der päpstliche Tross jetzt durch Slums auf Lesbos in Griechenland, AIDS-Hospitäler in Mosambik oder Auffanglager für verletzte Flüchtlinge in Bangladesch.
Lange schon sitzt der Papst schweigend vor den Gräbern auf diesem Acker, als die kanadischen Organisatoren der Vatikan-Delegation das Zeichen geben, dass es Zeit wäre: Er will jetzt zu den Überlebenden des Horrors, den seine Kirche angerichtet hat, er will direkt mit vielen von ihnen sprechen, und es würde einer der schwersten Wege im Leben dieses alten Mannes werden.
Deswegen ist er hierhergekommen, auf diesen Acker voller Gräber in Kanada, weil er zeigen will, dass er wagt anzufassen, was niemand je hatte anfassen dürfen. Er hat das Siegel gebrochen, das auch sein Vorgänger wie alle 264 Päpste vor ihm gehütet hatte, und das Siegel hütete einen unantastbaren Satz: Die von Gott selbst gegründete katholische Kirche kann gar nicht schuldig werden, sondern nur ihre Mitglieder.
Aber hier in Kanada und in vielen anderen Ländern und in vielen Jahrhunderten ist die katholische Kirche schuldig geworden. Nicht nur einzelne Sünder machen der Kirche zu schaffen. Franziskus ist der erste Papst, der zugibt: In der Kirche Gottes selbst steckt der Wurm.
13. März 2013
Vatikan
Am Nachmittag dieses 13. März 2013 fegte der Wind immer wieder leichte Regenschauer über den für diese Jahreszeit noch ungewöhnlich kalten Petersplatz in Rom. Die Nässe trieb die Menschen nach und nach dazu, sich unter den mächtigen Kolonnaden zusammenzudrängen. Von hier aus konnten sie das Dach der Sixtinischen Kapelle aber nicht mehr sehen. Deswegen behielten sie die Gruppe, die auf dem Platz stehen geblieben war, fest im Blick. Diese kleine Schar hatte freie Sicht auf den Schornstein, der aus dem Dach der Sixtinischen Kapelle ragte. Dieser Schornstein wird nur unmittelbar vor der Papstwahl auf dem Dach der Kapelle installiert und danach sofort wieder abgebaut.
Allen Zuschauern war klar: In dem Augenblick, in dem Rauch aus dem Schornstein aufstieg, würde die Gruppe johlen. Wenn es schwarzer Rauch war, würde sich die Aufregung rasch legen. Doch ein Brausen würde über dem Petersplatz erklingen, wenn es weißer Rauch sein sollte. Die Menschen würden kreischen, klatschen, einige würden beginnen zu beten, andere würden Kirchenlieder singen. Eine feierliche, eine festliche und vor allem eine gespannte Stimmung würde die vielen Tausend Menschen erfassen: Denn in Kürze würden sie den 265. Nachfolger des heiligen Petrus sehen, den neuen Bischof von Rom, den Mann, der die Wahl gewonnen hatte. Und dieses Mal würde es nicht nur darum gehen, für was dieser Papst stand, sondern vor allem, gegen wen er sich stellte.
Irak
Am Nachmittag dieses 13. März 2013 räumt Suhair Nagit, eine Christin, ihre durch Granaten beschädigte Boutique in Mosul im Irak auf. Sie ist 47 Jahre alt und glaubt, dass diese Angriffe der Terroristen des Islamischen Staates (IS) Einzelfälle seien. Sie versteht noch nicht, dass viele ihrer muslimischen Nachbarn die Kämpfer des IS tatsächlich willkommen heißen. Sie ahnt nicht, dass diese Armee von Vermummten, die sich ISIS oder Daesh nennen, ein Jahr später über Nacht ihren Heimatort Mosul einnehmen werden, eine Stadt von der Größe Hamburgs.
»ISIS« und »Daesh« sind Abkürzungen für die deutsche bzw. arabische Bezeichnung des »Islamischen Staates im Irak und in Syrien«. Ursprünglich ging diese militärische Gruppierung aus Teilen der regulären irakischen Armee hervor.
ISIS-Kämpfer forderten die nichtmuslimischen Bewohner der besetzten Stadt Mosul per SMS auf, sofort zum Islam zu konvertieren und alle Frauen abzuliefern. Wer sich nicht daran hielt, wurde geköpft. Die Christen, die seit Jahrhunderten in Mosul lebten, gaben nicht auf. Es kam zu Feuergefechten. Männer ließen sich im Kugelhagel zerfetzen oder versuchten, mit ihren Frauen, Töchtern und Söhnen über den Fluss Tigris nach Erbil zu fliehen.
Die, die es nicht schafften, erlebten die Hölle auf Erden. Frauen wurden auf Sklavenmärkten verkauft, als sei das Mittelalter in das Zweistromland zurückgekehrt. In besonderem Maße litten Jesidinnen. Die Frauen, die dieser Religion angehören, deren Wurzeln 1500 Jahre älter sind als das Christentum, galten dem IS als perfekte Beute. Da Jesiden im Gegensatz zu Juden und Christen kein heiliges Buch kennen, galt für sie nicht die mindeste Rücksichtnahme. Die Jesiden nahmen auf der Flucht eher den Tod durch Verdursten oder Verhungern in Kauf, als vom IS gefangen genommen zu werden. Frauen, die nicht fliehen konnten, nahmen sich häufig mit Plastiktüten das Leben.
Acht Jahre später gehört Suhair Nagit zu den 500 Opfern, die nach der Flucht in einem lang gestreckten, nie zu Ende gebauten Betonkoloss am Basar in Erbil Schutz suchten. Die Zugänge zu dem Gebäude wurden von christlichen Freiwilligen bewacht, die mit Kalaschnikows bewaffnet waren. Suhair Nagits Familie lebt in bitterer Armut in Erbil und kann die Demütigungen, den Hunger, die Gewalt nicht vergessen: Aber die irakische Regierung fühlt sich nicht zuständig für das Elend dieser Christen, und ein Land, das sie aufnehmen will, gibt es nicht.
Vatikan
Am Nachmittag dieses 13. März 2013 versucht der Argentinier Jorge Mario Bergoglio in der Sixtinischen Kapelle darüber nachzudenken, wer der richtige Mann für das Amt des Papstes sein könnte. Er selbst hat seine Arbeit für die katholische Kirche offiziell beendet. Er ist 76 Jahre alt und hat mit dem Erreichen des 75. Lebensjahres seinen Rücktritt eingereicht, wie alle Bischöfe. Jorge Mario Bergoglio weiß, dass viele im Vatikan nur darauf warten, dass er seinen Posten räumt. Es hatte viel böses Blut gegeben in den vergangenen Jahren. Rom hatte ihm das Leben schwergemacht, und er hatte rebelliert. Wenn der argentinische Erzbischof nach Rom gekommen war, um an einer Synode teilzunehmen, hatte er auf Journalisten mürrisch gewirkt, in sich gekehrt, verschlossen. Bergoglio schien ein Mann zu sein, der dazu neigte, stets schlecht gelaunt durch den Tag zu gehen. Die Teilnehmer der Synoden und die Beobachter sahen ihn nie lächeln. Das war durchaus verständlich. Er hatte eine Menge Schlachten in seinem Leben schlagen müssen und meistens verloren. Als Johannes Paul II. im Jahr 1978 zum Papst gewählt wurde, trug der Pole den Konflikt mit dem linken Flügel der Jesuiten, zu denen auch Pater Jorge Bergoglio gehörte, offen aus. Johannes Paul II. entschied sich im Jahr 1981 zu einem radikalen Schnitt und setzte einen persönlichen Delegaten an die Spitze des Ordens, der normalerweise seine Generäle, wie die Ordensoberen der Jesuiten heißen, selbst wählen darf. Der Konflikt war ungewöhnlich, denn die Jesuiten – und nur die Jesuiten – schwören durch ein besonderes Gelöbnis dem Papst direkt Gehorsam. Aber ganz offensichtlich war Johannes Paul II. davon überzeugt, dass die Jesuiten nicht mehr hinter ihm standen, und übernahm persönlich die Kontrolle über den Orden. Bergoglio hatte zu denen gehört, denen Papst Johannes Paul II. wegen ihrer Vorliebe für die Politik eher mit Argwohn begegnete. Er ließ ihn nur deswegen zum Erzbischof von Buenos Aires aufsteigen, weil er ihn für den am wenigsten gefährlichen Mann mit sozialistischen Tendenzen gehalten hatte. Besonders geschätzt hatte er ihn nie. Aber diese Schlachten waren geschlagen, und der 76-jährige Argentinier hätte sich einfach in den Ruhestand verabschieden können, denn er passte einfach nicht nach Rom. Er hatte den prächtigen Palast der Jesuiten gemieden, als er zur Papstwahl gekommen war. Er hatte nicht darum gebeten, standesgemäß in der Zentrale wohnen zu können, sondern sich ein ganz einfaches Zimmer im Priesterheim in der Via della Scrofa genommen. Irgendwie passte er auch nicht hierher, in das prächtige Lapislazuli, dessen geradezu mystisches Blau die Sixtinische Kapelle verzaubert.
Bergoglio wusste, dass sich das argentinische Präsidentenehepaar Cristina Fernández de Kirchner und ihr Mann Néstor Kirchner immer wieder hier in Rom über ihn beschwert hatten: Bergoglio sei ein viel zu politischer Kardinal. Seine Predigten waren so gefürchtet, dass das Präsidentenpaar selbst an den hohen Feiertagen seiner Kirche fernblieb, um sich nicht anzuhören, was er ihnen an den Kopf warf. Er beklagte, dass die Arbeiter ausgebeutet würden, dass der Staat die Armen in ihrem Elend allein lasse, dass die Reichen korrupt und rücksichtslos seien. Diese Jahre waren nicht einfach gewesen, und dann war der Tiefpunkt im Jahr 2005 gekommen. Jorge Mario Bergoglio hatte an der Papstwahl teilgenommen, und ausgerechnet sein Mitbruder im Jesuitenorden, der frühere Mailänder Erzbischof, Kardinal Carlo Maria Martini, hatte vor ihm gewarnt. Sein Verhalten während der Zeit der Militärjunta in Argentinien sei nicht korrekt gewesen. Jorge Mario Bergoglio hatte daraufhin darum gebeten, ihn nicht mehr zu wählen.
Zwei Männer sind seitdem der Albtraum des Jorge Mario Bergoglio geblieben, die Patres Franz Jalics und Orlando Yorio. Die Militärs hatten die Patres am 23. Mai 1976 in den Armenvierteln Bajo Flores von Buenos Aires gefangen genommen und monatelang gefoltert. Hätte er das nicht verhindern müssen? Sie hatten Jorge Mario Bergoglio später angeklagt, er habe sie verraten, die Anklage dann aber wieder zurückgezogen. Aber ein Misstrauen gegen ihn blieb. Er musste damals in psychiatrische Behandlung, weil er mit den Zweifeln nicht fertigwurde.
Es hat Jorge Mario Bergoglio verletzt, dass sich die Kardinäle fragten, ob sie ihm trauen konnten. Er wusste, dass sie grübelten: Saß in diesem Konklave, das den Nachfolger von Joseph Ratzinger wählen sollte, aus ihrer Sicht also ein Mann, der das mörderische Regime der Militärjunta unterstützt hatte? Hatte er die beiden Patres wirklich an die Militärs verraten? Würde das eines Tages doch noch herauskommen? Bergoglio konnte die fragenden Blicke der Mitbrüder im Kardinalskollegium nicht übersehen. Wäre es nicht am besten zu gehen? Es gab mehr als genug Gründe dafür, sich einfach in die Rente zu verabschieden. Aber da war seine Überzeugung, dass so vieles in dieser Kirche anders laufen müsste.
Er hatte damit nicht hinter dem Berg gehalten während der Treffen vor dem Konklave. In seiner Ansprache hatte er beschrieben, dass Christus an die Tür klopfe. Das hatte ihm nicht nur Sympathien, sondern auch viele Anfeindungen eingebracht, denn sie alle hatten verstanden, was er damit gemeint hatte, dass Christus nämlich in dieser Kirche gar keinen Platz hatte, dass diese arrogante europäische Kirche diejenigen aussperrte, die Christus wirklich brauchen. Aber so mancher war auch zu ihm gekommen und hatte ihm gesagt: »Mach du es!«
Er fragte sich, ob er jetzt noch zurückkonnte. Konnte er die, die auf ihn gesetzt hatten, die, die eine ganz andere Kirche wollten, jetzt noch vor den Kopf stoßen? Konnte er seine Kandidatur für die Nachfolge des heiligen Petrus doch noch zurückziehen, indem er dem Konklave klarmachte, dass er einfach zu alt und mit dem einen ihm verbliebenen Lungenflügel und dem Hüftleiden auch zu schwach war für ein solches Amt?
Griechenland
Am Nachmittag dieses 13. März 2013 beobachtete die griechische Küstenwache die Versuche von Flüchtlingen, von der türkischen Seite aus auf die griechische Insel Lesbos zu gelangen. Der Krieg der Taliban in Afghanistan, der aufflammende Bürgerkrieg in Syrien, aber auch die Not der Flüchtlinge aus dem Irak und den Kurdengebieten hatten dafür gesorgt, dass immer größere Flüchtlingsströme in die Türkei drängten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nutzte die dramatische Lage, um die EU zu erpressen, die diese Menschen in Not nicht aufnehmen will: Er kann entscheiden, sie durchzulassen oder gegen viel Geld ihre Weiterreise zu verhindern.
Das größte Problem der Insel Lesbos ist ihre Lage. Vom Strand der Insel aus kann man die türkische Seite in etwa zehn Kilometern Entfernung gut sehen. Ein guter Schwimmer kann die Insel von der Türkei aus durchaus erreichen. Mit einem Boot scheint es ein Kinderspiel zu sein. Doch immer wieder kentern Boote, ertrinken vor allem Frauen und Kinder, die nicht schwimmen können, im Meer. Bewaffnete Schleuserbanden bringen mehrmals pro Tag Flüchtlinge nach Griechenland. Die Küstenwache weiß: Wenn der Krieg in Syrien nicht sehr bald zu Ende ist, sondern weitergekämpft wird, werden weiterhin Tausende nach Lesbos kommen. Niemand kann das aufhalten. Aber wenn die Türkei die Menschen nicht haben will und die EU auch nicht, wer soll für diese verzweifelten Frauen und Männer eintreten?
Vatikan
Es gibt etwas, was Jorge Mario Bergoglio am Nachmittag dieses 13. März 2013 beruhigt: Die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Papst gewählt werden könnte, ist gering. Denn um ihn zu wählen, müssten die Kardinäle gewaltigen Mut aufbringen. Sie müssten die einzige unangenehme der vier Varianten einer Papstwahl wahr werden lassen. Da Kardinäle aber dazu neigen, Ärger zu vermeiden, war es unwahrscheinlich, dass sie Konflikte in Kauf nehmen würden.
Die erste Variante, nämlich den Nachfolger eines verstorbenen erfolgreichen Papstes zu wählen, wäre kein Problem. Das Konklave musste lediglich einen Kandidaten aussuchen, der sehr eng mit dem Papst zusammengearbeitet hat.
Die zweite Variante wäre ebenfalls einfach: den Nachfolger eines verstorbenen Papstes zu wählen, der schwere Fehler gemacht hatte. Die Kardinäle im Konklave mussten einfach einen entschiedenen Gegner des Papstes wählen. Der Vorgänger wäre ja tot und müsste den radikalen Kurswechsel, der sein Pontifikat zunichtemachen würde, nicht mehr miterleben.
Den Nachfolger eines zurückgetretenen erfolgreichen Papstes zu finden, wäre auch kein Problem: In dem Fall konnten die Kardinäle einen engen Mitarbeiter des Papstes wählen.
Die vierte Variante, den Nachfolger eines zurückgetretenen Papstes zu bestimmen, der schwere Fehler gemacht hatte, stellte allerdings ein gewaltiges Problem dar. Dann mussten die Kardinäle einem Lebenden und seiner Mannschaft das Messer in den Rücken stoßen. Sie würden durch die Wahl eines Gegners das Lebenswerk des Zurückgetretenen zerstören, obwohl sie ihn selbst und seine Mannschaft jahrelang hofiert und über den grünen Klee gelobt hatten. War das machbar?
Jorge Mario Bergoglio musste an diesem 13. März 2013 davon ausgehen, dass er kaum Chancen haben werde, die Wahl zum Papst zu gewinnen und das Steuer der Kirche radikal herumzureißen, denn nahezu alle Kardinäle im Konklave hatten Joseph Ratzinger im Laufe seiner Amtszeit zu seiner weisen Führung der Kirche gratuliert.
So ist das nun mal im Staat des Papstes. In der letzten absolutistischen Wahlmonarchie der Welt misst sich Macht ausschließlich daran, wie nahe die oder der Betreffende dem Souverän kommt und wie wohlgesonnen der ihm ist. Es liegt daher in der Natur der Sache, dass Kardinäle dem Papst schmeicheln. Nur sehr selten wagen Kardinäle, ernste Konflikte mit einem Papst auszutragen. Das hat damit zu tun, dass laut der Glaubenslehre der katholischen Kirche der Heilige Geist den Papst aussucht. Wenn die Kardinäle ins Konklave einziehen, singen sie »Veni Creator Spiritus«. Das ist ein Befehl, es heißt »Komm her, Heiliger Geist!« Aber ein Kardinal, der Purpurrot trägt als Zeichen dafür, dass er bereit ist, sein Blut für die Kirche zu vergießen, kann ja kaum gegen einen Papst aufbegehren, den der Heilige Geist persönlich ausgesucht hat. Das würde ja unterstellen, dass der Heilige Geist danebengegriffen hat.
Seit der Erfindung der Papstwahl galt, dass ein Papst bestenfalls aus dem Jenseits mitbekommen kann, ob die Kardinäle, die seinen Nachfolger wählen, seine Arbeit würdigen und einen Mann aus seinem Umfeld wählen oder einen klaren Schnitt machen, weil sie unzufrieden sind mit seiner Leitung. Sollte es ein Leben nach dem Tod geben, wird sich Papst Johannes Paul II. möglicherweise darüber gefreut haben, dass die Kardinäle einen seiner engsten Mitarbeiter zum Nachfolger wählten, den Mann, den er seinen »bewährten Freund« nannte, Joseph Ratzinger. Diese Wahl bedeutete vor allem, dass Papst Johannes Paul II. sehr viel richtig gemacht hatte, sodass die Kardinäle damals ein »Weiter so« wollten. Aber auf Erden hätte er die Wahl seines Nachfolgers nicht mehr beeinflussen können. Papst Pius XII. musste auch nicht als Lebender erfahren, dass sein liberaler Gegenspieler als Johannes XXIII. zum Papst gewählt wurde.
Doch im Jahr 2013 ist alles anders.
Joseph Ratzinger ist nicht tot. Die Kardinäle stehen jetzt vor einer heiklen Aufgabe. Entweder wählen sie einen Ratzinger-Mann, dann können sie nach der Wahl dem zurückgetretenen Papst noch problemlos unter die Augen treten. Oder aber sie wählen einen Anti-Ratzinger-Mann. Dann gäbe es im Vatikan zum ersten Mal einen verärgerten Expapst, der einen Gegner auf dem Thron Petri erdulden muss, den er freiwillig verlassen hat. Würden die Kardinäle das wagen? War das Pontifikat von Benedikt XVI. ein solcher Tiefpunkt gewesen, dass es keine andere Wahl gab, als alles anders zu machen?
Das größte Problem bestand darin, dass die Kardinäle Joseph Ratzinger nicht nur aus seiner Amtszeit zwischen 2005 und 2013 kannten, sondern sehr viel länger, weil er schon seit dem Jahr 1981 Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre gewesen und sagenhafte 24 Jahre lang Chef der Behörde der Glaubenshüter geblieben war. Nahezu alle wahlberechtigten Kardinäle hatten irgendwann mit Joseph Ratzinger geplaudert und ihn in seinem Amt als Papst mit Ermutigungen und Lob überschüttet. Und jetzt? Das »Team Ratzinger« saß noch an allen Hebeln der Macht. Es war von seinem Chef schlagartig seinem Schicksal überlassen worden.