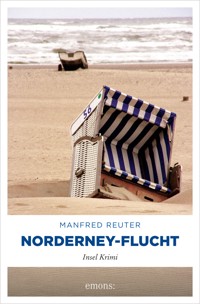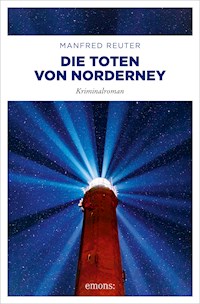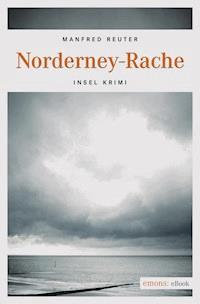
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Insel Krimi
- Sprache: Deutsch
Norderney-Rache: Ein fesselnder Insel-Krimi voller düsterer Geheimnisse und unerwarteter Wendungen – Gent Visser, Band 2 An einem stürmischen Abend auf Norderney kehrt eine wohlhabende Ferienhausbesitzerin nicht von ihrer Yogastunde zurück. Ist sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen? Während Oberkommissar Gent Visser die Insel von einer Hundertschaft der Polizei absuchen lässt, beginnt für die Frau ein unvorstellbares Martyrium. Wenige Tage später wird eine Leiche am Strand gefunden – doch es ist nicht die Entführte. Die Insel steht unter Schock. Norderney-Rachenimmt die Leserinnen und Leser mit zu einer ebenso mörderischen wie unheimlichen Reise auf die sonst so idyllische Nordseeinsel. Fesselnd bis zur letzten Seite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Manfred Reuter, Jahrgang 1957, stammt aus der Eifel und arbeitet als Journalist in Ostfriesland, zuletzt als Chefredakteur der Norderneyer Badezeitung. Er wohnt mit seiner Familie, zwei Schafen und fünf Hühnern in einem kleinen Dorf in der Nähe von Aurich.
www.reutermanfred.de
www.facebook.com/mhreuter
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/ts-fotografik.de Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Christine Derrer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-136-9 Insel Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für meinen Bruder
Was immer dir widerfahren mag,seit ewig war es dir bestimmt.
Marc Aurel (121–180n.Chr.),
Prolog
Er war sieben Jahre alt, als die Kindheit aus ihm verschwand wie jemand, der die Tür hinter sich schließt und niemals mehr zurückkehrt. Und als straften ihn die Augenblicke des Grauens mit Ewigkeit, erinnerte er sich auch als Erwachsener noch an alles, was geschah; auch an diesen Tag.
Es war der Tag, an dem er mit seinem dürren Kinderkörper in den Dünen lag und sein Blick mit den Wolken eins wurde. Das Gesicht trug bereits die ersten Züge eines Erwachsenen; blutleere Lippen, mattlederne Haut, hängende Lider. Die Augäpfel vergruben sich tief in den Höhlen, als wollten sie sich verstecken, die Nasenflügel wippten in nervösen Rhythmen auf und ab, als witterten sie Ungemach. Hinter der schmalen Brust rasselte die Lunge; wenigstens die Hustenanfälle hatten nachgelassen.
Am Tag zuvor war der Junge nach seinem vierten Klinikaufenthalt nach Norderney zurückgekehrt. Natürlich war er noch nicht wieder ganz hergestellt, doch die Ärzte waren überzeugt, dass die restliche Genesung auf der Insel vonstattengehen würde. In einem Klima, das mit seiner heilenden salzhaltigen Luft dazu prädestiniert war, den Körper wieder auf Vordermann zu bringen und ihn in die altersgemäße Leistungsstärke zu versetzen. Der regelmäßige Besuch der Schule, der Umgang mit Gleichaltrigen und das geordnete Elternhaus würden zusätzlich dazu beitragen, das seelische Gleichgewicht wiederzuerlangen.
Der schmächtige Heimkehrer wusste nicht genau, wann, aber es war schon lange Zeit her, dass er zuletzt mit dem Rad in die Dünen am Nordbadestrand gefahren war. Auch an jenem Tag genoss er, wie der Sommerwind über sein Gesicht strich und die kleinen, von der Anstrengung des Radfahrens übrig gebliebenen Schweißperlen trocknete.
EINS
Es gehörte zu den liebsten und festen Gewohnheiten von Marion und Amke Folkerts: Nach dem Yoga am Dienstag fuhren sie mit dem Rad noch eine Runde »um den Pudding«, um anschließend ein Stündchen− manchmal wurden es auch zwei oder sogar drei− im Surfcafé einzukehren. Besonders im Sommer bereitete dieses Ritual am Norderneyer Januskopf allergrößtes Vergnügen: ein Gläschen Prosecco, ein kühler Chardonnay oder ein erfrischendes Weizenbier; irgendein Sundowner zu den Kult-Klängen von »Knockin’ on Heaven’s Door« ließ sich immer finden. Ein Prösterchen hier, ein Small Talk dort– und schon versank die Sonne sanft im Ozean. Inselherz, was willst du mehr?
Heute lieferte der Tag solche Bedingungen nicht. Wie die Meteorologen richtig vorausgesagt hatten, waren bereits am frühen Abend wuchtige Wolkenformationen aufgezogen, und für einen Junitag zeigte sich der Himmel zu erstaunlich früher Stunde bereits düster.
»Ich hasse ja das Wort Sundowner«, sagte Amke, während sie ihrer Schwiegermutter die Tür zum Lokal aufhielt und mit ihr geradewegs auf die bereits anwesenden Yoga-Kolleginnen zusteuerte.
»Heute brauchst du ja auch keinen«, erwiderte Marion und zeigte mit einer weit ausholenden Armbewegung in den trüben Himmel, »es ist ja praktisch keine Sonne da, die untergehen kann.«
»Okay, dann nehme ich einfach wieder einen Prosecco und bilde mir ein, dass die Sonne gerade in ihren schönsten Farben am Horizont klebt«, zwitscherte Amke mehr, als sie sprach, und lachte laut, dass alle im Café spätestens jetzt wussten: Die Norderneyer Yoga-Fraktion ist nun komplett.
Mit elegantem Schwung nahm Marion auf der komfortabel gepolsterten Bank mit dem Rücken zum Fenster Platz. Sie war eine ausgesprochen selbstbewusste Person und dafür bekannt, gern das Wort zu führen. Bis vor Kurzem arbeitete sie als Krankenschwester im Norderneyer Inselhospital, eine Tätigkeit, die sie mit Leidenschaft und Hingabe ausübte. Vor fünf Jahren war Fred, mit dem sie dreiunddreißig Jahre lang verheiratet war, gestorben. Er hatte Lungenkrebs und Metastasen im Gehirn. Von der Nachricht über die Erkrankung bis zum Tod hatte es lediglich gut drei Monate gedauert. Marion hatte lange gebraucht, um über diesen Schicksalsschlag hinwegzukommen.
Für eine Frau von Anfang sechzig wirkte Marion durchaus attraktiv: Die äußerst gepflegten, immer noch vollen und mehr silbern als grau glänzenden Haare fielen flippig auf die schmalen Schultern. Stets trug sie sie offen. Sie zelebrierte es regelrecht, sie in den Wind zu halten und von ihm frei und ungestüm modellieren zu lassen. Sogar beim Sport und beim Thalasso in der Nordsee, dem Baderitual zum Wecken der Lebenskräfte, verzichtete Marion auf ein Haarband. Es schien ihr Vergnügen zu bereiten, das wild wallende Haar immer und immer wieder mit geübten Fingergriffen hinters Ohr zu streichen oder herumwirbelnde Strähnen mit leicht vorgeschobener Unterlippe aus der Stirn zu pusten und dabei den Kopf verspielt zur Seite zu neigen. Ihr auffallend aufrechter Gang, die bewusst nach vorn gedrückte Brust, die vollen, niemals ungeschminkten Lippen und ihr fester Blick signalisierten ohne Umschweife: Hier kommt jemand um die Ecke, der garantiert kein Mitleid braucht.
Entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten hielt Marion sich an diesem Abend in der Yoga-Runde auffallend zurück. Amke hatte schon seit einigen Tagen bemerkt, dass ihre Schwiegermutter sich auch zu Hause ein wenig reserviert zeigte. Irgendetwas schien nicht zu stimmen mit ihr. Auch heute im Surfcafé ließ Marion die vertraute Dominanz weitgehend vermissen. Und während Amke den dritten Prosecco orderte und mit Karin und Luisa mehr und mehr in Feierstimmung geriet, steckten Marion und Emma die Köpfe zusammen.
Emma war Marions beste Freundin. Sie hatten schon gemeinsam die Insel-Grundschule an der Jann-Berghaus-Straße besucht und waren zusammen stets durch dick und dünn gegangen. Jede kannte die Vorlieben und Abneigungen der anderen und natürlich auch alle Befindlichkeiten und Gefühlslagen. Dass Marion der weitaus tonangebendere Teil von beiden war und auch finanziell wesentlich besserstand, störte Emma nicht. Es machte ihr nichts aus, wenn sie als Vierhundertfünfzig-Euro-Verkäuferin in der Edelboutique am Kurplatz Marion Röcke, Hosen und Blusen verkaufte, die sie sich selbst niemals würde leisten können. Dafür genoss Emma das sichere Gefühl, im Schatten der starken Freundin gut aufgehoben und stets in bester Gesellschaft zu sein.
Auch Emma war Marions sonderbare Verschlossenheit nicht entgangen. »Was ist los mit dir, du gefällst mir nicht. Du bist doch nicht etwa krank?«, fragte Emma hinter vorgehaltener Hand, während die anderen Frauen munter drauflosquatschten und mit den Surfern vom Nachbartisch schäkerten.
»Eigentlich ist nichts.«
»Eigentlich? Du weißt, dass das Wort jede Menge Raum für offene Fragen lässt.«
Marion pustete ein Strähne aus der Stirn und nippte an der Rhabarberschorle. Ansonsten gab sie sich weiter extrem einsilbig. »Es ist nichts passiert.«
»Was heißt, es ist nichts passiert? Heißt das etwa, es ist noch nichts passiert? Rück endlich raus mit der Sprache. Mir machst du nichts vor, Marion. Oder hat es was mit mir zu tun?«
»Nein.«
Emma hob die Stimme. Sie wurde ungehalten, ihre Wangen röteten sich. »Sag’s endlich! Bist du krank? Warst du beim Arzt? Hat er dir etwas Schlimmes gesagt, oder wartest du auf irgendeinen Befund?«
»Nein. Auch das nicht.« Marion schaute rüber zu Amke, Karin und Luisa. Sie erwiderte deren fragendes Lächeln kurz, wobei man diesem Lächeln ansah, dass es nicht echt war.
Sie nahm einen weiteren Schluck und rückte näher an Emma heran, die beleidigt wirkte. »Emma. Es ist nichts. Ich mache mir nur ein paar Sorgen. Die sind aber wahrscheinlich unbegründet. Ich bin in den vergangenen Tagen dreimal angerufen worden. Anonym.«
Emma schaute auf und griff nach Marions Hand. Da der Lärmpegel und die damit verbundene gute Laune im Surfcafé in den vergangenen Minuten deutlich angeschwollen waren, rückten die beiden Freundinnen nun noch enger zusammen. Die Beine berührten sich, Emma legte zusätzlich den Arm um Marions Hüften.
»Ich vermute, es handelte sich um einen Mann. Er hat nichts gesprochen. Ich habe nur gehört, dass jemand am anderen Ende der Leitung war. So ein leichtes Schmatzen, eine Art Keuchen, ein Atmen. Mehr war da nicht. Sicher irgendein perverser Idiot.«
Marion machte eine Pause, schaute zur sich öffnenden Eingangstür, durch die gerade sieben breitschultrige Männer– angeführt von Norderneys Polizeichef Gent Visser– eintraten.
»Fief Beer un fief Kloorn«, polterte es aus tiefer Kehle, dabei hatten Visser und seine Fußballkumpels vom Revier noch gar keinen Tisch ergattert.
Jedenfalls brachten die insularen Ordnungshüter jede Menge gute Laune mit. »Sech to, wi hem Dörst«, blökte Vissers Kollege Neumann gleich hinterher.
Marion nahm den forschen Einmarsch der Inselpolizisten nur am Rande zur Kenntnis. Durch die offene Tür sah sie, dass es zu regnen begonnen hatte und die Kellnerinnen draußen die Tische leer räumten, die Sonnenschirme herunterkurbelten und die Decken zusammenlegten und in Sicherheit brachten.
Emma fixierte Marions Gesicht: ihre vollen, tadellos geschminkten Lippen, die klaren blauen Augen, die kostbaren Kreolen. Sie schätzte ihre Freundin nicht nur, sie verehrte sie.
Und bevor sie etwas sagen konnte, setzte Marion erneut an: »Wie gesagt. Ich kann nur vermuten, dass es ein Mann war. Vielleicht jemand, der mir nachstellt, einfach so, weil es ihm Spaß macht und er mich ärgern will. Aber in meinem Alter…«, fügte sie hinzu und drückte den Rücken durch, dass die Brust deutlich exponiert wirkte. Zugleich strich sie die Haare hinter die Ohren zurück. Dem Ganzen folgte ein gedehnter Blick ins Lokal; doch niemand beachtete sie.
»Ich bitte dich«, gab Emma zurück. Du könntest wirklich noch genügend Männer haben, an jedem Finger fünf, mindestens.«
»Nun übertreib mal nicht, Emma.« Marion schien sich gefangen zu haben. Allmählich taute sie auf und war dabei, ihr altes Selbstbewusstsein wiederzugewinnen, wenngleich ihre Augen weiterhin nachdenklicher dreinschauten als üblich. Rasch nahm sie den Gesprächsfaden wieder auf. »Seit diesen Anrufen– der erste war übrigens genau heute vor drei Wochen– habe ich manchmal das Gefühl, beobachtet oder verfolgt zu werden.«
Emma verdrehte die Augen und spitzte den schmallippigen Mund extrem, als würde diese maskenhafte Geste die Bedeutung ihrer Frage besonders untermauern. »Bist du sicher?«
»Keineswegs. Das heißt: Erst kriege ich einen Schreck, und dann denke ich, ich bilde mir das nur ein. Jedenfalls habe ich in dieser Hinsicht bislang noch keine wirklich handfesten Beobachtungen gemacht. Ich könnte jetzt nichts beweisen, wenn es hart auf hart käme. Ich glaube, ich bin einfach nur verunsichert.«
»Wann hat der Typ denn zuletzt angerufen?«
»Am Sonntag, also vorgestern. Auf dem Handy wieder. Ich frage mich, woher der meine Nummer hat.«
Emma reckte sich und wehrte mit einer dezenten Handbewegung die Kellnerin ab, die plötzlich freundlich nach einer weiteren Bestellung fragend vor ihnen stand. »In Zeiten von Internet, Google und all dem Kram ist doch nichts mehr geheim. Eine Telefonnummer rauszukriegen ist heutzutage doch alles andere als Zauberei.«
Marion nickte und schwieg. Nach einem Blick auf die Uhr wandte sie sich wieder Emma zu. »Meine Liebe, was meinst du? Sollen wir? So wie immer? Lass die jungen Leute noch ein bisschen feiern. Für uns ist es spät genug. Und die Sache mit dem Anrufer sollte ich nicht allzu ernst nehmen. Es gibt so viele Verrückte auf der Welt. Mein ›Verehrer‹ ist bestimmt längst auf dem Festland und stöhnt dort am Telefon eine andere an«, sagte sie mit gewohnt glasklarer Stimme und lachte.
Diesmal war Marions Lachen echt. Das Gespräch mit Emma hatte ihr gutgetan. Emma nahm ihre Freundin in den Arm. Nachdem sie bezahlt hatten, schwangen sie sich aufs Rad und fuhren in die Inselnacht.
* * *
Theo Folkerts kniff die Augen zusammen und schaute zur Uhr. Zweiundzwanzig Uhr elf. Für seine Amke war es noch zu früh. Sie pflegte oft erst gegen Mitternacht nach Hause zu kommen, wenn sie mit ihren Freundinnen dienstags nach dem Yoga unterwegs war und die Insel noch ein wenig unsicher machte. Seine Mutter Marion hingegen würde sicher schon bald um die Ecke biegen. Sie lebte gleich nebenan in der anderen Hälfte des großen Doppelhauses an der Luisenstraße. Lichter brannten dort jedenfalls keine, bemerkte Theo, als er das Wohnzimmerfenster öffnete und einen vorsichtigen Blick in die Nacht warf. Der Sturm hatte zugenommen, und der Regen klatschte ihm ins Gesicht, als er den Kopf über die Brüstung hielt. Darum schloss er das Fenster rasch und schlurfte mit den Filzpuschen ins Arbeitszimmer, wo er den Rechner noch einmal hochfahren ließ.
Theo war seit elf Jahren mit Amke verheiratet. Die Schlankheit hatte er wohl von seinem verstorbenen Vater geerbt, ebenfalls die dünnen, strähnigen Haare, die immer aussahen, als wären sie nicht gewaschen. Am meisten aber fiel seine Nase auf, am Ansatz breit und fleischig, aber auffallend spitz zulaufend. Es wirkte so, als lägen die Augen tief in die Höhlen, dabei waren es die dunkel schimmernden Lider und die bräunlichen Tränensäcke, die diesen Effekt verursachten. Mit Vorliebe trug Theo braune oder beige Cordhosen aus einer britischen Edelkollektion, dazu passend ein Tweedsakko in Kombination mit einer Lederweste. Bei seinen eher seltenen Aufenthalten außerhalb des Hauses, etwa beim Gang zur Bank oder zur Kurverwaltung, sah man ihn nie ohne einen seiner irischen Lambswool-Schals und Fred-Perry-Kappe. Unaufgeregt und in allen Belangen souverän verwaltete er die fünf schicken Ferienwohnungen in den beiden Häusern. Immerhin tat er dies bereits seit vierzehn Jahren, nachdem er seine Lehre als Dekorateur abgebrochen hatte. Damals war er zweiundzwanzig und im Tourismusgeschäft ohnehin schon recht versiert. »So etwas wird einem richtigen Insulaner in die Wiege gelegt«, pflegte Mutter Marion zu sagen.
Nachdem das Fenster geschlossen und der Rechner hochgefahren war, ging er noch rasch ins Zimmer von Thore. Der Junge hatte erst vor drei Tagen seinen zehnten Geburtstag gefeiert und war der ganze Stolz der Familie. Besonders Theo war er ans Herz gewachsen. »Mein Junge. Er ist mein Ein und Alles«, sagte er bei jeder nur passenden Gelegenheit.
* * *
Wegen des schlechten Wetters hatten Marion und Emma nicht den Weg über die Promenade genommen, sondern waren vom Januskopf gleich in die Knyphausenstraße abgebogen. Sie hatten sich für die kürzere und vor allem weniger stürmische Strecke durch die Stadt entschieden. Vor ihrer Wohnung in der Winterstraße verabschiedete Emma sich und drückte Marion noch schnell einen Kuss auf die Wange.
»Mach’s gut, meine Liebe«, sagte sie, »oder soll ich dich nicht doch noch wenigstens bis zum Kurplatz begleiten?«
Marion winkte ab. »Lass man gut sein. Die paar Meter schaffe ich noch allein. Und falls mir einer blöd kommt, dann lernt er meine Luftpumpe kennen.« Lachend stieg sie aufs Rad und fuhr los.
Da der Sturm an Heftigkeit zunahm und der Regen unablässig ins Gesicht peitschte, hielt Marion nach ein paar Metern noch einmal an und knotete die Bänder der Kapuze fest. Sie stieg hastig wieder aufs Rad und kämpfte sich voran Richtung Kurplatz und Wilhelmstraße. Keine Menschenseele war auf der Straße zu sehen, alle hatten offenbar Reißaus genommen vor diesem Vorsommersturm, mit dem man in dieser Heftigkeit nicht gerechnet hatte. Schemenhaft waren hinter den regennassen Fenstern bei Gosch nur noch ein paar Gäste zu erkennen. Bald würden sicher auch dort die Lichter ausgehen.
In zwei Minuten würde sie zu Hause sein, überlegte Marion, als sie schnaufend die Abzweigung zur Georgstraße passieren wollte und sich wie aus dem Nichts ein Schatten auf die Fahrbahn legte. Ein dumpfer Schlag traf sie am Bein, dann rutschte das Vorderrad auf dem nassen Pflaster zur Seite, und ihr Körper klatschte auf die Straße. Sie war chancenlos. Im Bruchteil einer Sekunde hatte sie die Kontrolle über das Rad verloren. Es war unmöglich gewesen, diesen Sturz abzufangen.
Ob sie mit dem Kopf aufgeschlagen war? Als sie das Bewusstsein wiedererlangte, spürte sie einen heftigen Schmerz an der rechten Schläfe. Ihr war übel. Marion lag auf der Seite, ihre Hose war vom Regen durchnässt. Ihr Blick fiel in die dunkle Gasse gegenüber der Georgstraße, den Treppenaufgang zur Arztpraxis konnte man nur schemenhaft erkennen, dafür gleich fünf, sechs, vom Sturm umgeworfene Räder vorn an der Ecke des Apartmenthauses. Auf diese fiel der Schimmer einer Straßenlaterne, die vom Sturm geschüttelt wurde und nur noch in der Lage war, diffus zuckende Lichtstreifen auszusenden.
Marion versuchte aufzustehen, doch sie schaffte es nicht. Ihre Hüfte sandte einen heftigen stechenden Schmerz aus, dann wurde ihr speiübel. Sie ließ den Kopf auf das kantige Straßenpflaster sinken, schloss die Augen und schnaufte durch. Als sie ein weiteres Mal probierte aufzustehen, überkam sie Schwindel und erneut Übelkeit. Zudem irritierte sie der Duft eines Parfüms, woraufhin sie derart erschrak, dass sie glaubte, keine Luft mehr zu bekommen. Ihr Magen krampfte, und sie musste würgen. In ihrem Mund sammelte sich säuerliche Flüssigkeit, Tränen schossen in die Augen. Ein Hustenanfall folgte, der ein weiteres Mal Brechreiz erzeugte und ihr den Atem nahm.
Als sie realisierte, dass jemand ihren Kopf aufs Straßenpflaster drückte und sich ein Knie in die Seite bohrte, begann sie panisch zu röcheln. Aus ihrer Kapuze fielen schimmernde Haarsträhnen auf den unebenen Boden, durch dessen Furchen sich kleine Rinnsale ihren Weg Richtung Kanalschacht bahnten. Drüben vom Meer drang das Rauschen der Brandung an ihr Ohr, ein Geräusch, das in dieser Situation wie ein Stöhnen wirkte, bedrohlich und voller Unheil.
Oder handelte es sich bei dieser Lärmkulisse um das Ächzen eines Menschen, vielleicht um genau das Keuchen, das Marion, die es jetzt nicht mehr wagte, die Augen zu öffnen, am Telefon gehört hatte?
Und dann wagte sie es doch. Sie nahm nun all ihren Mut zusammen und riss den Kopf aus der Umklammerung, sodass die Kante des Klinkersteines einen schmerzhaften Schnitt in ihrer Wange hinterließ. Ihr starrer Blick mündete in ein von einer schwarzen Strumpfmaske verborgenes Gesicht mit dunklen Augen, die neben äußerster Entschlossenheit Eiseskälte aussandten.
Marion war nicht in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Alle Kraft schwand. Sie sackte in sich zusammen wie ein nasses Bündel Mensch, das weggeworfen wird. In dieser Sekunde, die nicht zu Ende gehen wollte, wünschte sie, diesen Befreiungsversuch niemals unternommen zu haben. Dann griffen zwei mächtige, nach Kälte und Moder riechende Handschuhe nach ihr, und die Welt um sie herum wurde stockdunkel.
* * *
Gegen Mitternacht war kein Mensch mehr auf der Straße zu sehen. Der Sturm hatte nach der Insel gegriffen und weitere großflächige Regenbänder herangeschleppt, die die sieben Ostfriesischen Inseln sowie den gesamten Küstenstreifen von Emden bis zum Jadebusen massiv unter Wasser setzten. Zwar hatte Theo kurz vor dem Zubettgehen die Rollläden in Thores Zimmer heruntergelassen, dennoch drang das Flirren und Klackern der Seile und Gurtschlaufen von den stählernen Fahnenmasten sehr viel lauter als üblich in den Raum. Zudem fegte der Sturm den Regen unbarmherzig heftig gegen das Haus.
Thore riss die Augen auf und rümpfte die Nase. Er benötigte ein paar Sekunden, um sich darüber im Klaren zu sein, dass er von dem Unwetter wach geworden war. Getrieben von einer ganzen Menge Angst im Nacken stieg er aus dem Bett, strich die blonden Haare aus der Stirn und tippelte ans andere Ende des Flures zum Elternschlafzimmer. Theo und Amke schliefen. Thore überlegte ein paar Sekunden, dann kroch er zu seiner Mutter unter die Bettdecke.
»Geh wieder rüber in dein Bett«, murmelte Amke und küsste den Jungen auf den Lockenkopf. »Du bist doch schon groß, musst keine Angst haben, alles ist gut. Es ist nur das Wetter.«
»Und wenn ich Papa frage? Der lässt mich bestimmt in sein Bett.«
»Den lässt du schlafen und hör jetzt auf zu quengeln.« Damit stand Amke auf, führte den Jungen zurück zu seinem Bett und drückte ihm erneut einen Kuss auf die Wange.
»So. Und nun schlaf schön. Morgen früh bist du stolz, wenn du es allein geschafft hast. Ich hab dich lieb.«
* * *
Auch im Surfcafé waren die Lichter längst erloschen. Zögerlich hatten sich die letzten Gäste um kurz nach Mitternacht auf den Nachhauseweg beziehungsweise auf den Weg in ihr Feriendomizil gemacht. Auch Visser und seine engsten Kollegen Neumann und Stamm– der harte Kern der Inselcops– wären gern noch ein Stündchen geblieben, wo es doch gerade so gemütlich war. Besonders gut aufgelegt hatte sich Visser gezeigt. Er hatte ein paar Tage Urlaub, und ihm kam es auf das eine oder andere Bier mehr ohnehin nicht an. Und da die drei Polizisten irgendwie das Gefühl hatten, dass ein kleiner– weiterer– Absacker nicht schaden konnte, gönnten sie sich diesen bei den Vissers zu Hause.
»Wenn das weiter so schüttet und stürmt, müssen wir morgen unsere Bleiwesten anlegen, damit wir nicht vom Rad fallen«, rief Neumann in seiner kindlichen Unbekümmertheit lautstark ins Haus hinein, als sie das Wohnzimmer der Vissers in der Frisiastraße betraten.
Dabei war es mehr ein Entern als ein Betreten: Denn anstatt die Garderobe im Flur zu benutzen, pellten die Männer sich ihre klitschnassen Regenjacken in der Stube vom Leib und schüttelten sich zudem derart heftig, dass die Wassertropfen nur so umherspritzten.
Visser drückte die beiden Kollegen aufs Sofa am Fenster und blökte zurück: »Jungs, Maul halten, sonst wird Frauke wach, und dann ist der Spaß hier vorbei. Ich hole uns jetzt erst mal den Köm.«
Visser hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da stand seine Frau bereits im Türrahmen. »Guten Abend, die Herren. Schön, dass ihr unseren ersten Urlaubstag feiert und mich so charmant dazu eingeladen habt.«
Auf der Stelle war Ruhe. Frauke war mit einem Meter sechzig zwar »nicht jeden Tag gewachsen«, wie Visser sich bisweilen scherzhaft auszudrücken pflegte. Aber ihr resolutes Auftreten und ihre Körpersprache wirkten durchaus respekteinflößend. Entschlossen hob sie den Kopf mit dem flotten Kurzhaarschnitt und griff nach ihrer blauen Strickjacke, die über der Lehne des Sessels hing.
»Und da ich morgen ebenfalls frei habe und wegen des Orkangetöses da draußen auch noch kein Auge zugemacht habe, leiste ich euch noch ein bisschen Gesellschaft. Ihr habt doch sicher nichts dagegen.«
Dann ließ Frauke sich mit breitem Lächeln auf den Sessel plumpsen und rief ihrem Mann hinterher: »Herr Oberkommissar, dann bring mir doch bitte gleich ein Schnapsglas mit.«
Die Jungs vom Revier und Frauke kannten sich seit Jahren. Nicht nur, dass das Inselleben die Räume ohnehin enger machte als auf dem Festland; auch die Tatsache, dass Visser als Chef der Norderneyer Polizeiwache ein außerordentlich gutes Verhältnis zu seinen Kolleginnen und Kollegen pflegte, prägte das Zusammenleben enorm. Und zwar ausschließlich in positivem Sinne. Von daher kannte auch Frauke die Eigenarten und die Art des Humors von Stamm und Neumann; umgekehrt wussten die beiden mit dem hintersinnigen Witz Fraukes klarzukommen.
»Ja, dann hoch die Tassen«, sagte Visser, als sie in der Runde zusammensaßen und die Getränke auf dem Tisch standen.
»Wisst ihr, an was mich dieses Schietwetter erinnert?«, fragte Stamm und kratzte sich den Drei-Tage-Bart. Er wirkte bei seinen Worten nicht gerade fröhlich.
Neumann legte seine Pranke um die Schnapspulle und schüttete nach. »An Weihnachten vor zwei Jahren. Da konnte man eine ganze Woche lang nicht aus dem Haus. Grauenhaft. Dreizehn Grad, Dauerregen bis in die letzten Ritzen und Sturm, jeden Tag. Von Weihnachtsstimmung keine Spur. Die Feuerwehr musste einen Keller nach dem anderen leer pumpen. Man hätte meinen können, die Welt geht unter.«
»Oh mein Gott. Bei dem Stichwort fällt mir aber noch was ganz anderes ein.« Visser atmete tief durch, wischte sich die Brille, auf der sich immer noch ein paar kleine Regentropfen verirrt hatten, am T-Shirt trocken und holte aus: »August 2013. Ein Scheißjahr. Erst drei OPs, nix Schlimmes, aber verdammt unangenehm und schmerzhaft, anschließend nicht enden wollender Ärger mit einigen Vorgesetzten vom Festland, denen meine Konzepte zur Umstrukturierung der Inselwache nicht gefielen. Dann der Höhepunkt, und das war wirklich wie der Weltuntergang; die Apokalypse, wie sie die Bibel kaum klarer beschreiben kann.«
»Oha. Ich weiß, was jetzt kommt«, brummte Neumann und schlug sich mit dem Handinneren gegen die Stirn, dass es nur so klatschte.
»Ja, ja. Die von einem handverlesenen Kreis von Amateuren geplante Großübung, die für alle Rettungs- und Hilfsorganisationen der ganz große Wurf werden sollte. Der Innenminister persönlich hatte von einem Zukunftsmodell für den Katastrophenschutz für ganz Niedersachsen und darüber hinaus gesprochen. Natürlich konnte das nicht gut gehen. Wat’n Schiet!«
Visser hob die Hände hilfesuchend in die Höhe. »Nur ein vollkommen unbedarfter Laie kann auf die Idee kommen, weite Teile einer Insel zu evakuieren, um das Zusammenspiel der Rettungskräfte im Falle eines Tsunamis zu demonstrieren.«
Er lief rot an, schnappte kurz nach Luft und nahm den Faden gleich wieder auf. »Außerdem die katastrophale Kommunikation. Die Rechte wusste nicht, was die Linke tat. Ich sage euch: Wenn wir vier, die wir hier sitzen, diese Übung geplant hätten, jeder mit einer bis zum Rand gefüllten Pulle Rum im Bauch, dafür aber ohne die Großkopferten in Aurich, Hannover und sonst wo, dann wäre dabei eher was Gescheites rausgekommen.«
Mit einem Mal war die gute Stimmung im Wohnzimmer der Vissers verflogen. Frauke merkte ihrem Mann die Erregung an und legte ihm sanft die Hand aufs Knie.
Doch er war nicht zu bremsen. Mit wild rudernden Armen sagte er: »Gut. Und dann kam natürlich alles zusammen. Zwei aufeinanderfolgende Mini-Tornados waren die Sahnehäubchen auf der Planung, die keine war. Als die Seenotretter mit der ›Bernhard Gruben‹ kenterten und zwei Drittel der Feuerwehr im Inselosten absoffen, war die Katastrophe perfekt. Mein Gott! Das darfst du wirklich keinem erzählen. Ich wünsche mir immer noch nichts sehnlicher, als dass es nur der irre Traum irgendeines Phantasten gewesen wäre.«
Visser richtete sich auf, drückte den Rücken durch und kratzte sich am Kopf. Sein kurz geschnittener Bart schimmerte im gedimmten Lampenlicht des Wohnzimmers schwarz-silbern. Sein kugelrunder Kopf war nach vorn gebeugt, gleichzeitig berührte sein Bauch die Tischkante. Dann stieß er einen für einen Mann ungewöhnlich spitzen Laut aus, in dem sich vielleicht wenigstens ein Teil der Machtlosigkeit aus dem Ereignis bündelte.
»Wie gut, dass es vorbei ist und wir wieder alle friedlich beieinandersitzen«, sagte Frauke nun rasch, mit dem Ziel, dieses Thema abzuschließen.
»Und wie schade, dass wir beide morgen arbeiten müssen«, ergänzte Stamm, der gleichzeitig dem für seine Verhältnisse auffallend ruhigen und vor sich hin starrenden Kollegen Neumann leicht in die Rippen stieß.
»Komm, mein Freund. Lass uns nach Hause gehen«, sagte Stamm und fügte augenzwinkernd hinzu: »Morgen früh ist die Nacht vorbei.«
ZWEI
Nur sehr zögerlich erwachte der Tag auf Norderney. Der Eindruck, als würde sich die Insel vor dem Hellwerden ducken, täuschte nicht. Denn Tief Sandra zeigte sich hartnäckig und unnachgiebig, ja regelrecht aggressiv. Ein übler Charakter, auf den die Meteorologen da reingefallen waren. Sie hatten das Tief zwar kommen sehen, seine Boshaftigkeit allerdings bei Weitem unterschätzt. Dabei schien es Sandras Spezialität zu sein, kleine Arbeitspausen einzulegen und die Sonne ein, zweimal durchschimmern zu lassen, um dann aber rasch den Hinterhalt zu verlassen und auf Orkanstärke hochzudrehen, dass selbst die extrafest angetäuten Fähren im Hafen gegen die Spundwände zu schleudern drohten.
»Erst mit dem Arsch wackeln und dann das Messer in den Rücken rammen. So ein schöner Name und doch so hinterfotzig«, entfuhr es Theo mit Blick auf das seit zwei Tagen im NDR angekündigte Orkantief, während er gemeinsam mit Amke den Frühstückstisch deckte.
Die warf ihrem Mann aufgrund seiner unfeinen Wetterbeschreibung einen ebenso fragenden wie vorwurfsvollen Blick zu, immerhin saß Thore bereits mit am Tisch.
»Entschuldigung«, schickte Theo gleich hinterher. »Das Wetter geht mir halt mächtig auf den Geist. Außerdem habe ich schlecht geschlafen.«
»Wie kommt’s?«, fragte Amke. »Wieder zu lange vor dem Computer gesessen?«
Statt zu antworten, brummte Theo irgendetwas vor sich hin und verdrehte die Augen. Amke nahm neben Thore Platz und strich ihm über die Haare. Auch ihr stand der Schlaf in den Augen. Sie trug noch ihren Bademantel, den sie immer wieder am Revers zurechtrücken musste, um ihr üppiges Dekolleté im Griff zu behalten. Die schulterlangen braunen Haare hatte sie mit einem dünnen Gummiband zu einer Bergheim-Palme hochgebunden. Eigentlich hatte sie schon kurz nach Thores Geburt ein paar Kilogramm abnehmen wollen, doch jeder noch so groß angelegte Diätversuch war praktisch im Ansatz gescheitert. So war ihr ein gewisses Maß an Pummeligkeit geblieben, die aber irgendwie zu ihr passte, wenngleich die wulstigen Lippen und die kantigen Wangen so gar nicht mit der hohen, piepsigen Stimme korrespondierten. Dafür aber gab Amke als Mitglied der insularen Jagdgenossenschaft bei der Karnickeljagd eine gute Figur ab. Für diese Freizeitbeschäftigung wollte Theo derweil überhaupt kein Verständnis aufbringen, im Gegenzug kritisierte Amke ihren Mann dafür, weil der zu viel Zeit am Computer verbrachte und Thore über alle Maßen verwöhnte.
Theo schaute zur Uhr. Schon gleich halb acht. »Jetzt müsste Mutter aber langsam kommen.«
»Ja. Das kennt man gar nicht von ihr. Sonst sitzt sie doch pünktlich um Viertel nach sieben hier am Tisch«, sagte Amke und ergänzte lächelnd: »Kerzengerade.«
Dabei bezog sie sich auf die allseits bekannte Disziplin und den Stolz von Marion.
»Vielleicht hat sie verschlafen«, sagte Theo. »Wie spät war es denn gestern bei euch?«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie und Emma sind wie immer um kurz nach zehn losgefahren, mitten ins Unwetter hinein. Wir haben noch gesagt: ›Hoffentlich kommen die beiden halbwegs trocken heim.‹ Später als üblich war es jedenfalls nicht.«
»Vielleicht sind sie ja noch anderswo eingekehrt?«
Amke schüttelte den Kopf und machte eine abwehrende Handbewegung.
»Und wenn sie krank ist?«, fragte Thore.
Theo und Amke schauten sich an. Einen Moment lang hörte man nur das Tropfen des Wasserhahns und das leise Brummen des Kühlschranks nebenan in der Küche.
»Nein«, antwortete Amke entschieden. »Oma war gestern Abend topfit und guter Dinge. Ich glaube nicht, dass sie krank ist.«
Theo legte die Stirn in Falten und schaute ungläubig in seine Kaffeetasse. Dann nahm er einen Schluck und sagte: »Wisst ihr was? Ich rufe sie einfach mal an.«
Das Orkantief und das nun gleichzeitig auflaufende Tidehochwasser hatten es erforderlich gemacht, dass die Mitarbeiter der Technischen Dienste auf Norderney einige hundert Strandkörbe, die zu nah am Spülsaum standen, in Sicherheit bringen mussten. Mittlerweile war es kurz vor acht, und noch immer fegte der Orkan mit unverminderter Wucht über die Insel hinweg. Normalerweise wären die ersten Jogger zwischen Giftbude und Riffkieker längst zu sehen gewesen, außerdem die ersten waghalsigen Schwimmer, die sich normalerweise von nichts davon abbringen ließen, den Tag mit einem Sprung in die kühl schäumende Nordsee zu begrüßen.
Doch heute war alles anders. Die Strände waren im wahrsten Sinne des Wortes wie leer gefegt, und auf den Straßen und Plätzen war ebenfalls kein Mensch zu sehen. Auch am Hafen herrschte Ausnahmezustand, die Arbeiten am Neubau des gigantischen Frisia-Terminals waren erst gar nicht aufgenommen worden, der kurzerhand verhängte Baustopp galt für unbestimmte Zeit. Die erste Fähre zum Festland, die um Viertel nach sechs tapfer, aber bedenklich schwankend mit den Norderneyer Gymnasiasten Richtung Norddeich gestartet war, hatte die Reederei bereits zehn Minuten nach der Abfahrt unter dem Jubel ihrer jungen Fahrgäste zurückbeordert. Dann endlich machte der Fahrdienstleiter Nägel mit Köpfen und stellte den Fährverkehr von Norddeich nach Norderney und umgekehrt bis zum Abklingen des Orkans komplett ein.
Amke warf einen letzten Blick in den Spiegel. Sie benötigte nur knapp fünf Minuten zu Fuß bis zu ihrem Arbeitsplatz im Rathaus, wo sie bei der Stadt Norderney als Verwaltungsfachangestellte in der Finanzabteilung arbeitete. Immer wenn sie nervös war, bildeten sich rote Flecken in ihrem Gesicht. So auch jetzt, denn die Anrufe Theos bei Marion waren erfolglos geblieben. Sowohl auf dem Festnetz als auch auf dem Handy war sie nicht zu erreichen. Das war wirklich ungewöhnlich.
»Na ja. Vielleicht hat sie einen frühen Termin beim Arzt, und sie hat vergessen, uns Bescheid zu sagen«, rief Amke, drückte Theo noch rasch einen Kuss auf die Wange und machte sich auf den Weg zur Arbeit.
»Ich gehe trotzdem jetzt mal rüber und schaue nach«, rief Theo seiner Frau hinterher. »Bis später.«
* * *
Normalerweise wären an diesem Morgen am Norderneyer Hafen bereits einige hundert Passagiere abgefertigt worden. Heute aber herrschte beängstigender Stillstand. Bei den momentanen Wetterverhältnissen glich das Gelände weniger einem gemütlichen Versorgungshafen denn einem alten, verlassenen Industriegelände, auf das Regengüsse und Orkanböen unerbittlich niedergingen. Zudem verwandelten die Umrisse des im Bau befindlichen neuen Hafenterminals das Areal in eine bizarre, unwirkliche Kulisse.
Allerdings war dort große Hektik angesagt. Weil ein Großteil der Handwerker am Morgen wegen des Orkans nicht zur Insel pendeln konnte, um die Baustelle zu sichern, musste die Freiwillige Feuerwehr eingreifen. Gemeinsam mit einem Trupp des Norderneyer Baustoffunternehmens befestigten die Floriansjünger die wild um sich schlagende und zu reißen drohende Dachfolie, indem sie palettenweise Ziegelsteine aufbrachten. Der Kranwagen schwankte heftig, und Feuerwehrchef Tamme Schweers grollte unter seinem beschlagenen Helmvisier: »Hoffentlich ist dieser Spuk hier bald vorbei.«
Doch es kam noch schlimmer: Ein ohrenzerreißender Schrei übertönte das Prasseln des Regens und das Pfeifen des Orkans. Die Einsatzkräfte horchten auf. Wenige Sekunden später nahmen Tamme und seine Feuerwehrkameraden panische Hilferufe direkt am Anleger wahr. Als sie nach wenigen Sekunden dort ankamen, riss Tamme das Visier hoch und verzog das Gesicht zur Fratze.
Ein Matrose war beim Versuch, die »FrisiaIII« zusätzlich mit einem Stahlseil an einem Hafenpoller zu sichern, abgerutscht. Dabei waren Fuß und Unterschenkel zwischen die auf und ab wippende Fährbrücke und die Kaimauer geraten, und zwar genau in dem Moment, als die See das Schiff gegen die Spundwand drückte.
Karl-Ulrich Kluiver stand der Schreck ins Gesicht geschrieben. Der Reeder der AGNorden-Frisia war mit der »Bernhard Gruben«, dem Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, von Norddeich aus auf die Insel gebracht worden.
»So etwas haben wir noch nicht erlebt. Ich hoffe, der Kollege ist bald wieder wohlauf«, sagte Kluiver und warf einen besorgten Blick auf die Unfallstelle.
Inzwischen hatten Polizei und Feuerwehr den Hafen komplett abgesperrt, nur noch einige Mitarbeiter der Baustofffirma sowie Feuerwehrleute arbeiteten weiter daran, die Baustelle zu sichern, indem sie Kisten und Säcke mit Dämmmaterial, Zement und Rohre in den Rohbau hineinbugsierten.
»Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Für einen Tag im Juni ist ein solcher Orkan eher ungewöhnlich; vor allem, weil er so lange anhält«, sagte Kluiver, der sich mit seinen beiden Prokuristen und Tamme mittlerweile im Baustellengebäude in Sicherheit gebracht hatte.
Tamme zog die Stirn in Falten. In den glatt rasierten vollen Wangen und um die runde Kinnpartie reflektierte die Baustellenbeleuchtung die vom Regen übrig gebliebene Feuchtigkeit.
»Wissen Sie, Herr Kluiver, das, was uns hier und auf der ganzen Welt Sorgen bereitet, ist doch alles hausgemacht. Die Industriestaaten, also wir, diejenigen, die darin wohnen, haben dieses Klima zu verantworten. Ich bin gewiss kein Verschwörungstheoretiker oder Panikmacher. Ich warne allerdings davor, dass wir zu Heuchlern verkommen. Wir leben hier mitten im Nationalpark Wattenmeer. Wir sind Teil des Weltnaturerbes. Wir locken mit dem Wertvollsten, was uns die Schöpfung hinterlassen hat, die Touristen an die Küste und auf die Inseln. Gleichzeitig lassen wir es zu, dass wir uns zu perfiden Umweltsünden hinreißen lassen.«
Tamme hob die Hände. »Wasser predigen und Wein trinken, sage ich da nur. Das fängt beim Silvesterfeuerwerk auf dem Deich an und endet bei der Verklappung von Müll und radioaktiven Abfällen in Nordsee und Ostsee.«
Er nahm den Helm vom Kopf, seine dünnen Haare standen in alle Himmelsrichtungen ab. Er war blass im Gesicht. Dem, was er gesagt hatte, war nichts hinzuzufügen. Sein Blick blieb grimmig, der Groll wühlte in ihm. Der Feuerwehrmann war in seinem Element. Doch er blieb nun stumm.
Auch Kluiver schwieg, innerlich hatte er das, was Tamme gesagt hatte, längst abgehakt. Denn natürlich wusste er, dass jedes Wort und jede Silbe, die Tamme mit Leidenschaft und innerster Überzeugung betont hatte, zutrafen. Er klopfte ihm deshalb auf die Schulter wie jemandem, dem man einerseits Anerkennung zollt, von dem man aber andererseits auch weiß, dass er einen Kampf führt, den er nur verlieren kann. Nicht einen Fisch im Ozean und nicht einen einzigen Wattwurm würde er retten können. Deshalb ging Kluiver auf das Thema auch nicht weiter ein.
Er reichte Tamme nur noch die Hand. »Danke für die Unterstützung hier«, sagte er hanseatisch knapp, drehte sich auf dem Absatz und verließ das Gebäude.
* * *
Als Amke an ihrem Arbeitsplatz im Telefondisplay die Nummer von zu Hause sah, schreckte sie auf. Es war ungewöhnlich, dass Theo sie an einem frühen Vormittag im Büro störte. Sie wusste, er rief nur an, wenn es wirklich wichtig war.
Aber vielleicht war Marion ja aufgetaucht, und Theo wollte nur eben die gute Nachricht verkünden, sprach sie sich Mut zu. Und dennoch zog sich in dem Moment, als sie den Hörer hob, der Magen zusammen. Und tatsächlich: Ihre böse Vorahnung sollte sich bestätigen.
»Sie ist nicht da. Nirgends ist sie. Ich habe das ganze Haus abgesucht«, kam Theo gleich zur Sache. Er atmete schwer.
Amke merkte auf der Stelle, dass es ihrem Mann nicht gut ging. Er hatte ohnehin Probleme, mit Krisensituationen klarzukommen, geriet manchmal sogar schon leicht aus dem Konzept, wenn irgendetwas Alltägliches nicht nach Plan verlief.
»Bist du sicher? Warst du auch im Bad? Im Hauswirtschaftsraum? In der Garage?«
»Ja, war ich. Und ich habe auch alle Gastfamilien rausgeklingelt. Sie haben nichts gesehen und nichts gehört, sagen sie.«
Amke musste schlucken. Sie spürte, dass ihr das Blut in den Kopf stieg, die Schläfen pochten und ihr immer wärmer wurde. »Theo, hast du mal bei Emma angerufen? Vielleicht weiß die was.«
Stille in der Leitung. Theo sagte nichts.
»Theo, was ist los?«, rief Amke.
Inzwischen waren die Kolleginnen im Büro auf das Telefonat aufmerksam geworden und hatten erkannt, dass mit Amke etwas nicht stimmte. »Theo«, hörten sie Amke ein weiteres Mal rufen.
Dann sprang sie auf, schob mit den Kniekehlen den Bürostuhl nach hinten, dass er gegen einen Aktenschrank rollte, und sagte: »Er hat aufgelegt. Tut mir leid, ich muss weg. Da stimmt was nicht.«
Mit zerzausten Haaren und triefend nass erreichte Amke das Haus in der Luisenstraße. Sie riss sich den Anorak vom Körper und warf ihn achtlos über eine Stuhllehne im Esszimmer.
Dann sah sie Theo, der im Wohnzimmer nebenan auf dem Sofa saß und telefonierte. »Bist du sicher, wirklich sicher?«, hörte sie ihren Mann sprechen. »Und sie war auch nicht betrunken oder angesäuselt oder so etwas?«, fragte Theo weiter.
Amke merkte, dass Theo mit einer Frau sprach. Sie hatte nur keine Ahnung, mit welcher.
»Ja, danke, Karin«, sagte Theo, »und halte bitte die Augen auf.«
Da wusste Amke, dass ihr Mann mit ihrer Yoga-Freundin Karin gesprochen hatte und auch die offensichtlich vollkommen ahnungslos war.
Amke rückte auf dem roten Ledersofa so nah an Theo heran, dass sie ihn mit den Beinen und den Schultern berührte. Rasch drückte sie ihm noch einen Kuss auf die unrasierte Wange. Nachdem sie ihre klobigen Pantoletten abgestreift hatte, versanken ihre kleinen Füße im schweren Gewebe des Berbers.
Theo hatte einen Becher mit Kaffee vor sich stehen. Man sah der trüben Brühe an, dass sie längst kalt war. Eigentlich hatte Amke auf den Kuss und ihren fragenden Blick eine Reaktion erwartet, doch Theo blieb regungslos. Seine Hände zitterten leicht, allerdings atmete er ruhig– ganz im Gegensatz zum Telefonat vor ein paar Minuten.
Endlich regte er sich. »Emma ist unterwegs hierher«, stammelte er. »Ich habe sie angerufen. Sie ist aus allen Wolken gefallen.«
»Warum hast du eben einfach aufgelegt?«
»Ich habe nicht aufgelegt.«
Theo starrte immer noch vor sich hin. Seine leeren Augen trafen die marmorne Tischkante, die zauseligen Haare fielen wie Fäden in die Stirn und wirkten noch öliger als üblich. Die schuppige Haut war nicht eingecremt, das konnte man mühelos erkennen. Außerdem hätte er dringend seine Nase putzen müssen. Immer wieder sog er schniefend nach Luft.
Das alles machte Amke wütend. »Ich kann verstehen, dass du dir große Sorgen um deine Mutter machst. Aber wenn du nicht mit mir sprichst, wird es nicht besser.« Dann warf sie ihm ein Papiertaschentuch vor die Nase und fragte erneut: »Warum hast du eben aufgelegt?«
»Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich dachte natürlich, dass es Mutter ist. Also bin ich aufgesprungen, wobei mir das Telefon aus der Hand gerutscht ist.«
»Und wer bitte schön stand vor der Haustür?«
Theo nuschelte mit halb offenem Mund, während er nach dem Taschentuch griff und es umständlich vor der Nase auffaltete. »Der Postbote.«
Zwar hatte Amke ihren Mann darum gebeten, mit dem Anruf bei der Polizei zu warten, dennoch meldete er das Verschwinden seiner Mutter sofort.