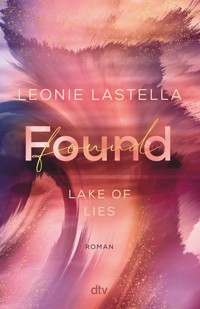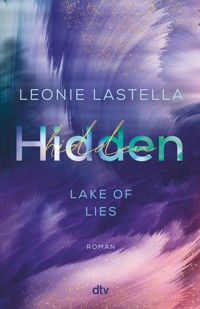9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bezaubernder Liebesroman, der die Herzen stolpern lässt – mitten hinein ins Glück Als Juna zum ersten Mal nach acht Jahren Bosse wiedersieht, ist da sofort wieder die explosive Anziehungskraft, das Herzbeben, das Gefühl von Sand und Meerwasser auf der Haut. Eigentlich wollte sie nie wieder einen Fuß nach Amrum setzen. Zu groß ist das Loch, das die Ereignisse von damals in ihr Herz gerissen haben. Das Loch, das Bosse dort hinterlassen hat. Doch jetzt ist Juna gezwungen, auf die Insel zurückzukehren. Und Bosse ist immer noch da. Es hat keinen Tag gegeben, an dem er nicht an sie gedacht hat. Doch neben den Gefühlen, die sofort wieder zwischen ihm und Juna aufbrechen, lauert noch der alte Schmerz, der sie nicht loslässt und beide in einen wahren Herzseilakt stürzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Leonie Lastella
Nordsternfunkeln
Roman
Über dieses Buch
»Ich starre in diese Augen, die einmal mein Mittelpunkt waren. Dunkel, fast schwarz, brennt sich Bosses Blick in meinen. Er dürfte nicht hier sein. Aber stattdessen steht er jetzt vor mir und wirft mich aus der Bahn. Früher war es ein gutes Gefühl. Wie der freie Fall, wenn man die Sicherheit des Bungee-Seils an den Fußgelenken spürt. Bosse war meine Sicherheit.Ich habe wirklich geglaubt, ich würde nicht mehr so auf ihn reagieren, aber das war ein fataler Irrtum. Er bringt mich noch immer dazu, mich aufzulösen, zu springen, zu fallen. Was sich verändert hat, ist, dass er nicht mehr meine Sicherheit ist. Da ist kein Netz mehr, nur der drohende Aufprall.
Ich kenne jeden Zentimeter seines Körpers, und gleichzeitig kommt er mir so fremd vor. Ich schließe die Augen, weil sein Anblick jeden geradlinigen Gedanken zerfasert. Aber selbst hinter meinen Lidern spüre ich den Schmerz, den er in mir hervorruft und diese verdammte Anziehung, die uns schon damals schockverknallt hat herumtorkeln lassen.«
Weitere Bücher der Autorin:
»Brausepulverherz«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Leonie Lastella liebt ihre Söhne, ihr Pferd und ihr kleines Häuschen im Norden Deutschlands. Wenn sie sich nicht gerade den frischen Nordseewind um die Nase wehen lässt, schreibt sie über die große Liebe. Von sich selbst sagt sie, sie sei der ungeduldigste Mensch auf dem Planeten. Ganz besonders, wenn es um die Liebe geht.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück gmbH, 30827 Garbsen.
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: Getty Images und Shutterstock
ISBN 978-3-10-490474-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Prolog
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Bosse
Juna
Epilog
Dank
Für meine Familie
Ihr seid mein Licht. Der Navigationspunkt, der mich immer wieder nach Hause bringt. Mein Anker.
Prolog
Liebe sollte bedingungslos sein. Sie sollte keine Grenzen kennen und jede Zelle deines Körpers verwirbeln, dein Ich in Millionen Stücke zersetzen und neu zusammenfügen.
Obwohl ich erst siebzehn bin, liebe ich Bosse auf genau diese Art. Wie ich noch nie vor ihm einen Menschen geliebt habe. So wie ich nie jemand anderen lieben werde.
Die Menschen denken, wir wären zu jung und unsere Liebe sei nicht ernst zu nehmen. Ich sehe es in ihren milden, nachsichtigen Blicken. Sie halten es für etwas Flüchtiges … Vergängliches. Und das ist in Ordnung.
Ich brauche niemanden außer Bosse, um zu wissen, dass wir anders sind. Anders als die Menschen, deren Jugendliebe das Scherbenfundament für die richtige Liebe bildet und am Ende nur eine bittersüße Erinnerung ist. Bosse und ich sind unser Fundament. Wir sind richtig!
Bosse lässt sich neben mich in den Sand fallen und schüttelt kühles Nordseewasser auf meinen Bauch. Seine Haarspitzen berühren mein Bikini-Oberteil. Ich zittere und rolle mich lachend zusammen. Es ist nicht die Kälte, die er vom Kitesurfen mitgebracht hat. Es sind seine warmen Lippen und das Kratzen seiner Bartstoppeln direkt über dem Bund meiner Shorts, die mich erschaudern lassen.
Meine Hände verheddern sich in seinen von der Sonne gebleichten Haaren, während ich ihn seufzend an mich ziehe. Ich wünschte, wir wären allein auf der Welt und ich könnte dem Beben nachgeben, das jede seiner Berührungen in mir auslöst. Das ist ungesund, genauso wie das absurde Gefühl von Liebe und das Kribbeln, das durch meine Eingeweide zieht, wann immer er mich angrinst.
»Hi, Sternchen.« Er ist der Einzige, der mich so nennt. Es ist verboten kitschig, aber die Erklärung für den Kosenamen pflanzt mir ein warmes Gefühl in den Körper.
Ich bin sein Navigationspunkt, das Leuchten, das ihn nach Hause bringt. Zurück zu mir. Egal, was uns trennt. Dass ich ihm glaube, macht unsere Liebe zu etwas Ernstem, Unumstößlichen.
Es gibt nichts, was uns dauerhaft trennen, nichts, was uns etwas anhaben könnte. Das sagen viele Menschen und noch mehr scheitern. Wir nicht. Diese Gewissheit steckt in mir, wie ein Bosse-Rettungsanker. Ich bin sein Zentrum, sein Mittelpunkt. Ich war nie der Typ Mensch, der an diese eine alles verzehrende Liebe geglaubt hat. Bis Bosse vor fast drei Jahren auf die Insel gezogen ist.
Er küsst mich. Sandkörner stehlen sich zwischen unsere Lippen, begleiten seine Berührungen auf meiner Haut und machen sie rau und wild. Wie Bosse, wie unsere Liebe, die nie enden wird.
Acht Jahre später …
Juna
Die Fähre zerteilt die Wassermassen am Bug des Schiffes in schäumend dunkle Wellenkämme. Ich stehe allein auf dem Achterdeck. Der Sturm zerrt an meiner Jacke und schleudert feuchte, braune Haarsträhnen in mein Gesicht. Ich sollte reingehen. Aus dem geheizten Innenraum der Fähre dringt warmes Licht durch die Tropfen auf der Scheibe und lockt meinen durchgefrorenen Körper, aber ich rühre mich nicht. Vielleicht will ich, dass der Sturm mir sowohl die Vorfreude als auch die Angst aus dem Kopf bläst – die ewig ambivalenten Gefühle, hervorgerufen von der maulwurfshügelgroßen Insel, deren Umrisse im Halbdunkel des verhangenen Tages auftauchen. Vereinzelte Lichtpunkte blitzen durch die Dünen der Westküste und markieren die wenigen Häuser, die direkt am Strand liegen. Einer dieser Punkte war früher mein Zuhause.
Ich bin hier geboren, aber meine neue Heimat liegt tausende Kilometer von hier entfernt – in San Francisco. Dort ist es warm, der Himmel meist wolkenlos blau und das Wetter so beständig wie die gute Laune der Menschen dort.
Eine Windbö holt mich fast von den Füßen und hat dabei dieselbe Kraft wie meine Gefühle, die so eng mit Amrum verbunden sind wie das Watt mit der Nordsee.
Da sind die zwiespältigen Empfindungen für meine Mutter und die sehr viel eindeutigeren für Bosse. Sie sind schwarz, dunkel und stärker als der Sturm, der das Regenwasser gegen die Scheiben peitscht.
Ich atme tief durch. Ich bin erwachsen, die Dinge haben sich verändert. Es gibt keinen Grund, so verdammt nervös zu sein.
Obwohl ich weder bei Facebook noch bei Google Einträge über ihn gefunden habe und deswegen nicht sicher sein kann, dürfte Bosse längst in einem Surfcamp auf Tarifa sein, wie er es immer vorhatte. Meine Mutter und ich befinden uns seit Jahren schon nicht mehr in der Mutter-Tochter-Pubertäts-Kampfarena. Wir verstehen uns sogar ziemlich gut. Zugegeben könnte das auch an den zig tausend Kilometern Distanz liegen, die uns bis heute getrennt haben. Das Wichtigste ist aber, dass ich mich verändert habe.
Die Sonne Kaliforniens und Tante Caro haben mich wieder hinbekommen, nachdem ich desillusioniert und am Boden zerstört vor acht Jahren von der Insel geflohen bin. Ich habe mich berappelt. Bin stärker als früher. Und das ist vor allem Tante Caros Verdienst. Sie lebt, seitdem ich zwölf bin, an der Westküste der USA. Sie hat sich dort ein Leben aufgebaut, ist stark, selbstbewusst und immer für mich da. Dank ihrer Unterstützung habe ich jetzt, mit 25, ein Leben, das ich liebe und auf das ich stolz bin.
Allison, meine Mitbewohnerin, meint zwar, ich wäre geradezu manisch, was mein Arbeitspensum angeht, aber sie verzeiht es mir, solange ich ab und an mit ihr auf Beutezug durch die Clubs von San Francisco ziehe. Das hat sich nun vorerst erledigt. Das nächste Visum für die USA kann ich frühestens in sechs Monaten beantragen. So lange werde ich hierbleiben. Meine Finger krampfen sich um die Reling. Sechs Monate können lang werden, aber ich schiebe den Gedanken beiseite, dass mich die Vergangenheit einholen könnte. Ich will mich auf Amrum freuen, auf meine Ma, die ich trotz ihrer Macken liebe, auf meine alten Freunde, mit denen ich viel zu lange kaum oder gar keinen Kontakt hatte. Die Insel ist ein Teil von mir, den auch acht Jahre Amerika nie vollständig ausgelöscht haben. Ich horche tief in mich hinein, wo Vorfreude aufsteigt. Ich komme nach Hause.
Ein leichtes Grinsen umspielt meine Lippen, während meine Hände noch immer die Reling umklammern. Das Metall ist rau und solide. Nicht schön, aber funktional, so wie fast alles hier. Im Gegensatz zu den Nordlichtern legt der Amerikaner großen Wert darauf, Dinge schön aussehen zu lassen – gerade wenn sie es eigentlich nicht sind.
Einer der Gründe, warum Ma mich nicht einmal besuchen gekommen ist. Sie hasst diese oberflächliche, unechte Fassade. Sie lobt sich die ehrlich derbe Art der Norddeutschen. Und genau das zeigt, wie unterschiedlich wir sind. Ich mag es, wenn man den dunklen Dingen im Leben einen bunten Hochglanzanstrich verpasst. Es hat mir damals geholfen zu überleben.
Die Motoren stellen den Schub um. Wir sind da. Der nassgraue Beton der Anlegestelle liegt verwaist vor uns. Das orangefarbene Licht der Straßenlaternen spiegelt sich in den trüben Pfützen, und als die Fähre mit einem Ruckeln anlegt, kommt auch mein Herz zur Ruhe. Ich habe diese Insel immer geliebt. Ein illoyaler Teil von mir hat es selbst dann getan, als ich alles an diesem Ort hassen wollte.
Ich springe die Stufen hinab und kann mich gar nicht sattsehen an dem, was sich meinen Augen bietet: vom Wind plattgedrücktes Dünengras, die Häuser von Wittdün, der Sandstrand westlich des Stadtzentrums, der sich in der einbrechenden Dunkelheit und einer Wand aus Nieselregen verliert. Erinnerungen tanzen durch meinen Körper, aber es ist kein sinnlicher Tanz. Eher Nervenzellen aufreibender Heavy-Metal-Pogo.
Trotzdem entlocken mir die Bilder ein Lächeln, das noch breiter wird, als ich Ma am Ende des Anlegers entdecke. Der Kragen ihres kanariengelben Regenmantelungetüms ist hochgeklappt. Ein abwegig bunter Wollschal lugt zusammen mit jeder Menge krausem, blondem Haar unter dem Cape hervor. Instinktiv berühre ich mein eigenes Haar. Es ist im Gegensatz zu ihrem glatt und dunkel. Das sind die Gene meines Vaters. Ma hat ihn in ihrer wildesten Zeit kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt. Für den begrenzten Zeitraum eines Monats waren ihre Gefühle echt und irre intensiv, wie sie nie müde wird zu wiederholen. An seinen Nachnamen erinnert sie sich allerdings nicht mehr und schon gar nicht an eine Adresse oder auch nur den Hauch eines Anhaltspunktes, wo er abgeblieben sein könnte.
Ich verdrehe die Augen. So ist Ma, und auch wenn sie mir damit manchmal den letzten Nerv raubt, hüpft mein Herz genauso auf und ab wie ihre schlanke Gestalt, als sie quietschend auf mich zurast. Bei der Aktion verliert sie um ein Haar einen ihrer ebenfalls gelben Gummistiefel und fällt mir dann lachend um den Hals.
Ma ist wie eine Naturgewalt – wunderschön, mitreißend, überwältigend. Deswegen liebe ich sie. Es macht sie zu meiner Ma, und ich weigere mich, den Gedanken an ihre andere Seite zuzulassen, die verschlingend ist, ungerecht und manchmal zerstörerisch.
»Juna-Maus. Mein Mädchen.«
Ich versteife mich unwillkürlich. Ihre Art, mich ›Juna-Maus‹ zu nennen, lässt alte Bilder aufsteigen. Von uns, wie wir um jeden Meter Boden gekämpft haben. Damals, bevor ich weggegangen bin. Ich war jung und habe sie in den Wahnsinn getrieben. Und ihre Art hat nicht gerade deeskalierend gewirkt. Aber wir haben uns beide weiterentwickelt. Es gibt keinen Grund zu denken, es würde wieder so werden.
Ich drücke sie fest an mich und suche nach Worten. Ich möchte ihr sagen, wie sehr ich mich freue, sie wiederzusehen, aber die Worte bleiben in meiner Kehle stecken.
»Ich habe dich so vermisst, meine Kleine.« Ich sie auch. Und wie. Meine Brust wird eng. Ich schließe meine Augen, weil ich nicht will, dass sie meine Tränen sieht. Ich atme Mas Geruch ein und lasse zu, dass Erinnerungen an den liebevoll, bunten, verrückt chaotischen Teil meiner Kindheit den letzten Rest Abwehr zerstören, der noch in meinen Knochen steckt.
»Ich danke dem Kosmos, dass er dich mir zurückgebracht hat.« Sie lächelt und streicht mir über die Wange. Tränen glitzern in ihren Augen, und ich weiß, dass ihre Gefühle für mich echt sind. Das waren sie immer, auch wenn es sich oft anders angefühlt hat. Das war einer der Gründe, warum ich mich damals so sehr an Bosse festgehalten und von Ma entfernt habe. Erst wenige, kaum merkbare, winzige Schritte, die uns aber in der Summe auseinandertrieben, und als das Ende von Bosse und mir mich urplötzlich ins Nichts geschubst hat, war sie bereits zu weit entfernt, um mich zu stützen. Die Wolle ihres Schals kratzt mich, während ihre Locken meine Nase kitzeln und die Wut fortstreichen, die sich durch die Erinnerungen in mir zusammenballt, wie eine Minikernfusion. Die Wut ist nutzlos und dumm. Es ist sinnlos, sauer auf Ma zu sein wegen etwas, das acht Jahre zurückliegt. Und Bosse ist längst fort. Auf ihn wütend zu sein ist noch nutzloser.
Er ist nicht mehr als eine Erinnerung, von der ich wünschte, sie wäre blasser. Dann würde ich nicht sein Lachen sehen, sobald ich sie zulasse. Nicht fühlen, wie mitreißend es war.
Er wollte immer weg von hier und der verfluchten Sandbank, wie er Amrum stets nannte, den Rücken kehren. Sternchen.
Es ist das erste Mal seit Jahren, dass seine Stimme durch meinen Kopf hallt. Als würde der Wind, der um Ma und mich herumtobt, sie zu mir tragen. Bosse hat mich nicht wiedergefunden. Er hat nicht einmal gesucht. Vielleicht weil ich erloschen bin. Weil mich unsere gemeinsame Vergangenheit zu einem anderen Menschen gemacht hat.
»Lass uns nach Hause gehen«, sage ich und sehe, wie sehr es Ma freut, dass ich von ihrer Wohnung als meinem Zuhause spreche. Ich drücke sie noch einmal fest an mich, weil es mir die Zuversicht gibt, dass die nächsten sechs Monate schön werden. Dass es anders sein wird als damals. Besser. Ich weiß, dass Ma hofft, ich würde bleiben, aber mein potentieller Arbeitgeber Marriott International wird eine andere Betriebswirtschaftlerin einstellen, wenn ich meinen Aufenthalt in Deutschland verlängere. Und das würde bedeuten, dass ich mich ganz umsonst durch das zweijährige Trainee-Programm gekämpft habe. Außerdem würde ich das kleine, bunte Reihenhäuschen in San Francisco unendlich vermissen, genau wie mein winziges, gemütliches WG-Zimmer. Ich brauche die fluffigen kalifornischen Schäfchenwolken, die Sonne, aber vor allem Tante Caro und meine Freundinnen, Allison und Caitlyn. So gut es sich auch anfühlt, zurück zu sein, ich weiß, dass ich dem Sturm auf dieser Insel nicht ewig standhalten kann.
»Kommst du?« Ma deutet auf ihr Hollandrad, an das sie einen altersschwachen Hänger gekoppelt hat. Die Konstruktion sieht nicht so aus, als könnte sie meinen zentnerschweren Hartschalenkoffer unfallfrei bis zur Wohnung transportieren.
»Das Gefährt gibt es immer noch?« Ich kann nicht glauben, dass ihr alter Drahtesel all die Jahre überlebt hat. Ma achtet wirklich auf Nachhaltigkeit.
»Natürlich.« Sie grinst. »Es ist ein sehr treuer Gefährte.« Treuer als ihre Tochter, die sie fast ein Jahrzehnt allein gelassen hat. Bei jedem anderen würde diese Aussage als versteckte Botschaft zwischen den Worten kleben, aber Ma ist nicht nachtragend – das versaut das Karma.
Gemeinsam hieven wir den Koffer auf den Anhänger und schlendern Seite an Seite in Richtung ihrer Wohnung. Es fühlt sich vertraut an, gut und ein bisschen verquer. Die Art von verquer, die ein warmes Gefühl in der Brust erzeugt.
Bosse
Die Sonne klettert über einen kaltblauen Horizont, als ich von der Küste weg über die aufgeraute See gleite. Die Wellenkämme werden zu steilen Sprungschanzen, als der Kite und das Board an Fahrt aufnehmen. Ich ziehe die Bar an mich, verkürze so die Backlines und damit den Zug, um noch mehr an Geschwindigkeit zuzulegen.
Ich liebe es vor der Arbeit rauszufahren, über das Wasser zu gleiten und mich einmal am Tag vollkommen frei zu fühlen. Die Natur gibt mir Adrenalin und Freiheit zugleich.
Ich jage den Kite über das Wasser, und nutze die nächste Welle, um abzuspringen. Mein Körper und das Board arbeiten zusammen, um den perfekten Moment für möglichst viel Airtime zu erwischen. Es ist wie Fliegen. Ein rasantes Schweben. Ich stehe einen Moment in der Luft, bevor der Wind abfällt, sich der Kite aus dem richtigen Winkel dreht und mich auf das Wasser zurückkatapultiert. Es gelingt mir, den Kite einzufangen, und ich nehme erneut Fahrt auf. Ein Grinsen macht sich auf meinem Gesicht breit, als ich die Geschwindigkeit auf bestimmt fünfzig km/h hochtreibe. Die Gischt überzieht mein Gesicht mit eiskaltem Wasser und macht mich wacher, als es zehn doppelte Espressi könnten.
Ich wende und rase parallel zum Strand zurück zu der Stelle, wo ich meinen Wagen vor den Dünen geparkt habe. Es wird Zeit, dass ich nach Hause komme und mich für die Arbeit fertigmache. Auch wenn mir die Stunde mit dem Brett unter den Füßen, den Wind in den Haaren und der Kraft der Elemente am liebsten ist, bringt mir das Kiten kein Geld ein. Auf jeden Fall nicht genug, um davon zu leben, und ich habe schon lange aufgehört, illusorischen Träumen nachzuhängen. Es gibt andere Wege, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Peer witzelt immer, dass ich zu einem Spießer mutiert bin, und vielleicht hat er recht. Früher hätte mir der Gedanke, Lehrer zu werden, Brechreiz verursacht. Aber jetzt gefällt es mir auf eine merkwürdige, nicht sadistische Art. Als ich mich dem Strand nähere und die Bar vom Körper weg bewege, verliere ich an Tempo. Erst, als ich knöcheltiefes Wasser erreiche, steuere ich den Kite ganz aus dem Windfenster. Langsam sinkt er auf den muschelüberzogenen Sandstrand, und mit dem Fahrtwind lässt auch das Rauschen des Adrenalins in meinen Ohren nach.
Früher wollte ich weg von hier. Heute bin ich mir sicher, dass dieser Ort der einzige ist, an dem ich leben will. Weil es meine Heimat ist, weil meine Freunde, mein Haus und mein Job hier sind und weil mich die Vergangenheit an genau diese Insel bindet.
Juna
Mein Zimmer sieht noch genauso aus wie vor acht Jahren. Als ich die Augen öffne und mich mit einem Ruck aufsetze, fühle ich mich für den schlaftrunkenen Bruchteil einer Sekunde wie mit siebzehn. Die Lichterkette an der Decke taucht das Weiß der Ikea-Kommode in ein milchig-gelbes Licht. Darauf liegen Überbleibsel meiner Kindheit – gesammelte Muscheln, Hölzer, Murmeln, mein Tagebuch, der kindliche bunte Schmuck und Filztaschen, die ich mit Ma gebastelt habe. Darüber hängt eine riesige Fotowand. Jedes Bild erzählt von dem Leben, das ich hinter mir gelassen habe und das sich letzte Nacht trotzdem wieder in meine Träume geschlichen hat. Mein Körper fühlt sich bleischwer an. Und in meinem Kopf hämmert ein dumpfer Schmerz. Einen schönen Gruß vom Jetlag. Ich massiere meine Schläfen, aber das macht es nur noch schlimmer. Draußen blinzelt die Sonne durch sich auftürmende Gewitterwolken in mein Zimmer. Ein untrüglicher Beweis, dass ich verschlafen habe. Ich angle nach meinem Handy und sehe nach der Uhrzeit. Ein Uhr nachts. Das kann nicht stimmen. Zusammen mit einem Adrenalinstoß knallt die Erkenntnis in mein zentrales Nervensystem, dass ich Idiotin vergessen habe, das Handy auf Mitteleuropäische Zeit umzustellen. Da klingelt der beste Handywecker acht Stunden zu spät –
Zu spät. Ich werde zu spät zu meinem Vorstellungsgespräch kommen. In einem Anflug von Panik strample ich die Bettdecke von den Füßen und flitze ins Bad. Der Boden ist kalt. Natürlich spart Ma Heizkosten. Nicht, weil sie es sich nicht leisten kann, dem norddeutschen Wetter mit geballter Heizungswärme entgegenzutreten, sondern aus Überzeugung. Eine Überzeugung, die mir bunt geringelte Wollsocken an den Füßen beschert. Ma hat sie mir gestern Abend gegeben, damit ich im Schlaf nicht erfriere.
Das Radio im Bad hat eine digitale Zeitanzeige, die mich höhnisch anblinkt. Ich habe noch zehn Minuten, um mich fertigzumachen und die Spuren der Nacht aus meinem Gesicht zu wischen. Dabei würde man vermutlich einen ganzen Trupp Visagisten und eine Woche Zeit brauchen, um das wieder hinzubekommen. Ich versuche es aus Mangel an Alternativen mit einer Mini-Katzenwäsche und etwas Make-up. Das muss im Hinblick auf mein Zeitfenster reichen. Der Inhalt meines Koffers bestätigt, dass meine kalifornischen Klamotten nicht Amrum-tauglich sind. Ich werde nicht nur zu spät kommen, sondern mir wird dazu noch schweinekalt sein.
Ich puste mir die Haare aus dem Gesicht. Mein Pony erholt sich noch davon, trendig kurz geschnitten worden zu sein. Allison war der Meinung, das wäre der letzte Schrei und würde mir mega stehen. Ich war gleich skeptisch und habe recht behalten. Es hat meine ansonsten weichen Gesichtszüge hart und fremd gemacht. Meine schokoladenbraunen Augen wirkten kalt und unnahbar. Mittlerweile reicht der Pony wieder bis über das Kinn, hat den Rest meiner taillenlangen Haare aber noch nicht eingeholt.
Unschlüssig sehe ich von meinem Koffer zu dem Schrank, der neben dem Bett steht. Wenn Ma nichts in diesem Zimmer verändert hat, müssten meine alten Klamotten noch da sein. Ich lege eine Hand auf den Metallknauf des Schranks und spüre, wie mein Magen rebelliert. Ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, ihn zu öffnen. Ich bin nicht darauf vorbereitet, gegen Erinnerungen zu prallen, noch nicht.
Merle starrt mich von den Fotos an, die über dem Schreibtisch hängen, und ich kann förmlich spüren, wie sie grinsend den Kopf schüttelt, weil ich mich verhalte wie eine Geistesgestörte. Ihr blonder, fransiger Bob ist wie sie: frech, ungestüm und anbetungswürdig. Auch nach all den Jahren ist sie noch meine Freundin. Die Einzige, zu der der Kontakt neben meiner Mutter nicht gänzlich abgebrochen ist, auch wenn er über die Jahre zäher und sporadischer geworden ist. Schuld waren nicht so sehr die Kilometer, die uns trennten, sondern mehr das eine Thema, das einen riesigen wunden Punkt bildete und Gespräche zu einem Minenfeld machte: Bosse.
Ich löse ein anderes Polaroid-Bild von dem rauen Korkuntergrund und halte es in das schräg einfallende Licht. Ich bin darauf zu sehen. In einem kurzen Sport-Top und einer enganliegenden Hose. Meine bloßen Füße berühren glänzendes Parkett, während ich in die Kamera lächle. Bosse hat das Foto aufgenommen. An dem Abend waren wir allein im Tanzstudio. Ich durfte die Räumlichkeiten nutzen, wann immer ich wollte, und Bosse hat mich oft begleitet. Ich habe trainiert, und er hat mir zugesehen oder gelesen. Ich habe es geliebt, mich frei von den starren Grenzen der Standardtänze zu bewegen und im Contemporary die Seele der Musik einzufangen. Und Bosse hat mich eingefangen in diesem Foto. Das, was mich damals ausgemacht hat.
»Juna, Frühstück?«, ruft Ma von unten und hört sich ungewohnt nach einer normalen Hausfrau an. Ihre Stimme reißt mich aus dem körperlos luftleeren Raum voller Erinnerungen, indem ich mich gerade auflöse. Sie katapultiert mich zurück ins Hier und Jetzt. Wo ein Schrank nur ein Schrank ist und die Zeiger der Uhr unerbittlich weiterlaufen.
»Komme gleich«, rufe ich ihr zu und bin erleichtert, dass meine Stimme nicht so angekratzt klingt, wie ich mich fühle.
Ich schmeiße das Foto verkehrt herum auf den Schreibtisch und schiebe die Türen des Schranks auf. Unwillkürlich zucke ich zurück. Jeder Pulli, jede Hose, jedes Stück Stoff darin erzählt eine Geschichte, und jede handelt von Bosse und mir.
Hastig zerre ich einen einfachen schwarzen Strickpullover aus dem oberen Regal und angle eine Jeans von einem der Bügel. Die Jeans habe ich getragen, als Bosse und ich die Inselmeisterschaft im Algenticken, der Lieblinsgfreizeitbeschäftigung unserer Jugend, gewonnen haben. Algen, Sand und Salz. Das ausgelassene, atemlose Lachen und die wilde Jagd. Sich in Deckung rollen und gleichzeitig den Gegner mit den glibbrigen Pflanzenketten ausschalten. Diese Erinnerungen, die zu den glücklichsten meines Lebens gehören, sind fest mit diesen Jeans verwoben. Den Pullover habe ich oft getragen, wenn wir ineinander verschlungen in den Dünen lagen, bedeckt von Sand und Sturm. Ich reiße mich los und streife mir die Kleidungsstücke über. Es sind nur Klamotten. Sie sind leger, aber klassisch, und damit genau das Richtige für mein Vorstellungsgespräch im Hotel Seemöwe. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich hoffe, Herr Kruse, dem das Hotel gehört, und sein Sohn Jakob werden mir den Job geben, den sie in Aussicht gestellt haben. Die Vorgespräche mit dem Junior-Chef über Skype waren toll. Die Chemie zwischen Jakob und mir hat vom ersten Augenblick an gestimmt, und ich bin sicher, dass wir ein gutes Team bilden werden. Die übrigen Kollegen scheinen laut Jakobs Beschreibungen ebenfalls nett und aufgeschlossen zu sein. Genau das, was ich jetzt brauche. Immerhin habe ich vor, mich voll in den Job zu stürzen. Nicht nur, weil ich genügend Geld für die Rückkehr nach San Francisco sparen muss, sondern vor allem, um mich zu beschäftigen und meine Gedanken in Schach zu halten.
Mit fünf riesigen Sprüngen hetze ich die Treppe hinunter und pralle fast mit Ma zusammen, die zwei Becher mit Tee zum Tisch balanciert.
»Juna.« Sie lacht und gibt mir einen Kuss auf die Wange. Ihre Haare hat sie zu vielen winzigen Zöpfchen geflochten. »Ich habe uns Frühstück gemacht«, erklärt sie fröhlich. Der Tisch ist vollkommen überladen mit Brötchen, Eiern, frischem Obst und Gemüse. Sogar Aufschnitt hat Ma besorgt, obwohl sie ansonsten streng vegetarisch lebt. Das ist ein riesiges Zugeständnis und macht mir sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht bleiben kann, um diese Geste ausreichend zu würdigen.
»Ma, das ist toll«, versuche ich es trotzdem. Ich schnappe mir ein Croissant und werfe mir meine Tasche über.
»Du willst schon gehen?«, fragt sie enttäuscht.
»Ich muss wirklich los, obwohl das hier galaktisch und oberlecker aussieht, aber ich bin schon viel zu spät dran.«
»Ich verstehe nicht, wieso du immer so sehr in Eile bist? Du bist doch gerade erst angekommen.« Sie hackt auf ihrem neuen iPad herum, mit dem sie sich seit dem Kauf auf Kriegsfuß befindet. Ich wundere mich, wie ein so kapitalistisches Produkt in ihre Weltanschauung passt, und wittere eine Chance, das Thema zu wechseln. »Du hast allen Ernstes ein iPad? Ist das nicht gegen deine Regeln?«, frage ich scheinheilig.
Sie braucht zwei Sekunden, um der neuen Wendung des Gesprächs zu folgen. »Das Ding hat einen Apfel als Logo«, erklärt sie. »Der steht für Fruchtbarkeit, Natur und Lebensweisheit. Außerdem spendet Steve Jobs einen beträchtlichen Teil seines Vermögens.«
Ma ist wie eine moderne Pippi Langstrumpf. Sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. »Steve Jobs ist tot, Ma«, erwidere ich seufzend und puste mir die Haare aus dem Gesicht.
Sie zuckt mit den Schultern. »Manche ereilt die Ewigkeit eben früher. Womit ich darauf zurückkomme, dass du zur Ruhe kommen solltest, um dein Leben zu genießen. Es ist kurz genug. Dieses Gehetze und die viele Arbeit können nicht gesund sein. Du wirst, was das angeht, immer mehr wie Caro.« Der Zug um ihren Mund wird hart, als sie den Namen meiner Tante ausspricht. »Es geht immer nur um Erfolg, Arbeit und die Karriere.«
»Ich habe dir vorher von dem Jobangebot erzählt«, erkläre ich geduldig. »Das ist der Grund, warum ich hier bin.«
Sie nickt, wirkt aber nicht überzeugt.
»Ich arbeite gern, Ma. Das ist mir wichtig und macht mich glücklich.«
»Die Frage ist, warum es dir so wichtig ist, zu arbeiten, und nicht wichtiger, zu leben«, sagt sie mit ihrer Therapeutenstimme, die mir sofort das Gefühl gibt, mit mir würde etwas nicht stimmen. Dass meine Einstellung zum Leben so anders ist als die ihre, führt sie natürlich auf den »schlechten« Einfluss ihrer Schwester zurück. Und allein deswegen heißt sie meinen Wunsch zu arbeiten nicht gut.
Sie legt das iPad beiseite und seufzt resigniert. Siri hat offensichtlich diese Runde gewonnen. Vielleicht verzweifelt sie aber auch an unseren unterschiedlichen Lebenseinstellungen. Ma umkreist mit ihrer Hand die Wohnung, das üppige Frühstück und sich selbst.
»Nimm dir Zeit, um zur Ruhe zu kommen, deine Mitte wiederzufinden. Ich habe hier mehr als genug Platz. Du hast dein eigenes Zimmer und kannst bleiben, solange du willst. Es gibt keinen Grund, etwas zu überstürzen. Wenn es soweit ist, wirst du schon etwas Geeignetes finden.«
Ich will keine Ruhe. Ich will diesen Job, und ich bin gereizt. Eine Sache hat sich schon mal nicht geändert. Ma plant noch immer gern fremde Leben. Ganz Therapeutin. Dabei ist ihr eigenes Leben das reinste Chaos. Am liebsten würde ich etwas Patziges erwidern, aber das würde uns wahrscheinlich postwendend zurück in alte Verhaltensmuster katapultieren. Deswegen versuche ich, ruhig zu bleiben.
»Die Arbeit ist geeignet. Geeignetere Stellen wird es hier auf der Insel nicht so bald geben. Wenn du mich also in deiner Nähe haben willst, muss ich jetzt los und das Vorstellungsgespräch meistern.« Sie weiß, dass ich nur arbeiten will, um wieder zu verschwinden, und ich sehe, wie sie um Worte ringt, die mich davon abbringen sollen. Etwas versöhnlicher schiebe ich hinterher: »Das Croissant ist himmlisch.« Kauend schnappe ich mir meine Jacke. »Von Bäcker Jan, oder?«, schiebe ich leise hinterher.
Es ist, als würde allein diese Aussage erklären, wieso Amrum und ich keine gemeinsame Zukunft haben. Es sind die winzigen Details, in denen so viel Vergangenheit steckt, die es unmöglich machen, zu bleiben.
Das spüre ich in meinem Herzen, wo ein tückisch scharfer Erinnerungssplitter von Bosse und mir auf der Bank vor Jans uriger Backstube aufblitzt. Bosse hat Schaumküsse in die aufgebrochenen, noch warmen Croissants gelegt und sie zu einer leckeren, kleinen Kalorienperversität zusammengedrückt. Ich schmecke die klebrige Süße, dann seinen Kuss, sehe seine genüsslich verdrehten Augen dicht vor meinen. Das Salz in seinen langen dunklen Wimpern und die Sandkörner in den ausgeblichenen Haarspitzen. Das Ausmaß der Perfektion dieses Moments treibt mir die Tränen in die Augen. Nur Bosse war in der Lage, etwas so Alltägliches wie ein Frühstück zu einer unauslöschlichen Erinnerung zu machen, die selbst ein Jahrzehnt später noch bittersüß in meinem Herzen hängt.
Das Hotel Seemöwe liegt ganz im Norden der Insel. Hinter Norddorf erstreckt sich nur noch das Naturschutzgebiet, so dass man einen atemberaubenden Blick auf die Dünen und die feinen Schaumkronen der aufgewühlten Nordsee hat, wenn man im Hotel Urlaub macht.
Der Name passt zu dem biederen Rotklinker mit einem kniehohen, weißen Friesenzaun davor und dem frisch gedeckten Reetdach. Ich blinzle das Bild des Marriott weg, wo stilvoll beleuchtete Wassersäulen das gigantische Hotel einrahmen und schon vor Betreten des Foyers keinen Zweifel am Wow-Effekt aufkommen lassen. Immerhin wirken das Haus und der winzige Garten zwischen Friesenzaun und Fassade gepflegt und liebevoll bepflanzt.
Ich trete ein und kämpfe mich eine ganze Weile mit der extrem schweren Glastür ab. Im Foyer angekommen, brauche ich einen Augenblick, um zu begreifen, dass ich tatsächlich durch die richtige Tür getreten bin. Rustikales Bauernhaus meets schlichte Eleganz beschreibt den Empfangsbereich wohl am ehesten und bricht mit der spießigen Außenansicht.
Ein Mann, der mir allenfalls bis zum Kinn reicht, erhebt sich von einem der Chesterfield-Sofas, die dem Foyer ein gemütliches Flair verleihen und tief in einem modernen Langflorteppich versinken. Der Mann hat nur noch wenige Haare, die er kunstvoll über eine glänzende Glatze drapiert hat.
»Sie müssen Frau Andersen sein? Paul Kruse.« Er lacht ein tiefes dunkles Lachen, das nicht zu der Größe seines Resonanzkörpers passen will, und reicht mir die Hand. Er scheint sich aufrichtig zu freuen, mich zu sehen, was mich auf einen positiven Ausgang des Gesprächs hoffen lässt.
Eigentlich hatte ich gedacht, ich würde das Gespräch mit seinem Sohn Jakob führen, der bis jetzt mein Ansprechpartner war. Aber wenn ich seinen Vater überzeugen kann, werde ich ab nächster Woche wohl noch genügend Gelegenheiten haben, ihn kennenzulernen. Ich gebe mir einen Ruck und schüttle die Hand meines Gegenübers.
»Freut mich, Herr Kruse!«, sage ich und zwinge meine Stimme in einen geschäftlichen Tonfall. Der professionelle Eindruck, den ich erwecken will, wird aber leider durch die Tatsache zerstört, dass ich über die Teppichkante stolpere.
Jakobs Vater lacht, aber es ist nicht abwertend, sondern ansteckend und freundlich.
»Folgen Sie mir doch bitte«, sagt er und zeigt mir den Weg zu seinem Büro. Er setzt sich hinter einen wuchtigen Mahagonitisch. Ein strenges, raumforderndes Möbel, hinter dem er versinkt, während er einladend auf die zwei modernen Stühle zeigt, die auf der anderen Tischseite stehen.
»Mein Sohn war von den Vorgesprächen mit Ihnen, Frau Andersen, sehr angetan. Wir haben bereits einige Bewerber für die Stelle eingeladen, aber Jakob bestand darauf, dass wir mit der endgültigen Entscheidung warten, bis wir mit Ihnen gesprochen haben. Er möchte sie unbedingt für unsere Familie gewinnen.«
Natürlich habe ich mich über das Hotel informiert und weiß, dass es ein Familienbetrieb mit nur wenigen Angestellten ist, und mir war klar, dass es sicher familiärer zugehen würde als im Marriott, aber für einen Moment wirft mich Paul Kruses Formulierung aus der Bahn. Ich meine, ich habe schon mit meiner Familie alle Hände voll zu tun. Eigentlich hatte ich nicht vor, mich allzu eng an diese Arbeitsstelle zu binden. Immerhin werde ich nicht lange bleiben, wovon die Kruses allerdings noch nichts wissen.
»Ich würde die Stelle sehr gerne antreten«, bemühe ich mich um ein wenig Distanz.
Er nickt, macht sich eine Notiz, die nicht halb so harmlos aussieht wie er selbst. Offensichtlich hat er etwas anderes erwartet als mich und meinen ewigen Versuch, Menschen auf Abstand zu halten.
Sein zunächst offenes Lächeln kühlt ab, genau wie sein Tonfall. »Wir suchen nicht nur eine Mitarbeiterin, die den Esprit unseres Hauses verkörpert und das neue Konzept vorantreibt, sondern auch jemanden, der ins Team passt. Wir sind wie eine Familie. Das macht die Arbeit hier aus. Ich habe das Hotel vor zwei Jahren von meinem Cousin übernommen, der das Haus leider aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen konnte. Ich bin selbst auf der Insel aufgewachsen und habe sofort zugegriffen, als sich mir die Chance bot zurückzukehren und gemeinsam mit meinem Sohn dieses hübsche Kleinod herzurichten. Wir haben seitdem viel verändert und tun alles dafür, dass sich die Gäste familiär betreut und wohl fühlen. Niemand reißt hier nur seine Stunden ab. Wir helfen einander und arbeiten eng zusammen.« Er sieht mich aus klugen, wachen Augen an, die hinter einem schmalen Brillengestell liegen. »Wie ich mitbekommen habe, sind Sie ebenfalls auf Amrum aufgewachsen und kehren nach einigen Jahren im Ausland hierher zurück? Wie lange waren Sie noch gleich fort?«, fragt er.
Ich glaube nicht, dass sich unsere Geschichten in irgendeiner Weise ähneln und rutsche etwas unbehaglich auf meinem Stuhl herum, nicke aber und murmle: »Acht Jahre.«
»Dann sind Sie früh von zu Hause weggegangen.«
Er sieht mich noch immer freundlich an und nickt mir aufmunternd zu, aber ich will ganz sicher nicht mein Privatleben vor einem im Grunde Fremden ausbreiten.
»Ich bin zu meiner Tante gezogen. Viele Jugendliche gehen für ein Jahr ins Ausland«, versuche ich ihn davon zu überzeugen, dass meine Geschichte nicht erzählenswert ist.
Doch er lässt nicht locker. »Aber Sie sind geblieben. Acht Jahre lang.«
Ich nicke und weiß nicht, was ich darauf erwidern soll.
»Gut.« Er klatscht in die Hände und sieht sich etwas unschlüssig um. Offensichtlich hatte er auf mehr Offenheit von meiner Seite gehofft, und da unser Gespräch zusehends stagniert, geht er zum nächsten Punkt über. »Immerhin dürften Sie keine sprachlichen Probleme haben, wenn wir ausländische Gäste betreuen. Wie schon gesagt, helfen wir uns gegenseitig, und uns fehlt bisher jemand, der sich um die fremdsprachigen Gäste kümmert.«
»Das dürfte kein Problem sein«, sage ich. Das ist sicheres Terrain. »Ich habe in Amerika studiert und meinen Abschluss dort gemacht. Ich könnte sämtliche englischsprachige Korrespondenz sowie die Betreuung ausländischer Gäste übernehmen.«
Wieder macht er sich eine Notiz. »In Ordnung. Ich habe mir Ihre Qualifikationen durchgelesen, und ich weiß, dass Sie rein fachlich eine Bereicherung für unser Team wären, aber die Chemie muss ebenfalls stimmen.« Weiter sagt er nichts, und die Stille, die plötzlich zwischen uns steht, ist vernichtend.
Ich muss ihn davon überzeugen, dass ich teamfähig bin, dass ich zu diesem Hotel und den Menschen, die darin arbeiten, passe, auch wenn ich auf den ersten Moment distanziert und unnahbar wirke.
»Ich habe nach meinem Studium zwei Jahre in der Marriott Group gearbeitet und war am Standort San Francisco tätig«, sage ich hastig. »Ich habe dort mit meiner Vorgesetzten ein großes Team geleitet. Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten und mich einzubringen.«
Herr Kruse klappt die Mappe mit den Bewerbungsunterlagen zu. Ich habe ihn mit den Floskeln, die ich herunterrattere, nicht erreicht, soviel ist klar. Ich bin dabei, den Posten zu verlieren, der mir so sicher erschien.
»Ihre Referenzen kenne ich, Frau Andersen, aber ich möchte wissen, ob Sie sich in ein familiäres Team integrieren möchten. Wir sind nicht das Marriott, wo Sie andere leiten und sich bestenfalls einbringen. Wir arbeiten hier zusammen.«
Ich beiße mir auf die Lippen. »Natürlich würde ich mich freuen, zu Ihrem Team zu gehören«, erwidere ich bestimmt, auch wenn ich spüre, dass mir Paul Kruse nicht glaubt.
Er nickt. Wieder kritzelt der Stift über das Papier und hinterlässt von meiner Position aus unleserliche Hieroglyphen. Ich zupfe meinen Pullover zurecht und wünschte, ich hätte die wunderschöne Chiffonbluse angezogen, die ich mir extra in San Francisco für das Gespräch gekauft habe. Dann würde ich wenigstens nicht von der Vergangenheit umgeben sein, während ich untergehe. Ich murmle eine Verwünschung in Richtung der Gewitterwolken, die sich bedrohlich über dem Meer auftürmen.
»Alles in Ordnung?«, unterbricht mich Paul Kruse und zieht eine Augenbraue nach oben.
»Ja, entschuldigen Sie«, quetsche ich hervor und deute nach draußen. »Das Wetter macht mir nur etwas zu schaffen.«
Er runzelt die Stirn und schüttelt dann den Kopf. Für Amrumer Verhältnisse ist das Wetter gut. Es regnet nicht, und der Sturm jagt die Wolken so schnell über das Firmament, dass immer mal wieder die Sonne durchblitzt.
Natürlich versteht mein Gegenüber nicht, warum mich das Wetter, die Insel und die Tatsache, dass ich mindestens sechs Monate hier verbringen muss, so aufwühlen. Er ist freiwillig hierher zurückgekehrt.
Ich atme tief durch. Das bin ich auch. Ich hätte überall hingehen können, um auf das neue Visum zu warten, aber ich bin hier. Ich wollte zurückkommen, um Zeit mit Ma zu verbringen. Um Merle wiederzusehen. Und um geradezurücken, was sich durch meinen Aufbruch und die jahrelange Distanz verschoben hat. Aber ich brauche diesen Job, wenn ich nicht durchdrehen will, während ich hier bin.
»Ich habe in San Francisco nicht nur an der Seite der Hoteldirektion gearbeitet, sondern war auch im Bereich der Kundenbetreuung tätig«, setze ich erneut an, Paul Kruse von mir zu überzeugen. »Ich habe viele hochkarätige nationale und internationale Gäste begrüßen dürfen und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet.« Aber schon während ich rede, merke ich, dass meine Worte das Gegenteil von dem bewirken, was ich mir erhofft habe.
»Dann haben Sie vielleicht die Insel verwechselt?«, antwortet Paul Kruse kühl. Er kneift ein Auge halb zu. »Da haben Sie auf Sylt bessere Chancen. Wir haben zwar deren Sand, aber die haben die Promis.« Er zuckt mit den Schultern, als wäre es ihm nur recht, wenn ich und all die oberflächlichen Leute auf die Nachbarinsel verschwinden.
»So habe ich das nicht gemeint.« Ich suche nach einer Erklärung. »Ich wollte damit nur sagen, dass sich jeder Ihrer Gäste bei mir wie ein großer Star fühlen wird.« Was rede ich da? Ich höre mich an wie eine Verkäuferin bei QVC, die versucht, anständigen Leuten minderwertige Ware aufzuquatschen. Ich seufze resigniert.
Paul Kruse starrt mich einen Augenblick wortlos an, bevor er hinterherschiebt. »Wir melden uns dann gegebenenfalls bei Ihnen.«
Das ist das Aus. Eindeutiger hätte man mir nicht mitteilen können, dass ich es in den Sand gesetzt habe.
»Hören Sie, Herr Kruse, ich glaube, wir hatten einen schlechten Start, und dafür will ich mich entschuldigen. Ich bin gestern Abend erst auf der Insel angekommen und hatte kaum Zeit, mich richtig zu akklimatisieren.« Mein verzweifelter Versuch, das Ruder herumzureißen, macht die Situation auch nicht besser. Ich atme tief durch und füge hinzu. »Es tut mir wirklich leid.«
Ein Klopfen schiebt sich zwischen uns, aber bevor Paul Kruse darauf reagieren kann, wird die Tür aufgerissen und ein gutaussehender Typ mit krausem blonden Haar eilt ins Zimmer. Sein Sohn Jakob. Ein vertrautes Gesicht. Er ist größer, als es über den Bildschirm aussah, und athletisch gebaut. Ich schätze sein Alter auf Anfang bis Mitte dreißig.
Damit ist er ein paar Jahre älter als ich, aber sein Lachen lässt ihn jünger wirken. Auf seiner braungebrannten Haut verteilt sich eine Vielzahl an Sommersprossen. Schon beim ersten Gespräch war er mir überaus sympathisch, und dieser Eindruck verstärkt sich gerade. Er zwinkert mir aus tiefgrünen Augen zu und schließt mich kurzerhand in die Arme. »Schön, dich endlich persönlich kennenzulernen, Juna.« Von so viel Herzlichkeit in der bestehenden Eiszeit zwischen seinem Vater und mir überrumpelt, nicke ich nur und erwidere die Umarmung. Obwohl wir nur einige E-Mails ausgetauscht und wenige Gespräche über Skype geführt haben, beruhigt mich seine Anwesenheit augenblicklich. Er verströmt eine gewisse Zuversicht und gibt mir ein wenig Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist.
»Na, wie läuft euer Gespräch?« Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Vater und Sohn bei der Arbeit jemals einen gemeinsamen Nenner erreichen. Sie scheinen grundverschieden.
»Ich weiß nicht«, sagt Herr Kruse und tippt auf seine Notizen. Jakob liest sie sich durch, während ich überlege, was ich sagen soll, bis ich beschließe, einfach still zu bleiben. Nachdem ich es geschafft habe, Paul Kruse bereits zu verärgern, sollte ich es mir nicht durch irgendwelche Aussagen auch noch mit Jakob verscherzen.
»Magst du uns kurz allein lassen?« Jakob sieht mich ernst an, aber ich kann den Schalk in seinen Augen sehen und frage mich, ob es überhaupt irgendetwas gibt, das ihn jemals daraus vertreiben kann.
Ich verlasse den Raum und setze mich auf eines der Sofas. Das Leder unter mir knarzt, während ich unruhig darauf herumrutsche. Nur wenige Augenblicke später kommt Jakob aus dem Büro und hält direkt auf mich zu, in der Hand einen Stapel Papiere, den er mir reicht. »Nimm den Vertrag mit. Lies ihn dir in Ruhe durch. Wir würden dich gern rückwirkend zum ersten September einstellen. Du sagtest, du könntest direkt anfangen, richtig?« Er grinst mich an und pustet sich eine Locke aus dem Gesicht.
Ungläubig starre ich auf die Vertragspapiere und nicke. »Darf ich fragen, wie du das angestellt hast?« Ganz im Gegensatz zu seinem Vater hat Jakob mir das Du nach geschlagenen zweiunddreißig Sekunden Skype-Unterhaltung angeboten. »Dein Vater schien kein großer Fan von mir zu sein.« Das ist die erste diplomatische Umschreibung, die heute über meine Lippen kommt.
Er nickt und tippt mit den Papieren an meine Schulter, damit ich sie ihm abnehme. »Du hast ziemlich dick aufgetragen. Mein Vater ist ein sehr geerdeter Typ. Und du solltest dir in Zukunft überlegen, wie du das Thema Größe umschiffst. Er ist da recht empfindlich. Das Team und ich betrachten es als moderne Form des Tabu-Spiels: Bringe den Alltag hinter dich ohne die Worte Größe, klein, winzig, mickerig und irgendeine Verniedlichungsform zu benutzen. Kann manchmal sehr lustig werden.« Er grinst mich an und entlockt mir ein Lachen. »Ich habe ihm gesagt, dass ich dich unbedingt fürs Team will. Dass du zu uns passt und dass du einfach extrem aufgeregt warst und noch mit dem Jetlag kämpfst. Vermutlich denkt er, du hättest eine fiese Tropenkrankheit. Auf jeden Fall hatte er Mitleid, und er ist mir noch einen Gefallen schuldig. Also hat er zugestimmt. Das bedeutet, wir sehen uns morgen.«
Ich reiche ihm als Zustimmung die Hand. Mir fällt ein Stein vom Herzen, und ich murmle ein tiefempfundenes »Danke«, während ich mich verabschiede. Jakob hat mich gerettet. Ich nehme die Papiere entgegen und verlasse das Hotel. Ich habe den Job wirklich bekommen. Ich könnte platzen vor Freude, auch wenn sich ein Funken schlechtes Gewissen dazu mischt. Denn ich habe Jakob und seinem Vater nicht gesagt, dass ich wieder gehen werde.
Ich kann nicht glauben, dass erst eine Stunde seit meinem überhasteten Aufbruch von zu Hause vergangen ist und tatsächlich ein Arbeitsvertrag in meiner Handtasche steckt.
Am liebsten würde ich meine Freundinnen in San Francisco anrufen und ihnen davon erzählen. Ich vermisse sie. Allison mit ihrer überschwänglichen Art und dem exorbitant hohen Verschleiß an gutaussehenden Typen, genauso wie Caitlyn, die eher schüchtern und ruhig ist. Auch wenn ihre Wirkung auf Männer nicht weniger durchschlagend ist, muss man bei ihr keine Angst haben, morgens mit einem halbnackten, tätowierten Typen im Bad unserer kleinen WG zusammenzustoßen.
Ein übergroßer Brocken Heimweh verstopft meine Brust, aber in San Francisco ist es jetzt mitten in der Nacht. Das heißt, ich störe Allie entweder bei heißem Sex oder ihrem Schönheitsschlaf. Beides ist keine gute Idee und schließt gleichzeitig auch Tante Caro als Gesprächspartnerin aus. Außerdem sollte ich den Besuch bei Merle nicht länger aufschieben, auch wenn ich Angst habe, unsere Freundschaft könnte so sehr auf Telefonate reduziert sein, dass uns ein echtes Treffen überfordern wird. Ihr von dem Vertrag zu erzählen dürfte zumindest ein guter Eisbrecher sein. Früher waren wir unzertrennlich, und dass der Kontakt in all den Jahren trotz unser beider Aversion gegen die sozialen Netzwerke nicht vollständig abgebrochen ist, zeigt, wie viel uns verbindet. Auch wenn wir uns durch die viele Arbeit, fehlende finanzielle Mittel und meine allgemeine Weigerung, nach Hause zurückzukehren, seitdem nicht mehr gesehen haben.
Von einem Bild, das sie mir mal per E-Mail geschickt hat, weiß ich, dass sie jetzt in einem alten Reetdachhaus im Zentrum von Wittdün wohnt. Mit knallroten Blumen davor. Natürlich sind die zu dieser Jahreszeit längst verblüht, aber auf dem Bild, das sie mir geschickt hat, gaben sie dem Haus ein Postkartenflair. Ich fahre mit dem Bus bis ins Zentrum und suche das Haus. Es ist leicht zu finden. Wesentlich leichter, als den Klingelknopf zu drücken, sobald ich davorstehe. Ich brauche vier Atemzüge, bis ich mich dazu durchringe. Eine Melodie, die an einen Walt-Disney-Film erinnert, hallt durch das Erdgeschoss. Kurz darauf sind Schritte zu hören und das Gebell von einem Hund, der sich anhört, als wäre er heiser.
»Sei still, du verrückter Köter.« Eine junge Frau mit langen, blonden Haaren und modischer, zurückhaltender Kleidung öffnet mir die Tür und hält einen unproportioniert wirkenden Dackel mit dem Bein davon ab, nach draußen zu entwischen.
»Ja?«
Es dauert einen Augenblick, bis mir klar wird, dass die Frau vor mir Merle ist. Sie sieht so erwachsen, angepasst und weiblich aus, dass ich erst mehrere Schubladen in meinem Kopf umsortieren muss, damit ich die Frau und meine chaotische Jugendfreundin übereinbringen kann. Wir haben uns beide verändert, und auch Merle braucht einen Augenblick, bevor ihr dämmert, wer da vor ihr steht. Als sie mich erkennt, gibt sie den Kampf mit dem Dackel auf, der die Gunst der Minute nutzt, an ihr vorbei und durch das Gartentor zischt und einen vorbeifahrenden Radfahrer attackiert. Merle sieht mich an, als wäre ich ein Gespenst.
»Hi«, sage ich leise und weiß, dass dieses eine Wort niemals ausreichen wird, um zu entschuldigen, dass ich Merle damals ohne eine Erklärung oder einen angemessenen Abschied verlassen habe und seitdem nicht ein einziges Mal zu Besuch gekommen bin oder die Sache per Mail angesprochen habe.
»Hi«, erwidert sie und löst sich langsam aus ihrer Schockstarre. »Was machst du hier? Ich meine … Juna … ich dachte, du bist in Amerika.« Früher wäre sie mir um den Hals gefallen, aber ich verstehe, dass sie zurückhaltend ist. Immerhin habe ich acht Jahre als beste Freundin pausiert.
»Was tust du auf Amrum?«, fragt sie unbeholfen und schließt mich dann doch kurz in ihre Arme. Die Berührung fühlt sich ungewohnt und eckig an.
»Ich bin zurück, schätze ich.«
Merle nickt. »Magst du reinkommen?« Auch wenn sie noch distanziert ist, blitzt echte Freude in ihren Augen auf.
Sie konnte noch nie länger als fünf Minuten nachtragend sein. Das macht sie zu einer denkbar unkritischen Person, aber auch zu einem wundervoll herzlichen Menschen, den ich vermisst habe.
Ich liebe sie, auch wenn uns Bosse verbindet und dieser Umstand wohl immer seine Schatten auf unsere Freundschaft werfen wird.
Merle sammelt den Dackel vom Gehweg ein und trägt das wild zappelnde Tier vor mir her in einen bunt chaotischen Eingangsbereich. Das Innere ihres Hauses passt besser zu der Merle, die ich in Erinnerung habe.
»Mama, Marie macht meine Legos kaputt!« Ein etwa sieben Jahre alter Junge steckt seinen Kopf durch den Türspalt der Wohnzimmertür und hält ein kleines Mädchen so zurück, wie Merle es zuvor mit dem hyperaktiven Dackel getan hat. Die Kleine brüllt, und eine wilde Rauferei beginnt.
Merle seufzt und zuckt entschuldigend mit den Schultern.
»Titus, lass deine Schwester in Ruhe und rück die Kekse wieder raus. Ich kann riechen, dass du deine Hosentaschen vollgestopft hast.« Merle baut sich zwischen mir und den Kindern auf. »Und Marie, hör bitte auf zu brüllen, sonst setze ich dich im Watt aus. Dann kannst du mit den Heulern um die Wette schreien.« Augenblicklich verstummt die Sirene und quetscht sich an ihrem abgelenkten Bruder vorbei.
»Das sind Titus und Marie.« Sie sieht mich an und streicht dabei das seidige Haar ihrer Tochter aus dem Gesicht und trocknet gleichzeitig ihre tränennassen Wangen. »Meine Kinder«, schiebt sie entschuldigend hinterher, und an die Kleinen gewandt. »Das ist meine Freundin Juna.«
»Die von dem Foto im Wohnzimmer?«
Merle nickt. Sie hat ihren Kindern von mir erzählt, ihnen Fotos gezeigt von uns. Sie ist Mutter, und sie lebt mit ihrer großen Liebe in einem wunderschönen Haus. Ich bin ein klitzekleines bisschen neidisch, aber vor allem freue ich mich für Merle.
»Du bist Mutter«, sage ich leise. Ich zeige auf die beiden kleinen Monster, die Merle das Glück so tief in den Körper pflanzen, dass es abfärbt. »Zwei Kinder.« Ich versuche beeindruckt zu klingen und nicht verletzt. Weil sie es mir verschwiegen hat. Weil Titus nur ein Jahr, maximal zwei, jünger ist als …
»Überraschung.« Sie grinst schief und beißt sich auf die Lippe. »Es tut mir leid. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dir davon zu erzählen, weil …«
Es ist klar warum. Trotzdem trifft mich das, was sie nicht in Worte fasst, genau wie die Tatsache, dass sie ihre Familie während der, zugegeben wenigen, Telefonate mit mir in den letzten Jahren vermutlich in die Abstellkammer gesperrt hat.
»Hör auf, dich zu entschuldigen. Sie sind toll und einfach süß«, sage ich betont leicht, obwohl es anstrengend ist, an dem Kloß in meiner Kehle vorbeizulächeln. Merle hätte mir von ihren Kindern erzählen sollen. Nicht nur, um mich besser vorzubereiten, sondern auch, weil ich gern für sie da gewesen wäre; während der Schwangerschaft und danach.
Ich hätte mit ihr Namen ausgesucht, wild diskutiert und nur für die skurrilsten Vorschläge abgestimmt. Es fühlt sich an, als hätten wir etwas Wichtiges unwiederbringlich verloren, weil sie mich schützen wollte und ich die Distanz so nötig hatte, dass ich zu wenig nachgebohrt habe.
»Das kannst du nur sagen, weil du sie nicht kennst«, brummt Merle mit einem Augenverdrehen. »Ich habe seit einer Ewigkeit nicht mehr durchgeschlafen, es ist immer laut, die Waschmaschine läuft permanent, und trotzdem liegt davor ein Mount Everest an schmutziger Wäsche, und wenn man in all dem Chaos tatsächlich mal Zeit für Sex findet, ist man zu müde.
Letztes Wochenende hatten Peer und ich kinderfrei und sind um neun auf dem Sofa eingeschlafen.« Sie sagt das, als wäre es furchtbar, dabei höre ich, wie sehr sie es liebt.
Mein Leben ist genauso reich, rede ich mir ein. San Francisco ist mein Zuhause. Ich habe Caro und meine Freundinnen. Sie sind meine Familie. Ich habe einen tollen Job, der auf mich wartet, sobald ich zurückkomme. Und doch ist es nicht dasselbe. Weil Teile von mir zersplittert auf dieser Insel liegen und ich hier wie dort nie ein ganzer Mensch war, bin oder sein werde.
»Wir können gern tauschen«, schiebt Merle hinterher und hebt dabei ein Paar dreckverkrustete Socken auf, die jemand unter die Treppe gefeuert hat.
»Würdest du nicht.«
Sie sieht mich an und lächelt. »Nein.« Ihr Gesichtsausdruck wird ernst. »Du hast recht, würde ich nicht.«
»Es ist schön, dich so glücklich zu sehen.« Die alte Merle hatte mehr Ecken und Kanten, als gut für sie war. Die neue Merle ist nicht mehr so. Nicht, weil sie jemand zurecht geschliffen hätte, sondern weil ihr das Leben die fehlenden Teile hinzugefügt hat.
»Dürfen wir hoch und einen Film ansehen, Mama?« Es ist klar, dass Titus genau weiß, es ist eigentlich zu früh für Fernsehen. Aber er ist schlau genug, eine Chance zu wittern, wenn sie sich ergibt.
»In Ordnung, ja verdammt, heute ist ein besonderer Tag. Juna ist endlich wieder zu Hause.« Ich höre, wie viel Überwindung es Merle kostet, das zu sagen. Nicht weil sie sich nicht freut, sondern weil sie noch zweifelt, ob sie mir verzeihen kann und ob es uns gelingen wird, die riesige Lücke zu schließen.
»Verdammt sagt man nicht«, sagt Titus und grinst dabei frech.
Merle sieht ihren Sohn drohend an. »Willst du Fernsehen oder mit mir diskutieren? Ich kann es mir auch ganz schnell anders überlegen. Und Titus?« Er hält auf der untersten Stufe inne, während Marie bereits nach oben klettert und dabei jede Stufe mit dem Eifer eines Reinhold Messners erklimmt.
»Die Kekse!« Merle hält auffordernd die Hand nach vorn, und Titus gibt sich geschlagen. Ohne weiteren Widerstand händigt er sechs runde Plätzchen aus und spurtet dann hinter seiner Schwester her.
»Er hat meine Intelligenz geerbt, aber leider auch meinen Appetit und Stoffwechsel. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich ein Schloss am Kühlschrank anbringen sollte.« Sie pustet sich ihre Haare aus der Stirn.
»Die langen Haare stehen dir gut.« Ich berühre die ungewohnte Frisur, die Merle weiblicher und erwachsener wirken lässt. Gezähmt irgendwie.
»Peer mag es. Ich gewöhne mich noch dran.« Sie führt mich in ein gemütliches, buntes Wohnzimmer.
»Du hast dich kaum verändert. Never change a running system, oder?« Sie grinst. »Immerhin hast du so schon früher reihenweise den Männern den Kopf verdreht.« Sie zuckt zusammen und verstummt. Da ist er wieder, der blinde Fleck. Der einzige Mann, der mich damals interessiert hat. Der, wegen dem mir meine Wirkung auf alle anderen egal war. Bosse droht Merles und meine Wiedervereinigung zu torpedieren.
Sie setzt sich auf ein breites hellgraues Sofa und klopft neben sich. Ich gleite neben sie und ziehe die Füße hoch, damit der Dackel nicht länger an mir herumschnuppern kann. Stattdessen verlegt er sich darauf, Merle um Leckerli anzubetteln, indem er sie mit einem penetranten Schmelz-Hundeblick anstarrt. Merle krault ihn gedankenverloren hinter den Ohren.
»Peer also, ja?«, durchbreche ich die Stille und entlocke ihr ein Nicken. Mir war immer klar, dass die beiden zusammengehören. Allerdings ist mein Instinkt in Bezug auf Liebe sonst nicht besonders vertrauenerweckend.
»Ich liebe ihn, obwohl ich mich langsam frage, ob ich einen Fehler begangen habe. Wir sind immer noch nicht verheiratet, und langsam denke ich, Peer wird mich nie fragen.« Sie zuckt mit den Schultern. »Er hat alles, was er will. Die Kinder, ein Haus, jeden Abend verunstaltetes Essen auf dem Tisch und meine Wenigkeit. Er hat keinen Grund mehr, mir einen Antrag zu machen. Ich hätte einen Trumpf in der Hand behalten sollen.« Sie grinst, und es ist klar, dass es sie zwar wurmt, aber nicht wirklich stört.
»Er hat dir ernsthaft keinen Ring an den Finger gesteckt?« Peer und sie sind schon ewig zusammen. Sie haben eine Familie gegründet, sind sesshaft geworden und haben einen Rauhaardackel. Alles Dinge, die ich ihnen weniger zugetraut habe, als zu heiraten. Peers und Merles Eltern führen seit einer Ewigkeit eine glückliche Ehe. Ich hätte gedacht, dass er sie längst vor den Altar gezerrt hat. Vorzugsweise auf einem Surfbrett am Strand von Hawaii. Das hätte zu ihnen gepasst.
»Du kennst ihn.« Sie spielt auf Peers Komme-ich-heute-nicht-komme-ich-morgen-Einstellung an, die sie schon zu Schulzeiten in den Wahnsinn getrieben hat, und grinst schief, als ihr klar wird, dass ich ihn eben nicht mehr kenne. Ich kannte den achtzehnjährigen Peer, der im Kopf gerade einmal fünfzehn war und ständig nur idiotische, schräge Ideen hatte, in die er Bosse und Magnus mit hineinzog.
»Du hättest ihm in den Hintern treten sollen«, sage ich trotzdem und fühle mich komisch dabei, einer Freundin nach so vielen Jahren Beziehungstipps zu geben. Noch dazu, wo ich nur Erfahrungen mit dem epischen Scheitern von Beziehungen habe.
Ohne darauf einzugehen, fragt sie: »Warum bist du hier?«
Ich könnte sagen, weil meine Beziehung mit Henry Lancaster nach drei Jahren an der Tatsache gescheitert ist, dass ich ihn nie wirklich geliebt habe. Weil die Visa-Behörde beschlossen hat, mein Studentenvisum nicht in ein Arbeitsvisum umzuwandeln, und ich dadurch keine Möglichkeit hatte zu bleiben. Ich müsste sagen, weil ich immer den Teil von mir gesucht habe, den ich damals auf der Insel zurückgelassen habe. Aber das tue ich nicht. »Weil das hier mein Zuhause ist«, sage ich stattdessen und meine es ganz ernst. Merle nickt, aber ich sehe die unausgesprochene Frage hinter dieser Geste, ob ich tatsächlich bleibe oder vorhabe, wieder zu gehen. Merle hat die Wahrheit verdient. Unsere Freundschaft braucht die Wahrheit.
»Ich bleibe aber nur für ein halbes Jahr«, sage ich gedämpft. Der Satz hängt zwischen uns und verbreitet eine unbehagliche Stille.
Merle zieht eine bunte Patchwork-Decke über ihre Beine und knibbelt an dem gesäumten Ende herum. »Ein halbes Jahr?«, fragt sie.
Ich nicke. »Mein Visum war abgelaufen, und ich warte darauf, ein neues beantragen zu können, um meinen Job in San Francisco anzutreten.« Ich halte den Atem an. Ich könnte verstehen, wenn Merle nicht bereit wäre, unsere Freundschaft unter diesen Umständen wiederzubeleben.
Aber Merle ist eben Merle. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge, und das ist so groß, dass sie keinen Platz für Negatives lässt.
»Dann bleiben uns also sechs Monate, um alles nachzuholen.« Sie sieht mich an, und ich lache, obwohl mir ein bisschen nach Heulen zumute ist.
»Ist deine Abreise verhandelbar?«
Ich schüttle den Kopf. »Ich denke nicht, aber ich werde sicher nicht noch einmal in so einer Nacht- und Nebelaktion abhauen. Ich komme zu Besuch, oder du setzt dich mit Peer und den Kids in ein Flugzeug und besuchst mich. Es wird diesmal anders sein.« Merle verzieht das Gesicht. »Peer in einem Flugzeug? Eher friert die Hölle zu, aber es ist schön, dass du nicht wieder ganz verschwindest.«
»Werde ich nicht. Versprochen. Und jetzt musst du mich auf den neuesten Stand bringen, in Ordnung?« Und dann lasse ich mir von Merle alles berichten, was in den letzten acht Jahren passiert ist. Hochzeiten, Todesfälle, Geburten. Lustige und schaurige Begebenheiten, den Klatsch, dessen Wahrheitsgehalt fraglich ist und gerade deswegen so viel Spaß macht. Es ist fast wie früher. Ich erzähle ihr von Caro, meinen Freundinnen, von Henry, der ein toller Mann, aber leider nicht mein Traummann ist, von San Francisco und dem Praktikum im Marriott Hotel. Wir bestaunen den gegenseitigen Werdegang, beneiden einander ein bisschen, besinnen uns auf die Dinge, die wir für kein Geld der Welt ändern wollen würden, und genießen es, wie jedes Wort die Kluft zwischen uns ein bisschen kleiner werden lässt. Nur ein Thema sparen wir sorgsam aus. Bosse.
Es ist mein erster Arbeitstag, und ich stehe an der Bushaltestelle. Der Versuch, mich in meinem Parka zu verkriechen, misslingt. Die Kälte sucht sich unbarmherzig ihren Weg unter den festen Stoff. Ich hüpfe von einem Bein aufs andere, aber wärmer wird mir dadurch nicht.
Noch zehn Minuten bis der Bus kommt. Morgen werde ich definitiv noch ein bisschen länger drinnen bleiben, und ich muss mir so schnell wie möglich einen Wagen kaufen. Der Sunshine-State Kalifornien hat mich temperaturtechnisch verweichlicht. Ich schlage die Hände vors Gesicht und puste warmen Atem in den schmalen Raum dazwischen, während ich auf- und abhopse.
»Hi, was machst du da?« Als ich durch die Finger spähe, sehe ich Teile einer schwarzen Karosserie, ein geöffnetes Wagenfenster und blonde Locken. Ich spreize die Finger weiter und sehe durch die Spalten Jakobs Grinsen. Auch wenn ich kein Interesse habe, entgeht mir nicht, dass er wirklich verteufelt gut aussieht.