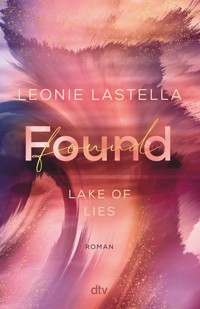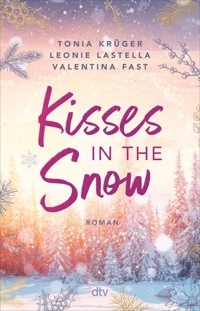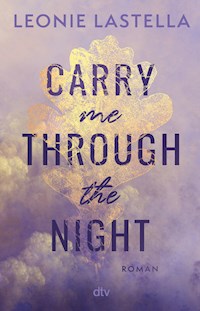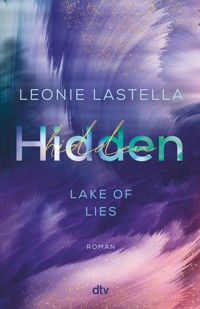
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lake of Lies
- Sprache: Deutsch
Via und Miles – zwischen Bedrohung und Begehren Nach dem plötzlichen Tod seiner Schwester fühlt Miles sich orientierungslos – und schuldig. Am idyllischen Lake Tahoe will er seine Trauer überwinden. Als er dort jedoch auf die geheimnisvolle und faszinierende Via trifft, ist sie es, die ihm neue Hoffnung gibt. In ihrer Gegenwart kann er seine Schuldgefühle vergessen und sich endlich wieder glücklich fühlen. Doch Via wirkt getrieben und panisch und scheint etwas zu verbergen. Was macht ihr solche Angst? Hat der Unfall ihres Ex-Freundes damit zu tun? Langsam beginnt Via sich Miles gegenüber zu öffnen. Denn auch er berührt etwas in ihr, bringt ihr Herz aus dem Takt. Aber dann überschlagen sich die Ereignisse und nicht nur Via, sondern auch Miles gerät in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Für die meisten ist der Lake Tahoe ein Sehnsuchtsort. Nicht für Via. Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund River, einem aufstrebenden Sportler, bricht ein Shitstorm über sie herein. Drohungen und Übergriffe bestimmen plötzlich ihr Leben. Die Hidden Woods Lodge am See wird zu ihrer Zuflucht. Aber die Ereignisse sitzen tief. Via traut niemandem mehr. Doch dann ist da Miles. Ihr Zimmernachbar, der es schafft, ihr Vertrauen zu gewinnen und mit der Zeit auch ihr Herz. Als allerdings ihr Ex River auftaucht und sie um Hilfe bittet, willigt Via ein – nichts ahnend, dass sie damit nicht nur sich selbst in Gefahr bringt, sondern auch Miles.
Nach dem plötzlichen Tod seiner Schwester fühlt Miles sich orientierungslos – und schuldig. Am Lake Tahoe, ihrem Lieblingsort, will er seine Trauer überwinden. Aber erst als er Via kennenlernt, geht es ihm endlich besser. Mit ihr kann er seine Schuldgefühle für einen Moment vergessen, sich wieder glücklich fühlen. Doch Via wirkt getrieben und panisch. Sie verbirgt etwas und Miles muss sich entscheiden, ob er das Risiko eingehen will, sein Herz an sie zu verlieren.
Von Leonie Lastella sind bei dtv außerdem lieferbar:
Das Licht von tausend Sternen
Wenn Liebe eine Farbe hätte
So leise wie ein Sommerregen
Carry me through the night
Seaside Hideaway – Unsafe
Seaside Hideaway – Unseen
Kisses in the Snow (zusammen mit Valentina Fast und Tonia Krüger)
Leonie Lastella
Lake of Lies
Band 1
Roman
Für alle, die den schwersten Schritt bereits getan haben und an sich selbst glauben
Via und Miles
Soundtrack
A Lot More Free * Max McNown
Carry You Through * Samuel Jack
London Boy * Taylor Swift
False Confidence * Noah Kahan
Good To Be * Mark Ambor
Coal * Dylan Gossett
Tourniquet * Zach Bryan
Me Without You * Havelin
When You’re Gone * Jon and Roy
Unhinged * Nick Jonas
Dancing On My Own * Callum Scott
Where’s My Love * SYML
How Do I Say Goodbye * Dean Lewis
Falling Like the Stars * James Arthur
Walked Through Hell * Anson Seabra
Stay * Rihanna, Mikky Ekko
Something in the Orange * Troy Ramey
Prolog
River war mein Lieblingsort. Ich hasse, hasse, hasse dieses bescheuerte »war«. Weil es Vergangenheit bedeutet. Und ich will nicht, dass wir vergangen sind. Doch niemanden scheint zu interessieren, wie ich das sehe. Es gibt uns nicht mehr.
Zittrig atme ich durch, den Rücken gegen die Mauer der Sac State Library gepresst. Die Steine sind rau und kalt. Mein Innerstes ein Froststern. Wie kann das sein? Was, verdammt noch mal, ist passiert?
Alles war gut. Wir haben uns geliebt. River war meine Zukunft. Nicht auf eine hormongesteuerte Ich-bilde-mir-ein-unsere-Highschoolliebe-hält-für-immer-und-mein-Herz-springt-aus-meiner-Brust-wann-immer-ich-dich-sehe-Weise. So etwas geht nur schief. Wir waren Freunde. Und irgendwann mehr. Wir waren echt. Immer füreinander da. Ab dem Moment, als River nach Sacramento zog. Und jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist falsch. So falsch, wie etwas nur falsch sein kann.
Für viele ist Riv der angehende Wakeboardprofi des Sacramento State Teams, Social-Media-Star, der Sunnyboy, loyaler Freund, bester Teamkollege, stets fair, gut drauf, sorgenfrei. Ich kenne ihn besser, weiß, wie hart er für dieses Leben gekämpft hat, mit sich gekämpft hat. Ich kenne ihn. Wie kann er das wegschmeißen? Uns wegschmeißen?
Mir ist schlecht. Auf die Art, bei der sich das Innerste nach außen stülpen will. Weil sich jede meiner Zellen gegen die neue Realität wehrt, sie abstößt. Ich atme dagegen an, gegen den Schwindel an, und beiße mir auf die Lippe, stoße mich von der Mauer ab, haste weiter, ignoriere das Getuschel der Leute, an denen ich vorbeilaufe. Ich sage nichts. Was denn auch? Sie haben ihr Urteil längst gefällt.
Dabei kennen sie uns nicht. River nicht und mich schon gar nicht. Sie wissen nichts. Ich starre auf meine Füße, auf die sonnenwarmen Steine darunter, laufe. Vor meiner eigenen Wut davon, die in meiner Brust sitzt und gegen meine Kehle hämmert, raus will.
Ich muss zum Wohnheim, mich verkriechen, bis die Welt wieder normal ist, nicht so abgrundtief verrückt und falsch. Verzweifelt versuche ich, nicht auf die Blicke zu achten, nicht auf die feindliche Stimmung oder die Nachrichten, die seit Rivers letztem Posting mit leisen Vibrationsstößen meinen Posteingang fluten. Versuche stark zu sein, aber ich hänge nur noch mit den Fingerspitzen an einem winzigen Felsvorsprung und jedes Beben könnte mich in den Abgrund stoßen.
Eigentlich hätte ich Kurse. Eigentlich bin ich nicht der Typ, der schwänzt. Aber eigentlich hat sich erledigt, seitdem River uns heute Morgen mit ein paar hingeworfenen Worten beendet hat. Einfach so. Als wäre es nichts. Und als hätte es nicht gereicht mein Leben mit ein paar Sätzen zu zerstören, musste er es noch durch den Mixer drehen. Sichergehen, dass nichts von uns übrig bleibt.
Ich drücke die Tür des Wohnheims auf, schleppe mich die Treppen hinauf. Drei Wochen lang habe ich um diesen Mistkerl gekämpft, wollte nach dem Unfall für ihn da sein. Zweiundzwanzig Tage, an denen er mich nicht sehen wollte und ich trotzdem jeden Tag ins Krankenhaus gegangen bin. Ich war so dumm. So verdammt dumm, weil ich mir eingeredet habe, sein Mich-von-sich-Stoßen wäre nichts Persönliches, nur eine verständliche Reaktion auf das, was ihm zugestoßen ist. Dass er Zeit bräuchte und alles wieder gut würde. Ich meine, die Verletzungen beenden nicht nur seine Karriere als Wakeboard-Profi. Der Unfall hat sein komplettes Selbstverständnis bis in die Grundfeste erschüttert. River hat seinen eigenen Wert schon immer über die Dinge bestimmt, die er leistet, nicht darüber, wer er ist. Das hat ganz sicher mit seiner Vergangenheit zu tun. Mit dem Teil seines Lebens vor seiner Adoption, von dem er mir nie erzählt hat. Der Teil seines Lebens, der dunkel und verborgen unter seinem Lachen und dem ganzen Erfolg immer da war, den er wie ein Panzer um sich herum aufgeschichtet hat.
Aber er brauchte keine Zeit. River liebt mich nicht mehr. Irgendwann in diesen zweiundzwanzig Tagen hat er einfach damit aufgehört. Und ich komme null damit klar. Das zeigen die heißen Tränen auf meinen Wangen. Das Nicht-atmen-Können. Die Wut auf ihn. Die Wut darüber, den Menschen verloren zu haben, der ich sein wollte und jetzt nicht mehr sein kann.
Liebe ist stark, aber manchmal nicht stark genug.
Ich will mir die Ohren zuhalten, aber Rivers Worte sind in meinem Kopf. Das würde also nichts bringen. Rein gar nichts. Ich würde sie trotzdem hören und wissen: Das war’s. Es gibt uns nicht mehr. Nie wieder. All die Pläne, die ich hatte. Weg. River hat sie mit den Buchstaben in seinem Posting ausradiert.
Via verdient jemanden, der ihr ein fucking gutes Leben bieten kann. Aber das bin nicht mehr ich. Kann es nicht mehr sein, so wie ich jetzt bin.
Es hat ihm nicht gereicht, mit mir Schluss zu machen. Er musste den halben Campus auf seine Seite ziehen, all seinen Fans vormachen, ich wäre schuld an dieser Herzbrechaktion. Ich hätte ihn verlassen, weil er vielleicht nie wieder gehen können wird und seine Karriere vorbei ist. Als wäre er nie mehr als ein Statussymbol für mich gewesen. Ein Accessoire, mit dem ich mich geschmückt habe, solange es vorzeigbar war. Wenn ich wirklich so wäre, würde ich mich auch hassen. Aber das bin ich nicht und ich würde auch niemals solche Nachrichten verfassen. Erst waren es nur ein paar negative Kommentare zwischen Tausenden Genesungswünschen unter Rivers Posting, aber dann … wurde es ein verdammter Schneeball, der auf mich zugerast kam, immer mehr Fahrt aufnahm, dabei größer wurde und tiefschwarz wie die Nacht.
Unter meinen alten Beiträgen stapeln sich jetzt Berge aus Hetze und Boshaftigkeit. Ich habe versucht die Kommentare zu löschen, aber es waren zu viele. Dann kamen hasserfüllte Nachrichten hinzu.
Nora meinte, dass es sich schon wieder geben würde. Ich sollte es ignorieren. Aber wie macht man das? Wie, wenn es immer schlimmer wird? Einfach nur immer schlimmer. Ich will nichts mehr als mich zusammenrollen und nie wieder aufstehen.
Mit wackligen Beinen erreiche ich meine Etage, schleppe mich zu meinem Zimmer. Keine Ahnung, wie lange ich mich noch aufrecht halten kann, bevor ich einfach umkippe. Und das darf auf keinen Fall in der Öffentlichkeit passieren. Wo es jeder sehen und sich das Maul darüber zerreißen kann. Ich nestle den Schlüssel aus meiner Tasche, will ihn ins Schloss stecken, aber … Da ist kein Schloss mehr. Ich starre auf das ausgefranste Holz. Auf den riesigen Splitter, der in einem grotesken Winkel absteht, und atme zitternd aus. Holzspäne bedecken den Boden wie frisch gefallene Schneeflocken. Ich starre sie an wie etwas Schönes. Dabei sind sie hässlich. So verdammt hässlich, dass sie mein Herz zusammenkrampfen. Ein schmaler Streifen Licht fällt durch den Spalt auf den Flur. Ich hebe die Hand, berühre die rote Farbe auf dem Türblatt. Sie ist nicht trocken, klebt an meiner Haut. Wie Blut.
Ich wische das Rot am Stoff meiner Hose ab. Zunächst wie in Trance, dann immer manischer, weil ich hoffe wieder Luft zu bekommen, wenn es nicht mehr an mir klebt. Tränen verwischen die Worte an der Tür. Aber nicht genug, um die Botschaft nicht zu sehen. Den Hass.
Stirb, du herzlose Schlampe!
Via
Der Busbahnhof von Tahoe City ist ein simples Gebäude aus Natursteinen, Glas und Holz. Neu und modern, aber winzig im Vergleich zu dem in Sacramento. Außer dem Amtrac-Bus, mit dem ich angekommen bin, steht nur noch ein privater Hotel Shuttle vor dem Haus. Die Sommersaison ist so gut wie vorüber. Die Wintersaison hat noch nicht begonnen. Neben einer älteren Dame und einem hochprofessionell ausgestatteten Radsportler bin ich der einzige Fahrgast, der aus dem Bus klettert.
Das Fahrzeug fährt wieder an, weiter Richtung Reno. Ich sehe ihm nach, während die Frau in den Wagen ihres Hotels steigt und der Radler auf sein Bike. Als ich mich wieder umdrehe, stehe ich allein auf dem Parkplatz. Und mit allein meine ich vollkommen allein. Nicht mal das Kassenhäuschen der Busstation ist besetzt. Na super. Wie komme ich denn jetzt bitte zu meinem Hotel? Warum habe ich nicht gefragt, ob mich der Shuttle mitnimmt? Weil ich dann hätte sprechen müssen und das hätte ich nicht hinbekommen. Nicht, ohne zu schreien.
Ratlos starre ich auf meine Tasche, überlege. Das Riesenteil kriege ich niemals bis zur Lodge geschleppt. Ich werde mir einfach ein Uber bestellen. Über die App. Da muss ich wenigstens nicht reden.
Ich öffne das Handy und stelle meine Anfrage. Einer der Fahrer kann in vier Minuten hier sein. Das ist schnell. Unerwartet schnell. Ich wähle die Fahrt aus und kurz hüpft ein Funken Freude über den Erfolg durch meine Brust, bevor die Dunkelheit ihn wieder verschlingt. Gefräßiges Dunkel. Mom und Dad meinten, es wäre gut herzukommen, endlich den Gutschein für den Aufenthalt am See einzulösen, den ich von ihnen vor über einem Jahr zum Highschool-Abschluss bekommen und bis jetzt nicht eingelöst habe. Ich war einfach zu beschäftigt. Mit der Uni, River, dem Leben.
River. Mein Herz schnaubt. Gut, dass ich hier bin. Weit weg von ihm. Und von der Presse. Ich will Dad schließlich nicht durch irgendeine unbedachte Handlung noch mehr schaden. Dad sagt es nicht, aber er hat ähnliche Sorgen, sonst hätte er nicht seinen Freund und Besitzer der Hidden Woods Lodge überredet mich aufzunehmen, obwohl sie gerade renovieren und eigentlich bis zur Wintersaison geschlossen haben.
Ich lege den Kopf in den Nacken, sehe in den azurblauen Himmel, atme den Geruch nach Pinien und Kräutern ein. Vögel zwitschern und irgendwo plätschert Wasser. Der See kann das nicht sein. Das Ufer ist zu weit entfernt. Vielleicht einer der vielen Wasserfälle, die sich von den Bergen in kleine Flüsse ergießen und schließlich in den See münden. Es ist friedlich. Viel friedlicher als in meinem Kopf. Oder meiner Brust.
»Hattest du ein Uber zur Hidden Woods Lodge gerufen?«, höre ich plötzlich eine Stimme hinter mir.
Ich nicke. Den Blick noch immer in den Himmel gerichtet. Das waren keine vier Minuten und ich wünschte, ich könnte die Wärme der Sonnenstrahlen und den Frieden dieses Moments, der in so krassem Gegensatz zu dem Scheiß der letzten Tage steht, noch ein wenig länger genießen. Aber dann hält mich der Fahrer sicher für durchgedreht und das will ich nicht – hier auch noch negativ auffallen. Also zwinge ich mich ihn anzusehen.
Vor mir steht ein junger Typ. Braune Haare. Ein bisschen zu zerwühlt, um noch als Frisur durchzugehen. Bluejeans, weißes Shirt, das eng an einem muskulösen Körper klebt, und darüber ein Baumwollhemd, das ein bisschen zu sehr Holzfäller schreit, um modisch zu sein. Ein lässiges Grinsen im Gesicht, als wäre ihm beides egal.
Ich hatte auf einen alten, Schnurrbart tragenden Kerl mit Klapphandy gehofft, der mit Social Media nichts am Hut hat. Aber, hey, seit wann ist das Leben schon ein Zuckerwatte-Kirmesbesuch?
»Wenn du noch fertig meditieren musst, ich habe es nicht eilig«, sagt er belustigt, stellt sich direkt neben mich und starrt in den Himmel, als müsste er dringend ausprobieren, was ich da bis eben getan habe. Seine Mundwinkel zucken.
Abwehrend sehe ich ihn an. Er ist mir zu nah. So nah, dass ich den schwachen Geruch nach Seife, Motorenöl und Holz wahrnehme, der in seinen Klamotten hängt. Er verarscht mich. Eindeutig. Früher hätte ich über so etwas gelacht. Aber das war früher. Bevor jeder von Rivers vier Millionen Followern wusste, wer ich bin und was ich angeblich getan habe. Bevor ich bei jedem Menschen, der in Rivers Zielgruppe passt, Angst haben musste, dass ich erkannt werde und ein Eimer Hass über mir ausgekippt wird. Und mein Uber-Fahrer ist leider der Posterboy eines River-Anhängers.
Die Situation könnte jeden Moment kippen. »Kannst du mich einfach nur in mein Hotel bringen, bitte?«, murmle ich leise und versuche neutral zu klingen. Neutral ist gut. Das ist weit entfernt von heftig und zerreißend und zu viel. Von einfach allem, was ihn nichts angeht. Niemanden, um genau zu sein.
Wortlos drehe ich mich um und will die Tasche nehmen, aber der Kerl ist schneller, hebt sie hoch und schiebt sie auf die Rückbank. Wahrscheinlich, weil der Kofferraum bis unter das Dach mit Zeug vollgestopft ist. Das Gepäckstück ist riesig, weil ich so gut wie alles aus meinem Zimmer eingepackt habe, und nimmt deswegen mehr als drei Viertel der Sitzfläche ein.
Sie haben die Zimmertür im Wohnheim zwar in Ordnung gebracht, aber das hat diese Wahnsinnigen beim letzten Mal auch nicht davon abgehalten, meine Privatsphäre und die Hälfte meiner Sachen zu zerstören. Ich drücke und quetsche, um genug Platz für mich neben der Reisetasche zu schaffen, und zucke zusammen, weil der Holzfäller-Typ plötzlich meinen Arm berührt. Sanft, aber fest. Und ich kann an nichts anderes denken, als dass dieser Griff jede Sekunde in Hass und Gewalt umschlagen könnte.
Auf meinem Handy befinden sich genug bildhafte Beschreibungen, was Rivers Follower mit mir anstellen wollen. Mein Herz schlägt hart gegen meine Rippen, aber der Typ lächelt nur. Sanft und irgendwie freundlich … was mich total irritiert. Hat er mich echt nicht erkannt? Ruckartig mache ich mich los und weiche einen Schritt zurück, um Abstand zwischen uns zu legen. Denn ganz sicher will ich ihm nicht nah sein, sollte sich das ändern.
»Hey«, sagt er mit einem Lächeln und hebt beschwichtigend die Hände. »Ich wollte dir nur anbieten, dass du vorn sitzen kannst. Nicht dass dich die Monstertasche frisst.«
Sehr ritterlich. Misstrauisch sehe ich ihn an, aber er zuckt nur die Schultern, öffnet die Beifahrertür und geht dann um den Wagen herum, bevor er auf den Fahrersitz klettert. Ich sehe zwischen dem gemütlich wirkenden Beifahrersitz und dem schmalen Streifen Sitzpolster, das die Tasche nicht bedeckt, hin und her. Was soll schon passieren, wenn ich mich nach vorn setze? Nichts, was nicht auch passieren könnte, wenn ich mich auf die Rückbank quetsche. Seufzend schlage ich die hintere Tür zu und lasse mich neben den Typen fallen.
Aber anstatt endlich anzufahren, dreht er sich auf dem Sitz zu mir um und mustert mich erwartungsvoll. Zu lange. Zu intensiv. Er hat braune Augen. Dunkelbraune, in die ich irgendwie hineinkippe. Als wären sie ein verdammter Abgrund.
Nervös streiche ich mir die Haare hinters Ohr und presse den Rucksack mit meinen Wertsachen an meine Brust. Was will er denn bloß? Mein Herz schlägt so laut, dass ich denke, er muss es hören.
»Und?«
»Was und?«, frage ich viel zu lautlos, um unbeteiligt zu wirken. Ich sollte der verfluchten Schwäche in meiner Stimme dringend etwas entgegensetzen. Unsere Blicke treffen sich und seiner kriecht mir unter die Haut. Intensiv, aber zugewandt und irritierenderweise … warm. Und ich bin so ausgehungert nach etwas zwischenmenschlicher Wärme, dass ich lächle. Echt jetzt? Und er … lächelt zurück. Nach all dem Hass der letzten Tage tut das so verdammt gut, dass ich heulen könnte. Ich presse die Kiefer zusammen. Zusammenreißen. Ich muss mich einfach nur zusammenreißen. Das sollte doch zu schaffen sein. Immerhin habe ich als Tochter eines Politikers ein ganzes Leben lang Übung darin. Ich bin quasi der Jedi der Selbstkontrolle.
»Also, ich bin Miles. Dein Fahrer«, stellt er sich vor. Seine Stimme ist tief und rau. Als hätte er gestern zu lang und zu ausgiebig gefeiert, aber irgendwie glaube ich, dass er immer so klingt. Er streicht sich die Haare aus der Stirn, streckt mir die Hand entgegen, wartet.
Ich will es nicht, ergreife sie aber zögerlich. Weil es das ist, was allgemein erwartet wird, und ich bin gut darin, Erwartungen zu erfüllen. Ich war gut darin. Da ist es wieder, das War. Ich hasse es echt. »Nett dich kennenzulernen, Miles.«
»Okay.« Er lacht. »So funktioniert das nicht, Olivia.«
Eis. Seine Worte verwandeln mein Blut in Eis, vertreiben den Anflug von Sicherheit, der kurz da war und jetzt weg. Er kennt meinen Namen. Ich wusste es. Natürlich ist ihm klar, wer ich bin, was passiert ist. Wie sollte es auch anders sein? Wahrscheinlich ist niemand in unserem Alter wohnhaft in der westlichen Hemisphäre um Rivers Post und den viralen Shitstorm herumgekommen, den er ausgelöst hat.
»Fangen wir einfach noch mal an«, sagt Miles amüsiert. »Ich bin Miles. Und du bist?«
Was soll das denn jetzt? Er weiß doch längst, wie ich heiße. Atmen. Ich muss nur atmen und so wenig Angriffsfläche bieten wie möglich. Dann gibt er vielleicht auf und fährt los. Oder ich steige besser aus, bevor das hier kippt. Aber in der Zeit, die ich brauche, um meine Tasche von der Rückbank zu hieven, schafft er es auf jeden Fall auch aus dem Auto. Soll ich ohne meine Sachen wegrennen? Wie gefährlich ist der Typ? Ich beiße die Kiefer so fest aufeinander, dass es wehtut.
Er schüttelt den Kopf. »Olivia, so steht es in deinem Uber-Profil, aber es passt null.« Er überlegt.
Entweder ist er ein echt guter Schauspieler, was ich bezweifle. Oder er kennt meinen Vornamen wirklich nur von meinem Profil. Nicht von einem Foto von mir mit Teufelshörnern und dem Satz darunter: Die Welt wäre besser dran, wenn du an seiner Stelle gegen die Kaimauer geklatscht wärst, Fotze.
»Oli«, probiert er eine mögliche Kurzform meines Namens aus und sieht mich erwartungsvoll an. »Nein«, verwirft er sie keine zwei Sekunden später, weil ich keine Reaktion zeige. »Passt auch nicht wirklich. Liv vielleicht?«
»Via«, murmle ich. Wieso sage ich ihm das? So hat River mich immer genannt. Alle haben mich so genannt. Nicht Fotze, Schlampe, Hure oder asoziales Miststück.
»Okay, Via.« Er sieht mich fest an und tippt gegen das Armaturenbrett vor sich. »Du musst wählen.«
Ich starre auf den Zettel, als hätte er mir vorgeschlagen, mit ihm ein Tieropfer zu bringen. Die Ränder sind schon etwas eingerissen und darauf steht: Welcome to Miles’ Uber Ride. Darunter sind die verschiedenen Möglichkeiten aufgelistet. Ich mache dich fertig, weil du eine kalte, berechnende Schlampe bist, ist nicht darunter und ich entspanne mich etwas.
»Wähl einfach einen aus«, fordert er mich auf, weil ich noch immer keinen Ton gesagt habe.
»Ich kann dir den Funny Ride empfehlen.« Er setzt sich wieder gerade hin und lässt die Fingerknöchel knacken. »Ich erzähle dir jede Menge mehr oder weniger gute Witze und als Kirsche obendrauf peinliche Anekdoten aus meinem Leben.«
Er macht sich nicht die Mühe zu verbergen, dass er denkt, ich hätte ein Lachen bitter nötig.
»Der Creepy Ride fällt weg, weil ich dich dafür im Rückspiegel anstarren müsste, während wir beide kein Wort miteinander wechseln, und da du vorn sitzt …« Ein Schulterzucken. »Die Seifenblasen sind zu empfehlen. Machen echt gute Laune, aber ist ’ne ziemliche Sauerei.« Er verzieht das Gesicht, lacht aber, als wäre es das trotzdem wert.
Das Geräusch lässt meine Mundwinkel zucken, als würden sie sich daran erinnern, wie es ist, wenn Seifenblasen ausreichen, um glücklich zu sein. Ich zwinge meinen Blick zurück auf das Armaturenbrett des Kombis.
»Oder du versuchst den Therapy Ride«, sagt er leise und so verdammt ernst, dass sich mein Innerstes anfühlt, als hätte ich dort eine Gänsehaut. »Du siehst aus, als könntest du jemanden brauchen, der zuhört. Ist eine meiner Stärken und manchmal gebe ich sogar ganz brauchbare Tipps.«
Sein Vorschlag trifft mich unvorbereitet, wirft mich ohne Vorwarnung in eine Erinnerung. An River, meine Freunde, die jetzt nicht mehr meine Freunde sind, weil sie zu ihm halten. Alle bis auf Nora. An meine Eltern, für die die Situation gerade in Dads Wahlkampfphase eine Katastrophe ist und die mir trotzdem nie Vorwürfe gemacht haben. Weil sie mich lieben. Was es irgendwie schlimmer macht. Tränen treten mir in die Augen, aber ich blinzle sie weg. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und ganz sicher will ich meinem Uber-Fahrer nicht erzählen, dass mein altes Leben nicht mehr existiert und das neue schlimmer ist als nach einer Zombie-Apokalypse.
Das Geräusch des Motors lässt mich zusammenzucken. »Okay.« Er nickt. »Der Awkward Ride soll es also sein, bei dem du das Menü ignorierst und wir uns die gesamte Fahrtzeit anschweigen. Gute Wahl.«
Da müsste Sarkasmus in seiner Stimme sein, Wut oder zumindest ein leichtes Genervtsein, aber sie klingt noch genau wie am Anfang unseres Gesprächs. Warm und entspannt. Wie eine Decke, in die man sich einschlingen will, um sich geborgen zu fühlen. Ist das echt mein verfluchter Ernst?
Er fährt los und erfüllt seine Rolle, aber das Schweigen ist nicht merkwürdig. Keine Ahnung, ob man tröstlich schweigen kann, aber wenn, tut Miles genau das. Und ich glaube, das ist besser als jeder Therapy Ride, besser als seine Ich-habe-zu-viel-gefeiert-warme-Decken-Stimme. Ich kuschle mich tief in den Sitz, sehe das Wasser des Sees zwischen den Pinien aufblitzen, höre den Countrysong im Radio und fühle dieselbe Art von Frieden wie eben auf dem Parkplatz. Einen wackligen Frieden, im Auto eines Fremden, aber ich klammere mich daran fest.
Doch viel zu bald lässt Miles den Wagen vor dem Hotel ausrollen. »Da wären wir.«
Ich kämpfe mich aus meiner zusammengesunkenen Haltung hoch und lege ihm zwanzig Dollar auf die Mittelkonsole. Das sind acht mehr, als per App vereinbart waren. »Stimmt so«, murmle ich und steige aus. Die Sonne tanzt baumgefiltert auf dem Kies vor der Lodge und wärmt meine Haut.
Miles lädt meine Tasche aus und deutet auf den Natursteinweg, der über einen mit Schiefer, Steinen und Pflanzen begrenzten Wasserlauf zum Eingang des Hotels führt. »Ich trag dir das Teil noch zum Zimmer«, bietet er an. »Der Laden wird eigentlich renoviert.«
Ich ignoriere die Frage, wieso ich trotzdem hier bin. Als einziger Gast in einem ansonsten geschlossenen Hotel.
»Deswegen haben die gerade niemanden, der das macht. Also …« Er zuckt die Schultern, als gäbe es keine Alternative, als sein Angebot anzunehmen.
Sehe ich echt so aus, als würde ich es nicht schaffen, meine eigene Tasche zu tragen? »Geht schon.« Ich packe die Griffe, aber Miles lässt nicht los.
»Sieh es als Teil des Service.« Er verzieht den Mund zu einem halben Grinsen. »Großzügiges Trinkgeld muss man sich verdienen.«
Es ist nicht nur eine Tasche, nicht nur eine Gefälligkeit. Wenn ich das zulasse, weiß er, wo ich wohne. Nicht nur, in welchem Hotel. Er wüsste, welches mein Zimmer ist. Bislang war er nett, aber das habe ich an der Uni von vielen Menschen gedacht, bis ihr Verhalten in Hass umschlug. Ich schließe die Augen, sehe Holzsplitter, rote Farbe, spüre die Angst. Auf keinen Fall. »Ich schaffe das allein«, wiederhole ich mich und reiße die Tasche mit einem Ruck an mich.
Miles lässt tatsächlich los und weicht etwas perplex zurück, während ich die losen Haarsträhnen hinter meine Ohren streiche und mich sammle. Seit Tagen ist er der Erste, der mich nicht wie den Antichristen persönlich behandelt hat, und was tue ich? Ich benehme mich wie die Bitch, als die mich alle sehen wollen. »Tut mir leid«, murmle ich. »Ich wollte nicht …« Egal was ich jetzt sage, ich mache es nicht besser. Also straffe ich den Rücken, murmle ein »Bye« und zerre die viel zu schwere Monstertasche hinter mir her zum Eingang der Lodge.
Miles
Ich reibe mir mit der Hand über den Nacken und sehe Via nach. Sie kämpft mit der Tasche. Oder das Monsterding mit ihr? Debatable. Hat auf jeden Fall etwas von den Naturdokumentationen auf dem Discovery Channel, die Hazel ständig geguckt hat.
Als ich sicher sein kann, dass sie es heil über den Fluss geschafft hat, steige ich zurück in den Wagen. Im Rückspiegel sehe ich, wie sie sich durch die Tür ins Innere des Hotels müht.
Ich hätte ihr geholfen, aber ich kenne mich mit sturen Frauen aus, die partout keine Hilfe wollen. Von niemandem. Haze war genauso. Mein Herz zuckt zurück, aber zu spät. Wie immer stoßen mich die Gedanken an sie in dieses Loch, aus dem ich es tagelang nicht hinausschaffen werde. Ladys und Gentlemen, willkommen in meinem Drecksleben. Ich fahre mir durch die Haare, atme. Zu schnell. Erinnere mich, obwohl ich nicht will. An die schlechten Dinge. Nicht an die guten. Weil das anscheinend nicht drin ist. Keine Ahnung. So funktioniert mein Hirn eben.
Hätte Hazel damals Hilfe angenommen, anstatt ihre verdammte Krankheit vor mir zu verbergen, hätte sie aufgehört diese Scheißjobs zu machen und mich das Geld verdienen lassen, würde sie heute vielleicht noch leben. Wir hätten uns nicht bis zuletzt über irgendwelche Scheiße gestritten. Wer dran war mit Toilette putzen. Oder Müll rausbringen. Ich hätte mich weniger wie ein verwöhnter Wichser aufgespielt, die Zeit anders genutzt, sie mehr wertgeschätzt.
Und ich hasse mich. Weil es dafür jetzt zu spät ist. Weil ich blind war. Ein ichbezogenes, blindes Arschloch. Hazel ist vor meinen Augen gestorben und ich habe es nicht einmal gemerkt.
Meine Finger kribbeln und für einen Moment denke ich, ich klappe zusammen. Einfach so hinter dem Lenkrad. Und ich denke, dass es vielleicht gut wäre. Endlich Ruhe, aber stattdessen ist mir einfach nur kotzübel und mein Körper fühlt sich an wie mein Leben. Kaputt und wie ein Haufen Scheiße.
Frustriert stoße ich die Luft aus und fahre das Fenster herunter. Nach wenigen Inches bleibt es stecken. Der Heber ist verreckt. Die nächste Sache, die ich reparieren muss. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich ans Wasser. Sonst platzt mein Herz, weil jeder Schlag mehr und mehr und mehr Schuldgefühle hineinpumpt.
Eigentlich müsste ich noch weitere Fahrten übernehmen, um einigermaßen mit der Kohle hinzukommen, aber stattdessen logge ich mich aus meinem Uber-Profil aus und halte an dem Aussichtspunkt über der Emerald Bay.
Im Sommer ist es hier brechend voll und die Autos stehen an der Straße den halben Pass hinauf. Heute parkt nur ein Jeep der Parkranger neben mir.
Ich mache mir nicht die Mühe, den Wagen abzuschließen, nachdem ich meinen erbärmlichen Hintern aus dem Auto geschafft habe. Niemand will die hässliche Rostlaube ohne funktionierende Fensterheber haben. Niemand außer mir. Denn der Wagen hat Hazel gehört. Also werde ich ihn fahren, bis ich ihn nicht mehr repariert bekomme. Dürfte eher früher als später so weit sein. Ich verliere dieses bescheuerte Auto. Stück für Stück. Genauso, wie ich Hazel verloren habe. Jeden Tag ein bisschen mehr. Bis nichts mehr übrig ist.
Den Anfang des Weges runter in die Bucht gehe ich noch, werde dann immer schneller, bis ich renne. So schnell, dass meine Lungen brennen und ich nicht mehr heulen muss.
Der Boden der Bucht ist mit feinem Sand und Kiefernnadeln bedeckt. Außer mir haben sich heute nur ein paar Streifenhörnchen an den Strand verirrt. Sie verfolgen mich neugierig, während ich zu der umgestürzten Jeffrey-Pine gehe, die am Rande der Bucht ins Wasser ragt. Liegt an den Touristen, die die Viecher füttern, obwohl es verboten ist. Aus Gründen, denn mittlerweile sind die Tiere so an den Menschen gewöhnt, dass sie sogar in Rucksäcke klettern.
Hazel fand es total wunderbar, wenn sich ein verflohter Nager durch ihre persönlichen Sachen gewühlt hat. Weil sie einfach allem etwas Gutes abgewinnen konnte. Und weil sie eine Schwäche für Tiere mit niedlichen Kulleraugen hatte. Ich klettere auf den Baumstamm und balanciere dann bis zur äußersten Spitze. Das hier war Hazels Lieblingsort.
Ich setze mich, atme schwer aus. In mir wird alles glatt. Ein bisschen wie die Oberfläche des Sees. Hier bin ich ihr nah. Hier ist sie nicht ganz so weit weg wie überall sonst auf der Welt. Wenn ich die Augen schließe, höre ich ihr Lachen, sehe das ausgelassene Blitzen in ihren Augen, höre sie schimpfen, weil ich sie mit dem eiskalten Wasser des Gebirgssees nass spritze. Seitdem ich das Haus aufgeben musste, ist dieser Ort der einzige, an dem ich mich an Hazel erinnern kann, ohne auseinanderzufallen. Hier vergesse ich sie nicht.
Aber das ist nicht der einzige Grund, aus dem ich am See feststecke. In Sacramento habe ich kein Zuhause mehr, mein bester Freund Riley ist weg. Versucht nicht für die verdammte Army draufzugehen. Hazel ist tot. Ich habe niemanden, zu dem ich gehen könnte, müsste im Auto pennen, bis ich mit etwas Glück ein Zimmer in einem der Wohnheime ergattern kann. Was wahrscheinlich Monate dauern würde, wenn es denn überhaupt klappt.
Hazel wollte, dass ich das Studium schaffe. Dafür ist sie gestorben und es zu pausieren fühlt sich widerlich an, nach Verrat. Aber ich kann nicht zurück. Nicht so. Nicht jetzt. Das packe ich einfach nicht.
Also bleibe ich, arbeite, versuche klarzukommen mit einem Leben minus Hazel. Unwillkürlich denke ich an Via. Via, die den See genauso dringend braucht wie ich. Denke ich. Sonst hätte sie nicht so fucking traurige Augen. Mehr Worte. Und nicht so verdammt viel Abwehr. Keine Ahnung, wieso ich ausgerechnet an sie denke. Wieso ich echt krass gern wissen will, was ihr zugestoßen ist.
Ich verziehe das Gesicht, weil ich genau weiß, was Hazel dazu sagen würde. Sie ist süß und genau dein Typ. Wenn du sie wiedersiehst, versau es nicht. Sie könnte dich endlich aus diesem Selbstmitleidsloch rausholen, Trauerkloß. Und dazu würde sie vollkommen übertrieben mit den Augenbrauen wackeln.
Ich vergrabe mein Gesicht in den Händen. Es liegt nicht daran, dass sie mein Typ ist. Ich kriege Via nur deswegen nicht aus meinem Kopf, weil mein beschissenes Helfersyndrom ungefähr ein Jahr zu spät kickt. Das ist falsch und total erbärmlich. Und ich bin auch nicht bereit aus dem verdammten Loch zu klettern, Schwesterherz. Vielleicht ist das der Inbegriff von armselig. Oder aber es ist das Schlauste, was ich tun kann, denn wenn ich anfange zu klettern, dann sollte ich das sicher nicht für einen Menschen tun, der an einem genauso dunklen Ort feststeckt wie ich.
Via
Zwei Tage bin ich jetzt schon am See. Zwei Tage, in denen ich es gerade so geschafft habe Mom und Dad anzurufen und ihnen Bescheid zu geben, dass ich heil angekommen bin. Es hat mich so viel Kraft gekostet, als wäre es ein verdammter Marathon gewesen.
Nora habe ich nur eine Nachricht geschrieben, dass ich sie liebe, weil sie als Einzige zu mir hält, aber dass ich im Moment gar nichts weiß und erst mal klarkommen muss. Und dass ich mich bei ihr melde, wenn ich so weit bin. Das war, bevor ich das Telefon ausgestellt habe. Nicht auf lautlos. Aus.
Seitdem habe ich nur im Bett gelegen, sämtliche Mahlzeiten ausfallen lassen, mich nicht geduscht oder auch nur umgezogen. Meine einzig erkennbare Leistung bestand darin, dass ich meine Netflix-Watchlist leer geschaut und ein komplettes Notizbuch vollgekritzelt habe, um nicht durchzudrehen. Kein erkennbares System. Nur Gedanken und Gefühle. Ungefiltert, damit ich atmen kann.
Meine Haare hängen mir strähnig ins Gesicht. Das Shirt trage ich seit zwei Tagen und ich stinke. Richtig schlimm. Richtig erbärmlich. Ich hasse mich gerade echt, weil ich mich so hängen lasse und nicht stark und souverän mit allem umgehe.
Stöhnend atme ich in das Kopfkissen, stemme mich hoch. Es ist bestimmt nicht besonders schlau rauszugehen, ohne etwas gegessen oder getrunken zu haben, aber ich kann auch nicht länger im Bett bleiben. Denn da läuft heute wieder das Blockbuster-Horrorkopfkino, starring mein verpfuschtes Leben.
Als ich wenig später mit nassen Haaren, frischen Jerseyshorts und einem schlichten weißen Top mit der Aufschrift So this ist love aus dem Bad komme, fällt mein Blick auf das Handy, das auf der Kommode liegt. Das Display starrt blind und schwarz zurück. Der Schriftzug meines Shirts spiegelt sich darin. Liebe. Ich verdrehe die Augen. Wenn das hier wirklich Liebe ist, will ich echt nichts mehr davon wissen.
Ich stopfe das Telefon unter meine Unterwäsche in der obersten Schublade der Kommode, ohne nachzusehen, ob River sich gemeldet hat, ob es ihm leidtut. Ich will es nicht wissen. Er hat uns zerbrochen. Das kann er nicht mehr zurücknehmen. Und erst recht will ich nicht wissen, wie viele Menschen mich hassen, weil sie denken, ich wäre diejenige gewesen, die unsere Beziehung beendet hat.
Seufzend zerre ich mir das Oberteil über den Kopf und tausche es gegen ein schlichtes schwarzes Shirt. Spiegelt meine Gemütslage deutlich besser. Die noch feuchten Haare binde ich zu einem unordentlichen Knoten zusammen und betrachte mich prüfend im Spiegel. Ein blasses Gesicht starrt mir entgegen. Stumpfe Augen. Die Haut darunter ist gerötet und Ringe zeichnen sich ab, aber zum Glück habe ich ja nicht vor unter Menschen zu gehen. Nur ein bisschen frische Luft.
Ich straffe die Schultern und verlasse mein Zimmer. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für die Post-River-Via.
Der Ausblick von meinem privaten Sonnendeck über den See schlägt Netflix um Längen, aber ich denke, es bräuchte fünf Seen und eine ganze Armee flauschiger Kätzchen mit übergroßen Kulleraugen, um meine Laune aus dem Monstertief zu zerren, in dem ich stecke.
Trotzdem raffe ich mich auf und laufe die wenigen Stufen von der Teakholz-Veranda vor meinem Zimmer zu dem etwas tiefer liegenden Pool hinab. Er ist ebenfalls von einer dunklen Holzterrasse eingefasst und fügt sich perfekt in die Natur ein. Als wäre das Hotel organisch in dieser Umgebung gewachsen und nicht von Menschen gebaut worden. Wie die Pinien, in denen Lichterketten hängen und die das Sonnenlicht in hellen Flecken auf das Holz werfen.
Ich finde den Zugang zum Hauptgebäude und auf Anhieb den Speisesaal, in dem ein einfaches Frühstücksbüfett für die Angestellten und Arbeiter aufgebaut ist, die das Hotel während der Schließung renovieren. Hier soll ich also essen. Keiner der Tische ist besetzt, was das Ganze irgendwie trostlos macht. Und da ich sowieso keinen Hunger habe, schnappe ich mir nur einen Apfel, den ich essen kann, sobald ich das Gefühl habe, wieder etwas runterzukriegen. Ich weiß, ich sollte etwas Richtiges essen, aber allein beim Gedanken daran dreht sich mir der Magen um. Dagegen ist das wacklige, leicht schwache Gefühl in meinen Beinen ein Klacks.
Das Wasser des winzigen Flusslaufs, der vor dem Hotel entlangläuft, gluckst unter mir, als ich aus der Tür trete. In den Bäumen zwitschern Vögel und die Äste geben das beruhigende Geräusch von sich bewegendem Holz von sich. Alles hier ist so friedlich, glättet die Anspannung in mir, dringt warm unter meine Haut.
Mit einem wohligen Seufzen laufe ich zum Parkplatz. Das erste Mal, seitdem River dieses bescheuerte Posting veröffentlicht hat, denke ich, irgendwann könnte vielleicht doch alles wieder gut werden, dass mir dieser Ort dabei helfen könnte, wieder ich zu sein. Genau wie Mom es mir prophezeit hat. Aber dann … erstarre ich mitten in der Bewegung.
Mein Nacken kribbelt, mein Puls beschleunigt sich. Ich atme so flach, dass mir schwindlig wird. Auf dem Parkplatz steht Miles’ Wagen. An fast genau derselben Stelle, an der er mich vorgestern rausgelassen hat. Das Hotel hat geschlossen. Dass er Gäste gefahren hat, kann ich also ausschließen. Und da mir kein anderer Grund einfällt, aus dem er hier sein könnte, bleibt nur einer und ich hasse ihn: Er muss herausgefunden haben, wer ich bin, und ist deswegen hier. Verdammt, das darf mich nicht so aus der Bahn werfen, mir nicht so viel Angst einjagen, dass ich unkontrolliert zittere.
Hastig sehe ich mich um, kann ihn aber nirgendwo entdecken. Vielleicht wartet er, dass ich einen der einsamen Wanderwege des Sees einschlage, sodass er mir allein auflauern kann.
Dir sollte man die Beine brechen, Miststück.
Mein Herz pocht viel zu laut. Ein brennender Druck baut sich in meiner Brust auf. Ich schließe die Augen, atme. Zu hektisch. Meine Reaktion ist überzogen. Ich drehe gerade durch, sonst würde ich mir nicht felsenfest einbilden, er hätte es auf mich abgesehen.
Und selbst wenn er deswegen hier wäre. Das ist nicht das verdammte Internet, wo sich jeder traut ungefiltert seinen Hass rauszubrüllen. Und Miles ist keine Meute aufgebrachter Fans, sondern ein einziger Mensch, dem ich etwas entgegensetzen kann, sollte er es wagen, einen blöden Spruch zu bringen. Und für den Fall, dass er mehr versuchen sollte, habe ich KO-Spray. Im Koffer in meinem Zimmer. Shit. Ich beiße mir auf die Lippen. Wenn ich irgendwann wieder ich sein will, muss ich mich auch wie mein altes Ich benehmen. Und die alte Via hätte sich gewehrt, ob nun mit oder ohne Spray. Mit Händen und Füßen. Zur Not auch mit den Zähnen.
Ich straffe die Schultern, verschlucke mich fast an … Ich hoffe, das ist Wut. Wut ist besser als Angst. Auch wenn sie watteweiche, grelle Punkte in mein Blickfeld malt. Ich schließe die Augen, schüttle den Kopf, als könnte ich so das leichte Gefühl in meinem Hirn einfach loswerden. Funktioniert nicht.
Ich kneife die Augen zusammen, blinzle, brauche einen Moment, um die Realität scharf zu stellen, und pralle fast an Miles’ Anblick zurück, der im selben Moment aus dem kleinen Wäldchen unter meinem Sonnendeck tritt, grüßt und zu seinem Wagen geht. Er lehnt sich gegen das Heck. Als wäre es sein angestammtes Recht hier aufzukreuzen und unter meinem Zimmer herumzuschleichen, als wäre es Zufall.
Er überkreuzt lässig die Beine, streckt das Gesicht der Sonne entgegen. Mit einer Hand trommelt er einen Rhythmus gegen die Karosserie. Mit der anderen tippt er auf seinem Telefon herum und grinst. Als wäre das verfluchte Internet ein Ort zum Lachen. Früher habe ich das auch gedacht. Bevor ich der verdammte Witz wurde.
Während ich auf ihn zulaufe, blicke ich mich um. Bis auf ein paar Streifenhörnchen, die über den sandigen Boden flitzen, sind wir allein. Kein Mensch sieht uns zu, sieht es, wenn ich die Fassung verliere.
»Was tust du hier?«, fahre ich ihn an. »In meinem Hotel?« Ich würde ihn am liebsten schubsen, aber das wäre ziemlich nutzlos, solange er an seinem Wagen lehnt und nicht umfallen kann. Und vielleicht auch übertrieben.
Außerdem sollte ich ihm wohl keinen Grund geben, der nächstbesten Zeitung ein Interview über die Tochter des amtierenden Stadtrats von Sacramento zu geben. Darüber, wie sie erst ihren unbequem gewordenen Freund im Stich lässt und dann gewalttätig gegen einen armen, hart arbeitenden Uber-Fahrer wird. Meine Sicht der Dinge spielt bei solchen Berichterstattungen keine Rolle.
Er sieht auf, stopft sich das Handy in die Hosentasche und runzelt die Stirn. »Dein Hotel?«, fragt er gedehnt.
»Mein Hotel«, bestätige ich und strecke das Kinn vor. »Ich wohne hier.«
Er nickt und lacht. »Ich weiß, ich habe dich hergefahren. Du erinnerst dich?«
Findet er das hier echt lustig? Ist ihm nicht klar, dass ich auch ein Mensch bin? Ein Mensch, der das alles nicht verdient hat? Egal wie viel Freude es ihm auch bereiten mag, mich zusammen mit all den anderen Idioten auf Social Media fertigzumachen, er sollte es mal mit Menschlichkeit versuchen. Mit Anstand, Respekt oder einfach etwas, das keinen Straftatbestand darstellt. Und da ist noch etwas. Nach vorgestern hatte ich gehofft, er wäre anders. Ich schlucke schwer. Wegen einer einzigen Autofahrt, auf der ich mich … geborgen gefühlt habe? Das ist echt wahnwitzig.
»Verschwinde!«, flüstere ich erstickt, sehe mich um, ob wir noch immer unbeobachtet sind. »Jetzt sofort.«
Er schüttelt den Kopf. »Nein.« Total lässig.
»Nein?« Mir ist schlecht. In meiner Vorstellung war das einfacher. Ich sage ihm, dass er abhauen soll, und er geht.
»Nope«, bestätigt er. »Geht leider nicht.«
Es geht nicht? Er will nur nicht. Und ich fühle mich, als wäre ich mit Volldampf gegen eine Wand gerast. Ich atme zu schnell, habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, und die Panik hebelt die Schwerkraft in meinem Kopf aus. Aber es ist nicht nur die Wut darüber, wie er mich auflaufen lässt, ich habe in den letzten Tagen kaum etwas gegessen oder getrunken und noch weniger geschlafen. War ja klar, dass sich meine Beine anfühlen wie poröses Zuckerrohr. Mein Kopf ist voll von Watte und Lichtblitzen. Bitte nicht. Körper, sei nett und gib nicht auf. Nicht hier. Nicht vor ihm.
Ich versuche das Flackern wegzublinzeln, aber es breitet sich aus, verschluckt mich. »Bitte, geh einfach!«, krächze ich, stolpere, suche ziellos mit den Händen nach etwas, an dem ich mich festhalten kann, erwische Metall, aber keinen Halt und dann sind da plötzlich Arme. Arme, die verhindern, dass ich auf den Boden krache. Und Miles’ Stimme, ganz dicht an meinem Ohr.
»Hey, was hast du? … Scheiße, warte … Ich.« Er klingt gar nicht verächtlich, sondern … irgendwie besorgt. Zu besorgt, dafür dass wir uns gar nicht kennen.
Ich blinzle gegen die Schatten an und sehe … direkt in seine dunklen Augen. Wunderschöne abgrundtiefe Augen, in die ich falle. Einfach, weil ich eh schon dabei bin.
Dabei gehören sie zu einem Typen, der hier ist, um mich fertigzumachen. Also, warum hält er mich? Wieso hat er mich nicht fallen lassen und das Ganze gefilmt? Das wäre sicher der Renner im Netz. Die gerechte Strafe für eine eiskalte Bitch wie mich.
»Es geht schon wieder«, flüstere ich leise, winde mich zittrig aus seinen Armen, aber sobald er mich nicht mehr stützt, knicken meine Beine erneut weg. Muss mich mein verfluchter Körper ausgerechnet jetzt so jämmerlich im Stich lassen? Ich erwarte ja nicht, dass er noch zu einem Halbmarathon fähig ist, aber er könnte ja wenigstens so gnädig sein, dass ich es bis zurück in mein Zimmer schaffe.
»Scheiße, das reicht, ich bringe dich hoch.« Miles schlingt einen Arm um meine Mitte. Ein starker Arm, der sich warm gegen meine Haut presst und meine überreizten Nervenenden vibrieren lässt. Ich bin so durch. Und er?
Er klingt gestresst. Wahrscheinlich hatte er sich das so nicht vorgestellt. Jemanden online fertigzumachen ist schön anonym. Aber jetzt sieht er ganz real, was es mit mir macht, sieht, wie fertig ich bin, und auch wenn ich mich ihm lieber nicht so verletzlich gezeigt hätte, denkt ein trotziger Teil von mir, gut so. Soll er doch sehen, was passiert, wenn man so was mit einem Menschen macht.
»Oder vielleicht fahre ich dich besser zu einem Arzt«, sagt er in diesem Moment und nickt, als wäre es der beste Einfall ever.
Ist es nicht. Denn in dem Fall werden meine Eltern von der Versicherung unterrichtet, dass ich zusammengeklappt bin, und wenn es eins gibt, was ich noch weniger will, als schutzlos in meinem Zimmer zu liegen, während Miles um mein Hotel schleicht, ist es, dass meine Eltern sich noch mehr Sorgen um mich machen. Außerdem kann kein Arzt dieser Welt wieder hinbiegen, was passiert ist.
»Auf keinen Fall«, stoße ich hervor. »Ich will auf mein Zimmer.« Ohne seine Hilfe. Weil es ihn zum Teufel noch mal nichts angeht, welches der vielen Zimmer meins ist. Aber bevor ich mir überlegen kann, wie ich das Ganze so nachdrücklich und beleidigungsfrei formulieren kann, dass selbst Dads Pressechef David Parker es abnicken würde, hebt Miles mich bereits hoch.
»Lass mich runter«, protestiere ich und klopfe gegen seine Brust, aber er rennt einfach los. Als würde er sich in einem Tunnel befinden und mich gar nicht wahrnehmen. »Lass mich, verflucht noch mal, sofort runter«, fahre ich ihn an und stemme mich gegen seinen Oberkörper.
Endlich reagiert er, aber nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. »Du bist mich los, sobald ich dich irgendwo abgesetzt habe, wo du nicht mehr umkippen kannst.« Und dieser Plan scheint in seiner Welt nicht diskutabel zu sein. Wahrscheinlich ist ihm entgangen, dass es hierbei um mich geht und nicht um einen Sack Reis, über den er einfach bestimmen kann. Das ist so … grenzüberschreitend, anmaßend, aber auch … fürsorglich, dass es fast süß ist. Hallo, was genau stimmt denn nicht mit mir? Erde an Via. Er tut das nicht für mich, sondern um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ich sollte ihm die Hölle heißmachen, aber … ich bin so verdammt fertig, dass ich einfach gar nichts tue.
Miles erreicht den Poolbereich, setzt mich aber nicht auf einer der Liegen ab, sondern steigt zielsicher die Stufen zu meinem Zimmer hinauf. Er weiß, wo ich wohne. Oh mein Gott, definitiv nicht fürsorglich und ganz sicher nicht süß. Er hat mir tatsächlich nachspioniert.
»Warte hier«, murmelt er, lädt mich auf einem der Deckchairs vor dem Zimmer ab und entfernt sich.
Keine Ahnung, wieso er annimmt, ich würde auf ihn hören. Ich sollte in mein Zimmer kriechen und die Tür abschließen, solange er beschäftigt ist. So viel Distanz zwischen uns legen wie möglich, mich in Sicherheit bringen und Hilfe rufen. Aber mein Hirn kriegt es nicht hin, kriegt einfach gar nichts hin.
Vorsichtig drehe ich den Kopf, um zu sehen, was er hinter mir tut. Schwarze Flecken tanzen durch mein Sichtfeld, aber ich sehe genug, um sicher zu sein, dass er sich an der Tür des Nachbarzimmers zu schaffen macht. Er überwindet den Türmechanismus und verschwindet im Inneren. Was wohl im Allgemeinen unter Einbruch läuft. Und bedeutet, dass auch meine Tür kein Hindernis für ihn darstellen dürfte. Mich dahinter zu verstecken ist also zwecklos. In der Lobby ist niemand, aber irgendwo in dem Wäldchen neben der Lodge höre ich leisen Baustellenlärm. Da müssten also Menschen sein. Wenn ich es bis zu ihnen schaffe, könnte ich die Polizei rufen. Und ihnen was sagen? Dass Miles mir eine Cola und zwei Proteinriegel gebracht hat. Denn genau das hält er mir im nächsten Moment unter die Nase. Das ist nett, kein Straftatbestand.
»Okay, das sollte helfen, wenn es nur ein zu niedriger Blutzuckerspiegel ist.« Klingt, als würde er das nicht glauben und als würde es ihm etwas ausmachen, wenn mir ernsthaft etwas fehlen würde. Mit einem gequälten Gesichtsausdruck lässt er sich auf den Stuhl neben mir fallen und atmet geräuschvoll aus. So als hätte er, seitdem ich zusammengebrochen bin, die Luft angehalten. Er reibt sich über den Nacken, sieht, dass ich noch immer bewegungslos dasitze. »Kannst du das, verdammt noch mal, bitte trinken?«, fragt er und schenkt mir ein angestrengtes Viertellächeln.
Ich sehe von ihm zu der Cola in meiner Hand und schraube schließlich die Flasche auf. Nicht weil ich auf ihn höre, sondern weil er recht hat. Ich muss etwas trinken. Flüssigkeit, Zucker. Das wird hoffentlich helfen.
Mit winzigen Schlucken leere ich gut ein Viertel der Flasche und spüre, wie sich der Zucker in meinem System ausbreitet. Der Schwindel wird weniger und die schwarzen Flecken verschwinden.
Miles beobachtet jede meiner Bewegungen.
»Geht es dir besser?« Seine Frage wirkt so normal. Unendlich normal.
»Warum bist du nett zu mir?«
»Ähm, warum sollte ich nicht nett zu dir sein?« Er runzelt die Stirn. »Außerdem hat es nichts mit Nettigkeit zu tun. Wenn ich dich ohnmächtig auf dem Parkplatz liegenlasse, läuft das im Allgemeinen unter unterlassener Hilfeleistung. Passiert dir das öfter?« Zwischen den letzten beiden Sätzen macht er keine Pause. Das erste Mal seitdem er sich gesetzt hat, wendet er den Blick ab.
Ich schüttle den Kopf. Nur wenn ich mich auf leeren Magen verfolgt fühle, nachdem ich Morddrohungen bekommen habe. Ich atme durch, formuliere um. »Du hast mich nur erschreckt«, sage ich und wette, David Parker wäre stolz auf mich. Keine Emotion, kein vorwurfsvoller Unterton, geradezu nett. Ich hasse es, nett zu solchen … mir fällt leider kein David-Parker-Wort für Arschlöcher ein, zu sein.
Miles hebt eine Augenbraue. »Ich erschrecke dich, weil ich neben meinem Auto stehe?«
»Es geht nicht darum, dass du neben deinem Auto stehst«, erwidere ich genervt, »sondern darum, dass du es auf diesem Parkplatz tust, vor meinem Hotel.« Ich denke, ich kann mich aufsetzen, ohne Miles noch mal vor die Füße zu kippen, und rapple mich mühsam hoch.
Er sieht nicht aus, als würde er verstehen, worauf ich hinauswill. »Können wir bitte aufhören, so zu tun, als wüssten wir beide nicht, warum du hier bist?«, frage ich langsam echt wütend. »Als wüsstest du nicht, wovon ich rede oder wer ich bin?«
Er verschränkt die Arme vor der Brust. »Keine Ahnung, für wen du mich hältst«, sagt er amüsiert. »Ich kenne so ungefähr fünfeinhalb Menschen auf dem ganzen Planeten.« Er hebt die Hände. »Ich finde das absolut ausreichend. Aber du gehörst nicht zu diesem Kreis. Wenn du also ’ne große Nummer auf Social Media oder die Tochter von irgendeinem VIP bist, tut es mir leid, ich …« Er zuckt die Schultern. »… kenne dich nicht. Kann mit so was nichts anfangen.«
Wenn das stimmt, dann …? »Was machst du dann hier? Ausgerechnet hier vor meinem Hotel?«
Er lacht leise und seine Augen blitzen. »Du denkst echt, ich wäre wegen dir hier? Das ist so was von … wow.«
Eingebildet? Egozentrisch? Paranoid? Vielleicht. Oder aber realistisch, vorsichtig, wachsam. Also halte ich seinem Blick stand.
»Okay, also gut, du willst echt eine Erklärung«, gibt er mit einem dunklen, leicht spöttischen Lachen nach. »Kannst du haben. Ich wohne hier.« Er zeigt über die Schulter zu der halb offen stehenden Tür.
»Und ich kann die Nationalhymne rückwärts singen«, entgegne ich, ohne darüber nachzudenken, was David Parker dazu sagen würde. Ich meine, das soll ich ihm glauben? Er fährt einen ziemlich ramponierten Kombi, jobbt als Uber-Fahrer und chauffiert sein gesamtes Zeug im Kofferraum herum. Man muss kein Genie sein, um sich auszurechnen, dass er sich die Zimmerpreise der Lodge nicht leisten kann.
»Du glaubst mir nicht«, stellt er seufzend fest.
Der Kandidat hat hundert Punkte. Ich verschränke die Arme vor der Brust.
»Fair enough.« Er schiebt den Unterkiefer vor. »Ein Zimmer in diesem Bunker kostet unter uns gesagt unverschämt viel Geld. Geld, das ich nicht habe, und hätte ich es, würde ich es vermutlich besser investieren. Aber wie du vielleicht mitbekommen hast, wird die Lodge renoviert.«
Ich nicke.
»Deswegen bin ich hier.« Er macht eine Verbeugung. »Der Juniorchef hat gerade ziemlich viel mit seinem anderen Hotel in South Lake Tahoe zu tun und kann selbst nur selten ein Auge auf die Arbeiten hier haben. Normalerweise wohnen die Angestellten in den Cabins weiter oben Richtung Straße.« Er deutet auf das kleine Wäldchen, das sich neben uns bis an den Highway erstreckt. »Aber auch die werden gerade renoviert. Die meisten Mitarbeiter haben deswegen frei und die wenigen, die hier sind, dürfen ein bisschen Luxus schnuppern.«
Das klingt plausibel, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt. »Als was genau arbeitest du?«
Seine Mundwinkel zucken. »So wenig Vertrauen.« Dann wird er wieder ernst. »Ich mache die Bauaufsicht. Und repariere, was kaputtgeht. Der Job ist nichts Besonderes, aber gerade genau richtig.« Seine Kiefer zermahlen die Lässigkeit.
Und ich ertappe mich dabei, dass ich mich für den Moment nicht auf mein eigenes Drama konzentriere, sondern wissen will, warum er plötzlich so angegriffen aussieht. Warum er sich hier versteckt. »Du bist also wirklich nicht wegen mir hier?«
»Nope, Sad Eyes.« Er streckt sich auf dem Deckchair aus, als wäre es vollkommen normal, dass er mir einen Spitznamen gibt und innerhalb von fünf Minuten erfasst hat, wie es mir geht. Wirklich geht. Er hat die Augen geschlossen. »Aber so wie es aussieht, sind wir vorerst Nachbarn.«
Miles
Der chromglänzende, schweineteure, sehr edel wirkende, aber sterben wollende Kaffeevollautomat aus dem Frühstücksraum liegt in Einzelteilen um mich herum auf dem Holzboden des Sonnendecks. Seitdem Via in ihrem Zimmer verschwunden ist, habe ich mich bis zur Antriebswelle der Brühvorrichtung vorgearbeitet. Die Sonne knallt von einem azurblauen Himmel und ich schwitze. So kalt die Nächte bereits sind, tagsüber hat der Herbst eine Identitätskrise und hält sich für kotzheißen August. Der Pool ist nur wenige Schritte entfernt, die Außenduschen auch. Ich müsste nur aufhören die Kaffeemaschine besiegen zu wollen und könnte mich abkühlen, aber dann würde ich aufhören zu arbeiten. Und das ist ein Problem. Denn das Mistding zu reparieren ist das Einzige, was meinen Kopf davon abhält zu denken. An Hazel. An Via. Via mit den feinen Sommersprossen auf viel zu blasser Haut. Mit den roten Locken, die wild und irgendwie unzähmbar sind und scheinbar das Einzige an ihr, was unkontrolliert ist. Via, die so schwach in meinen Armen lag wie Hazel. Kurz vor ihrem Tod.
Greller Schmerz wirft mich zurück. Fuck, und schon geht es wieder los. Ich presse die Handflächen gegen das warme Holz, gegen meine geschlossenen Augenlider. Als könnte das die Bilder aufhalten, die Schuld kleiner machen. Sie schmeckt wie Kotze. Fühlt sich an wie Fieber. Nicht so normales, sondern irgendein richtig fieses. Denguefieber, vielleicht. So ist Trauer. Eine verdammte Rasierklinge, die sich durch meine Brust arbeitet.
Ich schraube die Antriebswelle aus, weil das vielleicht verhindert, dass es mich komplett zerlegt, ersetze sie durch das Teil, das ich Alex, der diesen Bunker für seinen Dad managt, in weiser Voraussicht habe bestellen lassen. Hinter mir öffnet sich Vias Tür und obwohl ich gerade die Welle zwischen Thermoblock und Brühgruppe reinfummle, sehe ich auf. Sehe hin. Kann nicht nicht bemerken, dass sie nur kurze Jeans trägt. Verdammt kurze. Weil ich auf dem Boden hocke und sich meine Augen nun mal genau auf Höhe ihrer nackten Schenkel befinden. Der Anblick ist definitiv effektiver als die Arbeit an der Antriebswelle.
»Morgen, Sad Eyes«, murmle ich, aber es kommt kein »Guten Morgen« zurück, nur ein …
»Verf…« Sie bricht ab, schiebt dann ein gequetscht kontrolliertes »Verflucht noch mal« hinterher und hüpft auf einem Bein an mir vorbei zu den Deckchairs. »Was zum … Was ist das hier?«, presst sie durch zusammengebissene Zähne, deutet mit dem Kopf auf das Chaos, das um mich herum herrscht und sich genau vor ihrer Zimmertür befindet.
»Eine Kaffeemaschine«, antworte ich lahm. Die ich ganz sicher nicht hier auseinanderbauen hätte dürfen, wo sie sich als Gast an den Einzelteilen verletzen könnte. Wenn sie das meldet, bin ich meinen Job los. Normalerweise erledige ich solche Arbeiten in der winzigen Werkstatt neben den Angestelltenunterkünften im Wald oder in meinem Zimmer. Heute nicht und ich kann tausend krass logische Erklärungen finden, wieso ich hier bin. So was wie ›das Hotel ist geschlossen und ich dachte, deswegen wäre es okay‹. Oder ›der Vollautomat wiegt eine halbe Tonne und wer hat schon Lust, so ein Monsterding in die Werkstatt zu schleppen?‹. Oder ›in meinem Zimmer war einfach kein Platz, weil bereits jeder Inch voll mit der zerlegten Klimaanlage aus Zimmer Sechs ist‹.
Aber das ist alles Bullshit. Ich hatte einfach das völlig unpassende Bedürfnis, hier zu sein, sollte Via Hilfe brauchen. Und ich kapiere echt nicht, wo das herkommt. Vielleicht stimmt was ernsthaft nicht mit meinem Kopf.
Alex würde einen Anfall bekommen, wenn er wüsste, dass ich dreckige Maschinen in einem seiner heiligen Zimmer zerlege. Und wenn er das hier sehen könnte, würde er mich vermutlich anbrüllen. Würde ich ihm stecken, dass Via der Grund ist, wäre ich auf jeden Fall gefeuert.
Alex ist nur ein paar Jahre älter als ich und leitet die Lodge und einen Hochhaus-Casino-Albtraum in South Lake Tahoe, der kurz vor der Eröffnung steht. Er hat mir diese Arbeit nur gegeben, weil ihm sein Hausmeister, der die Bauaufsicht machen sollte, zwei Tage vor Beginn der Renovierungen gekündigt hat, gerade als ich in die Lodge gestolpert kam und sowohl den Job als auch das Dach über dem Kopf bitter nötig hatte. Wem mache ich etwas vor? Er hätte jederzeit auch jemand anderen gefunden und er hat schon Menschen gekündigt, die schlechter aufgestellt waren als ich. Der einzige Grund, aus dem er mich eingestellt hat, ist Hazel. Alex mochte sie. Keine Ahnung, ob er es ihr je gesagt hat oder was da lief, aber die Art, wie er das jedes Mal betont, wenn er mich sieht, lässt keinen Zweifel zu, mich mag er nicht. Wahrscheinlich ist er der Einzige, der kapiert hat, dass ich sie auf dem Gewissen habe.
»Und du denkst ernsthaft, du könntest das reparieren?«, fragt Via jetzt und sieht zweifelnd zwischen mir und den Einzelteilen hin und her. »Dad kriegt auch immer so Anfälle.«
»Ich bin Maschinenbaustudent, also ja, ich denke, die Chancen stehen gut.« Ich lächle, lasse zu, dass mich das Gespräch mit ihr von den Erinnerungen an Hazel wegtreibt. Erinnerungen, die wie ein Scheißrhinozeros auf meiner Brust hocken. »Dein Dad schlägt sich nicht so gut?«
»Er ist Politiker.«
Mehr sagt sie nicht, zieht aber ihre Nase kraus, was wohl Antwort genug ist. Ist wohl auch besser mit Worten als mit Händen.
»Das Chaos tut mir echt leid. Eigentlich haben wir geschlossen und ich hatte es nicht mehr auf der Platte, dass du angereist bist.« Ich deute auf ihre Tür. Wer’s glaubt, wird selig. Als könnte ich vergessen, dass sie jetzt neben mir wohnt. »Tut es sehr weh?«
»Nein.« Sie sieht mich herausfordernd an. So als würde sie mir am liebsten etwas Fieses an den Kopf werfen, weil es in echt sauwehtut. Ihr Kinn zittert, aber sie zwingt sich zu einem Lächeln. »Schon okay.«
Ich rapple mich auf, will verstehen, warum sie nicht einfach rauslässt, was sie denkt. »Kann es sein, dass hinter dem ›Ist schon okay‹ ganz schön viel Schmerz steckt?«, frage ich scherzhaft, meine ihren Fuß, aber sie lächelt nicht. Kein Stück. Ihre Gesichtszüge verschließen sich. Ihre ganze Körperspannung verändert sich und, fuck, erst jetzt wird mir bewusst, wie blöd der Spruch ist. Natürlich denkt sie nicht an ihren Fuß. Irgendwas oder irgendjemand muss ihr Leben aus den Angeln gehoben haben und ich Idiot musste sie daran erinnern. Ausgerechnet ich. Als wüsste ich nicht, wie scheiße das ist. Ich fahre mir durch die Haare. »Sorry, das war … Kann ich dir etwas zum Kühlen holen? Wäre das Mindeste.«
»Nicht nötig.« Sie steht auf, will gehen. Wahrscheinlich an einen ruhigen Ort, von dem aus sie Victor Reyes, Alex’ Dad, anrufen kann, um sich über mich zu beschweren.
»Hey.« Ich halte sie am Arm zurück, lasse aber sofort los, als ich ihren Blick bemerke. Angsterstarrt wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich gehe auf Abstand, obwohl ich sie lieber in meine Arme ziehen und gutmachen würde, was irgendein Arschloch ganz offensichtlich verkackt hat. Keine Ahnung, ob sie wirklich eine Beziehungskrise hat oder ganz andere Probleme. Sollte auch nicht meine verfluchte Sorge sein. Ich bin derzeit echt nicht in der Verfassung, mich mit den Katastrophen anderer Menschen rumzuschlagen, aber ich muss sie davon abhalten, dass sie mich feuern lässt. »Könntest du das hier vielleicht für dich behalten? Der Tag ist schon scheiße genug und ich brauche den Job«, murmle ich. Was ihr herzlich egal sein dürfte. »Bis du zurück bist, habe ich den Kram weggeräumt und ich verspreche, so was wird nicht wieder vorkommen.«
Sie sieht mich zweifelnd an, nickt aber. »Okay.«
Keine Ahnung, ob ich ihr glauben kann. Aber das muss ich, denn sie dreht sich steif um, geht zu einer der Teakliegen, streift sich Hose und Shirt ab und springt mit einem eleganten Kopfsprung in den Pool. Das Wasser kräuselt sich und ich starre wie hypnotisiert auf die Stelle, an der sie verschwunden ist. Erst als sie am anderen Ende des unregelmäßig geformten Pools wieder auftaucht, wende ich mich ab.
Egal wie gut sie in ihrem Bikini aussieht. Und, verdammt, sie sieht heiß aus. Egal wie sehr sich mein Helferkomplex getriggert fühlt, weil es ihr nicht gut geht. Egal wie sehr mich unsere Gespräche herausfordern, weil sie nie sagt, was sie eigentlich sagen will. Oder wie faszinierend ich diese verdammten Sommersprossen auf ihrer Haut finde, ich habe genug eigenen Scheiß zu bewältigen und absolut keine Kapazitäten mich auf irgendetwas einzulassen. Und schon gar nicht auf sie.