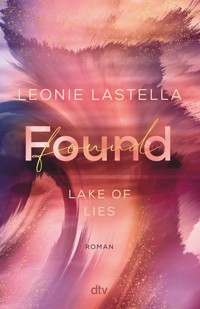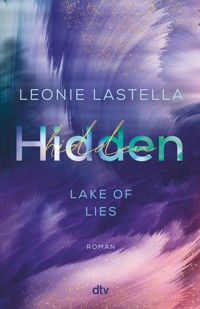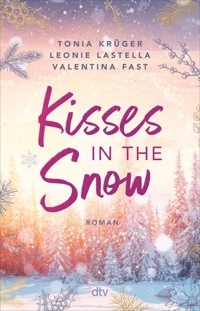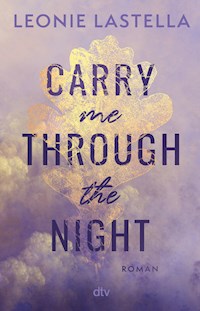9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Seaside-Hideaway-Reihe
- Sprache: Deutsch
Zwischen düsterer Vergangenheit und großen Gefühlen Zwei der beliebtesten #Booktok-Tropes: Enemies to Lovers und Romantic Suspense Eine einzige Nacht, ein furchtbares Verbrechen und Nevahs bisheriges Leben ist zerstört. Mit ihrer Familie taucht sie in dem Küstenstädtchen Rockaway Beach unter. Niemand darf erfahren, wer sie sind. Nevahs Leben wird bestimmt von Panikattacken und der Gefahr, die sie selbst hier einzuholen droht … Bis sie Jackson – Jax – begegnet. Ihr gut aussehender, ständig feiernder Nachbar treibt sie mit seiner unvergleichlichen Art in den Wahnsinn, aber auch zurück ins Leben. Mit ihm fühlt sie sich wieder sicher und schon bald ist sie machtlos gegen die Gefühle, die er in ihr auslöst. Doch will sie ihre Familie nicht gefährden, darf sie eines nicht tun – ihm die Wahrheit sagen. Ein großartiger Reihenauftakt – gefühlvoll und spannungsgeladen Alle Bände der ›Unsafe‹-Reihe: Band 1: Unsafe Band 2: Unseen Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar. Von Leonie Lastella außerdem erschienen bei dtv: Das Licht von tausend Sternen, Wenn Liebe eine Farbe hätte, So leise wie ein Sommerregen, Carry me through the night, Kisses in the Snow
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ihre Vergangenheit: geheim.
Ihre Zukunft: ungewiss.
Ihre Liebe: unmöglich?
Eine einzige Nacht, ein furchtbares Verbrechen und Nevahs bisheriges Leben ist zerstört. Mit ihrer Familie taucht sie in dem Küstenstädtchen Rockaway Beach unter. Niemand darf erfahren, wer sie sind. Nevahs Leben wird bestimmt von Panikattacken und der Gefahr, die sie selbst hier einzuholen droht …
Bis sie Jackson – Jax – begegnet. Ihr gut aussehender, ständig feiernder Nachbar treibt sie mit seiner unvergleichlichen Art in den Wahnsinn, aber auch zurück ins Leben. Mit ihm fühlt sie sich wieder sicher und schon bald ist sie machtlos gegen die Gefühle, die er in ihr auslöst. Doch will sie ihre Familie nicht gefährden, darf sie eines nicht tun – ihm die Wahrheit sagen.
Von Leonie Lastella sind bei dtv außerdem lieferbar:
Das Licht von tausend Sternen
Wenn Liebe eine Farbe hätte
So leise wie ein Sommerregen
Carry me through the night
Leonie Lastella
Seaside Hideaway
unsafe
Band 1
Roman
Linus.
Trust me.
You are special.
prolog
Ich kann die Kälte der Steine in meinem Rücken fühlen. Als würde sie vom Mauerwerk aus Besitz von mir ergreifen. Raue Fugen unter meinen Fingerkuppen. Jede kleine Unebenheit bohrt sich in meine Haut. Genau wie sein kalter Blick, als er unbeirrt auf mich zuhält.
Die Welt steht still. Ich stehe still. Dabei sollte ich rennen. Um mein Leben. Doch die Angst lähmt mich, ich verharre vollkommen bewegungslos. Nur mein Herz rast.
Seine Haare sind dunkel. Die Kleidung, seine Augen, alles an ihm. Er kommt näher. Immer näher. Die Finsternis, die ihn umgibt, macht mein Hirn leicht. So sehr, dass ich den Halt verliere, falle.
Ich schrecke zusammen, kurz bevor mein Kopf auf die Tischplatte vor mir knallt. Verzweifelt fahre ich mir durch die Haare, versuche mich zu orientieren. Nur langsam verdrängt die Realität den Albtraum und bringt mich aus dem schmuddeligen Apartmentkomplex in Queens zurück in den unpersönlichen Raum, in dem meine Familie und ich seit Tagen ausharren. Mein Bruder ist auf der Couch eingeschlafen, einen Arm locker an der Seite baumelnd. Er ist vollkommen entspannt. Ein Zustand, den ich vermutlich nie wieder erreichen werde. Nicht wach. Und erst recht nicht, wenn ich meine Augen schließe. Nicht nach allem, was ich gesehen habe.
Mom und Dad sind in einem Zimmer nebenan, besprechen, wie genau es weitergehen wird. Seit Stunden schon.
Ich stehe auf, schlinge die Arme um meine Mitte und trete an das Fenster. Auf gar keinen Fall will ich noch mal einschlafen.
In der Ferne sind Sirenen zu hören. Das Hupen von Autos. Die typischen Geräusche der Stadt, die niemals schläft. In einem spektakulären Farbenspiel klettert die Sonne über New Yorks Skyline und ich lege meine Hand an die Scheibe, als könnte ich mich so an der Stadt festklammern. Das ist meine Heimat. Meine Freunde sind hier. Meine Zukunft.
Mein Herz zieht sich so fest zusammen, dass nur Leere in meiner Brust zurückbleibt. Ich will nirgendwo anders leben. Doch dies ist mein letzter Sonnenaufgang zu Hause.
1. nevah
Das Ortsschild von Rockaway Beach fliegt an der Seitenscheibe des Wagens vorbei, während ein altmodischer Countrysong durch den Innenraum des Familien-Volvos dudelt.
Steine haben dieser gottverdammten Stadt ihren Namen gegeben. Steine, die Menschen in den Ozean werfen, weil das angeblich Glück bringt.
Ich bin einer dieser Steine. Hineingeworfen in mein neues Leben. Haltlos. So verwaschen, dass ich mich selbst nicht mehr erkenne. Das Glas der Fensterscheibe beschlägt von meinem Atem, als ich mich vorbeuge. Dad hält unseren Wagen vor einem kleinen Holzhaus mit vielen Erkern und Winkeln.
Sieht nicht so aus, als würde es hierhergehören. Auf dieses Grundstück, das ausschließlich aus einer sterilen, weitläufigen Rasenfläche besteht, die sich mit der Gemütlichkeit des Hauses beißt wie Pink mit Signalrot. Es passt nicht hierher. Ich passe nicht hierher. Verzweifelt versuche ich, nicht an mein altes Zuhause zu denken, in dem jetzt fremde Menschen wohnen. An meine Freunde, von denen ich mich nicht einmal verabschieden durfte. Oder an die Dinge, die ich nie werde vergessen können.
»Home, sweet home«, sagt Dad und schaltet den Motor aus. Mom lächelt, als würde sie sich auf diesen Neuanfang freuen. Als wären wir freiwillig hier.
Mein Bruder verdreht die Augen, öffnet die Tür und schält sich aus dem Auto. Mit seinen Kopfhörern um den Hals, der Sweatjacke, die er sich locker über die Schulter gelegt hat, und einem breiten Grinsen scheint er sich mühelos in dieser miesen Situation zurechtzufinden. Keine Ahnung, wie er das macht. Ich sollte mich für ihn freuen. Aber ich bin einfach nur neidisch. Garniert mit einer guten Portion Wut. Das alles ist nicht fair.
»Fuck«, stößt Miller aus und sieht sich um. »Hier ist ja nicht mal der Hund begraben. Der hat sich mit Sicherheit ’nen aufregenderen Ort gesucht, um vor sich hinzumodern.«
Mom und Dad sind ebenfalls ausgestiegen. Mom zieht die Augenbrauen hoch. Ihn wegen seiner Wortwahl zurechtzuweisen, spart sie sich. Einundzwanzig Jahre lang sind alle Versuche gescheitert, ihn vom Fluchen abzuhalten.
»Kommst du, Nevah?«, fordert sie mich sanft auf. Beim Klang meines Namens zucke ich zusammen. Nevah. Ich schnalle mich ab und klettere als Letzte aus dem Auto. Hauptsächlich um nicht mit meinem Namen allein zu bleiben. Das ist also unser neues Leben. Steine, Sand und Einsamkeit.
»In diesem Kaff gibt es ja doch mehr als nur Rentner und Familien mit Kleinkindern.« Miller hebt seine Hand und grüßt einen Typen in unserem Alter, der gerade aus dem einzigen anderen Haus in der Seaside Lane tritt.
Der Typ winkt knapp zurück. Er ist braun gebrannt, hat von der Sonne ausgeblichenes blondes Haar und trägt ein luftiges Muskelshirt zu kurzen Hosen und Flipflops. Das Abziehbild eines California Surferboys. Wir befinden uns aber verdammt noch mal in Oregon.
»Sieht locker aus, saucooles Haus in erster Strandlage, vielversprechend«, fasst Miller zusammen, macht eine Siegerpose wie nach einem gelungenen Touchdown und wackelt mit den Augenbrauen.
»Hör auf, Fred Astaire zu spielen. Hilf mir lieber, die Sachen reinzuschaffen«, sagt Dad und klopft ihm gegen die Brust, bevor er sich die ersten Taschen auf den Arm lädt und sie ins Haus bringt.
»Dein Ernst?«, zische ich Miller zu. Wir haben noch nicht mal ausgepackt und mein Bruder denkt schon daran, wo er Party machen und sein Leben auf dieselbe Weise gegen die Wand fahren kann wie in New York. Genau dieses rücksichtslose Verhalten hat mein Leben zerstört.
»Entspann dich, Nev.« Er bedenkt mich mit einem Blick, der sagt, dass alles leichter wäre, wenn ich nur etwas mehr wie er wäre und weniger wie ich.
Ich glaube, ich brauche eine Kotztüte.
»Kommst du jetzt, oder was?« Miller stößt mich an. Völlig überladen mit zwei Taschen, seiner Gitarre und Kleinkram wankt er zur Tür.
Ich blicke zurück auf die andere Straßenseite, wo der Typ aus dem Nachbarhaus in seinen Wagen gestiegen ist und gerade den Motor startet. Dann folge ich meinem Bruder, klemme mir aber nur meinen Rucksack und Moms Reisetasche unter den Arm.
Dad und Miller gehen noch zweimal, dann ist es geschafft. Alles, was von unserem früheren Leben übrig geblieben ist, häuft sich als trauriger Berg hinter der Haustür im Flur auf. Sechs Taschen, Moms Kisten mit Fotoalben, etwas Hausrat, Millers Playstation, sein über und über mit Aufklebern versehener Gitarrenkoffer, Dads Platten und eine Kiste mit den Büchern, die mir am wichtigsten waren. Mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen, wenn ich an die vielen Schätze denke, die ich zurücklassen musste. Und Bücher waren bei Weitem nicht das Schlimmste.
Mom streicht mir über den Rücken. »Wir schaffen das.«
Ich bin nicht überzeugt, aber es bringt nichts, ihr zu widersprechen. Mit einem Schnauben blinzle ich die Tränen fort, schnappe mir mein Zeug und gehe die Treppe in den ersten Stock hinauf, um mir mein Zimmer anzusehen.
»Wer zuerst oben ist, kriegt das große Schlafzimmer.« Miller überholt mich und erwartet mich mit einem breiten Eroberergrinsen gegen den Türrahmen des lichtdurchfluteten Hauptschlafzimmers gelehnt.
Mom und Dad werden unten schlafen. Die obere Etage gehört meinem Bruder und mir. Neben diesem Raum mit eigenem Bad gibt es noch ein kleineres Zimmer, das nicht zum Ozean zeigt, und ein winziges, nicht damit verbundenes Bad.
Das wird reichen. Statistisch gesehen wird das hier sowieso nicht von Dauer sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hierbleiben, liegt bei lächerlichen siebzehn Prozent. Und damit ist es wahrscheinlicher, dass ich mich an einem Getränkeautomaten verletze. Ich wende mich ab, um meine Sachen in das kleinere Zimmer zu bringen, aber Miller hält mich zurück. Die Lässigkeit ist aus seinem Blick verschwunden.
»Vergiss es. Nimm du das Größere.« Er fährt sich mit einer unsicheren Handbewegung durch die Haare. »Ich meine, scheiße, Ha … Nev«, verbessert er sich. Er starrt auf den Boden, blickt dann mich an und in seinen Augen sehe ich das Es-tut-mir-Leid. Nicht, dass er es ernst genug meint, um wirklich etwas zu ändern, aber in diesem Moment ist er wieder mein großer Bruder. Mit dem ich früher zusammen unter der Bettdecke gelesen habe. Der mir Lieder auf der Gitarre vorgespielt hat, wenn ich nicht schlafen konnte, und in unserem Garten so lange mit mir Trampolin gesprungen ist, bis ich Schluckauf bekam. Er war immer für mich da. Selbst als ich ihn gebeten habe, mit Hanna und mir eine Choreografie für die Aufnahme in das Cheerleader-Team zu einem Calvin-Harris-Song einzuüben. Ich liebe diesen Menschen. Aber genauso schnell wird er wieder zu Miller. Und der Typ ist ein Arsch, den ich am liebsten im Ozean ertränken würde.
Er zuckt die Schultern. »Im Gegensatz zu dir Nerd werde ich ja sowieso kaum hier sein. Hab nicht vor, mehr in dem Zimmer zu tun als gelegentlich zu pennen. Ich brauch also nicht viel Platz.« Er verwuschelt meine Haare, weil er weiß, wie sehr ich das hasse, und pfeffert seine Tasche und den Rucksack mit einem gezielten Wurf auf den Boden des kleineren Zimmers. Die Gitarre schiebt er mit dem Fuß unter das Bett, wo sie vermutlich die nächsten Jahre Staub ansetzen wird. Er hat ewig nicht mehr gespielt und ich glaube kaum, dass er vorhat, wieder anzufangen. Keine Ahnung, warum er darauf bestanden hat, ausgerechnet das Monsterding aus seinem alten Leben mitzunehmen. »Fernseher für die Konsole passt rein. Mehr brauch ich nicht«, reißt mich seine Stimme aus den Gedanken. Auffordernd schiebt er mich ins große Schlafzimmer. Auch wenn ich eigentlich dankbar sein sollte, dass er es mir überlässt, habe ich das dringende Bedürfnis, ihn zu schütteln. Weil ich zwar weiß, dass ihm leidtut, was passiert ist, es aber trotzdem nichts ändert. Alles, was mir bleibt, ist wütend zu sein. Das ist einfacher als all die anderen Gefühle. Und Miller ist die beste Adresse dafür. Verdammt, nur er schafft es, mir mit dem Überlassen des Zimmers ein Geschenk zu machen und mich im selben Atemzug zu beleidigen.
Sekundenlang legt er mir seine Hand auf die Schulter und sieht mich eindringlich an. Ich bin sicher, er weiß, was ich denke. Und es gefällt ihm nicht. Aber anstatt etwas zu sagen, wendet er sich ab und springt ohne ein weiteres Wort die Treppe hinab.
Ich betrete mein neues Reich, vermeide den Blick durch die Glasfront oder auf das einladende Boxspringbrett, das den hellen Raum dominiert. Stattdessen stelle ich die Reisetasche unausgepackt in den weißen Einbauschrank, schließe die Tür und folge Miller, um Mom und Dad unten zu helfen.
2. jackson
Es gibt ätzende Tage. Beschissene. Und dann gibt es ätzende, beschissene, allerletzte Scheißtage.
Ich komme heute Mittag vorbei. Sei da. Wir müssen reden.
Es ist elf und ich bin erst seit gefühlten drei Atemzügen wach, als die Nachricht von Dad diesen Tag zu einem solchen degradiert. Muss er wirklich das brüchige Gleichgewicht zwischen uns ins Wanken bringen, indem er herkommt?
Zu allem Überfluss entdecke ich über seiner Mitteilung auch noch eine meines Chefs, Pete. Er will mich dringend sprechen. Und ich weiß, warum.
Es geht um gestern. Ich bin bei der Arbeit mit dem alten Henderson aneinandergeraten. Das kostet mich, wenn’s übel läuft, meinen Job. Auch wenn ich es mir eigentlich nicht leisten kann, bereue ich es nicht, dem Idioten die Stirn geboten zu haben. Egal wie meine finanzielle Lage aussieht, ich bin kein Fußabtreter für Typen wie ihn.
Stöhnend wühle ich mich unter Maddisons Körper hervor und streife mir Shorts und das Muskelshirt über, das sie mir gestern direkt hinter der Tür vom Körper gezerrt hat.
Ich würde gern duschen. Den Sex von der Haut waschen und mit ihm das schlechte Gewissen, Maddie als Ablenkung von all dem Mist in meinem Leben zu benutzen. Aber wenn ich nicht verschwinde, laufe ich Gefahr, Dad in die Arme zu rennen, und das werde ich nicht riskieren. Meine Eltern haben mir beigebracht, Dinge anzusprechen, nach Lösungen zu suchen und Kompromisse zu finden. Vor einem Jahr hätte ich deswegen auf Dads Bitte definitiv anders reagiert. Aber es gibt nichts mehr zu reden. Kein Kompromiss wird wieder kitten, was zwischen uns zerbrochen ist. Kein Gespräch den Grand Canyon zuschütten, den meine Eltern zwischen uns geschlagen haben.
Lautlos schlüpfe ich aus dem Zimmer und schiebe die bodentiefen Glastüren des Strandhauses auf. Der Blick auf den Ozean lockert den Druck auf meinen Brustkorb zumindest so weit, dass ich das Gefühl habe, wieder atmen zu können. Am liebsten würde ich mich einfach in den Sand setzen und die nächsten zwei Stunden nichts weiter tun, als dem Rollen der Wellen zuzusehen, doch dann würde Dad sich irgendwann zu mir setzen. Für einen Moment wäre es wie früher. Nur um sich danach noch schlimmer anzufühlen.
Also wende ich der Wasserlinie den Rücken zu und gehe zu meinem Wagen. Gegenüber ziehen irgendwelche Leute ein. Wahrscheinlich Feriengäste, so wenig Kram, wie sie dabeihaben. Ich dachte, dass Grayson nicht an Urlauber vermietet. Deswegen stand der Kasten ewig leer. Anscheinend hat er seine Meinung geändert, damit das Haus nicht länger unbewohnt bleibt. Der junge Typ neben der geöffneten Kofferraumklappe hebt die Hand und ich grüße zurück. Er ist tätowiert und zu blass, um von der Küste zu stammen. Allerdings bemüht er sich im Gegensatz zu dem Mädchen, zumindest den Look des Easy-way-of-beach-Life der Einheimischen zu kopieren, indem er seine Jacke nur lässig über die Schulter wirft, dazu ein Shirt trägt, eine Cap und eine verspiegelte Fliegerbrille. Sie dagegen hat die Haare zu einem strengen Knoten hochgebunden und kneift die Lippen so fest zusammen, als gäbe es dafür einen Preis. Scheint, als hätte noch jemand den weltschlechtesten Tag seines Lebens.
Ich steige in meinen Wagen, fahre los und konzentriere mich auf wichtigere Dinge als meine neuen Nachbarn. Mit Pete treffe ich mich erst in zwei Stunden. Bis dahin muss ich etwas in den Magen bekommen. Und ich sollte mein Hirn dringend dazu bringen, irgendetwas Unterwürfiges zu formulieren, das mir vielleicht doch meinen Job und damit den Hintern rettet.
Keine zehn Minuten später parke ich den Wagen direkt am Strand vor Marshas Diner. Obwohl es erst kurz vor zwölf ist, sind bereits alle Außenplätze belegt. Schon vor der Tür empfängt mich der betörende Duft nach Meeresfrüchten, Fritten und Burgern, der nicht nur Menschen, sondern auch jede Menge Möwen anlockt. Mein Magen zieht sich vor Hunger zusammen.
Ich öffne die Tür und ein helles Vintage-Klingeln ertönt. Manchmal denke ich, das Geräusch löst bei mir den Pawlow’schen Reflex aus. Auf jeden Fall läuft mir das Wasser im Mund zusammen, während ich mich im klimatisierten Inneren auf einen der Sechzigerjahre-Barhocker am Tresen schiebe. »Hi, Marsha«, begrüße ich die kleine, rundliche Wirtin.
»Jackson, was für eine schöne Überraschung. Hab dich viel zu lange nicht mehr gesehen.«
Ich bin ständig hier, aber es entlockt mir ein Grinsen, dass Marsha es dennoch für nicht ausreichend hält und mich gern öfter um sich haben will. Sie kommt um den Tresen herum. Obwohl das aufgeregte Klingeln der Küchenglocke fertiges Essen in der Durchreiche ankündigt und ihre zwei Angestellten gerade draußen beschäftigt sind, nimmt sie sich die Zeit, mich in ihre Arme zu schließen. »Wie geht es dir, mein Lieber?«
»Gut.« Ich grinse. Die Übertreibung des Jahrhunderts, aber wen kümmert schon die verfluchte Wahrheit. »Noch besser würde es mir allerdings mit deinem Spezialburger im Magen gehen.«
»Kommt sofort.« Sie tätschelt meinen Oberarm, flitzt los und heftet meinen Zettel mit der Bestellung an das Rad über der Durchreiche zu den vielen anderen, die in der Hitze des Grills flattern. Ganz nach vorn. »Was willst du dazu trinken?«
»Ein Wasser reicht mir.«
Sie füllt ein mörderisch großes Glas mit Eiswürfeln und Coke. »Wasser«, schnaubt sie und schüttelt den Kopf. Mit einem »Geht aufs Haus« erstickt sie meinen Protest. Wie jedes Mal.
»Danke«, murmle ich und ertränke das Wort im selben Moment. Die Coke strömt kalt durch mein Inneres. Marshas Großzügigkeit ist mir unangenehm. Aber sie weiß als eine der wenigen, dass ich ständig knapp bei Kasse bin, insbesondere zum Ende des Monats, bevor Petes Gehaltsscheck kommt. Und sie hat nun mal ein Herz für Streuner. Früher, als meine Welt noch in Ordnung war, habe ich es als liebenswerte Macke abgetan. Heute rettet mich ihre Art. Denn ich bin genau das. Ein Streuner. Ohne Wurzeln. Ohne Ziel. Der in einer Luxushütte am Strand lebt.
***
Marshas Burger und die Coke haben meine Lebensgeister wieder geweckt. Das ist auch nötig. Sonst würde ich das Gespräch mit Pete in dem Büro seiner Ferienhaus-Firma sicher nicht überstehen. »Hast du den Verstand verloren?«, brüllt er mich gerade an. »Henderson hat sechs Anwesen. Sechs!« Pete fächelt sich Luft zu. Seine Gesichtsfarbe ist rot mit einem Stich Violett. Sieht nach Herzinfarkt in den nächsten zehn Sekunden aus. Was auch an den Temperaturen in dem kleinen Kabuff liegen könnte, das Pete Büro nennt. »Wenn er mir den Auftrag entzieht, kann ich dichtmachen.«
»Tut mir leid«, presse ich durch zusammengebissene Zähne. Henderson hatte es verdammt noch mal verdient. Ich mag den Job, die harte Arbeit. Weniger gut komme ich allerdings mit Menschen klar, die mich behandeln wie Dreck, weil ich ihre Regenrinnen sauber mache. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal dafür entschuldigen müsste, mir das nicht gefallen zu lassen. So sollte die Welt nicht sein.
»’n Scheiß tut dir leid.« Pete steht auf und läuft zum Fenster. Dann wieder zurück. »Du konntest noch nie gut lügen, Jackson Scott.« Mit einem Ächzen lässt er sich auf den zerschlissenen Drehstuhl fallen.
Ich sollte ihm vermutlich versprechen, dass ich mich ab jetzt zusammenreißen werde und so etwas nie wieder passiert. Aber das wäre die nächste Lüge. Und wenn es eins gibt, was ich noch mehr hasse, als keinen Job mehr zu haben, sind es Lügen. Also halte ich meine Klappe und sehe Pete stumm an.
»Könntest du wenigstens so tun, als wäre es dir nicht egal?« Pete rauft sich die Haare.
»Es ist mir nicht egal.« Ich halte seinem Blick stand und drehe den schwarzen Casinochip, der immer in meiner Hosentasche steckt. »Henderson ist ein Idiot, aber ich brauche diesen Job. Und ich arbeite gern für dich.« Ich brauche vor allem das Geld. Und vielleicht sogar Pete. Er ist eine meiner wenigen Konstanten in Rockaway Beach. Ansonsten würde ich nur Marsha und Maddie dazuzählen. Wobei Maddie im Grunde ihre eigene Konstante ist. Ich bin nur etwas Unverbindliches für sie. Genau wie sie für mich. Spaß, der trotzdem regelmäßig mein schlechtes Gewissen triggert.
»Ich werde versuchen, mich zusammenzureißen«, versichere ich. Ein Friedensangebot. Mehr kann ich ihm nicht geben.
Pete nickt ergeben und schiebt mir einen Zettel mit der Liste an Grundstücken zu, die ich morgen abfahren soll. »Weißt du, Menschen wie die Hendersons sichern das Überleben von Typen wie mir. Ich kann es mir nicht leisten, sie zu verärgern.«
Ich schon. Das ist, was Pete nicht sagt, was aber in seiner Aussage mitschwingt. Er hat keine Ahnung. »Hast du noch mal darüber nachgedacht, ob ich während der Ferien einen Tag mehr kriegen kann?« Mein Timing ist mies, aber ich brauche die Kohle. Während der Uni arbeite ich dreimal die Woche für Pete. Mehr ist neben den Kursen einfach nicht drin. Aber in den Semesterferien sieht das anders aus. Allerdings sind die fast vorbei und er ist noch immer nicht auf meine Bitte nach mehr Stunden eingegangen.
»Du hast echt Nerven. Sei froh, dass ich dich nicht direkt gefeuert habe.« Pete sieht mich streng an, zwinkert mir aber zu, als ich resigniert die Luft ausstoße. »Ich schau mal, was sich machen lässt. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege.«
»Okay.« Mit einem Seufzen rapple ich mich auf, schnappe mir den Zettel und trete mit einem knappen »Wir sehen uns« aus dem Kabuff-Büro. Meine Klamotten sind völlig durchgeschwitzt und kleben an meinem Körper. Am Wagen angekommen werfe ich die Papiere ins Handschuhfach und schnappe mir mein Surfboard und den Neopren-Shorty von der Ladefläche des Pick-ups.
All die Dinge, die ich gerade nicht ausgesprochen habe, kleben an meinem Gaumen. Wie die Klamotten an meinem Körper. Und wenn das überhaupt möglich ist, bin ich noch weniger bereit als heute Morgen, Dad zu begegnen. Und da er sicher noch nicht aufgegeben hat, werde ich noch etwas Zeit totschlagen müssen. Ich folge der leicht abfallenden Straße zwei Blocks, bis sie in einen Strandzugang mündet. Die Wärme des feinpulvrigen Sands dringt durch die dünnen Sohlen meiner Flipflops. Über mir schwingen sich Austernfischer zeternd über dem Ozean auf. Nachdem ich mich umgezogen habe, tauche ich mit dem Board ins Meer ein. Als ich die ruhige Stelle hinter dem Peak erreiche, an dem sich die Wellen brechen, setze ich mich auf das Surfbrett und warte. Das Wasser schlägt gluckernd gegen die Unterseite. Ansonsten ist es ruhig. Absolut still, aber mein Kopf verliert sich trotzdem nicht in den immer gleichen Gedanken. Der Ozean wäscht alles aus meinem System, was mich sonst vergiftet. Adrenalin lässt meine Muskeln vibrieren, als das perfekte Wellenset vom Horizont auf mich zurollt. Ich mache mich bereit, paddle, werde eins mit dem Wasser, der Strömung. Werde schneller und schneller, bis ich die Geschwindigkeit erreiche, die es mir erlaubt, mich aufzurichten. Ich finde meine Balance, verliere mich in dem Rausch, den nur das Surfen in mir auslöst. Ich bin glücklich, frei, vollkommen losgelöst von all den Problemen, die ich mit den verschwitzten Klamotten am Strand zurückgelassen habe.
Die Welle trägt mich, erlaubt mir einige Tricks, bis sie mich gurgelnd verschluckt. Wieder und wieder tauche ich durch die Brecher, verharre still in der Wartezone, bis ein geeignetes Set kommt, lege mich auf das Board, paddle und reite die Welle, solange sie es zulässt. Die Sonne steht bereits tief über dem Ozean, als ich schließlich vollkommen erledigt, aber zufrieden zum Auto zurückkehre. Zeit, nach Hause zu fahren. Die Luft sollte rein sein.
3. nevah
Miller hat das Abendessen eingeatmet. Wie ein Höhlenmensch. Er steht bereits auf und stellt seinen Teller in den Geschirrspüler, da habe ich noch nicht mal richtig begonnen.
»Ich bin dann mal weg«, sagt er und schlüpft in seine ausgetretenen Chucks.
Dad legt seine Gabel auf den Tellerrand und wischt sich den Mund ab. »Wo willst du denn hin? Du kennst hier doch niemanden.«
»Ich gucke mir das Nest mal an, sonst ändert sich das ja nicht.« Miller weicht Dads Blick aus. Er will hier raus, um sich nicht mit dem beschäftigen zu müssen, was passiert ist. Er ist der Typ, der Dinge abhakt und weitermacht.
Dad nickt bedächtig. »Bestechende Logik.« Ich sehe die Besorgnis in seinen Augen, Miller könnte erneut in Schwierigkeiten geraten. Aber anstatt ihn zurückzuhalten, steht er auf, zieht meinen Bruder in seine Arme und gibt ihm einen Kuss auf die Schläfe. Auf genau die Art, wie er es schon getan hat, als Miller noch ein Kleinkind war. »Pass auf dich auf, Großer. Und vergiss die Schlüssel und den Code für die Alarmanlage nicht.«
Miller hält den Schlüsselbund hoch und rattert den Code runter, bevor er sich umdreht und durch die Tür verschwindet.
Für einen Moment denke ich, Dad wird ihm nachlaufen, doch er tut es nicht. Ich kann sehen, wie schwer ihm das fällt. Aber er kommt zurück zum Tisch, setzt sich und drückt Moms Hand.
Dad hat uns immer vertraut, unseren Entscheidungen und Fähigkeiten. Das ist kaputtgegangen, auch wenn er sich dazu zwingt, so zu tun, als wäre es anders.
Schweigend essen wir zu Ende. »Was haltet ihr von einem guten Film und ungesund viel Popcorn an unserem ersten Abend?« Dad schiebt seinen leeren Teller von sich und klopft sich auf die Oberschenkel.
Mom lächelt. Ich lächle. Und ich weiß, wir beide würden lieber weinen.
»Klingt super, Dad«, murmle ich und beginne den Tisch abzuräumen. Mom macht Popcorn und Dad schließt in der Zeit den Fernseher ans Internet an.
Eigentlich bin ich zu müde, um mich auf einen Film zu konzentrieren. Ich will duschen, mich ins Bett legen und am besten morgen in New York wieder aufwachen. Miller dürfte sogar Witze über meine bescheuerten Albträume machen, wenn es bedeuten würde, das alles hier wäre nur das. Ein böser Traum.
Dad schläft schon nach dem Intro völlig erledigt von der langen Fahrt ein und auch Mom schafft es bloß bis zur Hälfte des Films, ehe ihr die Augen zufallen. Obwohl es noch früh am Abend ist, stelle ich den Fernseher aus und wecke meine Eltern, damit sie ins Bett gehen und sich den Rücken nicht auf dem Sofa ruinieren. Sie geben mir einen Kuss und ziehen sich ins Schlafzimmer zurück. Nach einigen Minuten verklingen die Geräusche. Die Stille fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Ich schlinge fröstelnd die Arme um meine Mitte und gehe zur Tür. Drei wuchtige Schlösser dominieren das Holz. Dad hat sie einbauen lassen, bevor wir hergekommen sind. Sie sollen uns Sicherheit vermitteln. Ich schließe sie ab und aktiviere den Alarm, aber die Angst verschwindet nicht. Trotzdem zwinge ich mich, ruhig zu bleiben, die Wolldecken auf dem Sofa zusammenzulegen, die Kissen drum herum zu drapieren und die Popcornschüssel abzuwaschen. Alltägliche Dinge. Als wäre irgendetwas hieran normal. Als es nichts mehr zu tun gibt, gehe ich duschen. In ein Handtuch gewickelt lasse ich mich eine halbe Stunde später auf das Bett fallen. Miller ist noch immer nicht zurück. Ich werde mir keine Sorgen um ihn machen. Werde ich nicht. Verdammt.
Das Boxspringbett ist supergemütlich. Für einen Moment presse ich meine verspannten Muskeln in die Matratze und sehe mich in dem Zimmer um. Der dunkle Boden passt in seinem warmen Kontrast perfekt zum Bett und den hellen Wänden. Die wenigen Bücher, die ich mitnehmen konnte, habe ich auf der Kommode gestapelt. Sie sind das einzig Persönliche in diesem Raum, der größer ist als mein altes Zimmer und sogar über ein eigenes Bad verfügt. Ich werde also nie wieder über Millers schmutzige Wäsche stolpern. Ein echter Pluspunkt.
Ich schüttele den Kopf über diesen Gedanken. Als würde ein Badezimmer dafür sorgen, dass irgendetwas hieran gut ist. Mit einem Ruck setze ich mich auf, streife mir saubere Sweatshorts und ein luftiges Shirt über und gehe zum verglasten Giebel. Gar nichts ist gut.
Na ja, außer dem Ausblick vielleicht. Ich atme tief ein, nehme das Bild in mich auf. Der Ozean liegt direkt hinter dem Haus des Muskelshirt-Typen. Nur durch einen muschelgesäumten Sandstrand davon getrennt. Im glitzernden Wasser ragen zwei Felsen dunkel gegen das Licht der untergehenden Sonne auf. Das müssen die Twin Rocks sein. Ich lehne meine Stirn an die kühle Fensterscheibe, die Hand gegen das Glas, als könnte ich die Felsformationen so berühren. Es gibt mir ein trügerisches Gefühl von Halt. Ich atme tief durch. Und zucke urplötzlich zurück.
Unser Nachbar steht auf der breiten Veranda des modernen Strandhauses und winkt mir zu. Erst jetzt wird mir bewusst, dass meine Hand an der Scheibe so wirken muss, als hätte ich ihn gegrüßt. Für einen Moment sehen wir uns an und Wärme breitet sich in mir aus. Dabei sind sein Lächeln und die erhobene Hand nicht sein erstes Willkommen an diesem Ort. So darauf zu reagieren, ist absurd. Er ist nur höflich. Und tut, was man im Allgemeinen tut, wenn man gegrüßt wird. Man grüßt zurück. Und das ist es auch schon.
Ein Mädchen taucht hinter ihm auf, schlingt ihre Arme um seine Mitte und lenkt seinen Blick von mir ab. Sie sagt irgendetwas zu ihm, schmiegt ihre Wange an seine und versucht ihn zu küssen. Halbherzig wehrt er sie ab, lacht und zieht sie im nächsten Moment doch in seine Arme.
Er hat eine Freundin. Und sie wirken so glücklich, so unbeschwert. Ich schaffe es nicht, meinen Blick von ihnen zu lösen, so sehr beneide ich sie darum. Unverwandt sehe ich sie an. Früher war ich genau wie die beiden – fröhlich, sorglos. Ohne Angst, die heute jede meiner Zellen ummantelt.
Obwohl seine Freundin mit allen Mitteln um seine Aufmerksamkeit kämpft, sieht unser Nachbar erneut zu mir hoch.
Hastig weiche ich zurück, aber natürlich hat er mitbekommen, wie ich ihn total Norman-Bates-psychomäßig angestarrt habe. In einem Reflex fasse ich meine Haare zu einem engen Knoten auf dem Kopf zusammen und stoße die Luft aus. Es sollte mir egal sein, was irgendein Typ von mir denkt. Ich kenne den Kerl ja nicht mal. Es gibt definitiv wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern sollte. Zum Beispiel meine noch immer volle Tasche, die mich anklagend ansieht, als ich die Schranktüren öffne. Ich gebe ihr einen unmotivierten Tritt. Dazu durchringen, sie auszupacken, kann ich mich jedoch nicht. Nur den Laptop und die zerlesene Ausgabe von ›Little Women‹, die nicht bei den anderen Büchern in der Kiste war, einfach weil dieses Buch etwas Besonderes ist, ziehe ich aus dem Seitenfach. Das Buch lege ich auf meinen Nachttisch. Den Laptop ziehe ich mit mir aufs Bett. Ich könnte lernen oder zum ungefähr hundertsten Mal in die Welt von Meg, Jo, Beth und Amy abtauchen, aber für beides bin ich zu erledigt. Und obwohl ich todmüde bin, bin ich gleichzeitig hellwach. Das ist die Angst vor den Träumen.
Seufzend öffne ich den Laptop und starre die Startseite an. Normalerweise würde ich die Zeit totschlagen, indem ich durch die sozialen Medien surfe oder eine Buchbesprechung auf meinen Blog hochlade. Aber ich habe seit Wochen keinen Roman mehr zu Ende gelesen, den ich besprechen könnte. Außerdem sind meine Accounts und mein Blog gelöscht. Nicht deaktiviert, sondern unwiederbringlich gelöscht. Und die Ansage war klar, keiner von uns darf einen neuen einrichten. Aus Mangel an Alternativen starte ich Netflix, wähle den Film aus, den ich unten mit Mom und Dad begonnen habe, und kuschle mich unter die Wolldecke, die schon in meinem alten Zimmer lag. Ein Geschenk von Hanna, meiner besten Freundin. Aber die Geborgenheit, die der Stoff sonst in mir auslöst, wird von der Ungewissheit überschattet, wie lange es wohl dauert, bis sie mich vergessen hat.
4. jackson
Das Mädchen am Fenster des Grayson-Hauses hebt die Hand und automatisch tue ich dasselbe. Es gibt keinen Grund, das bedeutungsvoll zu finden. Aber da ist etwas in ihrem Blick. Er ist ernst. Zu ernst. Weswegen ich unwillkürlich so etwas wie Verbundenheit fühle. Ich schüttle den Kopf. Weil mein Hirn Zeug zusammenwirft, das nicht zusammengehört. Ich sollte zur Party zurückgehen, die hinter dem Haus steigt, anstatt hier zu stehen und zu denken, sie könnte ebenso kaputt sein wie ich. Hübsch, ohne Zweifel, aber zerbrochen. Ich sollte mich nicht fragen, welche Art von Sturm ihr Leben dem Erdboden gleichgemacht hat. Es sollte mich nicht interessieren. Immerhin habe ich mit meinem eigenen Kram genug zu tun.
»Was machst du hier so ganz allein?«, flüstert plötzlich eine Stimme an meinem Ohr und Sekunden später schlingt Maddie mit einem hellen Lachen ihre Arme um mich. Ihre Wange eng an meine geschmiegt nimmt sie mir den Casinochip ab, den ich gedankenverloren über meine Fingerknöchel habe rollen lassen. »Was hast du nur immer mit diesem Ding?«
Ich erobere ihn wortlos zurück und lasse ihn in meiner Hosentasche verschwinden. Wieso er mir so viel bedeutet, geht sie nichts an. Das ist ein Teil meines Lebens, der nicht zwischen uns passt. Wie so vieles.
Sie nimmt meine abweisende Art nicht persönlich und beschreibt mir tornadogleich, was ich gerade alles verpasse, weil ich vor dem Haus Trübsal blase. Ich mag Maddies unbeschwerte Art. Sie reißt mich mit. Und das ist genau, was ich brauche, auch wenn es oft anstrengend ist. Ich brauche jemanden, der dafür sorgt, dass ich nicht auf Scherben stehen bleibe. Und dennoch wehre ich sie in diesem Moment ab und schenke ihr ein schiefes Grinsen, um die Abfuhr abzumildern.
Aber Maddie wäre nicht Maddie, würde sie meinen Widerstand ernst nehmen. »Komm schon«, stößt sie lachend hervor und schlägt mir gegen die Schulter. »Du schuldest mir ein bisschen Spaß, nachdem du mich den ganzen Tag allein gelassen hast.«
Ich war nicht freiwillig so lange unterwegs. Und sie wird sich glänzend mit ihren Freundinnen am Strand amüsiert haben, aber ich gebe mich geschlagen. Bevor ich ihr jedoch folge, werfe ich einen letzten Blick auf den verglasten Giebel des Hauses gegenüber und ertappe meine neue Nachbarin dabei, wie sie Maddie und mich anstarrt. Als wären wir Cream filled Churros mit Sahne drauf. Sie bemerkt, dass ich sie gesehen habe, und verschwindet hastig in der Tiefe des Zimmers.
»Was ist jetzt?« Maddie zerrt an mir wie ein Kleinkind an einem überdimensionalen Teddybären. »Ich will Spaß haben, also tausch endlich die geheimnisvolle, deprimierte Version gegen dein Party-Ich aus.«
Sonst wird sie sich mit jemand anderem amüsieren. Heute wäre es mir sogar ganz recht, wenn sie ihre Drohung wahr macht. Ich bin kaputt, hungrig und ein pochender Kopfschmerz erinnert mich daran, dass mein Hirn Ruhe braucht. Eine Ruhe, die ich ihm zu selten gönne. Denn der entstandene Raum füllt sich dann mit Fragen. Auf die ich nie Antworten bekommen werde.
Ich folge Maddie, halte sie aber auf Höhe des Lagerfeuers zurück. Ganz sicher werde ich mit meinem dröhnenden Schädel nicht im Epizentrum der Party herumhüpfen. »Ich trink erst mal was«, sage ich und deute auf die Kühlbox, die neben dem Feuer im Sand steht.
»Dein Ernst?« Sie schiebt die Unterlippe vor und verdreht die Augen. »Ziehst du diese melancholisch-unnahbare Rolle jetzt echt durch?« Sie küsst mich und zupft verführerisch an meinem Hoodie. »Wäre es nicht viel besser, stattdessen mit mir die Sau rauszulassen?« Aufreizend bewegt sie ihre Hüfte an meiner.
Sie lacht und für einen Moment bin ich geneigt nachzugeben. Weil es das ist, was unsere Freundschaft ausmacht. Und das Plus, das ich vor einigen Monaten dahinter gesetzt habe. Als sie mich aber in Richtung der Tanzenden ziehen will, mache ich mich los. »Heute echt nicht, Maddie. Ich bleib hier und mache einen auf unnahbar. Du magst doch Rollenspiele.« Ich grinse anzüglich. Was nicht so verdammt anstrengend sein sollte.
»Selbst schuld.« Maddie streckt mir die Zunge raus und verschwindet zwischen den Tanzenden, während ich mich neben die Kühlbox fallen lasse und eine Coke herausziehe. Ich sehe ihr zu, wie sie ihre Hüften schwingt, lacht und die Jungs damit um den Verstand bringt. Sie tut das nicht, um ihnen zu gefallen oder mich eifersüchtig zu machen. Maddie tanzt, weil sie tanzen möchte. Fertig.
»Hey.« Ein Typ schiebt sich in mein Blickfeld. »Kann ich mich zu dir setzen? Die Jungs dahinten meinten, es wäre deine Party.« Er deutet unbestimmt hinter sich. »Ich bin neu und wollte mal checken, was hier so los ist.«
Ich blinzle und erkenne meinen neuen Nachbarn wieder. Er trägt eine Sonnenbrille, was nach Sonnenuntergang weniger cool als verzweifelt wirkt. Die Cap ist einer Beanie gewichen. Das Muskelshirt zeigt eine Vielzahl von Tattoos, die fast jeden Inch seiner Arme bedecken. »Du bist heute drüben eingezogen, oder?« Ich nehme ein Bier und eine Coke aus der Kühltasche und halte sie ihm hin. Er wählt das Bier und setzt sich neben mich.
»Ja. Fuck, ist ziemlich verschlafen, der Ort, aber wie es aussieht, machst du das Beste draus.«
Ein Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus. Ich mag seine raue Art. »Ich bemühe mich. Jax«, stelle ich mich vor.
Kurz zögert er. »Miller. Freut mich.« Er schlägt mit mir ein. »Du glaubst gar nicht, wie sehr. Das hier ist verdammt noch mal ein echter Lichtblick.« Er macht eine Handbewegung, die das Haus, den Strand und die Party umfasst.
Miller hat recht. Wer weiß das besser als ich? Könnte ich nicht hier sein, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Ich stoße mit ihm an und sehe zu, wie er das Bier in einem Zug leert.
Wortlos reiche ich ihm eine weitere Dose. Eine Weile sehen wir ins Feuer. Miller schippt Sand mit dem Schuh auf die Ausläufer der Flammen. Muss heiß sein, aber er zuckt nicht zurück. »Von wo kommt ihr?«
»Illinois.« Miller sieht mich nicht an und ich höre die Dunkelheit in seiner Stimme. Heimweh oder schlechte Erinnerungen. Er führt es nicht weiter aus. Und ich hake nicht nach. Geht mich nichts an.
»Und du? Lebst du schon immer hier?«
Ich lasse den schwarzen Casinochip über meine Finger wandern, fange ihn auf und beginne von vorn. »Erst seit einem halben Jahr. Ursprünglich komme ich aus Portland. Ist das Haus meiner Eltern. Musste mal raus und hier bin ich.« Ich lasse offen, wieso ich aus Portland weggezogen bin.
Miller deutet auf meinen Hoodie. »Du gehst auf das Tillamook Bay Community College?«
Ich nicke.
Er zerdrückt die leere Dose Bier in seiner Hand. »Meine Schwester und ich auch. Sobald das Semester anfängt. Wir sollten uns fahrtechnisch zusammentun. Spart Benzin, schont die Umwelt und ist spaßiger, als allein mit meiner Schwester im Auto zu sitzen.« Er grinst schief.
Meine neuen Nachbarn sind also keine Feriengäste. Sie werden dauerhaft hier wohnen. Noch bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. Bisher war es vollkommen egal, wie laut und exzessiv die Feiern im Strandhaus waren. Es gab niemanden, den wir damit gestört hätten. Jetzt schon. Die Sache mit der Fahrgemeinschaft hat allerdings etwas. Jemand, der sich an den Benzinkosten beteiligt, wäre ein echter Glücksfall. Ich nicke. »Gern. Ich bin zwar nur dreimal die Woche am College, aber dann können wir auf jeden Fall zusammen fahren.« Bevor ich ihn fragen kann, was er studiert und wieso sie hergezogen sind, wirft sich Maddie atemlos neben mich in den Sand und schnappt japsend und lachend nach Luft.
»Ich bin Maddie«, stellt sie sich Miller vor, dreht sich auf den Bauch und mustert ihn interessiert. Dann schüttelt sie ihm die Hand wie auf einem hochoffiziellen Empfang und klaut mir meine mittlerweile warme Coke.
»Das ist Miller«, stelle ich meinen Nachbarn vor. »Er ist heute ins Grayson-Haus eingezogen.«
Sie nimmt einen Schluck, verzieht das Gesicht und spuckt die Flüssigkeit in den Sand. »Das ist echt widerlich.« Sie kippt auch die restliche Coke aus und nimmt sich eine frische aus der Kühlbox. »Damit meinte ich nicht dich oder das Haus«, stellt sie an Miller gewandt klar und sieht ihn mit diesem Augenaufschlag an, den sie für heiße Typen reserviert hat. Aber er reagiert gar nicht darauf.
Maddie schüttelt den Kopf, schnaubt und steht auf. Sie ist es nicht gewohnt, dass man sie ignoriert. »Entwickelt sich langsam zu einem Club, das hier.« Sie umkreist Miller und mich mit dem Finger und verdreht die Augen. »Wenn ihr noch keinen Namen habt, hätte ich einen Vorschlag. Wie wäre es mit: Der Club der melancholischen Beachboys?«
Ich lache. Gefällt mir.
Maddie verdreht die Augen. »Ich gehe lieber wieder tanzen, nur falls es einen von euch interessiert.« Mit wiegenden Hüften bewegt sie sich zurück zu dem Platz weiter unten am Strand, wo die Musik am lautesten ist.
»Deine Freundin?« Miller ist bei seinem dritten Bier. In nicht mal zehn Minuten. Und ich ertappe mich dabei, ihm sagen zu wollen, dass er halblang machen sollte, sonst schießt er sich am Ende komplett ab. Aber ich bin nicht seine Mom.
»Nein.« Ich grinse. »Maddie ist eine gute Freundin und wenn wir Spaß haben wollen, ist sie manchmal auch etwas mehr, aber wir sind nicht zusammen. Im Grunde bin ich nicht mal ihr Typ.« Miller schon.
»Okay.« Er sagt es so, dass vollkommen klar ist, er wird den Bro-Code trotzdem respektieren. Ich mag ihn. Und das nicht nur deswegen.
5. nevah
Das anhaltende Vibrieren meines Handys weckt mich. Der Film ist zu Ende. Der Abspann eingefroren. Schlaftrunken taste ich nach meinem Telefon und kontrolliere die Uhrzeit – zwei Uhr morgens. Verflucht. Millers Name blinkt im Rhythmus des Vibrationsalarms auf dem Display auf. Natürlich ist er es.
»Hey«, lallt er, bevor ich etwas sagen kann. »Bin drüb’n …« Er stöhnt, sucht nach Worten. »Schaffs nich nach Hause.« Etwas poltert, dann folgen Stille und ein schweres Seufzen.
»Miller?«
»Penn bei Jax … Bis morgen.«
Wow. Es hat sage und schreibe einen halben Tag gedauert. Ich habe nicht einmal meinen Koffer ausgepackt und Miller hat es schon hingekriegt, sich in Schwierigkeiten zu bringen.
»Von wegen bis morgen«, fahre ich ihn an. »Du schläfst auf keinen Fall bei irgendwem, den du kaum kennst.« Ich stehe auf und sehe zum Haus unseres Nachbarn hinüber. Dort brennt noch immer Licht. Musik dringt gedämpft durch die Fenster. Leiser, aber es ist derselbe Elektrosound, der auch durchs Handy sickert. Miller ist dort. »Ich komm dich holen.« Mom und Dad sollen sich keine Sorgen machen, nur weil er nicht mehr in der Lage ist, die paar Yards nach Hause zu kriechen.
»Muss du nich. Ich komm klar.« Seine Stimme klingt verwaschen und fremd.
»Ja, ist nicht zu überhören. Bleib, wo du bist, ich bin gleich da.« Wütend lege ich auf und horche ins Erdgeschoss. Mom und Dad scheinen zu schlafen. Gut.
Leise schleiche ich mich die Treppe hinunter und schalte die Alarmanlage aus. Die Schließmechanismen dröhnen durch die nächtliche Stille, als ich die Schlösser aufsperre. Mit einem letzten Blick auf Moms und Dads Schlafzimmertür schlüpfe ich aus dem Haus.
Auf der Veranda werfe ich mir meine Sweatjacke über. Obwohl es noch immer warm ist, lässt mich die Brise vom Ozean frösteln. Schatten begleiten mich, als ich aus dem Lichtkegel unserer Verandabeleuchtung trete. Es sind nur knapp hundert Yards bis zu dem Haus auf der anderen Straßenseite der Seaside Lane. Ich hole Luft. Das schaffe ich. Ich muss nur losgehen. Hundert Yards. Vielleicht etwas mehr.
Nach nicht mal fünf Schritten umschließt mich die Dunkelheit, drückt mir die Luft ab. Mein Herz beginnt zu rasen. Umrisse schälen sich aus der Finsternis. Der Wind wird zu Atemzügen, die meine Haut streifen. Ich blinzle, kämpfe mit der Panik, Millers Mist wäre uns bis hierher gefolgt und würde nach mir greifen. Das ist nicht real. Ich weiß das. Ich bin nicht dumm. Aber es zu wissen und es zu fühlen, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ich beginne zu laufen. Schneller. Immer schneller. Bis ich die Veranda auf der anderen Straßenseite erreiche. Das Blut rauscht in meinen Ohren und die Angst kribbelt in meinem Nacken. Ohne zu klingeln, reiße ich die Haustür auf und stolpere ins Innere. In eine Welt voll Musik und Licht, in der ich mir kindisch vorkomme, weil ich mich mit neunzehn Jahren wieder im Dunkeln fürchte.
Mit pochendem Herzen sehe ich mich um, versuche meinen Atem zu kontrollieren. Immerhin hat niemand meinen peinlichen Auftritt gesehen, denn ich stehe allein in der riesigen Eingangshalle. Vermutlich passt unser komplettes Haus in diesen Teil des Gebäudes. Die Halle öffnet sich in ein Wohnzimmer mit angeschlossener Küche. Die ist geradlinig und modern eingerichtet, genau wie der Rest des Hauses. Und ohne Frage teuer.
Aber nicht so unbezahlbar wie der Blick von hier auf den Ozean, in dem sich der Mond spiegelt. Die Party, die ich erwartet hatte, ist schon vorbei. Die Musik dröhnt zwar immer noch aus zwei tragbaren Partyboxen, die jemand achtlos in den Sand gestellt hat, aber nur mein Bruder sitzt völlig dicht auf einem der exklusiven Rattansofas der Veranda. Sonst ist niemand zu sehen. Nicht mal der Muskelshirt-Typ.
Eilig durchquere ich den Wohnraum und laufe nach draußen. »Dein Taxi ist da«, sage ich und stupse Miller an. »Lass uns gehen.«
Er versucht sich aufzurichten, ist aber nicht besonders erfolgreich damit. Er kippt hintenüber und bevor er seine Augen schließt, sehe ich, dass seine Pupillen unnatürlich vergrößert sind. Da war definitiv nicht nur Alkohol im Spiel. »Jetzt komm schon«, stoße ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.
»Du bist sauer«, nuschelt er überrascht.
Wundert ihn das jetzt echt? »Vielleicht kann ich mir etwas Besseres vorstellen, als dich nachts um zwei von der Straße zu kratzen.«
Er lacht, aber es klingt hohl. »Keine Straße, ’n verdammtes Strandhaus. Und fuck, ich hab dich nicht gebeten. Außerdem …« Er hebt den Zeigefinger, die Augen noch immer geschlossen. »… würd ich dasselbe tun, wenn du …« Er stöhnt leise und tippt sich gegen die Brust. »Wenn du … mal so bist.«
Um mich zu retten, müsste er zu dem Zeitpunkt nüchtern sein. Eher unwahrscheinlich. Und noch unwahrscheinlicher ist es, dass ich je in so eine Situation geraten werde.
Ich packe seinen Arm und lege ihn mir um die Schultern, sodass er sein Gewicht auf mich stützen kann. Als ich ihn hochhieve, geraten wir jedoch ins Straucheln. Es gelingt mir gerade noch, meinen Bruder aufs Sofa zurückzubugsieren, bevor wir gemeinsam zu Boden krachen. »So wird das nichts.«
»Sorry«, nuschelt Miller und streckt seinen Arm nach mir aus, aber ich reagiere nicht darauf und er lässt ihn zurück auf seine Brust fallen.
Wenn es ihm wirklich leidtäte, würde er nicht total betrunken vor mir liegen und damit exakt das tun, was überhaupt erst die Lawine ausgelöst hat, die unser Leben unter sich begraben hat. »Wo ist der Typ, der hier wohnt?«
»Jax?«, nuschelt Miller schläfrig. »Ist mit Maddie aufs Zimmer. Rummachen.«
Na großartig, dann werde ich ihn wohl stören müssen. Die absolute Traumvorstellung für meinen ersten Abend hier. Aber ich habe keine Alternative. Also gehe ich ins Haus und suche nach unserem Nachbarn. Am Ende des Flurs werde ich fündig. Das ist eindeutig ein … Stöhnen.
Ich beiße mir auf die Lippen und verfluche Miller. Ich verfluche, verfluche, verfluche ihn.
»Maddie«, höre ich eine heisere Männerstimme. Dunkel und rau. Dann folgt ein Lachen, das unverhofft meine Zellen auf links bürstet. Dabei gilt es nicht mir, sondern seiner Freundin, mit der er ganz offensichtlich gerade Sex hat. Ich werde sicher nicht hier stehen, ihnen dabei zuhören und damit eine weitere psychomäßige Norman-Bates-Vorstellung hinlegen.
So lange neben meinem schlafenden Bruder zu warten, bis sie fertig sind, scheidet ebenso aus. Wenn Mom und Dad mitkriegen, dass wir beide um diese Uhrzeit nicht zu Hause sind, kriegen sie einen Herzinfarkt. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, Augen zu und durch. Ich klopfe.
Hinter der Tür ist ein Fluchen zu hören, dann eine weibliche Stimme. »Mach nicht auf«, gurrt sie.
»Warte eben, okay?« Der Typ.
Es dauert zwei Sekunden, dann wird die Tür einen Spalt breit aufgezogen und Jax’ verwuschelter Haarschopf erscheint im Türrahmen. Er trägt nichts außer einer Boardshorts, die seine Erregung null verdeckt. Und er bemüht sich auch kein Stück, sie zu verbergen. »Was?«, knurrt er beim Öffnen der Tür, gefolgt von einem überraschten Lächeln, als er sieht, dass der Störenfried weiblich ist. Vermutlich ein Reflex.
»Sorry, dass ich euch unterbrechen muss.« Ich führe nicht aus, wobei. Ist ja eindeutig. »Aber du hast Miller abgefüllt. Er ist mein Bruder«, füge ich erklärend hinzu. »Und da ich nicht Hulk bin, bräuchte ich Hilfe, um ihn nach Hause zu schaffen.«
»Als ich ihn zuletzt gesehen habe, lag er bequem. Lass ihn einfach auf dem Sofa pennen. Zum Frühstück ist er zurück. Oder vielleicht rechnest du lieber erst zum Lunch mit ihm.« Er lacht.
Nicht witzig. »Nein«, sage ich knapp, aber mit so viel Nachdruck, dass er zumindest die Tür nicht wieder verschließt. »Ich werde ihn nach Hause bringen«, füge ich hinzu. »Entweder du hilfst mir dabei oder ich versuche es allein. Könnte aber sein, dass ich mir bei der Aktion den Hals breche. Und in dem Fall wird das mit dem Sex heute gar nichts mehr, weil Rettungssanitäter durch dein Haus turnen. Dürfte schneller gehen, wenn du mir kurz hilfst.«
Er mustert mich zweifelnd und grinst dann. »Wenn du mich so nett bittest, habe ich wohl keine Wahl.« Er verschwindet kurz im Zimmer und ich höre ihn leise mit seiner Freundin sprechen. Wenig später taucht er wieder auf. Ein Shirt in der Hand, das er sich irritierenderweise nicht überzieht. Er drängt sich an mir vorbei und mein Blick bleibt automatisch an seinem Rücken haften. Ein muskulöser Rücken, sonnengebräunt und definiert genug, um mich für einen Moment aus dem Gleichgewicht zu bringen. Als müsste er maximal viel von diesem Killerbody zur Schau stellen, sitzen die Boardshorts eine Spur zu tief auf seinen Hüften.
»Starrst du mir gerade auf den Hintern?« Er dreht sich im Laufen um, grinst und geht dann weiter zu Miller, der noch immer unbeweglich auf dem Sofa liegt.
»Ich … Nein!« Eingebildeter Mistkerl. »Hab mich nur gefragt, ob ich dir zeigen muss, wie man sich anzieht.«
Er ist vor meinem Bruder stehen geblieben, streift sich lässig das Shirt über und wirft mir dann ein Hundert-Kilowatt-Lächeln zu. »Hilfe brauche ich eigentlich nur beim Ausziehen.«
Vor nicht einmal zwei Minuten wollte er noch mit seiner Freundin schlafen. Und jetzt flirtet er mit mir. Typen wie er sind das Allerletzte. Da kann er so heiß sein, wie er will. »Google es einfach. Gibt bestimmt eine Anleitung.«
Er lacht leise und deutet dann auf Miller, der tief und fest schläft. »Sicher, dass du Dornröschen wecken willst?«
Ich nicke.
»Na gut, dann wollen wir mal.« Er schlingt genau wie ich vorher Millers Arm über seine Schultern und wuchtet ihn hoch. »Na, komm, Kumpel, hilf ein bisschen mit.«
Miller blinzelt, während ich an seine andere Seite eile und ihn ebenfalls stütze.
»Bin ein Arschloch«, lallt er und sieht mich dabei an. »Tut mir … leid.«
Ich nicke, presse die Lippen aufeinander, konzentriere mich auf das Gewicht meines Bruders, das mich fast zu Boden zwingt. Wie sinnbildlich.
»Schon tausend Mal gesagt«, nuschelt er. »Aber du glaubst mir ja nicht.« Er stolpert und nur dank Jax’ Hilfe schlägt er nicht der Länge nach hin.
Ich antworte nicht. Was soll ich auch sagen? Dass Taten wichtiger sind als leere Worte? Dass ich wünschte, er hätte mit seinen Entscheidungen nicht unser Leben gegen die Wand gefahren? Dann wären wir nicht gezwungen, hier zu sein.
»Ach, fuck«, stößt er leise hervor und sein Kopf sackt auf meine Schulter.
Ich keuche und beiße die Zähne zusammen. Wenigstens hält Jax sich mit Kommentaren zurück, während ich versuche, möglichst viel Gewicht meines Bruders selbst zu tragen. Weil er nun mal mein Problem ist, nicht das anderer Leute. Verbissen starre ich auf die tiefschwarzen Buchstaben LOL, die drei seiner Finger zieren. Von dort bildet der Handrücken einen blassen Graben unberührter Haut, bevor sich eine Vielzahl von Tattoos aneinanderreihen und fast seinen gesamten rechten Arm bedecken. Als wir endlich unser Haus erreichen, bin ich nassgeschwitzt und meine Lungen brennen. Vielleicht sind es aber auch die Tränen, die wie ein Klumpen in meiner Brust sitzen. Ich werde nicht heulen. Nicht hier. Nicht jetzt. Am besten nie.
»Mach auf, ich halte ihn so lange.« Jax wuchtet Millers gesamtes Gewicht auf seine Seite und ich lasse meinen Bruder los, um die Tür aufzudrücken.
Aber bevor ich zulasse, dass er ihn ins Haus schiebt, bleibe ich kurz stehen. »Könntest du versuchen, leise zu sein? Ist unser erster Tag hier und … meine Eltern machen sich schon genug Sorgen.« Damit sage ich eigentlich zu viel, aber ich will nicht, dass Miller ihre Pläne kaputt macht. Denn das wird er, wenn sie mitkriegen, wie er drauf ist. Sie wollen eine Chance in diesem erzwungenen Auf-Null-Setzen sehen und ihr Leben noch mal komplett neu ordnen.
»Und ich dachte, Eltern stehen drauf, die eigene Brut vollkommen zugedröhnt zu erleben.« Er verdreht mit einem leisen Lachen die Augen und nickt. »Ich geb mir Mühe. Können wir dann? Dein Bruder ist echt schwer. Trainiert er?«
Ich schlüpfe wieder unter Millers anderen Arm. Gemeinsam zerren wir ihn ins Haus.
»Boxen«, murmelt Miller und ächzt, weil er sich das Knie anstößt. »Vor tausend Jahren … in New York.«
Mir wird erst kalt und dann heiß. »Chicago«, versuche ich Millers Versprecher geradezubiegen. »Ich meine, er hat es das erste Mal in New York probiert, als wir bei Verwandten zu Besuch waren. Aber trainiert hat er in Chicago. Bis vor zwei Jahren.« Dann hat er aufgehört. Genau wie mit allem anderen, das ihm etwas bedeutet hat, und ist stattdessen mit Austin um die Häuser gezogen.
Jax’ Blick schweift über die Schlösser, die im Grunde zu wuchtig sind für die Haustür, dann zu der Alarmanlage, die Safe-House-Niveau hat. Mir ist klar, wie übertrieben ihm dieses Sicherheitssystem vorkommen muss. Er hat nicht mal seine Tür hinter uns zugezogen. Er zieht die Augenbrauen hoch, sagt aber nichts, während wir Miller gemeinsam die Treppe hinaufschleppen.
»Chicago«, stößt er schließlich hervor, nachdem er Miller auf das Bett fallen lassen hat, und lockert vorsichtig die Muskeln seiner Schultern. Dabei stößt er einen leisen Pfiff aus. »Da ist ziemlich was los. Im Gegensatz zu hier. Was verschlägt euch ausgerechnet in so eine winzige Stadt wie Rockaway Beach?«
Miller schnarcht leise und erinnert mich daran, dass unsere Mission erfolgreich beendet ist. Jax kann jetzt zu seiner Freundin gehen. »Danke«, flüstere ich, anstatt seine Frage zu beantworten. Keine Ahnung, warum ich leise rede. Miller ist so weit weg, dass er selbst eine Zombie-Apokalypse verschlafen würde.
»Keine Ursache.« Er reicht mir die Hand und als ich sie ergreife, fühlt sich das seltsam vertraut an. »Ich bin übrigens Jax.« Seine Stimme und die Berührung bewegen all die winzigen Atome in meinem Blut. Bloß eine physikalische Reaktion …
»Nevah«, murmle ich und entziehe ihm meine Hand, weil er sie nicht sofort wieder freigibt. »Wie gesagt, danke. Ich bring dich noch raus.« Und versetze dann das Haus zurück in den Fort-Knox-Zustand, der uns ein Gefühl von Sicherheit geben soll.
»Oder du kommst noch mit rüber und wir feiern, dass wir den schweren Sack unterm Radar die Treppe hochbekommen haben.« Er macht einen Schritt auf mich zu und kommt mir dabei so nah, dass ich die Wärme seines Körpers wahrnehme.
Mein Atem stolpert. Dabei kann ich es mir nicht leisten zu straucheln. Ich schließe die Augen. Schlucke. Ihn nicht anzusehen, bringt rein gar nichts. Ich reagiere trotzdem auf ihn. »Drüben wartet jemand auf dich«, krächze ich und versuche die Gänsehaut zu vertreiben, die seine Nähe auslöst. Mein Körper ist ein verdammter Verräter.
Er fährt sich über den Nacken. »Maddie ist längst nach Hause gegangen. Sie wartet nicht. Ist nicht ihr Ding.«
Seine Worte bringen zumindest mein Hirn wieder zur Vernunft. »Ein schlagendes Argument, wirklich«, schnaube ich und schlüpfe an ihm vorbei auf den Flur. »Aber ich werde ganz sicher nicht als Ersatz für dein verpatztes Date herhalten. Außerdem reicht es, dass du einen aus unserer Familie abgefüllt hast.«
Er steigt die Treppe hinab und bewegt dabei einen schwarzen Casinochip über seine Fingerknöchel. Auf halbem Weg zur Tür hält er inne und dreht sich noch einmal zu mir um. »Nur fürs Protokoll: Ich mag deinen Bruder, wir hatten Spaß, aber abgefüllt hab ich ihn nicht.«
6. jackson
Ich habe jede Lampe im gesamten Haus angeknipst. Aber die Helligkeit hält das abrupte Geräuschvakuum nicht auf, das sich durch die Räume frisst, seitdem ich die Musik ausgestellt habe.
Maddie ist weg. Ich hatte nichts anderes erwartet. Sie hat mir eine Nachricht geschrieben, dass ich mich die Tage melden soll, wenn ich mit dem Pfadfinderspielen durch bin und stattdessen Lust habe, mit ihr abzuhängen. Sie ist toll. Unkompliziert. Nicht nachtragend. Und am wichtigsten, sie sieht nicht mehr in mir als eine nette Ablenkung, bevor sie am Ende des Sommers für ein Semester nach Frankreich geht. Das ist gut. Denn ich kann derzeit niemanden gebrauchen, der mir so nah kommt, dass es mir den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn es schiefgeht. Maddie ist wie die Musik, die die halbe Nacht durchs Haus gedröhnt hat. Nicht mehr. Meine Ablenkung von der Stille, die ich einfach nicht ertrage. Weil sie diesen ätzenden Gedanken Platz einräumt. Gedanken von der Sorte Was-wäre-Wenn, die noch nie irgendwen weitergebracht haben. Ich fülle ein Glas mit Leitungswasser und stürze es herunter. Im Fenster spiegelt sich die Tür zu Dads Arbeitszimmer. Sie steht offen.
Es gibt nicht viele Regeln in diesem Haus. Im Grunde ist es mir egal, was die Leute treiben, wenn sie hier sind. Hauptsache, sie haben eine gute Zeit. Nur mein Zimmer und dieser Raum sind tabu. Die Türen sind deswegen immer verschlossen. Eigentlich.
Ich stelle das Glas in die Spüle und nähere mich Dads Büro. Sieht nicht so aus, als hätte jemand hier drin gefeiert. Keine Kippen auf dem Boden. Keine Plastikbecher oder Flaschen. Penible Ordnung auf dem Schreibtisch.
Wesentlich wahrscheinlicher ist, dass Dad die Tür offen stehen lassen hat. Er war heute hier und auch wenn ich wünschte, er hätte das Haus nicht betreten, es gehört ihm. Er hat jedes Recht hineinzugehen, obwohl ich hier wohne und es sich anfühlt, als würde er damit eine Grenze übertreten. Ich atme tief durch. Mitten auf dem Schreibtisch liegt der Schlüssel für die Tür.
»Scheiße, Dad«, murmle ich leise. Früher gab es für mich nichts Größeres, als in diesem Zimmer zu sein. Dad bei der Arbeit zuzusehen und ihm zu helfen. Ich wollte so sein wie er, seitdem ich denken kann. Jetzt bin ich nicht sicher, wer zum Henker ich überhaupt sein will. Wer ich bin.
Alles, was ich weiß, ist, dass sich jede Körperzelle von mir sträubt, den Raum zu betreten. Und Dad hat mit Sicherheit gewusst, dass es mir so gehen würde. Deswegen hat er den Schlüssel so platziert, dass ich gar nicht anders kann.
Mit der Zungenspitze fahre ich mir über die Lippen, löse mich schließlich vom Türrahmen und fische den Schlüssel von der Tischplatte. Es ist nur ein Raum. Ein Schlüssel – und darunter ein Scheck. Er ist fertig ausgefüllt mit Dads schnörkelloser Schrift. Das Ausstellungsdatum ist von heute. Daran haftet eine Notiz.
Nimm das Geld, Jackson. Du musst von irgendetwas leben.
Dad
Ich starre auf die Buchstaben. Durch sie hindurch. Bis zum Kern dieser Nachricht.
Er denkt, ich käme nicht klar ohne ihn. Er nimmt mir die Entscheidung ab, auf welche Art ich leben will. Von welchem Geld. So wie er mir jede Entscheidung abgenommen hat.
Ich schließe meine Finger um das Papier, zerknülle den Scheck und werfe ihn in den Papierkorb unter dem Tisch. Ich bin so wütend, dass das Blut in meinen Adern rauscht.
Erst der rhythmische Klang der Wellen draußen auf der Veranda beruhigt mich etwas. Ich atme tief durch, streife mir die Laufschuhe über, die ich gestern achtlos von den Füßen gestrampelt habe, und renne los. Hinunter zum Wasser und dann immer am Ufer entlang. Mein Herzschlag stößt hart gegen die Rippen und mein Hirn ist ab einem bestimmten Punkt allein damit beschäftigt, Luft in meine Lungen zu pumpen. Ich laufe zu dem entwurzelten und von den Gezeiten gezeichneten Baumstamm, der immer mein Ziel ist. Aber ich setze mich nicht und belohne mich vor dem Rückweg mit dem Blick auf die Twin Rocks, sondern powere mich mit Kraftübungen aus, bis mein Magen rebelliert und meine Muskeln brennen. Erst dann schleppe ich mich erschöpft zurück nach Hause.
Die Klamotten ziehe ich auf dem Weg ins Bad aus, sodass sich ein Pfad aus Schmutzwäsche durch das Erdgeschoss zieht, und lasse das heiße Wasser meine verspannten Muskeln massieren. Als die Temperatur merklich abkühlt, trockne ich mich notdürftig ab, werfe mir frische Kleidung über und setze mich auf eines der ausladenden Sofas hinterm Haus, auf denen vorhin noch Miller gelegen hat. Ich mag ihn und er hat die Party definitiv auf ein neues Level gehoben. Auch wenn er am Ende vollkommen hinüber war. So hinüber, dass ihn seine Schwester einsammeln musste.
Nevah. Ich schnaube. Sie hat mich wie einen Mistkerl behandelt, den man dringend auf Abstand halten sollte. Dabei habe ich ihr nichts getan. Im Gegenteil. Ich habe ihr geholfen und war so nett, dass ich dafür ein Pfadfinderabzeichen verdient hätte.
Seufzend lehne ich meinen Kopf zurück. Es ist bereits nach vier Uhr morgens. Um acht muss ich beim ersten von Petes Kunden sein und mir ist klar, dass es sich rächen wird, wenn ich nicht endlich die Kurve bekomme und schlafen gehe. Aber statt die Augen zu schließen, sehe ich lieber zu, wie sich der Himmel blassrosa verfärbt. Mit dem Handy mache ich ein Foto und lade es auf Instagram hoch.