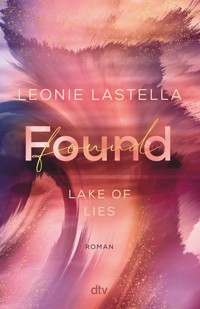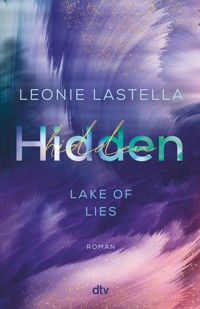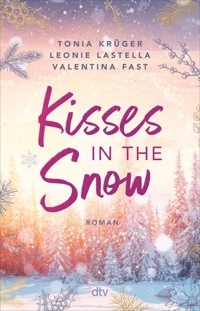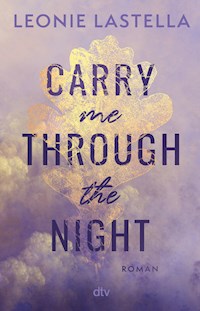9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nicht nur eine Lüge, auch die Wahrheit kann Herzen brechen Leonie Lastella erobert mit ihren sympathischen Figuren, einem frischen Ton und einer Prise Tiefe die Herzen der Leser*innen. So facettenreich wie das Leben und die Liebe selbst: intensiv, stürmisch – und dann wieder sanft Als Hope Cooper kennenlernt, ist sie wütend. Wütend auf ihre Mutter, die ihren Vater hintergangen hat, wütend auf die Welt, die ihr einen geliebten Menschen genommen hat. Doch Cooper gelingt es mit seiner unvergleichlichen Art, Hope zumindest für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen zu lassen. Auch Cooper genießt die gemeinsame Zeit und wünscht sich am Ende des Tages, Hope wiederzusehen. Denn nach allem, was er erlebt hat, waren die Stunden mit ihr die glücklichsten seit Langem. Doch dann erfährt Cooper, dass ihre Liebe womöglich keine Chance hat. Er behält es für sich – wohl wissend, dass dieses Geheimnis seine Beziehung zu Hope zerstören könnte … »›So leise wie ein Sommerregen‹ hat mich tief bewegt. Cooper und Hope sind der beste Beweis, dass sich zwei Menschen gegenseitig Luft geben können, wo sie allein zu ersticken drohen.« Nikola Hotel Folgende weitere Romance-Titel sind von Leonie Lastella bei dtv erschienen: »Das Licht von tausend Sternen« »Wenn Liebe eine Farbe hätte« »Carry me through the night« »Seaside Hideaway – Unsafe« »Seaside Hideaway – Unseen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Leonie Lastella
So leise wie ein Sommerregen
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Mama und Papa.
Ihr habt mich mutig gemacht.
Mutig genug, um zu träumen
und ich selbst zu sein.
Prolog
Die Bilder an der Wand meines Zimmers vibrieren, als mehrere Kampfjets tief über das Dach unseres Hauses auf der Militärbasis hinwegdonnern. Die Typen im Cockpit ziehen mal wieder eine Show über Cherry Point ab. Da ihr Auftrag wohl kaum lautet, den Normalsterblichen, die auf der Basis wohnen, das Trommelfell mit einem Tiefflug zu zerfetzen, tippe ich auf ausgewachsene Egoprobleme.
Seufzend schnappe ich mir meinen Rucksack, in dem ich Kleidung, eine Zahnbürste und mein Kissen verstaut habe, und hüpfe die Treppenstufen hinab. Zumindest brauche ich mein Partyoutfit für heute Abend nicht unter einem schlichten Pullover zu verstecken. Mom ist nicht da. Sie arbeitet eine Doppelschicht im Krankenhaus. Ich öffne den Kühlschrank, schnappe mir den Orangensaft und trinke direkt aus der Verpackung. Mom würde einen Anfall bekommen. Auf dem Küchentisch liegt eine Nachricht von ihr. Natürlich.
Vergiss nicht abzuschließen, wenn du gehst, und lass dich von Ivy nicht zu irgendwelchem Blödsinn überreden. Und keine Partys, Pumpkin. Viel Spaß, Mom.
Ich verdrehe die Augen und stelle den Saft zurück. Pumpkin. Sie nennt mich immer noch so. Nur weil ich mich im Kindergarten drei Jahre hintereinander an Halloween als Kürbis verkleidet habe und das Kostüm auch dazwischen kaum ausziehen wollte. Ich hasse diesen Spitznamen. Nur bei Dad stört er mich nicht. Ich vermisse ihn, aber es ist noch zu früh, um ihn per Skype zu erwischen. In Kandahar ist es noch mitten in der Nacht.
Das Wochenende werde ich bei den Johnsons verbringen. Wie immer, wenn Mom arbeiten muss. Etwas, worauf ich mich im Grunde freue, auch wenn es mich ärgert, dass Mom nur deswegen darauf besteht, weil sie nicht will, dass ich allein zu Hause bin. Frustriert knülle ich die Nachricht zusammen. Ich bin achtzehn. Viele meiner Freunde ziehen jetzt nach unserem Highschool-Abschluss auf den Campus, in andere Bundesstaaten, ans andere Ende des Landes. Ivy ist eine von ihnen. Mir traut Mom nicht mal zu, zwei Tage allein zu bleiben.
Ich schultere den Rucksack, nehme die Schlüssel für meinen Wagen und will gerade die Haustür hinter mir zuziehen, als ein schwarzer SUV in die Einfahrt einbiegt und mich zuparkt.
Ein ungutes Gefühl umschlingt augenblicklich meine Eingeweide und wird zu einem heißen Brennen, als zwei Männer in Uniform aussteigen. Es gibt nur einen Grund, warum Militärs in Uniform, mit unbeweglichem Gesichtsausdruck und im Gleichschritt, Privatgrundstücke betreten. Es muss etwas mit Dad sein. Das darf nicht … Ein Stöhnen verkantet sich in meiner Kehle. Die beiden Männer erreichen die Veranda und bleiben vor mir stehen. Den einen kenne ich. Jake. Er war in derselben Einheit wie Dad und hat uns ein paarmal besucht. Seitdem er im Einsatz verletzt wurde, arbeitet er für den Casualty Notification Sevice. Die Männer, die niemand sehen will. Sie überbringen die schlimmsten aller schlimmen Nachrichten. Jake darf nicht hier sein. Mir ist eiskalt, obwohl die Sonne unbeirrt meine Haut wärmt.
»Miss Miller?«, spricht mich sein Kollege an.
Ich sehe nicht auf. Mein Blick bleibt an den Abzeichen auf Jakes Brust hängen. Sie sind schief. Einige Millimeter nur, aber ich habe den irrationalen Wunsch, sie gerade zu richten.
»Miss Miller?«, wiederholt sich Jakes Kollege und endlich gelingt es mir zu nicken, den Blick noch immer auf das schiefe Metall gerichtet.
»Ist Ihre Mutter zu Hause?«
Meine Beine sind wachsweich, als ich den Kopf schüttle. »Was ist mit Dad?«, bringe ich krächzend hervor. Vielleicht wird er nur vermisst. Ich klammere mich an dieser Hoffnung fest.
»Hope.« Jake wechselt wie selbstverständlich zu meinem Vornamen und sieht mich mitfühlend an. Dieser Blick zerkleinert meine löchrige Zuversicht. Seine Hand auf meiner Schulter vernichtet sie. »Was ist mit ihm?«, wiederhole ich mit wackliger Stimme. Ich weiß nicht, wieso ich hören muss, was längst klar ist.
»Wir sollten das zusammen mit deiner Mom besprechen. Ohne sie dürfen wir nicht mit dir reden.«
»Sag mir, was mit Dad ist.« Meine Stimme ist zu schwach. Da ist keine Substanz in den Worten. Kein Nachdruck. »Ist er …?« Tränen verschleiern meinen Blick. »Sonst wärt ihr nicht hier, oder?«, bringe ich schließlich hervor. Ich will, dass sie mir widersprechen, mir sagen, dass er nur vermisst wird oder verletzt ist. Schwer verletzt. Das wäre schlimm, aber nicht endgültig.
Jake wechselt einen Blick mit seinem Begleiter, bevor er sich wieder mir zuwendet. »Hope, seine Einheit wurde in der Nähe der Basis während einer Patrouillenfahrt angegriffen.«
»Jake, das ist gegen die Regeln. Sie ist noch keine einundzwanzig«, mahnt ihn sein Kollege. »Nicht ohne ihre Mom.«
Jake bringt ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Ich kenne die Regeln«, murmelt er. »Aber ihr Dad war mein Freund.« Er sieht mich unverwandt an. »Es tut mir unendlich leid, Hope. Paul ist getötet worden.«
Die Worte dringen wie Chloroform in meine Synapsen. Verlangsamen alles. Die Welt wird unscharf. Ich nicke, fühle mich unendlich weit entfernt. Von allem. Vor allem von mir selbst. »Wie?«, ist das einzige Wort, das ich hervorbringe. Ich bekomme keine Luft. Mein ganzer Körper tut weh.
»Wo ist deine Mom?«, fragt Jake sanft. »Wir bringen dich erst mal zu ihr. Dann beantworten wir alle eure Fragen. So gut, wie es uns möglich ist.«
Jake hat recht, ich brauche Mom, egal wie oft wir sonst aneinandergeraten, gerade wünsche ich mir nichts mehr als ihre Nähe. Ihre Finger, die durch mein Haar streichen, als wäre ich noch immer ein kleines Mädchen, und das Versprechen, das sie mir damit gibt, alles würde wieder gut werden. Einfach, weil sie da ist. Sie darf mich sogar Pumpkin nennen, wenn das bedeutet, dass sie diesen Albtraum beendet. »Sie arbeitet. Im Newport General«, flüstere ich.
»In Ordnung. Dann fahren wir jetzt alle gemeinsam zu ihr.«
Mit einem Kopfschütteln trete ich einen Schritt zurück. Ich kann nicht. Alles in mir sträubt sich dagegen, mein Zuhause zu verlassen. Mom soll herkommen. »Kann ich nicht hier warten? Bitte.«
Jake berührt meinen Arm, drückt ihn leicht. »Du solltest jetzt auf keinen Fall allein sein, Hope.«
»Ivy.« Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche. »Meine Freundin, ich kann sie anrufen.« Ivy ist neben Mom überhaupt der einzige Mensch, den ich jetzt sehen will. »Bitte«, flehe ich und versuche die Fassung zu wahren. »Ich kann hier auf sie warten. Ich komme klar.«
»Sie ist ihre beste Freundin«, erklärt Jake seinem Kollegen. »Sie könnte auf Hope aufpassen, bis wir mit ihrer Mom zurück sind.« Er zieht die Schultern nach oben und lässt sie wieder fallen. »Paul hätte sicher nicht gewollt, dass ich seine Tochter in dieser Situation zu irgendetwas zwinge.« Er seufzt und deutet dann auf das Telefon in meiner Hand. »Also gut, ruf sie an. Wir kümmern uns darum, dass deine Mom so schnell wie möglich nach Hause kommt.«
»Okay«, sage ich mit einigermaßen fester Stimme, während mein Herz mit jedem Schlag in der Nähe der Soldaten die Gewissheit verteilt, dass Dad nicht mehr wiederkommt. »Ich gehe rein und rufe sie an.«
Ich möchte ihnen keine Möglichkeit geben, sich das Ganze anders zu überlegen. Eilig laufe ich ins Innere des Hauses. Die Fliegentür schwingt mit einem lauten Klappen hinter mir zu. Ein endgültiges Geräusch. Mit angehaltenem Atem, die Hand auf den Mund gepresst, warte ich, bis sich Sekunden später Schritte vom Haus entfernen und kurz darauf ein Motor aufheult. Erst dann lasse ich die Luft schluchzend entweichen. Ich sinke an der Wand hinab, meine Beine seltsam verdreht. Ich zittere. Aber ich fühle nichts. Da ist kein Boden mehr. Kein Halt. Nur ein völlig fremdes Universum. Eines ohne Dad. Keine Ahnung, wie lange ich einfach nur dasitze. Starr. Unbeweglich. Tränenblind. Still bis in die letzten Winkel meiner Zellen. Erst das Vibrieren meines Handys reißt mich zurück in diese Welt. Wie betäubt taste ich nach dem Gerät, das neben mir auf dem Parkett liegt.
Ivy. Ihr Name blinkt mir entgegen. Ich wische nach rechts und presse das Telefon gegen mein Ohr.
»Hi, Butternut.« Irgendwann hat Ivy angefangen, mich so zu nennen, und damit Moms Spitznamen erweitert. Butternut Pumpkin ist wirklich der grausamste Spitzname der Welt. »Wo bleibst du denn? Du wolltest schon vor einer Ewigkeit hier sein? Bist du bereit für die Party heute Abend?«, überhäuft mich Ivy mit der für sie so typischen Flut aus Fragen.
Ihre Stimme sickert durch einen zähen Filter. Als würde uns eine ganze Welt trennen. Nicht nur ein paar Meilen. Ihre Eltern leben. Mein Dad ist tot. Anstatt zu antworten, schluchze ich.
»Hope?«, fragt sie alarmiert. »Was ist passiert?«
»Dad«, bringe ich hervor. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Ivys Dad war auch beim Militär. Bevor er seinen Dienst quittiert hat, um bei seiner Familie zu sein. Sie versteht sofort. Ich bin in den Abgrund gestürzt, vor dem ich mich mein Leben lang gefürchtet habe.
»Bleib, wo du bist. Bin in zwei Minuten bei dir.«
Sie braucht selbst bei ihrem Fahrstil mindestens zwanzig, aber ich bin trotzdem dankbar, als ich höre, wie sie bereits den Schlüssel der Johnson-Familienkutsche aus der Schale neben der Tür fischt.
»Iv, ich muss auflegen.« Mir fehlt die Kraft, Worte zu formen. Das Telefon ans Ohr zu pressen. Mich aufrecht zu halten.
»Okay. Ich bin gleich da.« Bevor Ivy das Gespräch beendet, fügt sie hinzu. »Hope, egal wie schlimm es ist, wir schaffen das. Zusammen.«
Stumm presse ich mir die Hand vor den Mund. Ich kann ihr nicht zustimmen.
Kraftlos drücke ich meine beste Freundin weg und zucke zusammen, als das Telefon direkt wieder zu brummen beginnt. Eine unbekannte Nummer. Vielleicht ist es Mom. Von einem der Diensttelefone. Ich gehe ran.
»Hope, hier ist noch mal Jake«, meldet sich Dads Freund. Er muss die Nummer vom Notification Service haben. Moms und meine Kontaktdaten sind dort für den Notfall hinterlegt. Er macht eine kurze Pause. »Wir sind jetzt im Newport General. Bist du sicher, dass deine Mom heute arbeitet?«
Natürlich bin ich sicher. Mom ist nervtötend verlässlich. Wenn sie sagt, sie arbeitet, dann tut sie genau das. »Sie ist das ganze Wochenende dort«, bestätige ich tonlos.
»Das Problem ist, sie ist nicht hier und laut Dienstplan hat sie ihre Schicht getauscht und dieses Wochenende frei. Erreichen können wir sie auch nicht.«
Er muss sich irren.
»Hope, es ist wichtig, dass wir sie finden.« Ich höre ihn gepresst die Luft ausstoßen. Dann wendet er sich wieder an mich. Die Stimme so ruhig und glatt, als würde alles nach Plan verlaufen. »Hast du eine Idee, wo wir sie sonst finden könnten? Freundinnen? Lieblingsplätze?«
Ich weiß es nicht. Es fällt mir schwer, meine Gedanken zu ordnen. Wenn Mom nicht arbeitet, ist sie hier. Ihre Form von Vergnügen ist, eine doppelte Portion Mikrowellenpopcorn und literweise Diet Coke mit mir auf dem Sofa zu vernichten, während wir uns eine kitschige Liebesschnulze ansehen. »Sie muss dort sein«, erwidere ich mit kindlichem Trotz.
»In Ordnung, wir werden sie schon finden. Ist Ivy mittlerweile bei dir?«
Im Haus ist es totenstill. Staub steht unbeweglich im einfallenden Sonnenlicht. Unbeweglich wie meine Welt. Ich bin allein, aber wenn ich das zugebe, würden Jake und sein Begleiter mich abholen kommen.
»Hope?« Jakes Stimme erinnert mich daran, dass er auf eine Antwort wartet.
»Sie ist hier«, beeile ich mich zu sagen. Ich lüge selten. Und normalerweise bin ich schlecht darin. Aber jetzt kommen mir die Worte leicht über die Lippen. Die Nachricht von Dads Tod hat sowieso sämtliche Regeln außer Kraft gesetzt.
»Kannst du sie mir geben?«
»Sie ist gerade in der Küche und macht mir einen Tee. Ich habe mich oben hingelegt.« Das ist meine Stimme, aber die Person am Telefon fühlt sich nicht an wie ich.
»Okay, sag ihr, sie soll bei dir bleiben, bis wir da sind. Ich melde mich wieder. Wir beeilen uns, in Ordnung?«
»Okay.« Nachdem ich mich bedankt habe, lege ich auf, bevor Jake sich wundern kann, dass Ivy noch nicht mit dem Tee aufgetaucht ist.
Dann versuche ich Mom zu erreichen. Das Freizeichen ertönt. Aber die Mailbox schaltet sich ein. Mom stellt ihr Handy lautlos, wenn sie bei der Arbeit nicht gestört werden will. Nur arbeitet sie nicht. Also wo, zum Henker, steckt sie? Und wieso hat sie mir gesagt, sie würde arbeiten, wenn sie ihre Schicht getauscht hat?
Es gibt Dinge, die würde Mom nie tun. Vom Plan abweichen. Ausgelassen sein. Mich belügen. Ich schiebe die Erinnerungen weg, die mir beharrlich das Gegenteil beweisen. Zumindest, was den letzten Punkt angeht. Das war ein Mal. Ein einziges Mal. Und es ist Jahre her.
Verzweifelt versuche ich es weiter unter Moms Nummer. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jedes Mal lande ich auf der Mailbox.
Was wenn ihr etwas zugestoßen ist? Das wäre die einzige logische Erklärung, warum ich sie nicht erreichen kann. Panik breitet sich in mir aus, überschwemmt mich. Nicht auch noch Mom.
Tränen verwischen die Farben meines Handydisplays. Ich blinzle das Bild wieder scharf und bleibe an der Tracking-App hängen. Mom hat sie auf unseren Geräten installiert und sich auch nicht durch meinen Wutanfall davon abbringen lassen. Das ist so grenzüberschreitend. So überbehütend. So typisch für sie. Sie ist ein echter Kontrollfreak. Das treibt mich in den Wahnsinn. Aber gerade bin ich heilfroh, dass sie sich damals durchgesetzt hat. Denn über die App kann nicht nur Mom mich orten. Das Ganze funktioniert auch andersherum.
Ich öffne die App. Es dauert einige Sekunden, bis mir eine Adresse auf den Outer Banks, den vorgelagerten Inseln vor North Carolinas Küste, angezeigt wird. Etwas außerhalb von Port Haven, wo Ivy mit ihrer Familie wohnt. Ihr Standort liegt mitten im Nirgendwo. Dort gibt es nichts außer einer Straße und einigen verstreuten Häusern. Niemand, den wir kennen, wohnt in dieser Gegend. Vielleicht wollte Mom vor dem Dienst laufen gehen und hat sich verletzt.
Wahrscheinlich sollte ich warten, bis Ivy hier ist. Es wäre sicher gut, nicht allein nach Mom zu suchen. Wer weiß, was mich dort erwartet. Andererseits braucht Ivy noch eine halbe Ewigkeit und wir müssen sowieso zurück auf die Outer Banks. Ich schreibe ihr eine Nachricht, dass wir uns auf der Insel treffen, und hänge die Adresse an, die die App ausgespuckt hat.
Ihre Antwort warte ich nicht ab, sondern renne aus dem Haus zu meinem Auto, schiebe mich hinter das Lenkrad des alten Minis und setze den Kleinwagen hart zurück. Er protestiert mit einem Ächzen des Getriebes, als ich genauso gefühllos den Vorwärtsgang einlege und die Straße der Militärbasis hinaufjage. Dad hat bei jedem Heimaturlaub mit mir an der alten Kiste herumgeschraubt. Auch wenn er nie verstanden hat, wieso ich mein Herz ausgerechnet an einen Schuhkarton auf Rädern verlieren musste, war das Auto unser gemeinsames Projekt. Dad. Mein Atem schlingert und verteilt einen dumpfen Schmerz in meinem Brustkorb. Ich zwinge mich dazu, mich aufs Fahren zu konzentrieren. Auf die Aufgabe, Mom zu finden. Trotzdem rinnen mir Tränen die Wangen hinab. Mit dem Ärmel meines Shirts wische ich sie weg, bis die Haut um meine Augen rau ist. Aufgerieben wie der Rest von mir.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Atlantic Beach Bridge, über die ich die Outer Banks erreiche, ignoriere ich. Wasseradern durchziehen die Landschaft. Es ist wunderschön auf der Insel, aber dafür habe ich gerade keinen Blick, denn wenige Meilen hinter Port Haven erreiche ich mein Ziel.
Ich bremse den Wagen vor einem weißen Holzhaus. Eine Veranda zieht sich um das Gebäude und ist überladen mit Topfpflanzen und Blumenampeln, die von den Balken hängen. Moms Wagen steht in der Auffahrt. Und ein zweites Auto. Ein hässlicher Prius.
Vielleicht besucht Mom hier nur eine Freundin, die ich nicht kenne. Erleichterung schwappt durch meinen Körper und mischt sich mit Wut. Am liebsten würde ich sie anbrüllen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ausgerechnet heute. Eine von Moms obersten Regeln ist, dass wir einander immer sagen, wohin wir gehen. Verdammt. Sie sollte nicht ihre eigenen Vorschriften brechen.
Ivy ist noch nicht hier und ein Blick auf mein Telefon zeigt, dass sie meine Nachricht noch gar nicht gelesen hat. Das bedeutet, sie wird bald in Cherry Point ankommen und noch mal so lang für den Rückweg brauchen. So lange kann ich nicht warten. Also steige ich aus und starre, auf der Auffahrt stehend, sekundenlang in den Himmel. So wie ich es immer getan habe, wenn ich mit Dad auf den Ellis Lake hinausgefahren bin und wir stundenlang geredet haben. Dann stoße ich die Luft aus meinen Lungen und laufe zur Haustür. In meinem Kopf krame ich nach Worten, mit denen ich Mom das Unaussprechliche schonend beibringen kann. Dabei gibt es keinen Weg, so etwas behutsam zu sagen. Es wird wehtun.
Auf mein Klopfen reagiert niemand. Ungeduldig versuche ich es wieder, und als sich nichts rührt, umrunde ich das Haus.
Der Teil des Gartens, der zum Wasser hin abfällt, liegt in der Sonne. Mom sitzt auf einem Deckchair unter einer riesigen Eiche. In der Hand ein Glas Wein. Den Blick aufs Wasser gerichtet. Sie lacht. Ich habe sie lange nicht mehr so ausgelassen gesehen.
Das sollte etwas Gutes sein, aber ich friere mitten in der Bewegung ein.
Denn ihre andere Hand ist fest mit der eines Mannes verschlungen. Er berührt sie, wie es nur Dad tun sollte. Wie er es nie wieder tun wird. Und das Schlimmste ist, ich kenne den Mann. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Vor fünf Jahren. Mom hat uns belogen. Die ganze Zeit über. Lautlos drehe ich mich um, flüchte, während zum zweiten Mal an diesem Tag meine Welt zerbricht.
Kapitel 1Hope
Es ist unfassbar, dass Dad bereits zwei Wochen tot ist. Noch immer denke ich, er wird irgendwann nach Hause kommen. Wie stets mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht, während er im Eingangsbereich seine Sachen fallen lässt und mich in seine Arme schließt. Ich beiße mir von innen auf die Wange, um nicht loszuheulen.
Die militärische Beisetzung vor zwei Stunden habe ich überstanden. Da werde ich die Trauerfeier auch irgendwie bewältigen. Würde Mom nur aufhören, geschäftig trauernd durch die Räume des weißen Holzhauses zu rennen, wäre es bedeutend einfacher. Es ist das Haus, in dem ich sie mit dem Prius-Mann erwischt habe. Bis heute weiß sie nicht, dass ich hier war. Dass Ivy aufgetaucht ist, als ich den Mini gerade hart zurücksetzte, und es nur meiner besten Freundin zu verdanken ist, dass ich nicht längst durchgedreht bin. Allerdings könnte sich das heute ändern.
Denn aus jedem gemütlich hergerichteten Zimmer quillt der Verrat an Dad hervor. Trotzdem musste Mom darauf bestehen, seine Trauerfeier ausgerechnet hier stattfinden zu lassen. Und nicht nur das. Wir werden hierherziehen – wir beide. Morgen schon. Jetzt, wo Dad nicht mehr lebt, können wir nicht länger auf der Basis wohnen.
Mir ist übel. Ich stehe inmitten von Menschen, die ich nicht kenne oder nicht sehen will. In einem Haus, das ich verabscheue. Alle sind in solidarisches Schwarz gehüllt, als könnten sie meinen Verlust nachempfinden. Aber sie lachen, erzählen sich belanglosen Kram und essen. Ich habe seit Dads Tod kaum einen Bissen hinunterbekommen.
»Hey, Butternut, kommst du einigermaßen klar?« Ivy stupst mich an und reicht mir einen Becher mit tiefschwarzem Kaffee, bevor sie ihren Kopf gegen meine Schulter legt und ihre Arme um mich schlingt.
»Ich muss hier raus«, murmle ich. Dringend. Das Atmen fällt mir schwer. Und ich fürchte, ich bin kurz davor, Mom eine Szene zu machen. Vor allen versammelten Trauergästen.
In diesem Moment stellt sie sich auch noch auf die unterste Stufe der Treppe und lässt ihren Ehering klingend gegen das Glas schnellen. Die Gäste drehen sich zu ihr um und hängen an ihren Lippen, als sie beginnt, von Dad zu erzählen, unserer Familie, der Liebe, die sie mit ihm verbunden hat. Mom ist eine hervorragende Lügnerin.
Mit Nachdruck stelle ich den Becher auf die Kommode neben mir und will zu ihr gehen, sie anschreien, aber Ivy hält mich zurück. Sie weiß Bescheid über das, was ich vor zwei Wochen gesehen habe. Über das, was ich vor fünf Jahren beobachtet habe.
Als ich Mom damals mit einem anderen Mann gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Ausrutscher gewesen. Ich war mir sicher, dass sie die Sache beendet hat. Und ich wollte ihr so sehr glauben, dass sie diesen Fehler bereut hat. Ich dachte, sie würde Dad lieben. Sie wäre glücklich. Sie hätte diesen Typen nie wiedergesehen.
Ich habe mich geirrt. Ivy lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich.
»Lass uns einen Moment vor die Tür gehen«, flüstert sie und zieht mich hinter sich her. Ivy weiß genau, was in mir vorgeht, und sie weiß, dass es mir im Nachhinein das Herz brechen würde, Dads Trauerfeier durch einen offenen Streit mit Mom zu entweihen. Das hier ist nicht der richtige Ort. Nicht der richtige Zeitpunkt.
Auf der Veranda legt sich der schwere Geruch der Blumen zwischen uns und beschwört die Bilder dieses Nachmittags herauf. Als ich genau hier stand und Mom mit diesem Typen gesehen habe. Ich kann das nicht vergessen.
»Hope, du musst hier weg, bevor du etwas tust, was du später bereust.«
Damit könnte Ivy richtigliegen. »Okay«, murmle ich schwach. Aber wohin? In unserem alten Haus würde Mom mich als Erstes suchen. Und sie wird mich suchen, sobald sie bemerkt, dass ich fort bin. Als Nächstes würde sie zu Ivy nach Hause fahren.
Meine beste Freundin zupft mein Handy aus meiner Hosentasche und reicht mir im Gegenzug einen Ausweis. Mein Bild. Ein fremder Name. Holly Adams.
»Wir wollten doch zusammen auf dieses Konzert im Blue Taps. Den habe ich von so einem Typen aus der Elften. Damit solltest du reinkommen. Tanz dir den Kopf frei. Trink was. Egal, aber denk für ein paar Stunden nicht an diese Scheiße hier.«
Ich habe keine Lust auf das Konzert, aber es ist die beste Alternative und hierbleiben keine Option. »Du kommst nicht mit?« Diesen Abend überstehe ich auf keinen Fall ohne Ivy.
»Irgendjemand muss deine Mom ablenken und dafür sorgen, dass sie dich nicht helikoptern kann.« Mit einer bedeutungsvollen Miene legt sie das trackingapp-verseuchte Handy auf die Verandabrüstung, als wäre es eine instabile Bombe. »Ich sage ihr, dass du einen Spaziergang machst, weil du eine Weile allein sein willst. Sobald ich kann, komme ich nach.«
Sekundenlang schließe ich die Arme um Ivy, bevor ich mich losmache und an den vielen geparkten Autos vorbei bis zu meinem altersschwachen Mini laufe. Als hätte ich es geahnt, habe ich ihn an der Straße abgestellt, nicht in der Auffahrt, wo er jetzt zugeparkt wäre. Mit einem tröstlichen Husten springt der Motor an. Ich lege den Gang ein und fahre aufs Festland. Zum Blue Taps, einer Bar ganz in der Nähe der Militärbasis. Ivy liebt die Location, weil all die schnuckeligen Anwärter hier abhängen und oft Livemusik gespielt wird. Den gefälschten Ausweis drehe ich unbestimmt zwischen meinen Fingern. Bisher brauchten wir so etwas nicht, weil wir immer mit Ivys Bruder hineingekommen sind. Aber Lyle arbeitet nicht mehr hier. Er studiert jetzt in Boston und kann mir nicht helfen. Ich hoffe, das Ding erfüllt seinen Zweck, denn außer dem Blue Taps habe ich keinen Anlaufpunkt, an dem Mom mich nicht aufspüren würde.
Kapitel 2Cooper
Ich bin müde. Im Grunde zu müde, um Mac heute Abend noch gegenüberzutreten. Zwischen uns liegt so viel Ungesagtes. Ein ganzes Jahr, in dem wir uns kaum gesehen haben. Zwölf Monate, in denen ich bei meinem leiblichen Dad gelebt habe. Weil ich es wollte. So dringend, als hätte Chase die Antworten auf all die offenen Fragen in meinem Leben. Natürlich hatte er die nicht. Stattdessen hat sich Macs Prophezeiung erfüllt. Chase hat mich mit in den Dreck gezogen. So tief, dass Macs Angebot, zu ihm zu ziehen, meine letzte Rettung ist.
Vor mir taucht eine Bar auf. Neben einer Militärbasis, an der ich vor ein paar Meilen vorbeigekommen bin, ist das der erste Anhaltspunkt auf Zivilisation in dieser Einöde. Ich bremse den Pick-up ab und lenke ihn in eine der freien Parkbuchten hinter dem Gebäude. Mir ist klar, dass ich das unvermeidliche Aufeinandertreffen mit Mac nur hinauszögere, aber ich brauche eine Pause, bevor ich die restliche Strecke bis zu seinem neuen Haus zurücklege. Eine Ranch etwas außerhalb von Newport, nahe dem Croatan National Forest. Ich lache trocken. Mac ist ein hervorragender Arzt, aber bei jedem Handwerk, das außerhalb eines OP-Saals gefragt ist, scheitert er auf ganzer Linie. Ich verstehe nicht, wieso er sich nicht ein Strandhaus oder eine stylische Stadtwohnung gekauft hat statt einer Ranch, auf der er ständig mit seinen fehlenden Fähigkeiten konfrontiert sein dürfte. Das ist mindestens so idiotisch, wie wegen einer Frau ans andere Ende des Landes zu ziehen. Oder sich aus lauter Pflichtbewusstsein einen Menschen ans Bein zu binden, der nicht mal dieselben Gene besitzt.
Ich fahre mir mit der Hand über das Gesicht und steige aus. Der Kies knirscht unter meinen Schuhen. Aus der Bar quillt ein wilder, hitziger Mischmasch aus Südstaatenmusik, Lachen und Gläserklirren. Zielstrebig laufe ich auf den Eingang zu, als mich plötzlich eine Bewegung links von mir innehalten lässt.
Ein Mädchen lehnt gekrümmt an der Hauswand. Obwohl ich sie nur von hinten sehe, macht das Zittern ihres Körpers klar, dass es ihr nicht gut geht. Vielleicht hat sie zu viel getrunken. Auf jeden Fall scheint es, als bräuchte sie Hilfe. Wahrscheinlich sollte es mich nicht kümmern. Immerhin bin ich nicht für die Probleme wildfremder Menschen zuständig, aber irgendetwas hindert mich daran, einfach in die Bar zu gehen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Vielleicht ist es die Art, wie sie ungeduldig den Kies wegkickt. Etwas daran berührt mich. Vielleicht hat Mac aber auch recht und ich muss einfach jedes gottverdammte Problem auf diesem Planeten zu meinem machen. Er ist der Meinung, ich ziehe den Ärger bewusst an. Ich glaube, es ist eine Mischung aus genetischer Veranlagung, die ich Chase, meinem Erzeuger, zu verdanken habe, und guter Erziehung, die ich dann wohl von Mac habe und die es mir einfach verbietet, Menschen sich selbst zu überlassen.
Langsam nähere ich mich dem Mädchen und berühre sie an der Schulter. Vorsichtig, damit sie sich zu mir umdreht und ich sie fragen kann, ob sie Hilfe braucht. Aber so weit komme ich gar nicht. Im selben Moment, in dem ich sie berühre, wirbelt sie herum.
Bäm. Eine Millisekunde später fliegt mir fast der Schädel weg. Ich lande auf meinen Knien. Blut rinnt aus meiner Nase. Mein Jochbein fühlt sich an, als hätte sie es in Nanopartikel zerlegt. Sie hat mir ernsthaft eine reingehauen. Benommen lasse ich mich gegen die Wand sinken, lege den Kopf in den Nacken und schäle mich aus meiner Sweatshirtjacke, die ich mir gegen die Nase presse. »Bist du wahnsinnig?«, nuschle ich durch den Stoff.
Erst jetzt gibt sie ihre Terminator-Kampfpose auf und schüttelt Beine und Arme aus. »Dasselbe könnte ich dich fragen«, knallt sie mir an den Kopf. Ihr Blick zeigt, dass es ihr leidtut, mich geschlagen zu haben, aber anstatt sich zu entschuldigen, knurrt sie: »Du hast mich zu Tode erschreckt.«
»Ich wollte nur helfen. Scheint im Bundesstaat North Carolina nicht gut anzukommen.«
»Kommt nirgendwo gut an, ein Mädchen anzufassen, das allein im Dunkeln steht.« Sie beißt sich auf die Unterlippe und scharrt Kies mit dem Fuß beiseite.
Ihre Haare sind dunkel und fallen ihr in Wellen bis über die Schultern. Sie ist hübsch. Hat sanfte Gesichtszüge, die einen glatt in Sicherheit wiegen könnten. Ich weiß es besser. Vielmehr mein Jochbein weiß es besser. Wie kann jemand so Kleines, Zierliches so einen krassen Haken haben? Ich starre sie an. Dabei sollte ich wohl besser verschwinden. Sonst verpasst sie mir am Ende noch eine. Aber stattdessen frage ich: »Kannst du mir vielleicht etwas Eis aus dem Laden holen, damit ich das hier kühlen kann?« Sonst muss ich Mac am Ende erklären, warum ich aussehe, als hätte ich mich geprügelt. Und ich wollte unseren Neustart nicht unbedingt so beginnen, wie unser letztes Treffen in Los Angeles aufgehört hat.
»Das geht nicht.« Sie tritt unruhig von einem Fuß auf den anderen und setzt sich wider Erwarten neben mich.
Kein Eis. Ich seufze und löse den Stoff von meiner Nase. Die Blutung hat scheinbar aufgehört. Immerhin.
»Verdammte Scheiße«, flüstert sie, als sie das viele Blut auf dem Stoff meiner Jacke sieht, und klingt dabei so verzweifelt, dass ich lächeln muss.
»Halb so schlimm. Ich habe nicht vor, dich zu verklagen. Alles, was ich will, ist Eis zum Kühlen.«
»Gut zu wissen.« Sie seufzt. »Aber sie lassen mich nicht in die Bar.«
Klingt, als wäre das keine große Sache. Aber ihr Blick sagte etwas anderes.
»Hab’s versucht, aber dieses Teil ist absoluter Schrott.« Mit einem verächtlichen Schnauben schnipst sie einen Ausweis auf den Boden.
Er landet so, dass ich ihren Namen erkennen kann. Holly Adams. Und sie hat recht. Wer immer diesen Ausweis gefälscht hat, hatte definitiv keine Ahnung. Kein Wunder, dass man sie nicht in die Bar gelassen hat.
Wankend rapple ich mich auf. Holly setzt meinem Kreislauf definitiv zu, und ich bin nicht ganz sicher, ob das allein auf den Schlag zurückzuführen ist.
Sie steht ebenfalls auf und will gehen, aber ich halte sie zurück, indem ich die Hand hebe. Den Fehler, sie noch mal zu berühren, mache ich nicht. »Warte. Ich hole Eis für mein Gesicht und was zu trinken für uns. Du siehst aus, als könntest du einen Drink gerade genauso gut vertragen wie ich. Außerdem ist es bestimmt sicherer, das Kriegsbeil zwischen uns mit einem Shot zu begraben.« Ich versuche mich an einem schiefen Lächeln.
Sie zögert, nickt aber. Entweder aus Mangel an Alternativen oder ich sehe tatsächlich so übel aus, dass sie aus Schuldbewusstsein bleibt.
Kapitel 3Hope
Ich sitze hinter dem Blue Taps und warte auf einen wildfremden Typen, dem ich einen Drink schulde, weil ich ihn niedergeschlagen habe. Wirklich katastrophal ist jedoch, dass dieser Tag nicht deswegen der schrecklichste in meinem Leben ist. Ich sollte vermutlich verschwinden und mich in meinem Zimmer einschließen, bevor es noch schlimmer werden kann. Selbst wenn Mom mich dort finden wird.
»Ich bin übrigens Cooper«, durchbricht eine dunkle Stimme plötzlich meine Fluchtgedanken. Die Lichter der Bar verwaschen den Anblick meines Opfers zu einer dunklen Silhouette. Er ist groß, schlank und in seinen Bewegungen steckt diese verdammte Lässigkeit, die Typen seines Schlags haben. Kerle, bei denen das Selbstbewusstsein die Größe einer Gebirgskette hat.
Er setzt sich neben mich und hält triumphierend eine Flasche in die Luft. Eine braune Papiertüte verdeckt das Etikett, aber egal, was es ist, Hauptsache, es enthält Alkohol.
Er reicht mir die Flasche und ich nehme einen tiefen Schluck. Wodka, der mir fast die Speiseröhre wegätzt, nur um Sekunden später eine dumpfe Wärme durch meinen Körper zu schicken. Dahin, wo seit der Nachricht von Dads Tod nur Kälte war. Zur Sicherheit nehme ich zwei weitere Schlucke, bevor ich Cooper die Tüte samt Inhalt zurückgebe.
»Also dann, auf dich und deinen rechten Haken, Holly?«
Holly. Der Name steht auf dem gefälschten Ausweis, der noch immer am Boden liegt. Ich nicke. Ein fremder Name. Ein anderes Leben. Heute Abend bin ich Holly. Nicht Hope, deren Leben pulverisiert wurde.
Cooper nippt nur an der Flasche, anstatt richtig zu trinken, und sieht mich unverwandt an. Als würde ihn der Alkohol nicht halb so sehr interessieren wie ich. Dafür, dass noch immer Blut an seiner Nase klebt und sein Jochbein dunkel schimmert, sieht er verdammt gut aus. Wirres blondes Haar. Bartstoppeln, die einen Schatten auf sein markantes Gesicht werfen. Kluge, unergründliche Augen und ein Lächeln, das mir im Normalfall gefährlich werden könnte. Aber nichts ist mehr normal. Trotzdem lächle ich zurück. Keine Ahnung, warum ich das tue.
Als Cooper mir erneut die Flasche reicht, berührt sein Knie sanft meines. Sekundenlang starre ich auf unsere Beine, auf seine blaue und meine schwarze Jeans. Und ich denke, dass sie irgendwie zusammenpassen. Warum denke ich so etwas? Ich sollte nach Hause fahren und trauern, wie es sich gehört – und nicht mit irgendeinem Typen hinter einer Bar trinken. Am Tag von Dads Beerdigung.
Und dennoch nehme ich einen tiefen Schluck, bevor ich Cooper die Flasche zurückgebe. Meinen Kopf lege ich auf die angezogenen Knie und sehe ihn an. Und er mich.
Fühlt sich an, als würde mich sein Blick in das Auge eines Hurrikans befördern. Die dunklen Emotionen, die in mir rotieren, stehen still. Er ist die kurze Atempause, die ich so dringend benötige.
»Wie geht es dir?«, frage ich leise, weil ich das Gefühl habe, etwas sagen zu müssen, damit er nicht aufsteht, geht und dieses Gefühl mitnimmt. Egal, ob es angebracht ist oder nicht.
Er sieht mich fragend an und deutet dann auf sein Gesicht. »Du meinst wegen deiner Kriegserklärung?« Und da ist es wieder, dieses halbe Lächeln, das seine Augen flutet und meine Taubheit durchbricht. Kurz nur. Wie ein Rettungssignal.
»Ich bin peinlich berührt, aber sonst okay, denke ich«, fügt er grinsend hinzu. »Aber sie hatten kein Eis in diesem komischen Schuppen. Man wird morgen sehen, dass ich mit dir zusammengestoßen bin.«
Ich schließe die Augen, zähle die Sekunden, bis er aufstehen und verschwinden wird, weil ich dafür verantwortlich bin. Es wird mich zurück in den Sturm katapultieren.
Aber anstatt zu gehen, fragt er leise: »Was ist passiert?«
Wie kann er überhaupt sicher sein, dass es da etwas gibt? Ich zögere. Es fällt mir schwer, Dads Tod in Worte zu fassen, und ich verstehe nicht, wieso ich es trotzdem will. Vielleicht, weil ich Cooper nicht kenne und vermutlich auch nie wiedersehen werde. Und weil ich daran ersticke. »Mein Dad ist gestorben«, flüstere ich. Fast erwarte ich, dass diese Aussage eine Detonation erzeugt, die der Luft den Sauerstoff und Cooper die Fähigkeit nimmt, mich normal zu behandeln. So ist es immer. Und ich hasse es. Aber er zuckt nicht einmal mit der Wimper.
Er nickt nur, füllt etwas Alkohol in den Deckel der Flasche, bevor er sie mir reicht. Dann stößt er vorsichtig mit mir an. »Auf deinen Dad«, sagt er ruhig.
Dann kippt er den Inhalt des Deckels hinunter und wartet, bis auch ich einen tiefen Schluck genommen habe.
»Er ist im Einsatz getötet worden. Army.« Ich atme zitternd ein. Verdränge die Bilder, die Jakes Schilderungen von Dads letzten Minuten in mir heraufbeschwören. »Und genau jetzt sollte ich auf seiner Trauerfeier sein«, fahre ich fort und stöhne. »Ich bin ein schlechter Mensch.«
Cooper lehnt den Kopf gegen die Wand und sieht in den sternenverhangenen Nachthimmel. »Es gibt keine schlechten Menschen. Wenn überhaupt, schlechte Entscheidungen. Und selbst die haben meistens einen guten Grund. Also, warum bist du abgehauen?« Seine Stimme ist dunkel, als er im selben Moment seine Hand über meine legt. Wie selbstverständlich. Sie ist groß und warm. Und ich lasse es geschehen.
Vielleicht ist es der Alkohol. Vielleicht die Ruhe, die er ausstrahlt, oder aber das leise Prickeln, mit dem er mein Innerstes füllt und das die Leere vertreibt. »Ich war dort.« Ich starre auf unsere Hände. »Aber ich musste weg. Sonst wäre ich hundertprozentig mit meiner Mom aneinandergeraten.« Ich atme tief durch. »Und wenn du nicht noch ein blaues Auge willst, frag lieber nicht, wieso, okay?« Ich lächle schief.
Zwei Wagen biegen auf den Parkplatz ein. Die Scheiben heruntergelassen. Die Musik voll aufgedreht, sodass ganz North Carolina etwas von dem Gangsterrap hat, der aus den Boxen der getunten Karren quillt.
»Okay.« Er deutet auf die Autos. »Dann frage ich lieber, wie die allgemeine Meinung zu der Musik von 6ix9ine ist?«, wechselt er mühelos das Thema.
»Du weißt, wer den Dreck singt?« Ich gucke skeptisch von ihm zu den Autos.
Er lacht. »Das ist auf jeden Fall eine klare Meinung.« Zögernd löst er seine Hand von meiner und mustert mich. »Du stehst bestimmt eher auf Country?«
Ich verziehe das Gesicht und deute über meine Schulter. »Ist keine große Kunst, das zu erraten. Du wusstest, dass ich in die Bar wollte. Und die Livebands des Blue Taps spielen nur Country in allen Variationen. Das weiß jeder.«
»Eigentlich komme ich aus Los Angeles. Ist mein erster Tag hier.« Er reibt sich übers Kinn. »Hätte also auch Zufall sein können, dass sie heute ’ne Bluegrassband dahaben.«
Ich kneife ein Auge halb zu und betrachte Cooper von oben bis unten. Er ist braun gebrannt. Seine Haare sind an den Spitzen ausgeblichen. Ich kann mir gut vorstellen, wie er, ein Surfboard unter dem Arm, am Strand steht und sich dann in die Wellen stürzt. »Und was hört ein echter California-Surfboy für Musik?« Ich nehme die Wodkaflasche und stelle sie wieder ab, ohne zu trinken. Ich hatte definitiv genug. Sonst würde ich so etwas nicht fragen. Nicht ihn. Nicht hier. Nicht jetzt.
»Vielleicht bin ich ein echter Californiaboy, aber ich surfe nicht«, berichtigt er mich.
Natürlich surft nicht jeder Mensch in Los Angeles. Das ist mir klar. Trotzdem habe ich ihn in diese Schublade geworfen. »Also kein Surfer«, rudere ich zurück. »Was tust du dann?«
»Ich mag es, Dinge zu bauen.« Er bewegt seine Hände und sieht sie eine Weile gedankenverloren an. Wie etwas, das er verloren hat. »Und jetzt bin ich hier.«
»Warum?« Ich beiße mir auf die Lippe. So etwas Privates sollte ich ihn nicht fragen. Andererseits habe ich ihm erzählt, dass mein Dad gestorben ist. Er ist neben Ivy überhaupt der Einzige, mit dem ich freiwillig darüber gesprochen habe.
Er zögert kurz. »Familiäre Gründe. Hauptsächlich.« Er räuspert sich. »Ich brauchte dringend einen Tapetenwechsel und mein Dad lebt hier. Also bin ich hergekommen.«
Hoffentlich wird er noch mehr sagen. Mit mir gleichziehen und mir etwas ebenso Intimes erzählen wie ich ihm, aber Cooper bleibt stumm.
»Allmählich sollte ich wohl los«, seufze ich unsicher, als sich das Schweigen ausdehnt. Umständlich stehe ich auf und falle nur deswegen nicht, weil ich mich mit einer Hand an der Wand abstütze und mit der anderen – an Coopers Brust. Ich spüre die Wärme seiner Haut unter seinem Shirt und den Alkohol in meinem Blut. Hastig löse ich meine Hand von seinem Oberkörper. »Entschuldige. Ich trinke normalerweise nicht«, suche ich nach einer Erklärung für mein Verhalten und gleichzeitig nach meinem Gleichgewicht und Abstand.
Aber er lässt nicht zu, dass ich mich zurückziehe, und verringert den Raum zwischen uns noch, als er mir seinen Arm um die Taille legt, um mich zu stützen. Ein angenehmer Duft nach Holz, Sonne und Meer gemischt mit einer schwachen Nuance Wodka steigt mir in die Nase. Und wirft mich aus der Bahn.
»Vielleicht bringe ich dich besser nach Hause. Wenn du allein gehst, fällst du noch hin und siehst am Ende so aus wie ich.« Er verzieht sein ramponiertes Gesicht. Ein gedämpftes Lachen schüttelt seinen Körper und meine Empfindungen durcheinander.
»Ist es weit? Ich denke, keiner von uns beiden sollte noch fahren.«
Natürlich hat er recht. Damit scheidet wohl aus, zu Mom zurückzukehren oder bei Ivy zu übernachten. Zu Fuß würden wir ewig brauchen. Im Grunde gibt es aber sowieso nur einen Ort, an dem ich heute Nacht sein will. Unser altes Haus auf der Basis. Mein Zuhause. »Ist nur rund eine Meile in die Richtung«, murmle ich. Normalerweise würde ich Cooper sagen, dass ich durchaus in der Lage bin, den Weg allein zu bewältigen. Egal, wie viel ich getrunken habe. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Aber ich mag, dass meine Gedanken stillstehen, solange er mir nah ist. Deswegen nicke ich und bin erleichtert, dass er mich begleitet. Und obwohl ich ihn eigentlich nicht kenne und zwischen mir und Cooper im Grunde nichts passiert ist, fühle ich mich das erste Mal, seitdem meine Welt implodiert ist, wieder annähernd wie ein ganzer Mensch.
Kapitel 4Cooper
Mac erwartet mich seit einer gefühlten Ewigkeit. Er macht sich sicher längst Sorgen. Ich sollte den Bogen nicht überspannen, sondern umdrehen, in meinen Wagen steigen und endlich zu ihm fahren. Noch bewegt sich die Verspätung in einem Rahmen, den ich durch Stau und zu viel Verkehr erklären könnte.
Aber ich bin angetrunken und sollte nicht mehr fahren. Und ich kann Holly nicht allein lassen. Das scheidet aus mehreren Gründen aus. Ihr Dad ist tot. Sie hatte am Tag seiner Trauerfeier einen so heftigen Streit mit ihrer Mom, dass sie abgehauen ist. Und sie ist betrunken. Durch meinen Wodka. Das Mindeste ist also, dafür zu sorgen, dass sie heil nach Hause kommt. Mein Akku ist so gut wie tot, also schicke ich Mac nur eine kurze Nachricht, dass ich mich verspäten werde und er nicht auf mich warten soll. Das Handy stopfe ich zurück in meine Hosentasche und laufe dann weiter neben Holly her. Feine, dunkle Haare kräuseln sich in ihrem Nacken. Als wir den Parkplatz verlassen haben, hat sie sie unordentlich hochgebunden. Und ich kann nicht anders, als die zarte Haut ihres Halses anzustarren und mir vorzustellen, wie es wäre, sie genau dort zu küssen. Falsche Richtung, Cooper Oak Hayes. Die falscheste Abzweigung überhaupt, die meine Gedanken da einschlagen.
Sie ist traurig und betrunken. Und ich sollte nicht einmal daran denken, ihr näherzukommen. Nicht nach allem, was passiert ist.
Wenig später hält Holly vor einem kleinen, einladenden Haus der Cherry-Point-Family-Housing-Siedlung auf der Militärbasis. »Da wären wir«, sagt sie leise und geht den schmalen Weg hinauf, der von Blumenbeeten gesäumt ist. Das Gras des Vorgartens ist sattgrün und dicht, nicht verdurstet und braun wie bei den Nachbarn. Auch wenn sich die Häuser ähneln, sind sie nicht vergleichbar. Hollys Zuhause ist ein liebevoll hergerichtetes Heim. Das Nachbarhaus daneben hingegen ist farblos, verlassen, kalt. Es erinnert mich an Chase’ und Ambers Bude.
Ich folge Holly auf die vordere Veranda, die gerade genug Platz für zwei Deckchairs und eine Fußmatte hat, was uns zwingt, eng beieinanderzustehen. Ihre Haare riechen wie eine verfluchte Wildblumenwiese, was zumindest Chase und Amber aus meinen Gedanken löscht. Gut so. Sie haben nichts darin verloren.
Holly versucht die Tür aufzuschließen und lässt dabei die Schlüssel fallen. In der Stille der Nacht ist das Geräusch ohrenbetäubend laut. Ich beuge mich vor, um sie aufzuheben, und flüstere ihr zu, leise zu sein, damit wir ihre Mutter nicht wecken. Sie dürfte nach dem heutigen Tag vollkommen erledigt sein und sicher nicht erfreut, wenn sie sieht, dass ihre Tochter betrunken mit einem wildfremden Typen nach Hause kommt.
»Keine Angst, Mom ist nicht zu Hause«, erwidert Holly und nimmt mir die Schlüssel ab.
Ich mache einen Schritt nach vorn, um ihr zu helfen, aber das Einzige, was ich damit erreiche, ist, dass ihr Rücken meinen Oberkörper berührt.
Aber anstatt durch die Tür zu gehen, die sie längst einen Spalt geöffnet hat, und den Abend zu beenden, dreht sie sich zu mir um. Ohne die Distanz zu verringern. Ihr Atem ist hektisch. Als würde sie rennen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auf mich zu oder vor etwas davonrennt. Aber bevor ich mir darüber klar werden kann, stellt sie sich auf die Zehenspitzen und küsst mich.
Meine Muskeln spannen sich an. Sekundenlang kämpfe ich mit meinem Gewissen, das mir verbietet, sie betrunken und emotional angeschlagen zu küssen, aber dann bringt ihr Mund meine Selbstbeherrschung zum Einstürzen. Ich vergrabe meine Hände in ihrem Haar und erwidere den Druck ihrer Lippen, ziehe sie noch enger an mich. Gemeinsam taumeln wir ins Innere des Hauses. Die Tür schließe ich mit einem sanften Tritt. Ich verliere mich in unserem Kuss. Bis sich plötzlich salzige Tränen daruntermischen.
»Entschuldige«, murmelt sie und löst sich von mir. »Du solltest besser gehen.«
Ich strecke die Hand nach ihr aus, will verhindern, dass sie sich noch weiter zurückzieht. Nicht, weil ich mehr will. Obwohl dieser Kuss der Wahnsinn war. Ich will für sie da sein. Sie nicht mit der Traurigkeit allein lassen, die ihre Augen überschwemmt. Aber sie dreht sich um und ich höre nur ihre erstickten Worte, die von Tränen verwässert werden.
Ich lasse die Hand wieder sinken, überlege, ihren Wunsch zu respektieren und einfach zu gehen. Aber es fühlt sich falsch an. »Holly?«, frage ich sanft. Keine Ahnung, was ich mir erhoffe, aber sie reagiert nicht. Doch ihre Schultern zucken kaum merklich. Wegen eines Schmerzes, der so tief sitzt, dass er lautlos hervorbricht. Ich wünschte, ich könnte die Situation für sie besser machen. Dieses Scheißmitgefühl hat mir schon mal fast das Genick gebrochen. Aber Holly ist nicht Amber. Das spüre ich. Auch wenn ich sie kaum kenne.
Zögernd mache ich einen Schritt auf sie zu und berühre ihre Schulter. Sie zuckt zusammen, lässt aber zu, dass ich noch näher komme und sie dann wortlos in meine Arme ziehe. Ihr ganzer Körper ist angespannt. Sie wehrt sich dagegen, die Fassung zu verlieren.
»Wenn du das wirklich willst, gehe ich«, flüstere ich in ihr Haar. »Aber ich …« Ich beende den Satz nicht, denn nichts zu sagen, ist vielleicht genau richtig. Und tatsächlich verkrallt Holly ihre Hände Sekunden später in meinem Shirt. Schluchzer lassen ihren Körper beben, als sie sich verzweifelt an mich presst. Ich stehe so lange einfach mit ihr da, bis sie sich etwas beruhigt hat. Erst dann ziehe ich sie sanft zu der Couch und warte, bis sie unter die graue Wolldecke kriecht, die zerwühlt auf dem Möbel liegt. Sie weint noch immer. Still, aber nicht weniger heftig. Ich denke nicht groß darüber nach und schiebe mich hinter sie, tue einfach, was mein Gefühl mir sagt. Es fühlt sich richtig an, sie zu halten. Ich lasse sie nicht los.
Sekundenlang.
Minuten.
Stunden.
Erst als die Morgendämmerung bereits über die Siedlung von Cherry Point kriecht, fällt Holly in einen unruhigen Schlaf. Eine Weile liege ich noch neben ihr, wünschte, ich könnte bleiben, um sicherzugehen, dass es ihr wirklich besser geht, aber ich muss los.
Also schlüpfe ich vorsichtig unter der Decke hervor und schleiche mich aus dem Haus. Draußen atme ich tief durch, ziehe mein Handy aus meiner Hosentasche. Der Akku ist leer. Wahrscheinlich schon seit Stunden. Mac hat mittlerweile vermutlich die Nationalgarde alarmiert. Er hat die Verantwortung für mich übernommen. Vor Jahren schon und er ist tödlich pflichtbewusst.
Ich bin ziemlich sicher, dass er es sich zweimal überlegt hätte, etwas mit meiner Mom anzufangen, hätte er damals schon gewusst, was ihm das einbringen würde. Nämlich mich. Und jede Menge Ärger.
Obwohl mein Kopf dröhnt, als hätte mich ein Truck angefahren, jogge ich die knappe Meile bis zu meinem Pick-up. Dort angekommen, schiebe ich mich eilig hinters Lenkrad und schließe mein Telefon an die Powerbank, die im Handschuhfach liegt. Erst als es wieder zum Leben erwacht, kann ich die Navigationsapp aufrufen, die mich auf schnellstem Weg zu Mac bringen wird. Seine acht verpassten Anrufe ignoriere ich vorerst. Sie sind alle vom Vorabend. Mit etwas Glück ist er schlafen gegangen, nachdem er meine Nachricht erhalten hat, und liegt noch im Bett. Dann hätte ich eine Chance, mich reinzuschleichen, ohne dass er bemerkt, wie viel zu spät ich die Ranch erreiche. Ich sollte zusehen, dass ich losfahre, aber gerade als ich den Motor starten will, fällt mein Blick auf den einzigen anderen Wagen auf dem Parkplatz. Ein hundert Jahre alter Mini, aufgemotzt, mit einem verwegenen Ralleystreifen, der sich über Kühlerhaube, Dach und Heck des Winz-Autos zieht. Hollys Wagen. Sie hat ihn abgeschlossen, bevor wir gestern Abend losgegangen sind. Den Schlüssel lasse ich im Zündschloss stecken, springe auf den Schotter und zerre meinen Rucksack von der Rückbank. Aus den Untiefen befördere ich einen Block zutage. Das Papier ist zerknittert, weil ich ihn in Los Angeles in aller Eile in die Tasche geschmissen habe. Normalerweise notiere ich Upcycling-Ideen darauf. Skizziere Projekte. Jetzt reiße ich eine Ecke ab und schreibe eine Nachricht auf den Fetzen Papier.
Solltest du die Hoffnung verlieren und reden wollen, ruf mich an. Ich bringe Wodka mit. Cooper
Darunter notiere ich meine Nummer und schiebe den Zettel dann durch den Fensterschlitz. Er bleibt gut sichtbar auf dem Fahrersitz liegen. Zeit, abzuhauen und bei Mac um Vergebung für das missglückte Wiedersehen zu bitten.
Kapitel 5Hope
Die Sonne blendet mich, als ich aufwache. Das Erste, was ich spüre, ist, dass ich alleine bin. Cooper ist fort. Mich umgibt nur noch meine graue Lieblingsdecke. Nicht mehr seine Arme. Und obwohl der Alkohol nicht länger durch meine Blutbahn torkelt und damit als Ausrede für dieses bescheuerte Gefühl ausscheidet, wünschte ich, er wäre geblieben. Aber wer weiß, vermutlich ist es besser, wenn wir uns nie wiedersehen. Immerhin habe ich ihm all diese viel zu persönlichen Sachen erzählt, war total betrunken und habe ihn geküsst, nur um im nächsten Moment in Tränen auszubrechen. Er muss denken, ich wäre eine emotional gestörte Irre. Kein Wunder, dass er verschwunden ist.
Mein Verhalten war total daneben. Und trotzdem war er die halbe Nacht hier und hat mich in seinen Armen gehalten. Das lässt nur einen Schluss zu – er ist ein guter Kerl. Einer der wenigen, die das Richtige tun und weinende, betrunkene Menschen nicht sich selbst überlassen. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich stöhne unterdrückt. Meine Gedanken sollten nicht um einen Typen kreisen. Alles, was derzeit zählen sollte, ist Dad. Schuldbewusst ziehe ich die Decke fester um mich und atme den Geruch des Stoffs ein, den er mir von einem seiner Auslandsaufenthalte mitgebracht hat. Da war ich gerade drei Jahre alt. Er meinte immer, solange ich mich in den groben Strickstoff wickeln würde, könnte ich ihn fühlen. Er wäre so immer bei mir und könnte auf mich aufpassen. Selbst wenn er am anderen Ende der Welt wäre. Ich frage mich, ob das noch immer gilt. Jetzt, wo er nicht mehr am anderen Ende der Welt ist, sondern ganz fort. Wohl kaum. Aber es ist das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. All seine Bilder hat Mom in die Umzugskartons geräumt, die an der Wand gestapelt stehen, und ich bezweifle, dass sie die Fotos, die sie selbst geschossen und gerahmt hat, im neuen Haus aufhängen wird. Nicht einmal die Erinnerung an Dad kann ich mit ihr teilen. Jedes Mal, wenn ich wünschte, ich könnte es, ist sie so unnahbar und durchorganisiert, dass ich mich lieber zurückziehe. Und dann taucht das Bild von ihr mit dem Prius-Mann vor meinem inneren Auge auf und tiefschwarze Wut legt sich über alles. Tränen rollen mir über die Wangen und versickern in dem grauen Stoff.
Kurz darauf öffnet sich die Haustür. Es ist Mom, das höre ich an ihren Schritten, daran, wie sie im Eingangsbereich stehen bleibt und den Raum bereits von der Haustür aus mit Vorwürfen flutet, ohne etwas zu sagen.
Mühsam rapple ich mich auf, wische mir über die Augen und versuche mich für den Streit zu wappnen, der gleich folgen wird. Vor zwei Wochen hätte ich Mom nach meiner Aktion gestern jedes Recht eingeräumt, sauer zu sein. Ich hätte mich entschuldigt und die Konsequenzen, die so etwas nach sich zieht, einfach hingenommen. Aber das war in einem anderen Leben.
Mom kommt ins Wohnzimmer, schiebt ihre Schlüssel in die Tasche ihrer Shorts und bleibt vor dem Sofa stehen. Wartend.
Vermutlich darauf, dass ich den ersten Schritt mache und mich dafür entschuldige, einfach abgehauen zu sein, ohne ihr zu sagen, wo ich war. Ich bleibe stumm.
»Willst du mir das hier vielleicht erklären?«, knickt Mom schließlich starre Minuten später ein und hält mir mein Handy unter die Nase. Sie deutet auf mich, das Haus, und legt das Telefon dann als Beweismittel auf den Wohnzimmertisch.
»Eigentlich nicht«, murmle ich und versuche das Wundsein aus meiner Stimme zu frosten. Ich recke das Kinn in die Luft und starre sie an. Zwischen uns liegen sechs Fuß. Eine ganze Welt. Und ausgerechnet jetzt breitet sich der irrationale Wunsch in mir aus, Mom würde einfach die Distanz überwinden und mich in den Arm nehmen.
»Ich habe dich gesucht.« Auch wenn sie betont ruhig spricht, höre ich die Wut, die in ihr schwelt. Und die Enttäuschung.
Gut so. Dann fühlen wir uns wenigstens gleich beschissen. »Vielleicht wollte ich nicht gefunden werden. Nur einen Abend lang«, sage ich knapp.
Sie fährt sich durch die langen blonden Haare und stößt die Luft aus. »Gestern war nicht irgendein Abend.«
Will sie mir jetzt allen Ernstes ein schlechtes Gewissen machen, weil ich Dad am Tag seiner Trauerfeier nicht geehrt habe? Sie hat ihn verraten. All die Jahre. Und jetzt ist er tot. Ich presse die Lippen aufeinander, um sie nicht anzuschreien. Bohre die Nägel in meine Handflächen. Atme.
»Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Verdammt noch mal, Hope. Ich habe dich überall gesucht. Ich verstehe ja, dass du durcheinander bist, traurig, und vielleicht war die Feier auch einfach zu viel für dich. Aber du hättest mit mir reden müssen. Es wäre kein Problem gewesen, wenn du dich in dein Zimmer zurückgezogen hättest.«
»Mein Zimmer ist hier.« Ich kralle meine Finger in die Decke.
»Du hättest die letzte Nacht vorm Umzug auch in Cherry Point schlafen können. Ich hätte dir erlaubt, mit Ivy hierzubleiben und Abschied zu nehmen. Aber du kannst nicht einfach verschwinden. Und da ist noch etwas.« Sie atmet tief durch. »Dein Wagen steht vor dem Blue Taps.« Sie zieht die Augenbrauen hoch und verschränkt die Arme vor der Brust.
Mom hat wahnsinnige Angst, dass ich in einer Bar, in der ich mit gerade achtzehn absolut nichts verloren habe, einen Typen aufreiße, mich verliebe und mit neunzehn bereits verheiratet und wie sie schwanger sein werde. Ich habe eine Neuigkeit für sie. Ich bin kein Stück wie sie. Zum Beispiel hätte ich nie meine Familie belogen und ihr erzählt, dass ich glücklich mit ihnen wäre, und gleichzeitig meine Flucht aus diesem Leben vorbereitet. Ein Haus gekauft. Dad ins Ausland geschickt. Den Prius-Mann gefickt.
»Dir hätte sonst was zustoßen können, in so einem Laden. Was hast du dir nur dabei gedacht?«, fragt sie vorwurfsvoll.
»Dasselbe könnte ich wohl dich fragen.« Ich stehe auf und drehe Mom den Rücken zu. Wenn ich sie weiter ansehe, wird alles aus mir herausbrechen und ich bin sicher, das würde auch noch den letzten Rest widerspenstiger Liebe zwischen uns auflösen. Denn obwohl das absolut bescheuert ist, liebe ich sie. Egal, was sie getan hat. Ich kann sie nicht hassen. Sie ist alles, was ich noch habe.
»Was soll das heißen?« Sie versucht mich an der Schulter zu sich zu drehen, aber ich mache mich unwirsch los und klemme mir die Wolldecke unter den Arm.
»Vergiss es. Ich werde jetzt gehen.«
Aber da habe ich die Rechnung ohne Mom gemacht, die alles ausdiskutiert. Immer. Bis zum bitteren Ende, selbst wenn das nur verbrannte Erde hinterlässt.
Sie stellt sich mir in den Weg und stemmt die Hände in die Hüften. »Du gehst nirgendwohin. Nicht nach dem, was du da gestern abgezogen hast. Außerdem ist heute der Umzug und du hast versprochen zu helfen.«
Ich will nicht mal in dieses bescheuerte Haus und ich habe auch nichts versprochen. Ich habe lediglich nicht widersprochen. Ganz sicher werde ich nicht den ganzen Tag mit Mom Sachen schleppen und eingequetscht mit ihr in einem Wagen hocken.
»Und wenn das erledigt ist, reden wir über das, was offensichtlich zwischen uns steht. Über alles, was dich beschäftigt.« Sie stößt die Luft aus und ihre Stimme ist jetzt sanfter. »Ich habe uns Eis besorgt. Chocolate Mint.«
Meine Lieblingssorte.