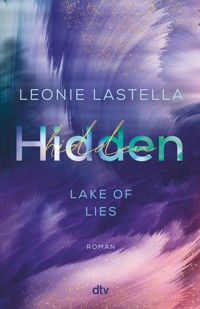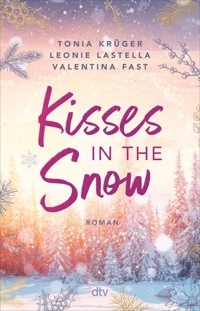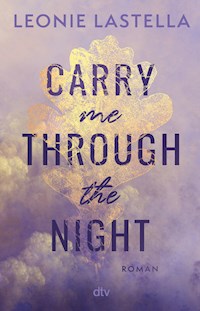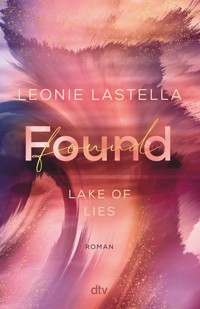
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lake of Lies
- Sprache: Deutsch
River und June – zwischen Anziehung und Misstrauen Rivers innigster Wunsch war es immer seine Kindheit und die damit verbundenen schmerzhaften Erinnerungen hinter sich zu lassen. Fast scheint es, als würde ihm das gelingen – am Lake Tahoe fühlt er sich endlich frei und glücklich. Bis er plötzlich vor den Trümmern seines Traums steht. Denn der kriminelle Clan, aus dessen System er sich mühsam herausgekämpft hat, bedroht nun alle, die er liebt. Auch June. Das Mädchen, das er einst in der Hölle seiner Kindheit zurücklassen musste und das keine Ahnung hat, wer er wirklich ist. Oder wie gefährlich es ist, ihm nahe zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Rivers größter Wunsch war es immer, seine traumatische Kindheit hinter sich zu lassen. Fast scheint es, als würde ihm das gelingen – er ist erfolgreich, beliebt, hat neu angefangen. Bis ein folgen schwerer Unfall seinen Traum zerstört und ihn zwingt am Lake Tahoe unterzutauchen. Denn der kriminelle Clan, aus dessen System er sich herausgekämpft hat, ist ihm auf den Fersen und bedroht nicht nur sein Leben, sondern alle, die er liebt. Auch das Mädchen, das er einst in der Hölle seiner Kindheit zurücklassen musste und das keine Ahnung hat, wer er wirklich ist. Oder wie gefährlich es ist, ihm Jahre später nahezukommen …
June musste sich alles in ihrem Leben mühsam erkämpfen, auch den Studienplatz am Lake Tahoe. Sie weiß, um ihr Stipendium zu behalten, darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen. Schon gar nicht von dem gut aussehenden River, mit dem June gleich am ersten Tag zusammenprallt und der ihr merkwürdig vertraut scheint. Doch sosehr sie sich auch dagegen wehrt – jede Begegnung mit ihm verstärkt dieses Gefühl der Verbundenheit und bringt ihr Herz mehr aus dem Takt. Allerdings ahnt sie nicht, was er vor ihr verbirgt und in welcher Gefahr sie schwebt …
Von Leonie Lastella sind bei dtv außerdem lieferbar:
Das Licht von tausend Sternen
Wenn Liebe eine Farbe hätte
So leise wie ein Sommerregen
Carry me through the night
Seaside Hideaway – Unsafe
Seaside Hideaway – Unseen
Kisses in the Snow (zusammen mit Valentina Fast und Tonia Krüger)
Snowflakes and Heartbeats (zusammen mit Valentina Fast und Tonia Krüger)
Lake of Lies – Hidden
Leonie Lastella
Lake of Lies
Found
Band 2
Roman
Für alle, die sich verloren fühlen. Ihr müsst nicht den Weg finden. Nur den einen Menschen, der euer Funke in der Dunkelheit ist.
River und June
Soundtrack
Dancing With Your Ghost * Sasha Alex Sloan
Say Something * A Great Big World, C. Aguilera
Can’t Catch Me Now * Olivia Rodrigo
Beautiful Things * Benson Boone
West Texas In My Eye * The Panhandlers
Scared To Start * Michael Marcagi
Ceilings * Lizzy McAlpine
To Build a Home * The Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson
Flowers * Lauren Spencer-Smith
Austin * Dasha
You Broke Me First * Tate McRae
All I Want * Lauren Spencer-Smith
1 Step Forward, 3 Steps Back * Olivia Rodrigo
If I Died Last Night * Jessie Murph
Too Hurt To Fall In Love * Lauren Spencer-Smith
Always Been You * Jessie Murph
Prolog
Ich wollte raus, nur raus aus der stinkenden Finsternis, aber jetzt bin ich es und die Helligkeit ist einfach nur abartig, weil ich sie verlieren werde und das ist schlimmer als alles andere. Ich atme Angst, keinen Sauerstoff. Ich blinzle, aber sehe nichts. Ich will schreien, aber kein Ton kommt über meine Lippen.
Mein Körper ist schweißgebadet. Mein Hirn pocht, meine beschissenen Finger kribbeln, spüren klebrige Nässe. Ich fühle mich schwindelig, so verdammt schwach, aber immerhin ist da kein Schmerz, einfach nichts. Als wäre ich gar nicht mehr richtig da. Fuck, vielleicht war ich das nie.
Aber ich bin auch nicht weg. Denn dann würde ich Fallons Stiefel nicht sehen. Verschwommen, doch mit jedem Atemzug ein wenig deutlicher. Nur die Geräusche fehlen noch immer. Ich werde verschwinden wie all die Menschen vor mir, die sich mit Fallon angelegt haben. Ich werde sterben. Und ein Teil von mir will das. Der kranke, hässliche Teil meines Hirns will, dass es wieder dunkel wird. Will Ruhe. Endlich Ruhe in mir. Ich bin einfach so unfassbar müde.
»So.«
Wie kann ein Wort so verdammt endgültig sein, mich komplett zerlegen? Mir wird schlecht.
Ich starre noch immer auf Fallons Schuhe. Ihn anzusehen, richtig anzusehen, würde mich vollkommen auseinandernehmen und alles zerstören, was von mir noch übrig ist. Also fixiere ich die zerkratzten Spitzen und denke, sie sind wie ich – kaputt.
Der Boden ist kalt, obwohl es stickig ist. Und ich denke, es gibt Schlechteres, als hier zu liegen und das fiebrige Pulsieren zu kühlen. Selbst wenn es für immer ist.
Fallon ansehen zum Beispiel. Oder den Schmerz ertragen. Oder leben. Fallon packt meinen Kopf, dreht ihn und ich sehe in ihre Augen, sehe sie. Keine Ahnung, ob das echt ist, aber es stößt eine verfickte Rebellion an.
Meine Muskeln spannen sich an. Das Flirren, das Tosen, alles wird immer lauter und lauter, hässlicher und hässlicher und ich denke, ich ertrag das nicht, diesen Lärm in meinem Kopf, aber ich muss. Für sie. Weil ich in einer Welt, in der sie lebt, nun mal nicht aufgeben kann.
River
Ich denke, ich werde taub von diesem beschissenen, abgrundtief hässlichen Lärm in meinem Kopf, aber ich stecke fest. In den Erinnerungen und dem verfickten Gefühl, nicht atmen zu können. Stecke mit Fallon im Wald fest, diesem Pisser. Ein netter Horrorfilm sponsored by meinem Unterbewusstsein und unserem Freund dem Schlaf.
Mein Körper ist komplett nass geschwitzt, meine Muskeln machen zu und, fuck, der Schmerz in meinem Bein, der Schmerz in meiner Brust sind so präsent, dass ich jeden Moment auf die frischen Laken kotzen werde. Zitternd rapple ich mich auf, weil das keine Option ist.
Denn Via kommt gleich vorbei und sie soll, verfickt noch mal, nicht wissen, wie beschissen es mir geht. Sie ist glücklich. Mit Miles. Sie denkt, sie hätte mich gerettet, als sie mich an den Lake Tahoe geholt hat. Sie denkt, ich hätte das Schlimmste überstanden. Also werde ich meinen ätzenden Scheißkörper rechtzeitig ins Bad schaffen, damit sie das weiter annehmen kann.
Ich angle nach den Krücken und hieve mein Gewicht auf das fast gesunde Bein, schleppe mich ins Bad, das den Namen nicht verdient, weil ich über dem Waschbecken hängen und meinen Mageninhalt in den Ausguss würgen kann, während ich gleichzeitig auf der Toilette sitze.
Schwer atmend rapple ich mich auf, mache exakt zwei Schritte nach vorn und stelle die Dusche an. Mitsamt meinen Klamotten stehe ich unter dem Strahl. Die sind eh ein Fall für die Wäsche. Das Wasser ist kalt. Der verdammte Boiler hat nur Warmwasser für zweieinhalb Minuten, aber nicht mal die nutze ich. Vielleicht bestrafe ich mich selbst. Aber vielleicht hilft kaltes Wasser auch einfach besser gegen dieses fiebrige Pochen in meinem Schädel. Keine Ahnung.
Ich bleibe so lange unbeweglich unter der Dusche stehen, bis ich nichts mehr fühle außer Kälte. Ist ein bisschen wie Urlaub von mir selbst. In Alaska. Oder Grönland. Ohne Schutzkleidung.
Stöhnend stelle ich die Dusche aus, schäle mich mit klammen Fingern aus meinen durchweichten Klamotten, packe mich zweimal fast hin, weil ich ein verdammtes Wrack bin, aber irgendwie schaffe ich es am Ende doch. Schaffe es aus dem Loch von Badezimmer.
Nackt, die Krücke unter den Arm geklemmt, gehe ich zurück ins Schlafzimmer, das gleichzeitig auch Wohnzimmer und Küche ist. Die Bude hat nur diesen einen Raum und das Pseudo-Winz-Bad. Fuck, warum muss alles einfach so verflucht mühsam sein? Ich lasse mich aufs Bett plumpsen, angle mir Boxershorts, eine Jogginghose und ein frisches Shirt aus dem offenen Regal und bleibe mit den Sachen im Schoß minutenlang einfach nur sitzen, starre meine Narben an, die sich das komplette linke Bein hinaufziehen und krass wehtun, obwohl mir jeder sagt, dass es besser wird. Wenn das besser ist, scheiße ich auf besser.
Ich bin so verdammt hilflos, echt erbärmlich und so richtig hässlich. Ein Loser, der es nicht mal schafft, sich seine Scheißunterhose selbst anzuziehen. Oder diese Arschlöcher dranzukriegen. Oder seine Schwester zu retten.
Halb. Sie ist meine Halbschwester, verflucht. Aber das ändert nichts. Selbst wenn sie rein gar nichts für mich wäre …
»Sie ist nichts, verdammt«, flüstere ich, aber hey, das tut nichts zur Sache. Denn selbst wenn sie nichts ist, ist sie wegen mir bei Fallon und Peter. Auf der Ranch. Es ist meine verfickte Schuld. Meine. And here we go again.
Ich muss etwas tun, um sie da rauszuholen. Etwas anderes, als rumzuheulen. Aber was? Die Kopien der Beweise, die Peter Loughlin haben will, existieren nicht. Sie existieren einfach nicht, auch wenn sie mir das dank Miles niemals glauben werden. Also, was zum Henker tue ich jetzt? Zuallererst sollte ich mir wohl was anziehen. Das wäre ein Anfang.
Ich brauche zehn Minuten, um mich in meine Klamotten zu quälen, und bin völlig durch, als ich endlich so weit bin. Erschöpft lasse ich mich wieder auf die Matratze sinken, denke, dass ich so unfassbar müde bin, dass ich auf der Stelle einschlafen könnte, weiß es besser. Weiß, was dann passiert, und versuche es gar nicht erst.
Mit der Krücke humple ich zur Küchenzeile und mache Kaffee. Fuck ey, Koffein ist das Einzige, was mich jetzt retten kann. Dann sehe ich weiter.
Als ich den ersten Schluck trinke, klopft es. »Ja, ist offen.« Ich weiß, dass es Via ist. Nicht, weil sie so einzigartig klopft. Es gibt einfach niemand anderen, der mich so früh besuchen würde. Knox schläft um die Uhrzeit noch und Miles muss arbeiten.
»Hey.« Sie lädt irgendwas auf dem Tisch ab und tritt von hinten an mich heran. Ihre Hand berührt mein Schulterblatt, streicht einmal darüber und nimmt die Wärme mit fort, als sie sie wieder wegzieht und sich einen Kaffeebecher von der Spüle angelt. »Du hast Kaffee, du Lebensretter.«
Als ob ich ihr jemals das Leben gerettet hätte. Das war Miles. Nachdem ich es zerstört hatte. Ich schenke ihr ein, lächle dieses verdammte Fake-Lächeln, das mir früher so leichtfiel und heute so kotzanstrengend ist.
Sie runzelt die Stirn. Vermutlich, weil ich noch kein Wort gesagt habe. »Wie geht es dir nach gestern?«
Gestern, als mich Avery, meine kleine Schwester, gefunden und damit den ganzen familiären Dreck wieder hochgewühlt hat. Als sie mit Flaschen nach mir geworfen hat, weil ich keinen Bock auf sie und ihre Heile-Welt-Familienzusammenführung hatte. Als ich die Cops gerufen und Peter fucking Loughlin gratis dazubekommen habe. Gestern, als er mir gesagt hat, dass ich sie in winzigen Häppchen zurückbekomme, wenn ich ihm nicht gebe, was er will.
»Alles … okay.« Ich presse die Kiefer aufeinander, nicke. Voll lässig. Als würde mich nichts davon kümmern.
Via verdreht die Augen. »Und in Wahrheit?«
In Wahrheit fühle ich mich wie ein armseliger Drecksack, aber das werde ich ihr ganz sicher nicht stecken, egal wie gut sie dadrin ist, mich zu lesen. »Ich muss gleich los. Professor Grayson will sich mit mir an der Uni treffen.«
»Grayson?«
Die Ablenkung hat funktioniert. Sie setzt sich mit ihrem Kaffeebecher an den Tisch und öffnet die Donutbox, die sie dort abgestellt hat. »Was will er? Ich meine, hier am See?«, nuschelt sie an dem Vierteldonut vorbei, den sie sich in den Mund gestopft hat. »Von dir?«
Die Frage ist berechtigt. Immerhin lehrt er an der Sac State und war zwar bis zu dem Unfall mein Boss und ich sein Assistent, aber mehr verbindet uns nicht. Warum bewegt er seinen Hintern also extra von Sacramento hierher, um mich zu treffen? »Ich weiß es nicht. Aber er hat mich gebeten zu kommen und da ich ihm was schuldig bin …« Ich zucke mit den Schultern. Story of my life. »Liegt eh auf halber Strecke zur Physiotherapie.« Die wie jeden zweiten Tag mein Untergang ist und die Schicht heute Abend im Bad Habits unerträglich machen wird. Vielleicht hat wenigstens David, mein Physiotherapeut, ausnahmsweise mal ein Einsehen und labert mich nicht stundenlang zu, dass ich den Job schmeißen soll, damit er nicht unseren Therapieerfolg gefährdet. Ich weiß, er hat recht, aber ich muss auch essen, Miete zahlen und vor allem etwas tun, was die Nächte kürzer macht und die beschissenen Gedanken eindämmt.
Die Gleichung ist einfach. Wenn ich eine Horde Junggesellen auf Sauftour davon abhalte, unsere Theke als Bierrutsche zu missbrauchen, kann ich mich nicht mit den Loughlins beschäftigen, der Ranch, dem Unfall oder Avery. Ich kann nicht darüber nachdenken, dass Seth noch immer verschwunden ist, nachdem er sich von den Loughlins hat einkassieren lassen. Und ich kann verdrängen, dass sie ihn wahrscheinlich in den Wald gebracht haben. In den verfickten Wald, in dem meine Kindheit gestorben ist. Ich blinzle die Bilder weg, die dämlichen Tränen, die niemandem helfen. Mir am allerwenigsten. Der Wald, das klingt nach Kindergeburtstag. Oder einem verdammten Sonntagsspaziergang. Aber es ist … Keuchend klammere ich mich an der Spüle fest, atme. Gegen die Scheißgefühle an. Gegen das Bild von Mom in diesem blauen Kleid, das nicht verschwindet, egal wie sehr ich die Augen zusammenkneife. Scheiße. Nicht jetzt. Aber meine Arme und Beine kribbeln und scheren sich einen Dreck darum, dass ich vor Via keine verdammte Panikattacke kriegen darf. Mir ist schwindelig, alles wird unstet, verschwimmt. Die Spüle, der Kaffeebecher, selbst Via, die mich alarmiert ansieht, weil ich einen auf fucking Casper mache.
»Riv?«
Ich will ihr ja antworten, aber auf meiner Brust sitzt eine Scheißelefantenherde und mein Herz knallt so hart gegen die Rippen, dass ich denke, es hat sich fest vorgenommen, da drinnen was kaputt zu machen. Good Luck, denn da drin ist nichts, was nicht längst zur Hölle gegangen ist.
Via berührt meinen Arm, aber sie schafft es nicht, mich da rauszuziehen. Das können nur Haarspitzen, die meine Haut streifen und die nicht Via gehören, getrocknete rosafarbene Blumen im Sonnenlicht. Ein Arm an meinem. Mein Herz stirbt ein wenig, aber ich komme langsam runter.
»Hey, Riv, verdammt, was hast du?« Via klingt ängstlich und ich will ihr, verfickt noch mal, keine Angst machen, aber die Panik verschlingt mich. Früher hatte ich solche Attacken selten. Höchstens mal vor einem Wettkampf und da konnte ich mir einreden, dass es an dem Druck liegt, nicht an dem, was ich in dieses hohle, tiefschwarze Loch in meinem Inneren geworfen habe, bevor ich einen Stein darübergerollt habe. Aber jetzt haben die Ereignisse den Stein zerbröselt und die Dinge kriechen raus und es wird schlimmer. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal.
Via macht ein Geschirrhandtuch nass und legt es mir in den Nacken, schiebt mich zu einem der Stühle und lädt mich darauf ab wie die Donuts auf dem Tisch. »Du musst was essen.«
Ich brumme, weil es, verfickt noch mal, nicht an einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel liegt, dass ich kurz vorm Zusammenklappen bin. Ich ticke einfach nicht mehr ganz sauber. Und das kriegt kein ekliger Donut der Welt wieder hin, aber ich nehme ihr das Teil dennoch ab und beiße brav hinein, kaue, sage etwas wie »hmm, lecker«, schmecke nichts, schlucke, spüre keine Verbesserung. »Geht schon wieder«, behaupte ich trotzdem, stehe auf und drehe mich von Via weg, weil sie es merkt, wenn ich lüge.
»Was willst du denn jetzt machen?«, fragt sie leise.
Ich zucke die Schultern, weiß, was sie meint, und tue so, als wüsste ich es nicht. »Ich gehe zu Professor Grayson.« Weil ich keinen Bock habe, ihn warten zu lassen. Weil ich keinen Bock auf noch so eine Scheiße wie eben direkt vor ihren Augen habe.
»Und was ist mit Avery?«
»Ich weiß es nicht.« Ich schüttle den Kopf. Angepisst, weil, na ja, ich eben angepisst bin. Nicht von Via. Die kann nichts dafür, dass mein Leben total krank ist. »Ich weiß es nicht, V«, schiebe ich deswegen etwas sanfter hinterher. »Ich melde mich später.« Was ich dann doch nie tue. Und manchmal frage ich mich, wieso sie überhaupt noch herkommt, so, wie ich drauf bin. Aber egal wie scheiße es ist, ich humple nach draußen und lasse sie allein in meiner Wohnung zurück.
Er ist ein Gewohnheitstier. Physio, Gym, Schicht in der Bar, ein Snack hinter dem Tresen der Kneipe oder ein Mikrowellenessen im Stehen am Küchentresen, schlafen oder auch nicht. Manchmal brennt das Licht die ganze Nacht und sein Schatten bewegt sich im Raum hin und her. Aber im Wesentlichen sieht jeder Tag gleich deprimierend aus. Manchmal besucht er Via und Miles. Meistens sie ihn. Er ist so vorhersehbar, dass er sich auch gleich eine Zielscheibe auf den Rücken malen könnte.
June
Ich liebe den alten Jeep, dessen Motor unrund tuckert, als ich ihn auf dem Parkplatz der SNU ausrollen lasse. Weil das Auto Zuhause ist. Alles, was ich besitze, alles, was ich bin, steckt in diesem Wagen. Und er hat mich hierhergebracht, an diesen Ort, den ich fast so sehr liebe wie den alten Jeep. Weil auch er Zuhause ist. Irgendwie.
Nicht, dass ich in einem der teuren Häuser mit Seeblick groß geworden wäre, aber Mom hat sie geputzt. Und manchmal durfte ich sie begleiten. Früher, als sie sich noch um mich kümmern konnte. Mich hat nicht interessiert, wie viele Zimmer die Mansions hatten, wie teuer die Einrichtung war oder ob die Bilder an den Wänden Originale waren. Für mich waren diese Häuser Luxus, weil man von überall aus auf das tiefe Blau des Lake Tahoe blicken konnte. Wann immer man wollte. Und draußen roch es nach Pinien und sandiger Erde. Nach Was-kostet-die-Welt.
Zu viel. Das habe ich schnell begriffen. Für Menschen wie mich kostet sie zu viel. Aber ich bin zu störrisch, um wie Mom meinen Platz in dieser Welt in einem trostlosen Trailerpark im Colfax County einfach zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass ich kein Recht habe, dieses Blau immer dann zu sehen, wenn ich es möchte. Und nicht nur dann, wenn ich einen Eimer mit Putzutensilien durch das Haus einer schwerreichen Familie trage.
Dafür musste ich hart arbeiten. Richtig hart. Aber ich habe es geschafft. Ein Vollstipendium an der SNU. Nimm das, Scheißvergangenheit. Ich grinse, ziehe den Schlüssel aus dem Zündschloss und die aktuelle Folge meines Lieblingspodcasts This American Life erstirbt zusammen mit dem Motorengeräusch. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich mich auf dem Campus der Uni befinde, der so wunderschön ist, mit den vielen Pinien, den satten Grasflächen und den aus Holz, Stein und Glas bestehenden Gebäuden, die wirken, als wären sie mit der Natur gewachsen.
Ich steige aus, schließe die Augen, atme tief ein. Pinien, sandige Erde, die frische, leicht feuchte Luft vom See. Und ich erinnere mich. An Mom. An ihr Lachen, wie sie mit mir getanzt hat, durch die Räume irgendeines Luxusanwesens, während es genau so gerochen hat. Aber da sind eben auch die anderen Erinnerungen. Die unschönen, die ständig anklopfen, reinwollen. In meinen Kopf und in mein Herz, um dort zu randalieren. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, sie nicht als hässlichen Makel zu sehen, sondern als Motor. Als etwas, das mich antreibt, stärker macht, ans Ziel bringt.
Trotzdem wird es nicht einfach werden. Ich muss meinen Notendurchschnitt halten, um das Stipendium nicht zu verlieren. Ich muss mich um Mom kümmern, die ohne mich nicht klarkommt, und ich brauche einen Job. Die Uni bezahlt zwar meine Studiengebühren und die Unterbringung im Wohnheim, aber ich kann mich ja nicht von Lehrbüchern und Seminaren ernähren. Ich muss etwas essen, will leben. So richtig leben. All das tun, was ich verpasst habe.
Ich setze einen Job suchen auf die Liste der Dinge, die ich als Erstes anpacken muss. Gleich nach dem Ankommen.
Ich schultere meinen Rucksack, in dem ich all die Sachen aufbewahre, die überlebenswichtig sind: Lehrbücher, meinen altersschwachen Laptop, meine Papiere und Fotos. Dann klemme ich mir eine der drei Reisetaschen unter den Arm, in denen der Rest meines Lebens steckt, und laufe los, orientiere mich an den in Stein gemeißelten Wegweisern und erreiche die David Hall. Mein Studentenwohnheim. Ich schließe Spotify, schieße ein Foto und schicke es Summer.
Meine beste Freundin schickt einen Smiley, dem der Kopf wegfliegt. Dann noch einen mit Sternchenaugen und in der nächsten Sekunde klingelt mein Telefon. »Hey«, sage ich ein wenig atemlos, weil die Tasche echt sauschwer ist und der Rucksack aufgrund meiner Schräglage ständig von der Schulter rutscht.
»Hi«, quietscht Summer. »Du hast doch wohl nicht gedacht, dass du die Roomtour ohne mich machst, nur weil ich in Philadelphia hocke?«
Das ist eine rhetorische Frage, aber ich antworte trotzdem. »Als könnten so schlappe viereinhalbtausend Kilometer den Sommer vom Juni trennen.«
Sie lacht. Der Witz, dass Summer und June zusammengehören, ist alt, aber so wahr. Wir sind seit der Middle School Freundinnen. Unzertrennliche Freundinnen. Das haben nicht mal Moms Absturz, die Enttäuschung mit meinem Stiefvater oder mein erneuter Umzug in eine Pflegestelle vermocht.
»Also, was ist jetzt?«, reißt mich Summer aus meinen Gedanken. »Ich will sehen, wie du wohnst und wer mir ab sofort Konkurrenz als beste Freundin macht.«
»Sie wird meine Mitbewohnerin«, sage ich lachend. »Der Platz als beste Freundin ist nämlich schon vergeben.«
»Hmm.« Sie wiegt ihren Kopf hin und her, was aussieht, als würde sie einen fiesen Robotertanz veranstalten, weil Facetime immer wieder einfriert. »Sie wird dich lieben. Und ich bin so weit weg.«
»Dann liebt ihr mich eben beide«, beschließe ich. Ist ja nicht so, als hätte ich nach all dem Mist nicht genügend freien Speicher für so viel Liebe, wie ich kriegen kann. »Ich bin echt aufgeregt«, flüstere ich, weil in diesem Moment zwei Mädchen an mir vorbeigehen und ihre Chipkarten gegen einen kleinen Schaltkasten an der Tür halten.
Ich beäuge das Teil und muss grinsen. »Guck mal«, sage ich und drehe die Kamera um, damit Summer sieht, was ich sehe. Ein Schild mit einem Bären, der sich die Nase an einer Fensterscheibe platt drückt. Daneben steht, dass man die Türen zu jeder Zeit fest verschlossen halten muss, weil die Bären sonst die Herrschaft über das Studentenwohnheim übernehmen.
»Das ist so cool.« Summer seufzt. »Hier gibt es nur stinknormale Studentenwohnheime.«
»Und du liebst es trotzdem.« Die UPenn war ihr Traum und wir haben wild gefeiert, als sie angenommen wurde. Dann noch einmal, als ich meinen Platz hier bekam. Aber wir haben auch ein bisschen geweint, weil uns das maximal weit voneinander trennt.
»Tue ich«, gibt sie zu, während ich die Tür öffne und mich irgendwie feierlich fühle. Als würde ich ein seidiges, rotes Eröffnungsband zerschneiden und nicht nur meinen Studentenausweis gegen die Schaltfläche drücken. Im Erdgeschoss befinden sich eine große Küche, mehrere Aufenthaltsräume, aus denen Musik und Gelächter dringt. Lernbereiche, die schallisoliert verschlossen sind und in denen eine zenartige Ruhe zu herrschen scheint, und ein Gym, das die Hälfte der Gesamtfläche beansprucht. Ein paar Mädchen sind dort und deutlich mehr Jungs, die trainieren oder in Gruppen zusammenstehen, posen und fachsimpeln. Ich finde es großartig. Alles daran. Summer auch, denn sie redet ununterbrochen davon, wie schön das Gebäude ist, wie schön und modern die Küche, was für schöne und megacoole Aufenthaltsräume, schöne Lernbereiche, in die durch die Bäume gefiltertes Licht fällt, und schöne Flure, schöne Böden, schöne Jungs.
Ich muss lachen. Als wären die Teil der Einrichtung. »Ich bin nicht hier, um einen Typen aufzureißen.«
Summer stöhnt. »Hast du dir die Kerle mal angesehen? Die sind im Team des Ruderclubs.« Sie schlägt mit der flachen Hand gegen die Linse der Kamera. Als Ersatz, weil sie mir nicht gegen die Stirn hauen kann, wofür ich sehr dankbar bin. »Ruderclub!«, betont sie noch mal.
»Was soll mir das sagen?« Ich kapier es nicht.
»Weißt du, was für heiße Oberarmmuskeln die Typen haben? Und vom Bauch fange ich gar nicht erst an.« Sie zerfließt auf ihrem Schreibtisch und richtet sich mühsam wieder auf. »Ich weiß, du hast keine Zeit, weil du lernen, dich um deine Mom kümmern und arbeiten musst, aber versprich mir, dass du wenigstens einen Ruderer klarmachst, anstatt abends allein im Bett zu liegen und Podcasts zu hören. Opfere dich für das Team, okay.«
Einige der Typen sehen schon gut aus und ich will leben, also … »Ja, mal sehen«, sage ich lachend. »Aber jetzt will ich erst mal rausfinden, wo ich die nächsten vier Jahre wohnen werde.«
»Ich auch. Zweiter Stock, oder?«
Ich nicke und betrete mit Summer in der Hand den Fahrstuhl. »Zimmer 26.« Das liegt ganz am Ende des Gangs, was mir hoffentlich ein wenig Ruhe bescheren dürfte, selbst wenn auf dem Flur gefeiert wird. Und ich mag es, dass Lichtbaumsprenkel auf die Tür fallen, als ich sie erreiche. Ich berühre das tanzende Licht und lächle.
»Du siehst aus, als hättest du dich gerade in die Tür verknallt. Jetzt mach schon auf.«
Ich klopfe. Es ist schon mein Zimmer, aber sollte meine Mitbewohnerin bereits da sein, ist es vielleicht angebracht. Als ich nichts höre, öffne ich die Tür mit meiner Karte und jetzt stehe ich da. In meinem neuen Zuhause. Ich höre Summer schimpfen, weil ich das Telefon gegen meine Brust presse und sie nichts sieht.
Es ist … nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Kleiner und … verdammt viel schwärzer.
Ich drehe das Handy um, weil Summer rumzetert, dass ich ja gar nichts sage und warum ich ihr nichts zeige. Sie verstummt. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen schockiert. Die Wände sind schwarz gestrichen. Daran hängen Fotos von …
»Sind das tote Tiere?«
»Jepp.« Ich zerre die Tasche hinter mir her ins Zimmer und setze mich auf mein Bett, lege den Kopf schief und betrachte die Fotos, die an der Wand der anderen Zimmerhälfte hängen, genauer. Tote Tiere, ein Scheißhaufen, benutzte Taschentücher und ein Kondom auf dem Waldboden neben Reifenspuren. »Sie sind definitiv künstlerisch.« Soweit ich das beurteilen kann, hat meine Mitbewohnerin Talent, aber die Auswahl ihrer Motive ist … gewöhnungsbedürftig.
»Kannst du mal aufhören, immer so fucking positiv zu sein? Du musst dafür sorgen, dass du ein anderes Zimmer kriegst.«
Das wäre eine Option, wenn es denn ginge, aber … »Sie haben nur begrenzte Kapazitäten auf dem Campus und ich will nicht in eines der Wohnheime off-Campus.« Ich hatte mich so gefreut, als ich die Zusage für die David Hall bekommen habe, aber so langsam schwant mir, warum hier noch ein Bett frei war. Ich stehe auf und gehe näher an die Fotografien heran, betrachte jede einzelne, aber das macht sie nicht weniger widerlich.
»Sie haben dich mit einer Psychopathin in ein Zimmer gesteckt.« Summer hört sich an, als hätte sie Sorge, meine Mitbewohnerin könnte mir im Schlaf ein Kissen aufs Gesicht drücken.
»Ich bin keine Psychopathin.«
Ich zucke zusammen.
»Nur verdammt wütend.« In der Tür steht ein Mädchen, das zu blass ist, zu dunkel. Als hätten die Wände auf sie abgefärbt. Schwarze Haare, schwarz umrandete Augen, mattschwarzer Lippenstift, schwarze weite Klamotten und Tattoos. Und sie funkelt mich böse an. »Was hast du an meinem Scheiß zu suchen?«
»Ich war nicht an deinem Scheiß«, murmle ich und versuche, nicht das Gesicht zu verziehen, als sie so nah an mich herantritt, dass mir ihr gewöhnungsbedürftiges Parfüm in die Nase sticht. Eau de Friedhof oder so. »Ich habe mir nur deine Bilder angesehen.«
»Und?«
Sie bohrt mir ihren Finger in die Brust und schiebt mich auf meine Seite des Zimmers. Und ich habe keine Angst vor ihr. Egal was sie für eine Show abzieht. Ich habe Schlimmeres gesehen, Dunkleres erlebt, auch wenn ich das tief in mir vergraben habe. »Sie sind sehr künstlerisch.« Und ich so verdammt diplomatisch, dass es wehtut. »Ich bin June«, sage ich mit einem Lächeln, das normalerweise ziemlich gut im Eisbrechen ist.
Sie sieht meine Hand an, ergreift sie jedoch nicht. »Okay, Barbie, hör zu.«
»Barbie?« Ich bin irritiert. »Ich bin nicht mal blond.«
»Aber wie es aussieht, voller Vorurteile. Oder wieso sonst glaubst du, alle Barbies wären blond?«
Fassungslos starre ich sie an.
»Also, Barbie, egal aus welcher Vorstadtidyllenhölle du auch immer gekrochen sein magst, ich werde nicht deine Freundin, verstanden.«
Ich schaffe es zu nicken. Soll sie doch denken, was sie will. Bis ich hierhergekommen bin, war Idylle etwas, wovon ich bestenfalls einen flüchtigen Blick in Summers Familie erhaschen konnte. Sie hat also keine verdammte Ahnung. Und mir ist meine Zeit zu schade, um mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die mich vorverurteilen, ob nun wegen meiner Herkunft oder meines Aussehens. Nicht mal, wenn sie meine Mitbewohnerin ist.
Ich verlasse den Raum, um den Rest meiner Sachen zu holen und Luft zu bekommen, die in unserem Zimmer keine Chance gegen die Feindseligkeit hat.
»Was war das denn?«
Ich halte das Telefon so, dass Summer mich sehen kann, und zucke die Schultern. »Das war dann wohl Annie.«
Sie verzieht das Gesicht. »Das klingt so lieblich.« Und dann lachen wir beide. Weil lachen schon immer besser war als weinen. Akzeptanz und Vorwärtsgehen schon immer besser als Wut und Stehenbleiben. Um ein Haar bodychecke ich einen Kerl, der rückwärts aus dem Gym gehumpelt kommt und mit einem Typen des Ruderclubs rumalbert. Zumindest trägt er ein entsprechendes Shirt.
»Ich hatte mindestens zwei Reps mehr, du Pisser.«
Der andere lacht. »In deinen Träumen vielleicht, Hornet.«
Im letzten Augenblick bemerkt er mich, kriegt es aber nicht hin, seine Rückwärtsbewegung zu stoppen, weil … irgendwas mit seinem Bein nicht zu stimmen scheint. Dafür funktionieren seine Arme hervorragend. Muskulöse Arme, die Summer noch mal auf dem Tisch zusammenbrechen lassen, was diesen komischen Moment lautstark untermalt. In letzter Sekunde stützt er sich damit an der Wand ab und ich ducke mich darunter durch, sodass wir nicht zusammenkrachen.
»Sorry«, murmle ich und streife seinen O’Neill-Hoodie, spüre seinen festen Körper unter dem Stoff, rieche, dass er frisch geduscht ist, und höre ein leises Stöhnen. Als hätte ihm die Bewegung wehgetan. Sein Bein. Vermutlich hat er echt Schmerzen. Aber als ich ihn ansehe, lächelt er und hebt die Hand als Zeichen, dass alles okay ist, und für zwei Herzschlagsekunden bleibe ich an seinem Lächeln hängen. Weil es warm ist, irgendwie unter meine Haut kriecht, vertraut wirkt und … total fake ist.
Ich schüttle über mich selbst den Kopf, laufe weiter. Ich kenne den Typen gar nicht. Woher sollte ich also wissen, ob es echt war oder nicht? Und vor allem geht es mich gar nichts an.
»Na, der war doch mal hot«, sagt Summer in diesem Moment. Und ich denke, das wird der Grund sein, warum ich überhaupt so lange über ihn nachgrüble. »Und du bist mit ihm zusammengestoßen. Vielleicht war das Schicksal.«
»Oder vielleicht hast du zu viele Liebesfilme geguckt.« Sonst wüsste sie, dass ein Typ niemals dein Schicksal ist. Dass es so etwas wie Schicksal gar nicht gibt. Weil man immer eine Wahl hat. Und ich wähle mich. Weil das sonst nun mal niemand tut.
River
Ich habe V gesagt, dass ich losmuss, um mich mit Grayson zu treffen, und das war nicht gelogen. Allerdings ist der Termin erst mittags. Aber ich wollte nach der Physio noch ein bisschen trainieren gehen, damit ich meinem Ex-Boss nicht den Kopf abreiße, weil ich gefrustet bin, dass ich nicht mehr für ihn arbeite, weil ich mein beschissenes Stipendium verloren habe, weil ich ein Loser bin, der einfach nicht wieder auf die Beine kommt. Für all das ist der Prof nicht verantwortlich und da ich nicht als der verbitterte Typ rüberkommen will, der ich bin, habe ich die letzten Stunden mit Knox im Gym der David Hall trainiert. Bis ich vor Anstrengung in eine der Toiletten gekotzt und mich anschließend geduscht habe.
»Was ist heute los mit dir? Ich habe dich so was von in die Tasche gesteckt.«
Als könnte Knox mir das Wasser reichen. Es hat einen Grund, warum er mit seinen Lauchärmchen der Schlagmann des Teams ist und nicht an einem der Ruder sitzt. Ich drehe mich zu ihm um und schiebe mit meinem Rücken die Glastür des Gyms auf.
»Ich hatte mindestens zwei Reps mehr, du Pisser.« Und das weiß die Pfeife genau.
Er lacht. »In deinen Träumen vielleicht, Hornet.«
Ich kotze innerlich, weil er mich so nennt, will mich umdrehen und stolpere fast über ein Mädchen mit dunklen Haaren, die sie sich zu einem Knoten auf dem Kopf zusammengebunden hat. Mit meinem Bein habe ich keine Chance, ihr auszuweichen. Nicht, wenn ich mich danach nicht flennend auf dem Boden wälzen will. Die Wand. Ich stoppe die Bewegung, indem ich meine Hand dagegenstemme und das Gewicht meines Körpers so auffange. Sie duckt sich, berührt meine Seite mit ihrer Hand. Ihr Blick trifft meinen. Dann stammelt sie ein piepsiges »Sorry«, bleibt stehen und starrt mich an.
Und ich denke, sie ist hübsch. Verdammt hübsch, und dann denke ich, fuck, nein, nicht schon wieder jemand, der mich erkennt und die ganze beschissene Story erzählt bekommen will, der sich an dem weidet, was mir passiert ist, als wäre es das Samstagabendprogramm, nicht mein verdammtes Drecksleben.
Ich stoße mich von der Wand ab, lächle, fake, dass es mir gut geht. So wie schon den ganzen Tag. Dabei würde ich mich lieber verkriechen. Aber stattdessen bin ich hier, trainiere mit Knox, höre mir seine blöden Sprüche an, erlaube ihm, so zu tun, als wären wir Freunde, weil ich so nicht sein will. So wie Seth, der an dem ganzen Scheiß kaputtgegangen ist. Ich lächle ganz lässig, als wäre nichts passiert, obwohl sich mein verficktes Bein anfühlt, als würde es den Geist aufgeben. So richtig. Ich hebe die Hand, auch ganz lässig, voll entspannt. Weil man nach so einer Geste eigentlich nur gehen kann, aber sie rührt sich noch immer nicht. Und dann geht sie doch und irgendein total kranker Teil von mir findet das schade. Echt jetzt? Mein fucking Ernst?
»Die war süß.« Knox starrt ihr nach. Oder vielleicht auch nur ihrem Hintern.
Er hat recht. Aber wer braucht schon süß? Ich nicht. Eine verdammte Lara Croft wäre gut, die der Welt in den Arsch tritt, weil ich, verfickt noch mal, zu müde dafür bin. »Ich muss los«, sage ich und halte ihm meine Hand hin, damit er einschlägt.
Knox runzelt die Stirn. »Ich dachte, du kommst noch mit, ’ne Runde zocken.«
Bestimmt hat V ihm aufgetragen, ein Auge auf mich zu haben. Ich brauche keinen Babysitter. »Hab gleich einen Termin mit meinem ehemaligen Professor. Der ist gerade hier.« Weiß der Teufel, warum. Ich tippe auf ein schickes Wochenendhaus. »Und will sich treffen.«
»Aha.«
Knox sieht mich an wie jemanden, der auf keinen Fall einen Professor hatte oder überhaupt wen, der etwas in ihm gesehen hat. Ich kann ja selbst kaum glauben, dass ich vor knapp drei Monaten noch studiert habe, mit Einserschnitt, und die verdammte Hoffnung des Sac State Wakeboard Teams war.
»Bis … ach, scheiße, irgendwann halt.« Zu etwas Verbindlicherem kann ich mich gerade nicht hinreißen und lasse die Hand sinken. Wenn Knox keinen verdammten Handschlag will, dann kriegt er eben keinen. Deswegen werde ich bestimmt nicht heulen.
»Klar, Hornet, bis dann.«
Er soll, scheiße noch mal, aufhören, mich Hornet zu nennen. Ich bin kein Teil des Teams mehr. Nicht mal mehr Student der Sac State. Ich bin eine tragische Figur für meine Social-Media-Anhänger, die einfach nicht weniger werden, obwohl ich seit dem Statement zu Vs und meiner Trennung nichts mehr gepostet habe, und die mir trotzdem ständig ihr beklopptes Mitleid bekunden. Ich sollte den Account löschen, ich weiß das, aber dafür müsste ich mich einloggen, hinsehen, und das habe ich schon seit Wochen nicht mehr gemacht. Not gonna happen.
Ansonsten bin ich vielleicht gerade noch eine Projektionsfläche für die Ladys im Bad Habits, die denken, sie wären wild und rebellisch, wenn sie den wortkargen Typen hinter der Bar angraben. Aber darunter bin ich nichts als Leere und verdammte Albträume, Schmerzen und jede Menge Fake. Verficktes Fake-Grinsen, verficktes Fake-Gelaber, verficktes Fake-Ich-komme-klar.
Knox nickt mir zu, stößt sein Skateboard an, läuft ihm hinterher und springt auf, bevor er sich in smoothen Schwüngen entfernt und ich dasselbe tue, null smooth. Ich gehe, ohne irgendetwas davon laut auszusprechen.
Zehn Minuten später halte ich meinen Wagen vor dem Marine Room. Ein Restaurant direkt am Ufer des Sees und dementsprechend teuer. Professor Grayson wartet bereits, obwohl ich pünktlich bin. Fake pünktlich, weil es mir eigentlich scheißegal ist.
»River«, sagt er. »Schön, dich zu sehen.« Er steht auf, reicht mir die Hand und zieht mich dann in eine kurze Umarmung, was echt weird ist. Ey, er war mein Professor, kein Kumpel. »Wirklich schön.« Er nickt, als müsste er es wiederholen, um es zu glauben.
Er setzt sich wieder und deutet auf den freien Stuhl ihm gegenüber, während er die Kellnerin mit einer Handbewegung heranruft.
Ich setze mich.
»Ein Glas Pinot Grigio. Und für dich?«
»Ein Wasser, danke.« Mehr kann ich mir in dem Laden sicher nicht leisten.
»Keine Sprite?« Er lächelt. Die Kellnerin wartet. Ich bin beeindruckt. Er erinnert sich an mein Lieblingsgetränk.
Ich schüttle trotzdem den Kopf. »Nein, danke, ein Wasser reicht.« Das ist umsonst und damit genau meine Preisklasse.
Die Kellnerin zieht endlich ab und Professor Grayson beugt sich halb über den Tisch, begutachtet mich. Wie ein Pferd auf der Viehauktion. Dann gleitet ein Lächeln über sein Gesicht.
»Du siehst besser aus.«
»Ist nicht schwer.« Das letzte Mal, als er mich gesehen hat, lag ich halb zermatscht im Krankenhaus. »Die Latte hängt nach dem letzten Treffen nicht besonders hoch.«
»Da hast du recht.« Er hält kurz inne, weil die Kellnerin die Getränke bringt, und nippt an seinem Weißwein, bevor er weiterspricht. »Wie geht es dir so? Was machst du? Ich hatte gehofft, dass du zurück an die Sac State kommst, aber man sagte mir, dass das nicht der Fall ist.«
»Ich arbeite in einer Bar«, sage ich provokant. Mit Erdnussmatsch und Kotze auf dem Boden. Eigentlich ist das Bad Habits deutlich weniger Spelunke und mehr hippe In-Bar im Herzen von Tahoma, aber hey.
Er lacht leise auf. »Wir alle müssen arbeiten, um über die Runden zu kommen. Die Frage ist, was ist der weitere Plan?«
»Es gibt keinen Plan. Nicht mehr.« Ich atme geräuschvoll aus und lehne mich auf meinem Stuhl zurück. »Warum sind Sie hier?«
»Okay.« Er faltet die Hände und sieht mich eindringlich an. »Du warst einer meiner besten Studenten. Ich bin hier, weil ich verhindern will, dass du alles wegen einer kleinen Bodenwelle schmeißt. Studier weiter, mach deinen Abschluss. Dir fehlt doch nur noch ein Jahr.«
Ich lache tonlos auf. Ist das sein verfickter Ernst? »Ich habe mein Stipendium verloren.« Ich schlage gegen die Schiene an meinem Knie, auch wenn es richtig kacke wehtut. »Und das bekomme ich auch nicht wieder zurück. Egal wie hart ich trainiere. Das Bein ist hin.« Ist also nicht so, als hätte ich hier Scheißoptionen.
Grayson bleibt ganz ruhig. »Ich weiß, dass du das Stipendium verloren hast. Und mir ist klar, dass du nicht wieder auf dem Niveau fahren kannst, um es zurückzubekommen.«
Auf dem Niveau? Innerlich wälze ich mich vor Lachen. Damit ich nicht losflenne. Ich werde nie wieder überhaupt auf einem Board stehen. Äußerlich gucke ich maximal uninteressiert. Wie ein arrogantes Arschloch, das die ganze Welt hasst.
»Mir ist das alles klar«, sagt Grayson jetzt. »Aber es gibt nicht nur Sportstipendien. Du bist schlau, River. Also gibt es Möglichkeiten.« Er kramt in seiner Tasche rum und schiebt mir irgendwelche Papiere zu.
»Was ist das?«, frage ich, ohne sie anzusehen.
»Transferunterlagen. Ich verstehe, dass du nicht zurück an die Sac State willst. Dahin, wo das alles passiert ist, wo dich jeder drauf anspricht. Aber du könntest dein Studium hier beenden.«
Ich habe vier Millionen Follower. Mich spricht auch hier jeder drauf an. Und hat er nicht zugehört? Ich habe die Kohle nicht.
»Ich habe mit der Verwaltung gesprochen. Bei deiner Vergangenheit, deinen Noten und mit meiner persönlichen Empfehlung wird es ein Leichtes sein, das Stipendiumskommitee zu überzeugen, dich im jetzt beginnenden Semester zu unterstützen.«
Ich friere ein, höre sogar auf zu blinzeln. Hat der Typ sie noch alle? Bei meiner Vergangenheit? Glaubt er ernsthaft, ich will, dass die mir aus Mitleid mein verschissenes Studium bezahlen?
Er legt eine Visitenkarte oben auf die Papiere. »Das ist die Karte von David Palmgren. Ein schwedischer Gastdozent für Wirtschaft und Politik hier an der SNU. Er bleibt zwei Jahre. Eines davon ist rum. Und er sucht für den Rest der Zeit einen studentischen Assistenten. Ich habe dich empfohlen. Du musst nur hingehen und bekommst die Stelle.«
Ich weiß, ich müsste danke sagen, aber stattdessen suche ich nach dem Fehler in der beschissenen Matrix. Nach dem Warum. Warum tut Grayson das? Für mich? Was hat er davon?
»Was sagst du dazu, River?«
Ja, was sage ich dazu? Dass ich es nicht schaffen werde, neben der Arbeit, dem Studium und dem Job als Assistent gegen die Loughlins zu ermitteln, und es deswegen nicht geht? Dass ich mich um die Sache mit Avery kümmern muss, obwohl ich es nicht will, und das Studium echt gerade keine Priorität hat? Dass ich weiß, es sollte mir wichtiger sein? Dass ich weiß, wie viel er riskiert, indem er sich so für mich einsetzt, und dass ich denke, er setzt aufs falsche Pferd?
»Ich muss los«, murmle ich, schiebe meinen Stuhl zurück, hieve mich hoch und fake, dass es leicht ist. Fake, dass kein Schmerz in meinem Bein explodiert und mir die Luft aus den verdammten Lungen drückt. Fake ein Lächeln und ein Danke.
»Vergiss nicht die Papiere.« Grayson ist ebenfalls aufgestanden und drückt mir den Packen an Unterlagen gegen die Brust. Wenn ich nicht will, dass sie auf den Boden klatschen, muss ich sie festhalten. Er nickt zufrieden über den Scheißmove, legt mir eine Hand in den Nacken und übt leichten Druck aus. Als wäre er mein Vater oder so was. »Ruf Palmgren an. Okay?«
Und ich nicke, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Immerhin hat er sich den Arsch aufgerissen, ist extra an den See gefahren, um sich mit mir zu treffen, und das macht es irgendwie so richtig beschissen ihn zu enttäuschen, indem ich die Wahrheit sage. Dass ich nicht vorhabe, mich bei Palmgren zu melden, die Unterlagen auszufüllen oder weiter zu studieren. Dass nicht nur mein Bein kaputt ist, sondern der Rest noch viel kaputter. Und dass mir einfach alles so scheißegal ist. Vor allem ich. Ich bin mir scheißegal. Also schenke ich ihm einfach ein fakes Lächeln, auf das es jetzt auch schon nicht mehr ankommt, und dann gehe ich, verfrachte die Papiere in mein Handschuhfach, wo ich sie nicht mehr sehen muss, und verschwinde.
Der Typ, der sich mit ihm in diesem schweineteuren Schuppen getroffen hat, in dem Leute wie River und ich uns nicht mal eine Vorspeise leisten können, hat ihm Papiere gegeben.
River ist nur kurz in seine Wohnung, irgendwas holen. Das ist, was er zu Via am Telefon gesagt hat. Das Auto hat er nicht abgeschlossen. Eine Gelegenheit. Nicht viel Zeit. Das Leder des Autositzes knurscht, als ich mich dagegenlehne und das Handschuhfach öffne. Ich muss nicht mal wühlen, die Blätter liegen obenauf. Ich ziehe sie heraus. Ein Stipendiumsantrag. Keines für Sport wie früher, sondern für akademische Leistungen. Ich kotze. Wieso kriegen manche Leute alles, während andere ums verdammte Überleben kämpfen müssen?
River ist ein guter Typ und ich will mich für ihn freuen, aber wie soll das gehen, solange das Leben scheiße unfair spielt?
Ich mache Fotos von den Papieren und stopfe sie dann zurück, knalle das Handschuhfach zu und schlüpfe aus dem Auto, zurück in die Dunkelheit.
June
Ich habe schlecht geschlafen, weil ich mich tatsächlich ein bisschen vor Annie grusele. Deswegen habe ich die halbe Nacht Elyse Myers Podcast Funny Cuz It’s True gehört, der mich sonst immer runterbringt, aber Fehlanzeige. Ich habe einfach kein Auge zubekommen und wenn ich noch vor dem Stipendiatenbrunch wieder hier sein will, muss ich jetzt aufstehen. Ich muss für Mom einkaufen, weil sie sich sonst ausschließlich von Toastbrot und Dosenobst ernährt. Außerdem muss ich nach dem Trailer sehen, bevor mich irgendwann ein unüberwindbares Armageddon aus Müll und Dreck erwartet, dessen ich nicht mehr Herr werde. Mom ist kreativ und verfällt ständig neuen Ideen, die sie groß rausbringen werden, was der Teil ihrer Krankheit ist, der gut ist. Ich mag diese Begeisterung. Aber für die Pflichten des Alltags lässt sie keinen Platz. Das ist okay. Ich habe mich damit arrangiert, das für sie zu übernehmen, wenn es bedeutet, dass sie stabil bleibt. Ich mag die guten Phasen.
Ich küsse meine Finger, presse sie sekundenlang erst auf eines der vielen Bilder von Summer und mir, die ich über dem Bett angebracht habe. Dann gegen das zerknitterte, das mich und meinen besten Freund aus Kindertagen zeigt. Er blond, ich braunhaarig mit einem rosafarbenen Kleid an, beide schlaksig, ein bisschen zu ernst, eng umschlungen, weil wir uns immer aneinander festgehalten haben. Es ist das einzige Bild, das ich von ihm habe, und er der einzige Part aus diesem Teil meines Lebens, an den ich mich überhaupt erinnern möchte und es doch nur verschwommen kann, weil etwas in mir blockiert, wenn ich es versuche.
Ich quäle mich aus dem Bett und schleiche in das Bad, das ich mir mit Annie teile und das im Gegensatz zu dem Bat-Höhlen-Zimmer merkwürdig normal aussieht, dusche, putze mir die Zähne, schlüpfe dann in eine kurze Jeans und ein süßes Top und binde mir die Haare zu einem Messy-Bun zusammen. An der Tür schnappe ich mir meine Chucks und schlüpfe damit aus dem Zimmer. Erst auf dem Flur ziehe ich sie an, um Annie nicht zu wecken, die schlafend in einer unmöglichen Position auf ihrem Bett verrenkt liegt.
Auf dem Campus ist es ruhig. Nur vereinzelt hetzen ein paar Studenten, die entweder besonders fleißig sind oder massiv zu spät dran, über die Gehwege. Auf dem Bootssteg lassen gerade einige verschlafen wirkende Typen ein Achter zu Wasser. Ich hebe die Hand und winke, weil Freundlichsein meine Art ist und ich Summer irgendwie versprochen habe, ich würde wenigstens versuchen einen Ruder-Hottie klarzumachen. Das könnte vielleicht als Versuch durchgehen. Ein kläglicher Versuch, aber immerhin muss ich so bei unserem nächsten Telefonat nicht lügen.
Ich erreiche den Jeep und klettere hinein. »Sei lieb und spring an«, flüstere ich ihm gut zu und er hört auf mich, auch wenn der Motor zwei, drei Umdrehungen braucht, bevor er sich aufrafft. Vom Campus aus fahre ich westwärts über die Interstate 80, verbinde mein Handy mit dem Autoradio und lasse die Folge Funny Cuz It’s True weiterlaufen, die ich vorhin gestoppt habe. Auf dem Weg halte ich kurz bei einem Supermarkt, besorge Lebensmittel und Toilettenartikel für Mom und erreiche nach zwei Zwanzig-Minuten-Podcastfolgen die trostlose Mainstreet von Colfax. Drei Reihen Häuser mit abgeblätterter Farbe, rissiger Asphalt, keine Perspektive. Der Trailerpark befindet sich am Ortsrand. Als wäre sich selbst eine Stadt wie Colfax zu gut, um damit in Verbindung gebracht zu werden. Ich halte vor Moms Trailer.
Ich mache mir nicht die Mühe zu klopfen. Mom würde es sowieso nicht hören. Der Wohnwagen ist leer. Sie muss draußen sein und ich nutze die Ruhe vor dem Sturm, denn sie ist ein verdammter Hurrikan, wunderschön, aufregend und beeindruckend, aber auch hässlich und zerstörerisch, räume die Lebensmittel in die Schränke und schaffe ein wenig Ordnung. Ich stopfe Verpackungen und alte Zeitschriften in einen Plastiksack und das Geschirr, das sie tatsächlich abgewaschen hat, verfrachte ich zurück in den Hängeschrank.
Dann beziehe ich das Bett neu und räume die Schmutzwäsche in einen Wäschesack, den ich mitnehmen werde, um die Sachen im Wohnheim durchzuwaschen. Nicht, dass Mom das nicht könnte, aber sie vergisst sie regelmäßig in der Gemeinschaftsmaschine und dann werden ihre Sachen geklaut oder sie stinken. Und wenn sie doch daran denkt und sie aufhängt, bleiben sie auf der Wäscheleine hängen, bis sie wieder dreckig sind.
Ich trete aus der hinteren Tür des Trailerhomes und entdecke Mom auf dem ausgedörrten Stück Rasen, das so was wie ihr Garten ist. Sie steckt gerade eine verrostete Blechdose auf einen kaputten Regenschirm.
»Hi, Mom.«
Sie dreht sich um und klatscht in die Hände. »Junebug«, sagt sie überrascht. »Ist heute denn schon Dienstag?« Sie sieht verwirrt aus und darunter wunderschön.
Ich gehe zu ihr. »Nein, Mom. Es ist Montag. Aber ich habe dir doch erzählt, dass ich morgen noch Termine wegen des Studiums habe und deswegen nicht kommen kann.«
»Na, ist ja auch egal.« Ihre Augen blitzen. »Hauptsache, du bist da. Das ist so schön, dass du mich besuchst.«
Sie drückt mich, gibt mir einen Kuss und presst mich noch ein bisschen länger gegen sich. Und ich atme ihren Geruch ein, spüre, wie mich ihre Haare an der Nasenspitze kitzeln, erinnere mich daran, dass sie mich früher oft genauso geweckt hat, indem sie mich mit dem Ende ihres Zopfes an der Nase gekitzelt hat, erinnere mich an ihr Lächeln, das warm war und tief und echt. Erinnere mich an diesen Geruch, den ich geliebt habe und vermisst. Viel zu viele Jahre vermisst.
Und ich nicke, obwohl mein Herz ein bisschen wehtut, weil wir diese Zeit für immer verloren haben. Weil sie sich meistens nicht mal bemüht. Sie weiß bis jetzt nicht, was ich studiere. Sie hat nie gefragt, tut es auch jetzt nicht. Stattdessen dreht sie sich mit fast schon kindlichem Stolz zu dem Haufen Müll um, den sie zusammengetragen hat, und entlockt mir ein Lächeln.
»Und?«
Ich zucke die Schultern und sehe sie ratlos an, weil ich keine Ahnung habe, was sie von mir hören will.
»Na, was sagst du dazu?«
Schön, dass du den Untergang der Welt aufhältst, indem du Müll sammelst? Aber ihre Begeisterung sagt mir, Sarkasmus wird sie kränken und eventuell das Tief nach dem Hoch einleiten. So ist das mit Mom. Ein Balancieren auf Eierschalen. »Was ist das?«, frage ich vorsichtig und lege den Kopf schief, weil ich hoffe, dass sich mir der Sinn vielleicht dann erschließt.
Sie positioniert mich mit ihren Händen an meinen Schultern direkt vor dem Gebilde. »Das ist …« Sie macht eine theatralische Pause. »… Kunst.«
Äh, okay. »Kuuuunst?« Jetzt ist es so weit. Sie hat den Verstand verloren.
Sie nickt eifrig. »Ich habe im Fernsehen was von so einem Typen in Europa gesehen, der macht dasselbe und verdient Millionen damit.« Sie lacht begeistert und zupft an einer Fahrradspeiche, die gefährlich absteht und jemanden erstechen könnte. »Millionen, Junebug. Das ist unser Weg hier raus.«
Ich mag, wie sie mich Junebug nennt, und ich will wirklich nicht, dass sie ihre gute Laune verliert, aber das ist nicht das erste Mal, dass sie einen todsicheren Plan hat, wie sie ihr Leben zum Besseren wenden wird, und ich kann da einfach nicht mehr mitmachen. Die Top drei der krassesten Ideen bilden der Vertrieb von Haschkeksen, für den sie fast im Knast gelandet wäre, gefolgt von dem Versand getragener Socken an Fußfetischisten, der ihr jede Menge kranker Wichser beschert hat, weil sie im Impressum ihre Privatadresse angegeben hatte, beide nur noch getoppt von der Idee, Schlangen in freier Wildbahn zu fangen, um sie dann zu züchten, weil das kein Eigenkapital benötigt, die sie am ersten Tag ins Krankenhaus und fast ins Grab gebracht hat. »Okay, Mom«, sage ich trotzdem, weil ich das Positive darin sehen will. Sie hat sich für diese irre Skulptur Werkzeug gekauft, nichts, was sie umbringen könnte, und sie liegt auch nicht apathisch in ihrem Bett. Sie begeistert sich für Müll und sie scheint glücklich zu sein. Und das ist gut. Damit kann ich arbeiten. Ich muss.
»Hast du schon gefrühstückt?«
Sie überlegt. »Nein. Ich glaube, ich habe schon seit gestern Vormittag nichts mehr gegessen. Ich war so in meinem kreativen Prozess, weißt du.«
Kreativer Prozess. Puh. »Ich habe Bagels mitgebracht«, murmle ich und locke sie damit weg von der Monstrosität, bevor uns ihre Kreativität noch unter sich begräbt, und in den Trailer. Ich lege ihr einen der mit Schinken und Frischkäse belegten Bagel auf einen Teller. Dazu gieße ich ihr Orangensaft ein und stelle beides vor sie auf den Tisch und schüttle das Gefühl ab, dass ich wünschte, es wäre nur einmal anders. Sie würde nur einmal mich umsorgen anstatt ich sie. »Guten Appetit, Mom.«
»Isst du nicht mit, Süße?«, fragt sie, während sie schon am ersten Bissen herumkaut und genüsslich die Augen verdreht.
»Ich habe schon gefrühstückt.« Das stimmt zwar nicht, aber ich bekomme das Essen auf dem Brunch der Stipendiaten umsonst. Und ich habe nicht vor, unnötig Geld zu verschwenden, um meinen protestierenden Magen schon jetzt zu beruhigen. »Außerdem muss ich gleich wieder los.«
»Nein.« Mom reißt die Augen auf, als hätte ich vorgeschlagen, die Republikaner zu wählen. »Du musst noch bleiben. Bitte.« Und als ich nicht direkt antworte, klimpert sie mit den Augen. »Bitte, bitte, bitte.«
»Ich kann nicht, Mom«, stöhne ich. »Ich muss noch so viel für morgen vorbereiten.« Die restlichen Unterlagen im Studentenbüro abgeben, noch zwei Kapitel lesen, um für die Vorlesungen bereit zu sein, Summer anrufen, mich um einen Job kümmern.
Ihr eben noch von einem euphorischen Lächeln leuchtendes Gesicht verdunkelt sich. Dieser Wechsel von himmelhoch jauchzend zu todbringend betrübt ist nichts Neues, aber ich werde mich wohl nie ganz daran gewöhnen. »Und übermorgen hast du mich ganz vergessen«, stößt sie bitter hervor.
Ich habe sie nie vergessen. Selbst dann nicht, als sie mich abgegeben und keine Gedanken mehr an mich verschwendet hat. Als es ihr egal war, was mit mir passiert. Als sie jeden einzelnen Brief von mir unbeantwortet ließ, in dem ich sie angebettelt habe, gesund zu werden und mich zu holen, und alle Besuchstermine verpasst hat, während ich innerlich fast zersprungen wäre. Ich schließe die Erinnerungen an diese Zeit weg. So weit weg, dass sie grau und diffus werden.
»Du verlässt und vergisst mich. Genau wie Keath«, jammert sie, wischt sich die Tränen weg, die ihr jetzt unaufhaltsam über die Wangen kullern, und beißt schluchzend von ihrem Bagel ab.
»Mom, ich vergesse dich doch nicht. Ich arbeite nur an einem Plan B hier raus. Das Studium ist wichtig.« Es ist mir wichtig.
»Ein Plan B, hm? Du glaubst also nicht an mich und meine Kunst.«
»Mom.« Ich strecke die Hand nach ihr aus, aber sie weicht zurück, steht mit einem Ruck auf und verlässt den Trailer, geht zu ihrer Skulptur und stößt sie um, reagiert sich so lange daran ab, bis der Müll im ganzen Garten verteilt liegt.
Und ich halte sie nicht auf, tue gar nichts, außer mich abwenden, und alles, was ich denken kann, ist, sie wird in das nächste Loch stürzen, aus dem sich hervorzukämpfen sie dann wieder Monate braucht. Monate und mich.
Ich atme tief durch und gegen das brennende Gefühl an, ich wäre schuld. Bin ich nicht. Ich weiß das, aber es ist schwer, dieses Wissen auch zu fühlen. Und wenn das überhaupt gelingen soll und ich mich nicht in ihre wechselhafte, krasse Gefühlswelt hineinreißen lassen will, brauche ich Abstand. Also schnappe ich mir die Wäsche, verlasse wortlos den Trailer. Höre, wie Metall auf Metall geschlagen wird, schließe sekundenlang die Augen, steige in den Wagen und wünschte, ich wäre stärker, nicht nur mental, sondern vor allem körperlich, denn gerade fühle ich mich, als würde ich jeden Moment zusammenklappen. Vielleicht sollte ich mit den Ruderern im Gym trainieren und meinen Körper abhärten, damit ich der Welt etwas entgegenzusetzen habe, diesen Situationen. Ich und die Ruderer, das würde Summer gefallen. Summer. Sie wird tausendmal besser helfen als ein Workout. Ich wähle ihre Nummer. Zum Glück ist es bei ihr bereits drei Stunden später und ich muss sie nicht wecken.
River
Ich hocke in meinem Auto und starre auf den fein getrimmten Rasen des modernen Bungalows mit Blick auf den South Lake Tahoe Country Club und den glitzernden See. Jeder verfickte Grashalm schreit hier, wie viel Kohle die Bishops haben. Wie leicht es gewesen wäre, mich zu unterstützen, anstatt mich aufzugeben.
Meine Schicht im Bad Habits fängt in einer Stunde an. Wenn ich also noch weiter hier rumsitze und dieses dämliche Haus anstarre, wird es zu spät sein, um mich aufzuraffen und zu klingeln. Dann muss ich zurück. Und vielleicht warte ich genau auf diesen Point of no return, an dem ich die Sache abblasen muss. »Fuck«, murmle ich, weil ich das schon mal gemacht habe. Vor dem Haus meiner Mutter stehen und nicht reingehen, ihr nicht die Meinung sagen, ihr nicht an den Kopf knallen, was für ein ätzender Mensch sie ist, sondern einfach wieder fahren. Aber heute ist das keine Option. Wegen Avery. Wegen mir, weil ich die verdammten Cops rufen musste und deshalb schuld bin, dass die Loughlins sie jetzt in den Händen haben.
Ich stoße die Fahrertür auf und steige aus. Hat ja keinen Zweck, sich die Scheiße mit dem Warten noch länger zu geben. Mein Puls kriegt Minderwertigkeitskomplexe, als ich auf das Tor zuhalte, das ihre Welt von meiner trennt, und einem Gärtner zunicke, der die ordentlich getrimmten Pflanzen vor dem marmornen Eingang wässert. Keine Ahnung, was mich mehr mitnimmt. Der Marmor, der Gärtner oder die beschissen akkuraten Pflanzen, gegen die ich mich underdressed fühle.
Ich klingle, verdecke die Kamera mit meinem Arm und will echt nur eines. Hier weg, rede mir ein, dass es nicht um mich geht. Kein Stück. Ich bin wegen meiner Schwester hier – Halbschwester. Ich belüge mich selbst. Es knackt und eine Männerstimme fragt, wer da ist.
»Paketdienst«, sage ich und mache mit dem Lügen gleich mal weiter. Der Summer geht, das Tor öffnet sich automatisch und ich kriege kaum Luft. Das ist das Haus meiner Mutter und ich muss lügen, damit man mir die Tür aufmacht. Das ist so abgefuckt.
In der Haustür taucht ein Typ auf. Mitte sechzig vielleicht, aber er hat sich gut gehalten und wirkt irgendwie nett nichtssagend.
»Walter Bishop?«, frage ich und klinge wie ein geprügelter Hund, der sich jeden Moment auf den Rücken schmeißt.
Er nickt und runzelt die Stirn, weil ich kein Paket in der Hand halte. »Ich müsste mit Ihnen über Ihre Tochter sprechen.«
Er verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich dachte, Sie würden was liefern.«
»Hab gelogen.« Ich zucke die Schultern und sehe ihn fest an.
Er will die Tür zuschieben, aber bevor er das hinkriegt, stelle ich meinen Fuß in den Rahmen. Ich meine, wenn er die Tür zuballert, wird das nichts nützen und ich habe noch eine körperliche Baustelle mehr, aber ich hoffe auf eine gewisse Hemmschwelle und siehe da, er hält tatsächlich inne.
»Was soll das?«
Irgendwie ist das alles zu viel. In meinem Kopf ist nichts. In meiner Brust – nichts. Und dieses Nichts verschluckt mich. Ich höre meinen eigenen Herzschlag, meinen Atem. Und der Rest der Welt ist plötzlich unendlich weit weg.
»Es geht um Avery«, krächze ich.
»Heather«, donnert seine Stimme durch das Erdgeschoss. »Hier ist schon wieder so ein Sozialarbeiter wegen Avery.«
Ist er dumm? Ich habe mich vor seine Haustür gelogen. Welcher Sozialarbeiter hat so was nötig? Aber ich habe keine Zeit mehr, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, weil meine Mutter in diesem Moment hinter ihm auftaucht und mein Herz von der Brust in meine Eingeweide sackt und sich dort in einen schleimigen, stinkenden Klumpen verwandelt. Fuck, sie sieht noch genauso aus wie früher. Nur teurer gekleidet und älter. Sehr viel älter.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragt sie und reicht mir die Hand. »Ich hatte doch schon alles mit Ihrem Kollegen am Telefon besprochen.«
Ich starre ihre Hand an, ergreife sie nicht, weil ich dann wahrscheinlich anfange zu heulen oder so.
Sekunden vergehen, in denen sie mich fragend ansieht und ihre Hand irritiert sinken lässt. Sekunden, in denen mir klar wird, dass sie mich nicht erkennt. Ich bin ihr verdammter Sohn und da ist einfach nichts. Und ich brauche mehr als nur Sekunden, um dieses Fehlen von einfach allem zu verarbeiten.
»Kümmer du dich bitte darum«, wirft Walter dazwischen. »Ich habe noch zu arbeiten.« Und mit den Worten zieht fucking Walter sich in seinen Palast zurück.
»Ich bin kein Sozialarbeiter«, nuschle ich und weil sie es immer noch nicht rallt: »Ich bin Averys verdammter Bruder.« Keine Ahnung, warum ich das sage. Ich meine, ich bin kein Bruder. Aber noch weniger bin ich ihr Sohn und irgendwas muss ich ja sagen.
»Du?«
Ihre Stimme klingt mit einem Mal schrill und passt viel eher zu dem Monster, zu dem sie über die Jahre in meinem Kopf und vor allem in meiner Brust geworden ist.
»Was hast du hier verloren?« Die Arme vor dem Oberkörper verschränkt sieht sie mich an. Als würde sie, verfickt noch mal, denken, ich wäre hier, weil ich Kohle von ihr will oder dieses Leben. Ich scheiße auf ihr Geld. Ich scheiße auf ihr Haus in einer der teuersten Gegenden am See. Ich scheiße auf sie.
»Was willst du?«
Nicht hier sein. Fuck. Mir ist schlecht und kalt und ich habe das Gefühl, jeden Moment auf ihrem schweineteuren Marmorpodest zusammenzuklappen. Denn sie hat mich immer noch nicht hereingebeten. »Wie gesagt, es geht um Avery«, flüstere ich. »Nicht um dich und … mich.« Weil es kein Uns gibt. Schon lange nicht mehr.
Sie wirkt erleichtert. So verflucht erleichtert, dass ich heulen will. »Die ist versorgt«, sagt sie und winkt ab.
»Sie ist auf der Ranch der Loughlins.« Dort, wo sie auch mich zurückgelassen hat. Und sie scheint das für einen sinnvollen, klugen, durchdachten Schritt zu halten, ihre Kinder bei diesen Arschlöchern abzugeben. Ich verkrampfe meine Finger so fest miteinander, dass die Knöchel weiß hervortreten, blinzle das Bild des blauen, im Wind flatternden Kleides weg, das sich vor das des eleganten schwarzen Hosenanzugs schiebt, den sie heute trägt. »Und genau darum geht es.« Keine Ahnung, wie es mir gelingt, so schweineruhig zu klingen.
»Ich verstehe nicht.«