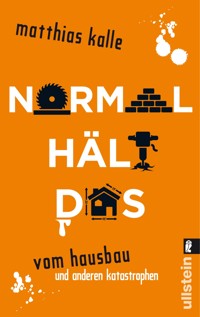
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Humorvoll, selbstironisch und leise verzweifelnd erzählt Zeit-Autor Matthias Kalle vom Wahnsinn und dem großen Glück, das einer erleben kann, der sich tatsächlich dazu entscheidet, ein Haus zu bauen: vom aufkeimenden Wunsch nach dem Eigenheim über die Standortsuche bis hin zu den subtilen Kämpfen, die man sich mit dem Bauleiter liefert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Matthias Kalle
Normal
hält
das
Vom Hausbau und
anderen Katastrophen
ullstein extra
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ullstein extra ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH www.ullstein-extra.de
ISBN 978-3-8437-0237-9
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Alle Rechte vorbehalten Satz und eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
INHALT
VORWORT
BAUSTELLE
PFUSCH
WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT
DACHSCHADEN
IN IST, WAS DRIN IST
»You think you can’t you wish you could
I know you can, I wish you would
Trip inside this house as you pass by.«
Primal Scream
VORWORT
Ich habe ein Haus gebaut, im Sommer 2009 fing ich damit an, und am 1. Februar 2011, gut anderthalb Jahre später, bin ich dort eingezogen. Ich habe dieses Buch in dem Haus geschrieben, ich schreibe gerade dieses Vorwort in dem Haus, ich habe ein Arbeitszimmer in dem Haus, es ist knapp zehn Quadratmeter groß, es liegt im Erdgeschoss des Hauses. Durch das große, fast bodentiefe Fenster sehe ich in den kleinen Vorgarten, den wir mit Sträuchern und kleinen Bäumen bepflanzt haben, und mittendrin stehen eine Bank und ein Tisch, und auf dem Tisch steht ein Aschenbecher, denn ich rauche nicht mehr in dem Haus, ich rauche draußen, und die Bank und der Tisch und der Aschenbecher und der Vorgarten sind Teil meines Büros. Wenn ich auf der Bank vor dem Tisch sitze und rauche, dann überblicke ich den Innenhof, ich sehe das Kopfsteinpflaster, das man besser hätte pflastern können, aber der Beruf des Pflasterers ist ausgestorben, diese Kunst wird nicht mehr gelehrt. Ich sehe die Blumenbeete, die von der Hausverwaltung angelegt wurden und die sogenanntes Gemeinschaftseigentum sind, die Beete stehen da zur Freude aller. Ich sehe das große gelbe Haus auf der anderen Seite des Innenhofs, das mal eine Fabrik war, früher, und in dem jetzt Wohnungen sind, in denen meine Nachbarn wohnen, und wenn meine Nachbarn aus ihren Fenstern schauen oder auf ihrem Balkon stehen, dann können sie mich manchmal auf der Bank vor dem Tisch sitzen sehen. Man grüßt sich dann, über den Innenhof hinweg, man hebt kurz die Hand, nickt, dann macht man weiter mit dem, was man gerade zu tun hat.
Vor ein paar Minuten hat der Wecker geklingelt, wie immer um 6 Uhr, denn für die Arbeit an diesem Buch bin ich früh aufgestanden, auch wegen des Arbeitsweges: Unser Schlafzimmer ist im zweiten Stock, und nachdem der Wecker geklingelt hat, schleiche ich mich ins Badezimmer und gehe unter die Dusche. Sie ist ebenerdig, und dass sie es ist, war ein harter Kampf, einer von vielen, die man kämpfen muss mit seinem Bauleiter, der es als seine Aufgabe ansieht, Schaden zu vermeiden, und es gibt für Bauleiter keinen größeren Schaden als den Wunsch des Bauherrn nach einer ebenerdigen Dusche. Außer vielleicht noch den Wunsch des Bauherrn, in der Küche und im Flur keine Fliesen haben zu wollen. Der Bauleiter ist ein Mann der Fliese und ein Gegner der Ebenerdigkeit.
Ich dusche, ziehe mich an und gehe in die Küche im ersten Stock, um mir einen Espresso zu machen, und während die Maschine rattert, schaue ich mir die Küche an, die ins Esszimmer übergeht, das ins Wohnzimmer übergeht, an dessen Ende die große Glastür ist, durch die man auf die Terrasse gelangt. Ich warte auf meinen Kaffee und frage mich, ob wir alles richtig gemacht haben, ob wir an alles gedacht haben oder ob nicht doch meine Mutter recht hat, die sagte: »Die Küche ist zu weit weg von der Terrasse.«
Mit dem Espresso in der Hand gehe ich ins Erdgeschoss. Aus dem Briefkasten hole ich die Zeitung und wage einen raschen Blick in den Innenhof: Meine Nachbarn schlafen noch, es gibt nichts zum Grüßen. Erst in einer Stunde etwa hört man die ersten Geräusche des Morgens, die Kinder, Türenschlagen, Schritte im Innenhof, die immer gleichen Anzeichen eines neuen Tages. Ich weiß nicht, ob man das, was ich in diesem Moment empfinde, Glück nennt oder Zufriedenheit oder ob ich mich nur wundere, dass ich hier stehe, vor meinem Haus, eine Tasse Kaffee in der Hand, die Zeitung unter dem Arm.
Auf dem Rasen des kleinen Vorgartens liegt der Tau, ich denke an Harald Schmidt, an die Zeit, als er noch jeden Abend in seiner Show davon berichtete, wie er um 4 Uhr 11 von den Wiesen zurückkam, wo er den Tau aufgelesen habe. Und ich denke, dass ich schon lange zu früh ins Bett gehe, um mir Harald Schmidt noch anzuschauen. Und ich erinnere mich daran, was mir Manuel Andrack einmal erzählte, als er noch Harald Schmidts Redaktionsleiter war und ich noch ein Reporter, der viel unterwegs war, damals, als ich noch in Wohnungen lebte. Andrack erzählte mir von seinem Hausbau, vielleicht war es auch ein Hauskauf, jedenfalls fragte er Schmidt um Rat, und Schmidt sagte, Andrack sei bescheuert, er solle zur Miete wohnen, nicht kaufen, nicht bauen, er wäre dann hundert Jahre unglücklich. Andrack sagte damals, es sei das einzige Mal gewesen, dass er nicht auf Harald Schmidt gehört habe. Was ist eigentlich aus Manuel Andrack geworden? Ist er ein glücklicher Mann?
Heute weiß ich: Wenn einer diese Grenze, die erste Grenze, überschreitet und sich vornimmt, die Welt der Miete zu verlassen, dann ist er für keine Ratschläge mehr empfänglich. Egal, wer was sagt, egal, was er sagt – mit der Entscheidung, nicht mehr zur Miete leben zu wollen, beginnt der erste Bau, nämlich der Bau des Tunnels, durch den man fortan gehen muss. Am Ende dieses Tunnels steht dann, wie in meinem Fall, ein Haus, und am Anfang dieses Tunnels steht eine Mietwohnung, aber der Blick ist nach vorne gerichtet, dahin, wo man durchmuss. Aber weil es dunkel ist in diesem Tunnel und weil er lang ist, länger, als man es sich vorstellen kann, sieht man nicht, was links und rechts ist. Man sieht nicht die Abzweigungen und die Falltüren, die Kurven und den ganzen Müll, der in diesem Tunnel rumliegt und an dem man vorbeikommen muss. Man kann nicht erkennen, was einem in diesem Tunnel alles entgegenkommen kann, welche Feinde dort auf einen warten und wie die Gegner versuchen, einen davon abzuhalten, das Ende des Tunnels zu erreichen.
Dieses Buch soll einen Eindruck davon vermitteln, was in diesem Tunnel los ist, was dort alles passieren kann. Es soll eine Ahnung davon geben, wie dunkel es in diesem Tunnel tatsächlich ist. Wie kalt. Wie ungemütlich. Wie es stinkt. Wie man manchmal daran denkt, einfach umzukehren. Wie man sich in diesem Tunnel verlaufen kann. Wie einsam es in diesem Tunnel ist. Aber dieses Buch berichtet auch davon, dass dieser Tunnel einmal zu Ende ist, ganz plötzlich sieht man dann das Licht, und man beginnt zu rennen, immer schneller, und wenn man dann in dieses Licht tritt, wundert man sich darüber, dass man es doch geschafft hat.
In dem Buch soll es um den Wahnsinn, die Katastrophen und um das große Glück gehen, das einer erleben kann, der sich tatsächlich dazu entscheidet, ein Haus zu bauen und diesen Tunnel zu betreten. Von der ersten aufkeimenden Unzufriedenheit nach mehrmaligen Umzügen in immer desolatere Mietwohnungen über die Entscheidungsfindung bis hin zu den subtilen Kämpfen, die man sich mit Bauleitern, Elektrikern, Vorarbeitern, Installateuren, der Telekom, Möbelverkäufern und den Gegnern des Hausbauens liefert. In diesen Kämpfen, das weiß ich jetzt, sind alle Mittel erlaubt, und der, der ein Haus baut, kämpft alleine, immer, er hat niemanden an seiner Seite, aber ihm gegenüber steht ein ganzes Heer, eine Armee, brutale Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben desjenigen, der ein Haus bauen will, so schwer wie möglich zu machen. Denn der Hausbau ist das letzte große Abenteuer des modernen Mannes. Der Hausbau führt ihn an die Ränder seiner Möglichkeiten, an die Grenzen der zivilisierten Welt. Der Hausbau lehrt einen Dinge, von denen man nicht einmal ahnen konnte, dass es sie gibt.
BAUSTELLE
Ich bin auf dem Weg nach Hause. An den kleinen Spaziergang von der Tramstation bis zu der Wohnung im vierten Stock habe ich mich gewöhnt, wenn ich schnell gehe, brauche ich fünf Minuten, und während dieser fünf Minuten stelle ich mir all das Schöne vor, das mich gleich empfangen wird: das Lachen meiner Tochter, die strahlenden Augen meiner Frau, den gedeckten Tisch, die Ruhe, die Ordnung, die Großzügigkeit und Behaglichkeit unserer Wohnung, unserer ersten gemeinsamen Wohnung, in der wir als Familie jetzt seit einem Jahr leben. Auf dem Weg zünde ich mir eine Zigarette an, es ist eine Art Ritual, die letzte Zigarette, sie verglimmt, wenn ich an der Haustür stehe, ich nehme dort noch einen Zug, einen letzten, denn natürlich rauche ich nicht mehr in der Wohnung, ich lebe ja nicht mehr alleine.
Ich bin dreiunddreißig Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter, sie wird bald ein Jahr alt. Bevor sie geboren wurde, zogen meine Frau und ich zusammen, unsere erste gemeinsame Wohnung nach drei Jahren Liebe, die erste Wohnung, in der ich nicht mehr alleine lebe, seit ich mit neunzehn von zu Hause ausgezogen bin. Ich habe die vergangenen vierzehn Jahre gerne alleine gelebt, ich kam gut mit mir aus, die berühmte Max-Frisch-Frage, ob man auch Humor habe, wenn man alleine sei, kann ich nur mit einem lauten »Ja« beantworten, tatsächlich ist mein Humor, wenn ich alleine bin, noch ein bisschen besser, als er es in Gesellschaft ist. Während dieser vierzehn Jahre habe ich mich nie einsam gefühlt, niemals alleine, im Gegenteil: Ich habe mich wohl gefühlt, es gab nichts, was ich vermisst hätte, nichts, was mir gefehlt hat, aber ich konnte ja auch nicht ahnen, dass es da etwas gibt, was noch besser ist, noch schöner, noch größer – etwas, das noch glücklicher macht. Auf dem Weg von der Tramstation zu der Wohnung im vierten Stock erinnere ich mich daran, jedes Mal, damit ich es nicht vergesse.
Um sicherzugehen, dass ich es tatsächlich nicht vergesse, niemals vergessen kann, damit nichts schiefgeht, damit es klappt, damit es funktioniert, haben wir eine Wohnung gemietet, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Eine große, schöne, lichtdurchflutete Wohnung im vierten Stock einer ruhigen Straße am nördlichen Rand des Berliner Stadtteils Prenzlauer Berg. Der Schnitt der Wohnung ist nahezu ideal, meine Frau und ich haben jeweils ein Arbeitszimmer, der größte Raum ist die Wohnküche, es gibt zwei Balkone, einen zum Hof und einen zur Straße. Am Ende der Küche gibt es zwei Stufen, sie führen zu einem zweiten Flur, von dem das Kinderzimmer, das Bad und das Schlafzimmer abgehen. Als meine Frau bei der Wohnungsbesichtigung das Bad sah, war die Entscheidung für die Wohnung endgültig gefallen. Das Bad hat eine freistehende Wanne und eine ebenerdige Dusche, die mit dunkelgrünen Schieferplatten gefliest wurde. Wenn man in der Badewanne sitzt, kann man aus dem Fenster schauen, man sieht dann in den Himmel über Berlin. Die Einbauküche, die bereits in der Wohnung war, liegt geschmacklich im oberen Mittelfeld, die Dielen in den Zimmern sind wunderschön aufgearbeitet worden, die alten Türen und Fenster sind erhalten, der Stuck immerhin zum Teil. Wir sind die einzigen Mieter in dem Haus, unsere Nachbarn haben ihre Wohnungen alle gekauft, als das Haus vor zwei Jahren komplett saniert wurde. Unsere Vermieterin, Anna, eine Holländerin, war damals beruflich in Berlin und konnte es nicht fassen, wie günstig man hier eine Wohnung kaufen kann, also entschloss sie sich zum Kauf, die Wohnung ist für sie eine Geldanlage, die Miete, die wir ihr monatlich überweisen, deckt ihre Finanzierung bei weitem. Anna lebt jetzt mit ihrem Mann und ihrem Kind in England, sie ist oft schwer zu erreichen, sie hatte sich dafür entschieden, keine Hausverwaltung zu beauftragen, deshalb müssen wir uns mit Kleinigkeiten direkt an sie wenden, was manchmal ein wenig mühsam ist, aber die Wohnung macht wenig Probleme. Wenn wir mit Anna sprechen, dann erkundigt sie sich immer auch nach unserer Tochter, sie nennt sie sogar beim Namen. Manchmal denke ich, dass man das auch erwarten kann bei so viel Geld, das sie von uns bekommt.
Ich stehe vor der Haustür und drücke die Zigarette mit dem Fuß aus. Den Stummel hebe ich auf, um ihn in einen der Mülleimer im Hof zu werfen. Ich schließe die Haustür auf, das Licht geht an, der Flur ist sauber. Ich gehe zum Hof und werfe die Kippe in den Müll, dann gehe ich zurück zu den Briefkästen, schließe auf und hole die Post. Mit dem Fahrstuhl fahre ich in den vierten Stock, und als ich aussteige, sehe ich das warme Licht durch die Milchglasfenster unserer Wohnungstür. Ich schließe die Augen, atme tief ein, dann wieder aus und schließe die Tür auf.
Es ist niemand da, anscheinend hat meine Frau vergessen, das Licht im Flur auszuschalten. Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und lehne meine Tasche gegen die kleine Flurkommode. Meine Schuhe ziehe ich aus und stelle sie an den dafür vorgesehenen Platz. Ich schaue in den Kühlschrank und nehme mir ein Bier raus, das ich auf dem Balkon trinke. Spätsommer, die Tage, bevor der Herbst übernimmt. Von dem kleinen Balkon kann man sehen, wie sich die Sonne neigt, wie sie langsam am Rand der Stadt verschwindet und alles in ein schwaches rosafarbenes Licht taucht. Ich trinke einen Schluck und kann mir nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben noch glücklicher werden könnte als in diesem Moment.
***
»Und die haben nichts geklaut?« Meine Frau schüttelt den Kopf. Sie ist vor einer Stunde aufgelöst nach Hause gekommen, unsere Tochter schlief im Kinderwagen, wir zogen ihr die Sachen aus und den Schlafanzug an und legten sie vorsichtig in ihr Bett. Währenddessen erzählte mir meine Frau, dass im Keller eingebrochen worden war, die Diebe hatten die Schlösser mehrerer Verschläge geknackt und diverse Sachen gestohlen: Fernseher, Angelausrüstungen, Fahrräder. Auch unsere Kellertür stand offen, als meine Frau nachschaute, aber sie konnte keinen Schaden feststellen.
»Aber wieso haben die denn ausgerechnet bei uns nichts geklaut? Ich kann das gar nicht glauben. Wir haben doch auch Sachen!« Irgendwie empfinde ich es als Demütigung: Diebe betrachten meinen Besitz und stellen fest, dass es sich nicht lohnt, irgendetwas mitzunehmen. Ich beschließe, mir selbst ein Bild zu machen, und gehe runter in den Keller, die Tür zu unserem Gitterabteil steht offen, morgen müsste ich ein neues Vorhängeschloss kaufen – obwohl: Wozu? Wenn die Herren Diebe sich zu fein dafür sind, etwas von unseren Sachen zu klauen, dann könnte ich es eigentlich auch gleich lassen.
Ich schaue mich um. Die Kiste mit den Büchern, die wir jetzt doppelt haben? Steht da. Die Kiste mit den CDs, die wir jetzt doppelt haben? Steht da. Das Rocky-Filmplakat, das meine Frau aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht in der Wohnung haben wollte? Steht da. Die Aktenordner aus der Studienzeit meiner Frau? Stehen logischerweise da. Der alte Computer, der natürlich nicht mehr geht? Steht dummerweise auch noch da. Die Diebe haben nichts geklaut, sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, richtig nachzuschauen, denn ich bin mir sicher, dass meine vollständige Sammlung aller »Spiegel Reporter«-Hefte mit Sicherheit einen Wert haben müsste. Ist natürlich noch da.
Plötzlich höre ich Schritte auf der Treppe, sie kommen näher, ich drehe mich um und sehe meinen Nachbarn.
»Und? Wie viel bei euch?«, fragt er. Ich sage ihm, dass wir verschont geblieben seien, und er sagt: »Na, dann vielleicht beim nächsten Mal.«
»Entschuldigung, was soll denn das heißen: beim nächsten Mal?«
»Die kommen in schöner Regelmäßigkeit und räumen die Keller aus. Wir wohnen jetzt seit sechs Jahren in diesem Haus, und das war der siebte Einbruch. Die Polizei sagt, das Haus sei ideal für Einbrecher: eine ruhige Straße mit wenig Durchgangsverkehr, gegenüber ein kleiner Park mit Fluchtwegen, wenig Assis.«
Weil ich etwas verständnislos schaue, erklärt er mir den letzten Teil: »Die wissen, dass hier Menschen wohnen, die arbeiten gehen. Keine Studenten, keine Rentner, tagsüber ist niemand hier, da steht das Haus ja quasi leer. Findet man ganz selten in Berlin, ist deshalb eine der ersten Adressen für das Pack.« Und obwohl es nicht so klingt, macht alles, was mein Nachbar sagt, Sinn.
Zwei Wochen später ist mein Konto mit 12 000 Euro überzogen. Anhand der Kontoauszüge stelle ich fest, dass ich wohl in den vergangenen Tagen jeden Abend einen nicht unwesentlichen Betrag an einem Geldautomaten am anderen Ende der Stadt abgehoben haben muss, außerdem scheine ich eine Monatskarte für den Nahverkehr gekauft und mich bei der Bekleidungskette »Frontwear« komplett neu eingekleidet zu haben. Ich lasse telefonisch sofort alle meine Bank- und Kreditkarten sperren und rufe die Polizei an. Als die Beamten eintreffen und ich ihnen meinen Fall berichte, erklären sie mir, dass das in der Gegend leider häufiger vorkomme. »Die fischen die Post von der Bank aus den Briefkästen, das machen die, bis sie eine neue Karte und ein paar Tage später die neue PIN-Nummer haben. Da sind wir quasi machtlos, Sie können aber gerne Anzeige erstatten. Um Ihr Geld kümmert sich ja die Bank.« Ich erstatte Anzeige und frage meine Bank, ob sie sich denn um mein Geld kümmern würde, und nachdem ich einige Formulare ausfüllen musste, wurde mir der gesamte Betrag, um den ich betrogen wurde, wieder auf mein Konto überwiesen.
In der Zwischenzeit sind im Badezimmer zwei Fliesen von der Wand gefallen, und meine Frau hat sich den Fuß aufgerissen, weil ein Zimmermannsnagel aus dem Boden ragt, wo noch nie ein Zimmermannsnagel aus dem Boden geragt hat. Und dann bekommen wir einen Brief von Anna, in dem sie uns mitteilt, dass sie zum nächsten Ersten die Miete gerne um fünf Prozent erhöhen würde. Sie bitte um Verständnis.
Und plötzlich haben wir ein Problem: Wir fühlen uns in der Wohnung nicht mehr wohl. Es war, als würde die Decke über uns in Zeitlupe einstürzen, und wir stehen da, Blick nach oben, und wundern uns, warum denn jetzt diese Decke einstürzt, denn das war nicht der Plan, das war nicht abgemacht – von einer einstürzenden Decke steht nichts im Mietvertrag. In dem Mietvertrag steht, so haben wir es jedenfalls verstanden, dass wir in eine glücklich machende Wohnung ziehen werden. Eine Wohnung, in der unsere Tochter laufen lernt, in der man Silvester feiert, weil man einen großartigen Blick über die Stadt hat. Eine Wohnung, in der alles möglich ist, in der man sich aus dem Weg gehen kann und ganz schnell wiederfindet. Eine Wohnung, von der aus man alles erreicht, den Supermarkt, den Park, die Kita. So eine Wohnung hatten wir gemietet. Und jetzt gibt es diese Wohnung plötzlich nicht mehr.
»Wir sollten ausziehen«, sage ich eines Abends zu meiner Frau. »Das macht hier keinen Sinn mehr.« Meine Frau sagt nichts. Wir sitzen am Küchentisch, ihr Blick wandert durch den Raum, so als ob sie alles prüfen, alles schätzen wolle, bevor sie zu einem Urteil kommt. Sie atmet tief durch die Nase ein und schenkt sich Wasser nach und sagt nichts.
Ich sage: »Unser Haus ist ein begehrtes Immobilienobjekt eines international operierenden Einbrecherkonsortiums, spezialisiert auf Kellerauflösungen und Briefkastenplünderungen. Hinzu kommt noch, dass hier alles ziemlich scheiße saniert wurde. Oberflächlich macht es einen guten Eindruck, tatsächlich aber hält nichts, Dinge fallen einfach ab oder kommen von irgendwo raus, wo sie nicht rauskommen sollten. Das ist ein Michael-Jackson-Haus!«
Meine Frau sieht mich an, wie sie mich manchmal anschaut, wenn ich ihr vorschlage, sie könne ja auch ruhig mal alleine zu einem Pärchenabend gehen.
»Und außerdem«, sage ich noch, »finde ich es eine Unverschämtheit, dass wir bald auch noch mehr Miete zahlen sollen. Das ist so, als ob man für ein Unfallauto mehr Geld ausgibt als für eines, das gerade frisch vom Band rollt.«
Meine Frau steht auf und schreitet durch die Küche, dabei erinnert sie mich an eine Königin, die ihre Ländereien zu Fuß begutachtet. Ich lehne mich im Stuhl zurück, denn ich habe locker und schlüssig argumentiert, es ist jetzt an ihr, konstruktiv zu sein.
»Und was schlägst du vor?«
Es ist anscheinend doch noch nicht an ihr, konstruktiv zu sein, noch nimmt sie die Rolle der Fragestellerin ein, also muss ich die Antworten geben: »Wir ziehen aus, je früher, desto besser.« Weil meine Frau nichts sagt, nehme ich ihr Schweigen als Einverständniserklärung, ich sehe es als Auftrag an.
***
Ich lebte zu diesem Zeitpunkt seit zehn Jahren in Berlin, in dieser Zeit wohnte ich in Kreuzberg, in Prenzlauer Berg, in Mitte und dann wieder in Prenzlauer Berg, und aus unterschiedlichen Gründen hat es mir überall gleich schlecht gefallen.
In Kreuzberg hatte ich eine grauenhafte Wohnung in einer furchtbaren Straße, weil ich die Wohnungssuche von München aus machen musste, wo ich zuvor lebte und arbeitete. Das Exposé, das ich im Internet fand, klang gut und vielversprechend, die Miete war für Münchner Verhältnisse, die ich gewohnt war, ein Witz, also sagte ich zu, ohne die Wohnung gesehen zu haben, und als ich dann ein paar Wochen später zwischen den Umzugskisten in der Wohnung stand, ging ich sofort wieder raus, aber auf der Straße war es noch schlimmer, weil mir ein Mann entgegenkam, der sich Milch über seine Jogginghose geschüttet hatte. Jedenfalls hoffte ich inständig, dass es Milch sei.
In Prenzlauer Berg war es anfangs noch sehr schön, aber plötzlich bekam ich schlechte Laune, wenn ich meine Wohnung verließ, um zum Bäcker zu gehen oder zum Supermarkt. Ich bekam schlechte Laune im Café und im nahen Park, ich bekam schlechte Laune bei meinem Lieblingsitaliener, und irgendwann wusste ich, woher diese schlechte Laune kam: Immer wenn ich unterwegs war, sah ich Leute wie mich. Ich sah keine alten Leute, ich sah keine Jugendlichen, ich sah keine Handwerker und keine Obdachlosen, und Ausländer sah ich auch nicht. Ich sah Männer und Frauen Ende zwanzig am Anfang ihrer Karrieren, sie hatten vernünftige Haarschnitte und eine leise Ahnung davon, wie man sich anständig anzieht. Sie hörten gute Musik und gingen in die gleichen Filme, die ich sehen wollte. Ich fühlte mich verfolgt, es war kaum zu ertragen.
Ich zog nach Mitte, mit der absurden Vorstellung, diesen Spiegelbildern meiner Generation aus dem Weg gehen zu können, was auch funktionierte, dafür sah ich aber überall unsere großen Geschwister, die im Leben alles richtig gemacht hatten und deshalb viel Geld in wirtschaftlichen Berufen verdienten und dafür sorgten, dass alles um sie herum so langweilig sein musste wie sie selbst.
Unsere Wohnung am nördlichen Rand von Prenzlauer Berg gefiel mir auch deshalb, weil sie in gewisser Entfernung zu all dem lag, aber manchmal war sie mir nicht weit genug weg. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir ein älterer Kollege einmal beim Mittagessen erzählte: Als der große österreichische Kabarettist Helmut Qualtinger auf eine Party ging, erkannte ihn die Gastgeberin, die eine große Verehrerin seiner Kunst war. Sie wollte sich natürlich um den Überraschungsgast kümmern, sie fragte ihn nach seinen Wünschen, was er trinken wolle, was er essen wolle, solche Sachen. Irgendwann sagte Qualtinger zu ihr: »Bittschön, gebns eahna ka Mühe, mir gefällts eh nirgends.«
Story of my life. Es gab mal einen deutschen Film, Ende der 80er Jahre war das, den habe ich nie gesehen, ich weiß nicht einmal, worum es in dem Film geht, aber damals, als ich darüber las, merkte ich mir den Filmtitel, er lautet: »Überall ist es besser, wo wir nicht sind«. Ich merkte mir den Titel, weil ich glaube, dass der stimmt, ich glaube wirklich, dass es überall besser ist, wo ich nicht bin, und wenn ich dann doch mal da bin, wird es schlecht. Wo soll ich also hin?
***
»Ziehen Sie doch nach Pankow«, sagt Herr Wollstein am nächsten Tag zu mir. Herr Wollstein ist Geschäftsführer des Café Einstein in Mitte, ein höflicher, zuvorkommender Mann, ein perfekter Gastgeber, ein netter Mensch. Ich esse gerade im Einstein zu Mittag, als wir ins Plaudern kommen, ich erzähle ihm von meiner Situation, und er erzählt mir von Pankow, wo er mit seiner Frau lebt. Wie schön es dort sei. Wie grün. Wie ruhig. Wie nah doch trotzdem an Mitte. Und er erzählt, dass in Pankow auch viel gebaut werde und dass jetzt viele junge Familien nach Pankow ziehen würden, eben weil es dort so herrlich sei. Herr Wollstein gehört nicht zu der Sorte Menschen, die dummes Zeug erzählen.
Als ich von der Arbeit nach Hause komme, habe ich drei Besichtigungstermine für das Wochenende. Fünfzimmerwohnungen in Pankow. Ich habe die Exposés aus dem Internet heruntergeladen, Fotos, Grundrisse, ich habe zwei Kopien gemacht und lege sie am Abend meiner Frau vor. Sie schaut mich fragend an.
»Was ist das?«
»Wohnungen. Schauen wir uns übermorgen an. Erinnerst du dich, wir haben gestern darüber gesprochen.«
Sie schaut mich immer noch fragend an. Kann es tatsächlich sein, dass sie unsere Abmachung vergessen hat? Ich sage, diesmal mit Nachdruck: »Wir waren uns doch einig, dass wir hier nicht bleiben wollen.«
»Ja. Aber zwischen ›hier nicht bleiben wollen‹ und ›nach Pankow ziehen‹ muss es doch mit Sicherheit noch etwas anderes geben.«
Und dann erzähle ich meiner Frau von meinem Gespräch mit Herrn Wollstein, und sie sagt: »Warst du schon mal in Pankow?«
»Äh, nein.«
»Ich war schon mal in Pankow. Und es gibt gute Gründe, warum ich da nur war und nicht bin. Pankow ist grauenhaft.«
»Ich kann die Termine doch jetzt nicht wieder absagen. Lass uns hinfahren. Nur gucken.«
Meine Frau sagt nichts mehr, kommt aber immerhin mit, und in Pankow ist es dann ganz furchtbar. Ich finde es zwar wunderbar, tolle Gegend, die Wohnungen sind sehr schön, die Mieten noch im Rahmen des Erträglichen. Unerträglich ist die Laune meiner Frau, die sich mit jeder Minute, die wir durch die Straßen gehen, mehr und mehr verschlechtert.
»Super hier, oder?«, frage ich sie noch am Anfang.
»Superscheiße«, sagt meine Frau, und ich sage dann erst mal nichts mehr.
Wir sprechen den ganzen Tag kein Wort mehr miteinander. Am Abend denke ich an all die Katastrophen und Tragödien, die unsere Beziehung überstanden hat, an all die Dinge, die der Liebe nichts antun konnten, und ich denke, dass es vielleicht die Suche nach einer Wohnung ist, die Menschen mehr trennt als alles andere, aber dann sagt meine Frau: »Wir können ja noch mal gemeinsam schauen, nach einer Wohnung, die uns beiden gefällt, in einer Gegend, die wir beide schön finden.« Dabei streichelt sie mir über den Kopf, und ich fühle mich wie ein kleiner Junge, der sich zu Weihnachten einen Flug zum Mond gewünscht hat und dem seine Eltern liebevoll zu erklären versuchen, dass das leider nicht ginge, dass man aber ja auch gerne mal ins Phantasialand fahren könne. Ich sage: »So machen wir das«, und küsse meine Frau. In der Nacht schlafe ich unruhig, ich habe Angst vor bösen Träumen.
Wir suchen die ganze Woche gemeinsam nach Angeboten, Vierzimmerwohnungen, besser fünf Zimmer, ruhig, aber doch zentral, gute Schulen sollten in der Nähe sein, Cafés, Supermärkte, ein Bäcker – solche Sachen. Meine Frau sagt, es sollte nicht zu weit weg sein von ihren Eltern, und ich nicke. Am Freitag ist unser Wochenende verplant, die Besichtigungstermine sind eng getaktet, die Exposés klingen vielversprechend, wir haben gute Laune.
***





























