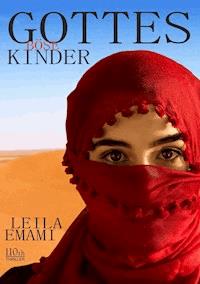Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leinpfad Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Im idyllischen Weinland Mittenrhein finden die rüstige Winzerin Elisabeth und das ewige Blumenkind Rosemarie ihre Freundin Klara tot im Garten ihres Hauses. Leider vertritt die Polizei die Theorie, dass tüdelige Alte schon mal aus dem Fenster fallen. Elisabeth und Rosemarie erkennen jedoch die Zeichen des Grauens – es war Mord! Damit beginnt für die beiden Freundinnen, für Elisabeths Neffen und Klaras Sohn und die türkische Detektivin Fatima eine aufregende Zeit. Auf beiden Seiten des Rheins ermitteln sie, wer von Klaras Tod profitieren könnte und das sind nicht wenige ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leila Emami, Fenna Williams, Zazie Chabrol
Nur überunsereLeichen
Krimikomödie
Die Handlung und alle Personen sind völlig frei erfunden; Ähnlichkeiten wären rein zufällig.
© Leinpfad VerlagFrühjahr 2017
Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: kosa-design, IngelheimLektorat: Christiane Geldmacher u. Angelika Schulz-ParthuLayout: Leinpfad Verlag, Ingelheim
Leinpfad Verlag, Leinpfad 5, 55218 IngelheimTel. 06132/8369, Fax: 896951E-Mail: [email protected]
eISBN 978-3-945782-34-7
INHALT
Prolog
1. Kapitel: Monika
2. Kapitel: Elisabeth
3. Kapitel: Monika
4. Kapitel: Elisabeth
5. Kapitel: Leo
6. Kapitel: Monika
7. Kapitel: Leo
8. Kapitel: Elisabeth
9. Kapitel: Leo
10. Kapitel: Monika
11. Kapitel: Elisabeth
12. Kapitel: Monika
13. Kapitel: Leo
14. Kapitel: Elisabeth
15. Kapitel: Leo
16. Kapitel: Monika
17. Kapitel: Elisabeth
18. Kapitel: Monika
19. Kapitel: Leo
20. Kapitel: Elisabeth
21. Kapitel: Monika
22. Kapitel: Leo
23. Kapitel: Elisabeth
24. Kapitel: Monika
25. Kapitel: Leo
26. Kapitel: Elisabeth
27. Kapitel: Monika
28. Kapitel: Leo
29. Kapitel: Elisabeth
30. Kapitel: Monika
31. Kapitel: Elisabeth
Epilog
Die Autorinnen
Prolog
»Wenn du nachher vorbeikommst, mein Lieber, und ich bin nicht da, heißt das nicht, dass ich gekidnappt oder ermordet worden bin. Es heißt nur, dass deine alte Oma sich erlaubt, ihre Angelegenheiten immer noch selbst zu erledigen. Ich habe sie schließlich noch alle beieinander … also … Falls ich schon weg bin, dann liegt der Umschlag für dich wie immer neben der roten Kasette.« Klara Schönlein überlegt einen Moment. »Ach ja, noch was: Da du es sowieso eines Tages erben wirst und mir ständig in den Ohren liegst, ich solle das einzig Wertvolle, was ich besitze, endlich hinter Vorhängeschlösser bringen, darfst du es dir heute nehmen und in Zukunft selbst für seine Sicherheit sorgen.« Sie lauscht angestrengt in den Hörer. »Nein, Peter, darüber brauchen wir nicht noch mal zu diskutieren. Ich habe das so beschlossen. Und so wird es gemacht. Tschüss, mein Lieber.«
Die alte Dame legt den Hörer auf und beginnt eines ihrer Selbstgespräche. »Mein Sohn Wilhelm hat seine Einbrecherphobie offenbar an meinen Enkel vererbt. Warum leben die beiden nur in ständiger Angst vor Verbrechen und Verbrechern? Ich dagegen …«
Ding Dong Dong …
Verwundert hebt Klara Schönlein den Kopf.
Die Türklingel?
»Ich erwarte doch niemanden!«
1. Kapitel: Monika
Ich habe noch nie einen Menschen umgebracht, aber das wird sich gleich ändern. Denn ich habe den besten Chef der Welt. Und der will das so.
Deshalb stehe ich jetzt auch in Hohenrhein vor dem Haus Cicerostraße Nummer 11 und klingele.
Ding Dong Dong …
Ich muss eine Aufgabe erfüllen. Eine wichtige. So richtig wohl ist mir allerdings nicht dabei. Aber ich werde es tun. Für Harald. Er wird mir dankbar sein und mich dafür lieben.
Er ist so niedlich, wie er da immer hinter seinem Schreibtisch im Rathaus sitzt, den weißen Kragen seines Hemdes ganz fest um den Hals liegend, den Krawattenknoten perfekt am Platz. »Monika«, sagt er immer, und das »o«, das er durch seine schmalen Lippen haucht, schmiegt sich um mich wie ein seidenes Tuch.
»Monika, setzen Sie doch bitte diesen Brief auf.«
»Monika, haben wir schon die Antwort vom Stadtrat?«
Monika. Wir.
Ich kenne niemanden, der so ein »o« sagen, meinen Namen so aussprechen kann.
Wenn ich abends im Bett meine Augen schließe, sehe ich, wie er in seinem eleganten Nadelstreifenanzug über einen roten Teppich auf mich zuschreitet. Ohne die jubelnde Menge zu beachten, seine Augen nur auf mich gerichtet. Diese Vorstellung treibt mir Gänsehaut über den Rücken.
Warum öffnet die Alte nicht die Tür?
Ich drehe mich noch mal um. Von der Gartenpforte, durch die ich eben getreten bin, führt ein mit Blumenrabatten gesäumter Plattenweg zum weiß gestrichenen Einfamilienhaus. Komisch. Als ich eben zur Eingangstür gegangen bin, erschien mir die Strecke unendlich weit, aber in Wahrheit sind es nur ein paar Meter.
Ich atme tief durch und drücke noch mal auf die Klingel.
Ding Dong Dong …
Kein Namensschild. Paranoid, diese Alten. Den Namen »Müller« muss man ja nun wirklich nicht verstecken.
Ich warte. Nichts regt sich. Vielleicht ist niemand zuhause? Bevor ich mich diesem hoffnungsfrohen Gedanken vollends hingebe, öffnet sich die Tür.
Ich kann nicht glauben, dass Frau Müller, die jetzt vor mir steht, achtzig sein soll. Sie sieht viel älter aus, wie neunzig oder hundert. Aber mit Senioren ist es wie mit Babys und Kleinkindern, man weiß nie, wie alt sie sind. Wobei es praktisch ist, dass man bei den Alten Männlein und Weiblein besser unterscheiden kann. Das Weiblein vor mir geht schon gebeugt, ihr Gesicht ist voller Falten, Frisur und Garderobe sind gepflegt. Weiße Locken, rosa Strickweste mit weißer Bluse darunter und einem blauen Rock, Perlonstrümpfe, die um die dünnen Waden Falten schlagen, weiße Lederschuhe. Eine Bilderbuchoma.
»Guten Tag«, sage ich und präsentiere ihr den Kuchen, den ich vorhin beim Bäcker gekauft habe. Dabei fällt mir ein, dass ich mich noch dringend bei diesem Backkurs in der Volkshochschule anmelden muss, damit ich Harald bald mit selbst gebackenen Köstlichkeiten verwöhnen kann.
Die Alte guckt mich misstrauisch an und ich setze mein extra-fantastisches Lächeln auf, das ich sonst nur für Harald reserviert habe.
»Ich bin Maria Metzger, Ihre neue Nachbarin, und möchte mich Ihnen vorstellen. Ich habe einen Kuchen mitgebracht.«
Metzger! Einen blöderen Namen hätte ich mir wohl nicht ausdenken können. Das muss was mit meinen Nerven zu tun haben. Und mit dem, worum ich mich jetzt kümmern muss.
Die Züge der Frau glätten sich, soweit dies in diesem Alter möglich ist, sie schaut verlangend auf den Kuchen und bittet mich hinein. In Zeitlupe ächzt sie vor mir die Treppe hinauf und nach gefühlten tausend Stufen landen wir in einem kleinen Vorraum mit Gummibaum, und dann in einem Wohnzimmer, das aussieht, wie aus einem Designer-Magazin für Senioren. Akkurat, piccobello, kein Stäubchen, alles an seinem Platz.
Ich setze mich auf die Sofakante. Während sie Kaffee kocht und mir aus der Küche freundliche Worte zuruft, die ich nicht verstehe, schaue ich mich um und überlege, wie ich ihr den Garaus machen kann.
Erst jetzt fällt mir so richtig auf, dass ich schlecht vorbereitet bin. Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Keine Pistole, kein Baseballschläger, kein Elektroschocker, noch nicht einmal K.-o.-Tropfen oder Pfefferspray.
Obwohl sich meine Mission ja abgezeichnet hatte. Schon vor Tagen hatte Harald mich gebeten, ihm behilflich zu sein. »Monika«, sagte er und schaute mich an mit diesen Augen, wegen derer ich mich schon abends auf den nächsten Morgen freue, »Monika, ich möchte Sie bitten, mir einen Gefallen zu tun.« So ist er. Er befiehlt nicht, er bittet, – ich schmelze.
Natürlich habe ich zugestimmt. Aber den Gedanken an die konkrete Ausführung der Tat habe ich dann wohl irgendwie verdrängt. Ich blöde Kuh. Und jetzt sitze ich hier und weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Ich denke nach. Ein Messer wird auf jeden Fall zur Hand sein, mit irgendwas muss die Alte den Kuchen ja zerteilen. Aber mit Blut habe ich es nicht so. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir vorstelle, mir beim Kartoffelschälen in den Finger zu schneiden.
Meine Augen scannen den Raum auf der Suche nach einem geeigneten Mordinstrument.
Auf dem zierlichen Schreibtisch vor dem Fenster thront ein Briefbeschwerer in Form eines lebensgroßen, goldfarbenen Igels. Damit könnte ich ihr eins über den Schädel geben. Oder ich könnte die Kristallkaraffe vom rauchfarbenen Beistelltischchen an der gegenüberliegenden Wand zertrümmern und den größten Splitter durch ihre Halsschlagader ziehen.
Mir wird schlecht.
Dann schon lieber die knallrote Geldkassette, die mir aus dem Regal über dem Sofa entgegenleuchtet. Die wäre schwer genug für einen effektiven Schlag auf den Kopf. Sie ist bestimmt aus Gusseisen oder Stahl oder so. Aber sie liegt wahrscheinlich nicht so gut in der Hand.
»Milch und Zucker?«, tönt es aus der Küche.
»Gerne!«, höre ich mich rufen, obwohl ich meinen Kaffee seit Jahrzehnten nur schwarz trinke. Diese verdammten Nerven.
Frau Müller schiebt einen quietschenden Teewagen in der typischen Nierenform der 60-er vor sich her. Ich helfe ihr, die Teller, Tassen, Kuchengabeln und die Kaffeekanne auf dem Sofatisch zu drapieren. Dann schüttelt sie das Kissen auf ihrer Seite zurecht, haut mit geübtem Handkantenschlag einen Knick hinein und lässt sich erschöpft in die Polster fallen. Mein Blick bleibt an dem Sofakissen hängen, grüner Samt mit goldenen Hirschen und Farnen darauf. Das ist es! Kein Krach, kein Blut, nichts. Einfach nur ein bisschen Stoff, der einer alten Dame den Atem raubt. Ich nicke zufrieden, während sie weiterspricht.
Obwohl sie ja wirklich zauberhaft ist. Schenkt Kaffee ein, legt Kuchen auf, nickt mir zu, lächelt mich an und zwitschert wie ein Vögelchen, während sie alle möglichen Dinge erzählt, denen ich kein Gehör schenke. Ich habe mich auf einen Mord zu konzentrieren.
Aber sie ist wirklich hartnäckig, strahlt mich aus allen Falten an und ich spüre, dass sie wahnsinnig froh ist, Besuch zu haben. Wie das so ist bei steinalten Leuten, die wahrscheinlich schon sämtlichen Freunden Blumen ins Grab nachgeworfen haben.
Ich kann das nicht. Ich kann diesem frohen Zwitschern kein Ende machen. Nein. Doch dann ich sehe wieder seine Augen vor mir. Blau mit kleinen Sprenkeln von Grün.
Gerade, als ich nach dem Sofakissen greifen will, erhebt sich die Alte.
»Es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie angeboten haben, meine Pflanzen zu gießen. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Dann zeige ich Ihnen mal die Blumen«, zwitschert sie.
Hatte ich ihr etwa angeboten, ihr Grünzeug zu wässern? Ich hätte beim Anblick des Sofakissens vielleicht nicht nicken sollen.
Sie läuft in Richtung Balkon und ich folge ihr, das Sofakissen in der Hand. Kurz überlege ich, ob ich sie nicht einfach über die Brüstung werfen soll, schmächtig wie sie ist, wäre das ein Kinderspiel. Aber ich traue mich nicht, das ist mir zu brutal.
» Sehen Sie«, sagt sie und ihr Arm umfasst mit einer liebevollen Geste ihr Pflanzenreich im Garten unter uns. »Da, meine Margeriten, und dort, die Rosen blühen auch schon.« Lächelnd dreht sie sich zu mir um, doch sogleich verfinstern sich ihre Züge. Aus ihrem freundlich schrumpeligen Weihnachtsapfelgesicht wird binnen Nanosekunden eine fürchterliche Fratze und sie schreit mich an: »Sind Sie von Sinnen?« Dabei deutet sie mit zitternder Hand auf das Sofakissen, das ich mir vor die Brust presse. Wer ist die Alte, eine Teufelin? Wie kann sie ahnen, dass das Kissen meine Waffe ist?
Sie schreit weiter: »Niemand, niemand, entfernt meine Sofakissen vom Sofa und nimmt sie mit auf den Balkon! Deswegen heißen sie Sofakissen und nicht Balkonkissen …« Sie fängt an zu japsen, schreit: »Und das da … das … ist mein persönliches … persönliches Lieblingskissen. Meins!« Schreit und fängt an, an dem Kissen zu zerren. Ich halte es mit aller Kraft fest. Schließlich ist es mein Mordinstrument. Doch dann sieht sie auf einmal so bleich aus und fängt immer heftiger an zu atmen.
Jetzt tut sie mir leid. Ich lasse das Kissen los. Morden ist sowieso nicht mein Ding. Ich werde Haralds Herz lieber mit Kuchen aus dem Backkurs erobern. Also entspanne ich mich. Aber nur so lange, bis ich sehe, wie die Alte durch das hölzerne Balkongeländer bricht. Scheiße! Ich hätte das Kissen nicht loslassen sollen.
Ich schaue hinunter. Sie liegt in der Rabatte mit Vergissmeinnicht, die Arme und Beine so komisch angewinkelt wie in den amerikanischen Serien, in denen öfter mal Leute aus dem Fenster stürzen und die ich manchmal gucke, um mir den Abend zu verkürzen, der mich von einem weiteren Tag im Büro trennt. Einem Tag mit Harald.
Ich fühle mich gar nicht gut. Obwohl: Haralds Wunsch habe ich erfüllt. Frau Müller ist verblichen. Aber ich muss hier weg. Übergeben darf ich mich nicht. Das weiß ich auch aus dem Fernsehen. Dann können sie einen nämlich drankriegen, wegen dem DNA-Zeugs und so.
Wegen dem DNA-Zeugs sammle ich auch das ganze Geschirr ein, das Frau Müller und ich benutzt haben. Obwohl meine Hände zittern, spüle ich den ganzen Kram. Es dauert eine Weile, bis ich herausgefunden habe, wo alles hingehört. Die Reste von dem Kuchen packe ich wieder in die Bäckertüte und verstaue sie in meiner Handtasche. Gut, dass ich heute die große braune mitgenommen habe. Jetzt sieht es so aus, als wäre ich nie hier gewesen.
Endlich bewege ich mich in Richtung Wohnungstür, da hallt ein Ding Dong Dong durch das Vakuum in meinem Kopf. Das darf jetzt nicht wahr sein! Meine Knie fangen an zu zittern. Wenn es klingelt, heißt das, dass da draußen jemand ist und dass ich nicht weg kann. In den Windungen meines Gehirns arbeitet es auf Hochtouren. Über den Balkon zu fliehen, macht keinen Sinn. Ich kann nicht klettern und außerdem liegt da unten die Frau Müller; ein Anblick, den ich mir gern ersparen würde. Ich muss einfach ruhig bleiben und ausharren, bis der Klingler wieder weg ist. Wie lange steht da einer, wenn niemand öffnet, bevor er wieder geht? Ich warte. Kein erneutes Klingeln.
Gerade als ich denke, dass alles noch mal gut gegangen ist, höre ich, wie ein Schlüssel ins Schloss gesteckt wird. Renne los, nehme die erste Tür, die vom Flur wegführt. Sehe ein Bett und einen Schrank. Springe in den Schrank. Mein Herz klopft, mir ist schwindelig. Garantiert werde ich gleich ohnmächtig. Werde aus dem Schrank fallen und dann ist alles aus.
Während ich langsam ein- und ausatme, damit nicht zu viel Sauerstoff in mein Gehirn kommt – wie früher in der Schule – erreicht ein vertrauter Duft meine Nase. Mottenpulver! Mottenpulver, das mich an meine Oma erinnert. Jetzt weiß ich auch, was das Weiche, Flauschige neben mir ist. Pelz.
Eigentlich ist es gar nicht so schlecht hier in dem Schrank, warm und kuschelig und voll von Kindheitsgerüchen. Wenn da bloß nicht diese Schritte wären. Jemand geht in der Wohnung umher. Er wird auch in dieses Zimmer kommen, das weiß ich. Ich hoffe nur, dass er nichts zum Anziehen braucht.
Ich öffne ein Auge und stelle fest, dass es in meinem Schrank gar nicht so dunkel ist wie ich dachte. Es ist ein moderner Schrank, nicht wie bei meiner Oma. In Höhe meiner Augen befinden sich Lamellen, durch die Licht fällt. Ich kann sogar das Zimmer sehen, wenn auch das Bild unterbrochen von Streifen ist.
Ich höre eine Männerstimme. »Hallo? Bist du noch da? Haaallooo, Oma?« Hoffentlich kommt der nicht auf die Idee, im Schrank nach ihr zu suchen. Jetzt ruft der Mann: »Da ist ja der Umschlag! Aber wo ist die Brosche?« Er seufzt. »Oma wird auch immer vergesslicher. Dann muss ich die Brosche eben suchen.«
Die Schritte kommen näher – jetzt ist er im Schlafzimmer. Ich müsste mich aufregen, doch das Mottenpulver wirkt auf mich wie ein Beruhigungsmittel. Ich öffne das andere Auge und sehe durch die schmalen Schlitze der Lamellen einen Mann, der zielstrebig auf eine Kommode zusteuert. Er zieht Schublade um Schublade auf, bis er schließlich ein blaues Kästchen ans Licht befördert. Darin kramt er herum und nimmt einen glitzernden Gegenstand heraus, den er in seiner Jackentasche verschwinden lässt. Dann noch ein paar Schritte, die sich immer mehr entfernen und schließlich höre ich die Wohnungstür ins Schloss fallen.
Ich bin erleichtert und müde. Ich möchte schlafen, nein, fliehen. Nein, beides. Lehne mich zurück in meinem Schrank und atme den Omaduft ein.
2. Kapitel: Elisabeth
»… bie schuur to wääär zam flauers in juur häär, if you’re goinnnggg to Saaan Fraaancisco …«
Ich halte mir die Ohren zu und versuche Scott McKenzie niederzubrüllen. »Rosemarie, dreh das Autoradio leiser, die Leute gucken schon.«
Die Leute sind ein paar Jugendliche auf dem Weg zur Schule, die neben uns die Straße entlanggehen und uns ansehen, als wäre die von Rosemaries Radio erreichte Dezibelzahl das Privileg ihrer Boomboxen. Eine orangefarbene Ente ist als fahrbarer Untersatz für sie sicher schon seltsam genug, aber dass aus diesem Gefährt auch noch Musik aus deren Blütezeit dröhnt und es so aussieht, als würde sie uns zwei alten Schachteln mit Hilfe von Schallwellen fortbewegen, das erscheint den Küken wohl doch zu dick aufgetragen. Wenn die auch noch wüssten, aus welchen Gründen unser Gefährt den Namen Miguel trägt … Ich lächle in ihre unerfahrenen Gesichter und sehe mit Genugtuung, wie Rosi ihnen die Zunge herausstreckt. Je älter man wird, desto mehr erlaubt man sich. In ein paar Jahren verhalte vielleicht sogar ich mich so, wie ich es immer gerne gewollt hätte …
Wegen Scott McKenzies Hippie-Hit schenkt meine liebe Freundin Rosi der auf Rot schaltenden Ampel dummerweise zu spät die notwendige Aufmerksamkeit. Durch das scharfe Bremsen ergattert sie nicht nur die Pole Position, sondern stürzt auch das Innere des Autos ins Chaos. All meine Umzugskartons, meine proppevollen Taschen, Schachteln und unzähligen Tupperdosen drängen ungebremst aus dem Fond nach vorne und bringen meinen wackeligen Beifahrersitz und mich in Schieflage. Für unfreiwillige Yogahaltungen dieser Art bin ich eindeutig zu alt.
»Bitte, leiser«, versuche ich es wieder, während ich einen Henkelkorb zwischen unseren Kopfstützen zu platzieren versuche, um nicht noch einmal zusammengefaltet zu werden. Dabei komme ich versehentlich gegen den Auslöser meiner Polaroidkamera, die ich obenauf gelegt hatte, um mit ihr die Ankunft in meinem neuen Heim zu dokumentieren. »Und fahr zur Abwechslung mal nach den geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung. Du bist hier nicht auf dem Hockenheimring. Außerdem transportierst du heute meinen wertvollsten Besitz: mich.«
»… bie schuur to wääär zam flauvrs in juur häär«, antwortet Rosemarie.
Ich atme langsam ein und aus. Meinen nächsten Umzug, das schwöre ich bei der stählernen Gesundheit meiner zweiundsiebzig Jahre, erfolgt mit den Füßen zuerst und mit Hilfe von sechs geübten Trägern.
»Rosemariiieee«, brülle ich. »Das hält doch niemand aus. Im Fahren mag das ja noch gehen, aber an der Ampel ist …«
Mich und mein verbliebenes Gehör rettet die Tatsache, dass Rosemaries Lieblingssender Wolke 7 FM die nostalgische Reise nach San Francisco durch ein schrilles Zeitzeichen beendet und die Nachrichten ankündigt. Der Beep bringt Rosemarie aus ihren blumenbekränzten Erinnerungen zurück ins Hier und Jetzt. Nachrichten aus der Provinz lässt sie sich nie entgehen.
»Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es genau zwölf Uhr. Radio Wolke 7 mit Nachrichten aus dem Weinland Mittenrhein, unserer heilen Wunderwelt!«, höre ich die Nachrichtensprecherin. »Heute ist ein großer Tag für einige unserer älteren Mitbürger. Das ehemalige Ursulinenkloster ›Himmelsleiter‹ in Klosterley ist endlich fertig saniert und umgebaut. Die Pläne, daraus ein Luxushotel für die oberen Zehntausend zu machen, sind damit endgültig vom Tisch. Wie die Heimleitung, Frau Anastasia Hemmschuh, uns soeben mitteilt, rollen die ersten Bewohner bereits an, um ihr neues Zuhause zu beziehen. Unser Reporter ist vor Ort und …«
Rosemarie dreht das Radio lauter: »Die reden von uns, Elisabeth! Hör mal, die reden von uns!«
Rosemarie ist meine beste Freundin. Ich kenne Rosi seit unserer Teenagerzeit und weiß deshalb, dass sie sich nie maßgeblich verändert hat. Im Gegensatz zu mir. Ich musste vom Tag meiner Eheschließung an die Verantwortung für das Weingut der van Amelns tragen, mich jeder wirtschaftlichen Änderung anpassen und die Konkurrenz des gesamten Weinlandes Mittenrhein im Auge behalten. Während ich mich immer wieder durchsetzen musste, bewahrte sich Rosemarie trotz wechselnder Ehemänner ihr kindliches Gemüt ebenso wie ihre Vorliebe für flatternde Kaftane, die sie – äußerst gewagt – mit Halstüchern jeden Musters und jeder Farbe kombiniert. Dieses Faible macht es mir leicht, Rosemarie zu beschenken. Ein neuer Schal und schon zaubere ich ihr ein strahlendes Lächeln aufs Gesicht. Natürlich hört sie auch immer noch dieselbe Musik wie damals: von den Beach Boys über Herman’s Hermits bis hin zu Crosby, Stills, Nash & Young. Genauso laut wie früher, heute allerdings, weil sie sich weigert, sich ein Hörgerät anpassen zu lassen und aus demselben Grund, aus dem meine Tochter Gesine auf eine Brille verzichtet: Eitelkeit.
Eitelkeit: Mich erstaunt sie bei Menschen immer wieder. Tiere sind schließlich mit ihrem Fell auch so zufrieden, wie es ihnen geschenkt worden ist. Ganz gleich, welche Farbe, welche Form, welches Alter. Das sollte bei Menschen auch so sein. Mir jedenfalls reichen die Hosen und Hemden und Jacken, die ich von meinem Armbrecht selig übernommen habe. Bis die aufgetragen sind, kommt mir kein kostspieliges Fähnchen ins Haus. Ich gebe mein Geld lieber für wichtige Dinge aus. Heutzutage kosten ja fünfundzwanzig Pfropfreben schon über fünfzig Euro. Blauer Spätburgunder. Von Riesling will ich hier gar nicht reden.
Nein, ich muss mein Geld zusammenhalten, besonders jetzt, wo ich in die Seniorenresidenz ziehe. Und obendrein mein Auge auf einen heruntergewirtschafteten Weinberg in Bestlage von Schönhell geworfen habe …
Wahrscheinlich habe ich mich doch ein wenig zu schnell von Rosi überzeugen lassen, ins neue Seniorenstift zu ziehen. Ab jetzt wohne ich zwölf Kilometer entfernt von unserem Weingut. Keine Kleinigkeit, wenn man nur Traktor fährt. Aber immerhin bietet sich jedem Besucher von meinem Turmzimmer aus ein grandioser Blick über das gesamte Weinland Mittenrhein. Ganz gleich, aus welchem Fenster man schaut, der Weingau liegt wie auf dem Präsentierteller vor dem Betrachter, auf der anderen Seite das gesamte linksrheinische Weinhessen. Außerdem kann ich auf meine Freundin zählen, auch wenn es nicht sonderlich bequem ist, mit ihr meine Habseligkeiten in mein neues Domizil zu bringen: Appartement 13, Turmsuite, Seniorenresidenz ›Himmelsleiter‹, Klosterley, Weingau. Ich gebe zu, das klingt gut. Keine überforderten Söhne und nervigen Töchter mehr am Hals, die nur ans schnelle Geld denken. Sich endlich mal bedienen lassen, ein ruhiges Leben führen. Traumhafte Zustände, wenn vielleicht auch ein ganz klein wenig … öde.
»Sag mal, hörst du schwer?« Rosemarie knufft mich in die Seite und ich merke erst jetzt, dass sie wieder losgefahren ist. »Hast du mitgekriegt, dass ich noch bei Klara Schönlein vorbei will, um mir endlich die Töpfe mit dem Bilsenkraut abzuholen, das sie für mich gezogen hat?«
Nein, habe ich nicht, aber das gebe ich natürlich nicht zu, sonst wirft mir Rosemarie wieder vor, dass ich in letzter Zeit unaufmerksam sei und zu viel grübele. Dabei denke ich nur nach. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen grübeln und nachdenken. Ich mache mir eben so meine Gedanken, wie es mit unserem Weingut weitergeht, wenn ich nicht mehr ständig vor Ort bin. Die van Amelns sind nicht irgendwer: Wir haben einen Ruf zu verlieren.
»Ich darf das Bilsenkraut übrigens in den ehemaligen Klostergarten pflanzen. Anastasia Hemmschuh, die Leiterin unserer Residenz, hat ihre Zustimmung schon erteilt«, sagt Rosi gerade und ich glaube, nicht richtig gehört zu haben.
»Was? Das kann nicht dein Ernst sein! Du willst vor den Augen der Leitung, ach was, vor der ganzen Welt, Drogen anpflanzen?«
Rosi macht ihre großen Ich-weiß-nicht-was-du-hast-Augen. »Außer dir und mir weiß doch keiner, wozu Bilsenkraut gut ist. Die grünschnäbelige Heimleitung jedenfalls nicht. Reg dich also bitte nicht auf, Lizzi, sonst brauchst du noch selbst welches!«
Wenn Rosi mich Lizzi nennt, ist das immer eine versteckte Drohung und der Hinweis auf den einen schwachen Moment meiner Jugendjahre, bevor ich mich entschloss, das Weingut van Ameln zu heiraten und beide Parteien sehr gut damit gefahren sind. Jedenfalls so lange niemand von diesem kleinen Ausrutscher erfährt. Ich höre also gnädig über den kleinen Erpressungsversuch hinweg und begnüge mich damit aufzuzählen, wie gefährlich Bilsenkraut ist. »Immerhin werden Extrakte von Bilsenkraut für die Herstellung von Laudanum verwendet. Es ist hochgiftig. Hat nicht schon Shakespeare Hamlets Vater damit ermorden lassen?«
»Großartig, was? Bilsenkraut kann Shakespeare«, sagt Rosemarie und rezitiert: »Da ich im Garten schlief, beschlich dein Oheim meine sich’re Stunde, mit Saft verfluchten Bilsenkrauts im Fläschchen. Und träufelt’ in den Eingang meines Ohres, das schwärende Getränk!«
Wenn Rosemarie in Theaterstimmung ist, kann ihr keiner beikommen. Ich gebe also zu, dass Bilsenkraut neben seiner halluzinogenen Wirkung auch durchaus nützliche Anwendungsgebiete aufzuweisen hat. »Gegen Krämpfe, Durchfall, Schlaflosigkeit«, zähle ich auf. »Zur Stimmungsaufhellung.«
»Vergiss die potenzsteigernde Wirkung nicht«, sagt Rosi zufrieden und strahlt mich an. »Ich habe vor, mir die Männer in unserem zukünftigen Internat ganz genau anzusehen. Und nicht nur die!«
Ich verzichte darauf, hierzu einen Kommentar abzugeben, weil wir die Cicerostraße in Hohenrhein und Klara Schönleins Haus erreicht haben.
Das Gartentor steht offen. »Sieh an, Klaras verpeilter Enkel Peter war zu Besuch«, sagt Rosi und geht strammen Schrittes den Plattenweg zum Haus hinunter. »Der lässt immer das Gartentor offen.«
»Du bist doch sonst nicht so streng«, kontere ich.
»Der kommt immer, um sich Geld zu leihen. Pah, was sag ich: leihen!« Meine Freundin macht eine unwillige Kopfbewegung. »Er schnorrt sich durch. Von Zurückzahlen kann keine Rede sein.«
»Man soll mit warmen Händen geben«, gebe ich meiner Meinung eine Stimme, aber Rosi hört mich nicht.
»Wenn Klara nur mit sich reden ließe! Aber sie ist ja so stur, wenn es um Peter geht. Der Junge hier, der Junge da«, sagt sie ungehalten. »Der Junge ist erwachsen. Der muss endlich lernen, für sich selber zu sorgen.«
Ich zähle im Geiste zusammen, dass mindestens vier Ehemännern die Jahre mit Rosi noch in schmerzhafter Erinnerung sind und sie sich von diesen finanziellen Polstern gerade Appartement 1 der ›Himmelsleiter‹ geleistet hat. Zugegeben die günstigste von allen Wohnungen, aber immerhin. Statt das näher auszuführen, überhole ich Rosi und drücke ausdauernd die Klingel.
»Wenn Klara so weitermacht, sind bald alle ihre Ersparnisse aufgebraucht.« Für ihre Freunde kann Rosi sich in jedes Thema hineinsteigern. »Und dann bleibt nichts mehr, um auch in unsere schöne, neue Residenz zu ziehen. Dabei wäre es doch viel besser für sie, bei uns zu wohnen, statt am Ortsrand von Hohenrhein, wo nie mal einer vorbeikommt. Noch nicht mal zufällig.« Rosi klatscht in die Hände wie ein kleines Kind. »Was wir als Dreierkleeblatt alles so bewegen könnten, nicht auszudenken!«
Da stimme ich ihr ausnahmsweise zu. Das möchte ich mir wirklich nicht ausdenken.
Als sich bei Klara immer noch nichts rührt, rüttele ich an der Tür und rufe laut ihren Namen. Ich will nach Hause und sie endlich besteigen, meine neue ›Himmelsleiter‹, besonders wo gerade die Presse …
Rosemarie zieht mich von der Tür weg. »Lass mal«, sagt sie. »Wir gehen einfach hintenrum, durch den Garten. Klara hat bestimmt wieder ihr Hörgerät nicht angestellt. Keine Ahnung, warum sie das viele Geld für das Ding ausgegeben hat, wenn sie es dann doch nie benutzt.«
Wir gehen durch den Garten und ich erwische mich dabei, wie ich auf Zehenspitzen gehe, um den akkurat geschnittenen Rasen nicht zu sehr zu zertrampeln. Jeder Golfplatz würde Klara mit Kusshand als Platzwart anstellen. Sie hat überhaupt einen grünen Daumen, alles um uns herum wächst, gedeiht und blüht. Jemanden wie sie könnten wir tatsächlich zur Anlage des neuen Gartens im Seniorenheim gebrauchen. Wenn ich irgendwann mal so alt bin wie Klara, will ich auch noch so voller Energie stecken. Sie ist …
»Klaraaaa! Um Gottes Willen!« Als wir um die Ecke des Hauses biegen, schreit Rosemarie plötzlich und rennt los.
Ich sehe gleich: Das mit der Hilfe bei der Gartengestaltung wird nichts mehr. Klara liegt genau unter ihrem Balkon. Ihre Beine stehen in weitem Winkel vom Körper ab, ihr Kopf ist völlig verdreht und sie starrt uns aus leeren Augen an. Für Klara muss sich kein Krankenwagen mehr beeilen.
»Ruf mal Dr. Dörfler an«, bittet Rosi und nimmt dabei Klaras Hand. Ich grabe in meinen Jackentaschen nach meinem Seniorenhandy und drücke auf die Kurzwahltaste mit der Nummer unseres Arztes. Besetzt. Ich fluche leise.
»Wir können sie doch hier nicht so liegen lassen«, sagt Rosemarie und sieht sich um. Wie automatisch greift sie nach einem Kissen, das neben Klara auf dem Rasen liegt und will es ihr unter den Kopf schieben.
»Das Kissen mit den Hirschen«, sagt Rosi traurig. »Ihr Lieblingskissen.«
Das ist das Stichwort. Rosi und ich sehen uns an. Wir haben beide denselben Gedanken.
»Das Hirschkissen!«, sagen wir unisono.
»Vom Sonntagssofa!«, bestätigt Rosi.
»Das mit den zackigen Hasenohren. Das würde Klara niemals mit auf den Balkon nehmen«, erinnere ich mich.
»Niemals! Nein.« Rosi ist derselben Meinung. »Da hat jemand nachgeholfen«, sagt sie düster. »Mutwillig. Böswillig. Tödlich.«
Ich lasse das mit Dr. Dörfler und rufe gleich die Polizei.
3. Kapitel: Monika
Ich will nicht so aufgeregt sein, denn gleich werde ich Harald sehen. Ich werde ihm ganz cool erzählen, wie ich gestern der Frau Müller den Garaus gemacht habe. Dass es ein Unfall war, braucht er ja nicht zu wissen.
Während ich mein Fahrrad vor dem Bürgermeisteramt in Klosterley abstelle, male ich mir die Szenerie aus: Wie stolz Harald auf mich sein wird, wie seine Augen leuchten werden, wie er mir Komplimente macht, ja, mich in den Arm nimmt, küsst.
Ich schwebe die altehrwürdigen Steintreppen hinauf bis in den zweiten Stock, doch bevor ich rechts in den Gang mit den Büros abbiege, mache ich noch schnell einen Abstecher in die Damentoilette. Ich muss unbedingt noch mal in den Spiegel gucken und auch meine schicken Schuhe anziehen. Zur Feier des Tages habe ich etwas Make-up aufgelegt. Dezent natürlich, wie es sich für die persönliche Assistentin des Bürgermeisters gehört. Estelle Luder, Saharasturm No. 16. Ich finde, es steht mir. Ich bin schließlich nicht wie die billige Elfie aus der Registratur.
In meiner Handtasche krame ich nach dem winzigen Flacon, den sie mir in der Parfümerie mitgegeben haben – sozusagen als Anerkennung für meinen großzügigen Einkauf – und sprühe mir eine anständige Ladung Black Opossum ins Haar. Jetzt kann es losgehen.
Mit Schwung öffne ich die Tür zum Gang und knalle sie fast der blöden Elfie an den Kopf. Doch die erschrickt sich noch nicht mal, sondern hüpft zur Seite und kichert. Schnepfe. Und der Busen von der ist so was von unecht! »Der Chef wartet schon«, flötet sie und macht sich hüftschwingend auf in Richtung Kaffeeküche. Dort wartet garantiert wieder dieser gelackte Franco Romanello vom Stadtbauamt auf sie. Aber das kann mir so was von egal sein. So was von! Denn auf mich wartet Harald! Der Herr über alles in unserem Rathaus.
Er erwartet mich so ungeduldig, dass die Tür zu seinem Büro offen steht. Ich drapiere mich im Türrahmen. Die Schuhe drücken wie verrückt.
»Hallo, Mooonika.« Mehr braucht er nicht zu sagen. Ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Er steht vom Schreibtisch auf, macht die Tür hinter mir zu, bietet mir den Platz auf dem karamellfarbenen Gästesessel an – wow! – und setzt sich wieder.
»Na, wie ist es gelaufen?«, fragt er und lacht dabei dieses verschmitzte Jungenlächeln, das mich immer ganz wuschig macht.
»Fantastisch«, sage ich und schlage ein Bein über das andere, graziös, wie ich hoffe. Mir fehlt nur noch eine Zigarette, am besten mit Elfenbeinspitze. Aber leider kann ich gar nicht rauchen und hier im Bürgermeisteramt ist es sowieso verboten. »Wissen Sie, es war natürlich nicht ganz einfach.« Ich versuche, meine Stimme so lässig und rauchig wie möglich klingen zu lassen. »Die Frau Müller hatte eine ganz schöne Kraft für ihr Alter. Wie verrückt hat sie sich gewehrt. Aber ich bin ja auch nicht aus Butter. Also hab ich ihr Sofakissen genommen …«
Ich springe auf, greife mir eine Akte vom Schreibtisch und gehe auf Harald zu, um ihm zu demonstrieren, wie ich die Frau Müller brutal mit dem Sofakissen erstickt habe. Als ich dicht vor ihm stehe, fängt er an zu husten, springt auf und reißt das Fenster auf. Scheiß Black Opossum. Ich hab auch schon Kopfschmerzen.
Ungern nehme ich wieder Abstand von Harald. »Also, wie gesagt, ich hab dann das Sofakissen genommen und es ihr aufs Gesicht gedrückt. Sie hat gejapst und gezappelt, dann nur noch gezappelt und dann war nichts mehr.«
Ich mache eine Kunstpause, setze mich auf die Kante des karamellfarbenen Gästesessels und drehe mein Gesicht so, dass Harald meine Schokoladenseite sieht. So wie die Stars in den Hollywoodfilmen. Welches meine beste Seite ist, das habe ich in jahrelanger Übung vor dem Spiegel selbst herausbekommen, dazu brauch ich nicht zum Film. »Und zur Sicherheit …«, wieder eine Kunstpause, aber diesmal klitzeklein, »… habe ich sie dann vom Balkon in den Garten geworfen.« Ich lächele so mondän wie möglich und hoffe, dass Estelle Luder, Saharasturm No. 16 die Wirkung unterstützt.
Harald nickt zufrieden. Doch bevor ich in den Genuss seiner Danksagung und Lobpreisung komme, klingelt das dämliche Telefon.
»Hallo, Axel«, sagt Harald gut gelaunt und ich weiß, dass am anderen Ende Axel Bärbaum, der Hotelier, ist. Der beste Freund von Harald also, dessen Schwiegermutter Frau Müller ist. Und die ich, Monika Schmelzeis, gestern auf Wunsch von Harald, was dann ganz sicher auch der Wunsch von Herrn Bärbaum gewesen sein wird, über den Regenbogen befördert habe. Ich strahle Harald an. Er schaut auf seinen Notizblock und malt diese süßen Strichmännchen.
Gebannt lausche ich dem Gespräch und muss mich schwer beherrschen, mir jetzt nicht mit einer dramatischen Geste die Haare aus dem Gesicht zu streichen. Aber dafür müsste ich sie vielleicht auch noch ein bisschen wachsen lassen.
Stattdessen wippe ich möglichst elegant mit dem Fuß und ärgere mich, dass ich in hohen Schuhen nicht laufen kann. Vielleicht gibt es dafür ja auch Kurse, so wie fürs Backen? Und vielleicht bekomme ich als Frau von Welt und persönliche Auftragskillerin des Bürgermeisters nicht nur dessen Zuneigung und Anerkennung, sondern auch einen Extra-Bonus oder mehr Weihnachtsgeld? Dann könnte ich …
»Nein!«, schreit Harald plötzlich das Telefon an. »Das kann doch nicht wahr sein!« Und dann: »Ja gut, ich kläre das mit ihr.«
Ende.
Was kann nicht wahr sein? Hat die Müller überlebt? Eben das kann nicht wahr sein. Ich habe sie doch gesehen, da in ihrer Blumenrabatte. Die war doch so was von mausetot!
»Monika …« Haralds Stimme ist freundlich, aber ich merke sofort, dass etwas nicht stimmt. Das »o« in meinem Namen ist zu kurz. Verdächtig kurz.
»Monika, wo waren Sie gestern wirklich? In der Cäsarstraße?«
Mir ist heiß. Nein, kalt. Nein, heiß und kalt.
Die rechte Tasche meiner Bundfaltenhose brennt sich in meinen Oberschenkel. Vielmehr der Zettel, der in der Tasche steckt. Denn ich weiß, was dort steht: Cäsarstraße 11. Und ich weiß, wo ich gestern war: Cicerostraße 11. Den Zettel hatte ich mir nur einmal angeguckt und mir die Adresse ins Hirn gemeißelt, wie das Detektive oder Auftragskiller so machen. Welche furchtbare Macht hat mich dann aber in die Cicerostraße gelockt? Bevor ich anfange nachzudenken, weiß ich es schon. Es war dieses »o«, das ich nun in seiner schönsten Form nie wieder hören werde. »Fixierung«, würde meine Schwester sagen. Die ist klug und hat studiert.
Harald an seinem Schreibtisch sieht auf einmal unglaublich weit weg aus, so, wie durch ein umgedrehtes Fernglas. Dafür kommen die Wände seines Büros immer näher und scheinen auch merkwürdig gewellt zu sein.
»Monika«, höre ich seine Stimme wie durch Watte. »Ist Ihnen nicht gut?«
Nein, mir ist gar nicht gut. Aber was soll ich jetzt sagen? Dass ich unter einer »o«-Fixierung leide?
Ich höre Flaschen klappern und rieche starken Alkohol. Ich sehe Harald, der mir ein Glas unter die Nase hält und mich anlächelt.
»Trinken Sie! Am besten in einem Zug. Das ist Tresterbrand aus Gottesacker. Eine Rarität. Danach geht es Ihnen besser.«
Die Welt ist gut zu mir. Ich habe Mist gebaut und Harald verwöhnt mich mit Raritäten. Die brennen allerdings wie Feuer in meinem Hals, ich schnappe nach Luft. Harald schenkt mir nach. Das zweite Glas trinke ich in einem Zug und jetzt sieht alles wieder ganz normal aus. Die Wände sind gerade und dort, wo sie hingehören und Harald sitzt in gewohnter Entfernung auf seinem Platz.
»Monika«, sagt er und es hört sich schon milder an. »Wo waren Sie gestern, um unseren, nun sagen wir mal kleinen Auftrag zu erledigen? Unsere Frau Müller lässt sich nämlich in diesem Augenblick quietschvergnügt von Axel zum Seniorenschwimmen abholen.«
»In der Cicerostraße«, antworte ich und fange an zu heulen. So viel zum Thema Selbstbeherrschung und dass ich heute eine besonders gute Figur machen wollte.
»Und wo sollten Sie hin?«
»In die Cäsarstraße«, flüstere ich und würde ihm so gerne den Grund für meinen Irrtum erklären, was natürlich ausgeschlossen ist. Was passiert jetzt? Oh Gott, er wird mich entlassen, oder, schlimmer noch, mir nicht mehr vertrauen und mich erst recht nicht mehr mögen.
Aber er sitzt da, die Ellenbogen auf dem Schreibtisch aufgestützt, die Fingerspitzen aneinandergelegt mit nachdenklichem Blick.
»Folgendes ist also passiert, Monika: Sie sollten gestern in der Cäsarstraße 11 die Frau Müller, die Schwiegermutter meines besten Freundes Axel Bärbaum tö…, äh, sich um sie kümmern. So weit korrekt?«
»Ja«, hauche ich.
»Stattdessen haben Sie sich in der Cicerostraße 11 um eine andere alte Dame gekümmert. Und das sehr effektiv«, sagt er und tippt wild auf der Tastatur seines Laptops herum. »Da will ich doch mal im Mittenrhein-Intranet schauen, wen Sie da wirklich besucht haben.«
Ich traue meinen Ohren kaum, aber ich höre ihn herzlich lachen.
»Monika, Monika«, sagt er, während er auf mich zukommt und belustigt den Kopf hin und her wiegt. »Das war natürlich ein Riesenfehler, den Sie da gemacht haben. Statt der gewünschten Frau Müller haben sie eine gewisse Frau Schönlein erledigt … Entschuldigung, haben Sie sich um eine gewisse Frau Schönlein gekümmert, die eben in der Cicerostraße lebte.«
Irgendwas gluckst aus ihm heraus, so wie ein unterdrücktes Kichern. Er setzt sich auf den anthrazitfarbenen Gästesessel, der neben meinem karamellfarbenen steht, schenkt sich einen Raritäten-Schnaps ein und lässt ihn genüsslich die Kehle herunterlaufen.
»Wissen Sie, Monika, mit der Schönlein haben Sie auch ein gutes Werk getan. Am Ende wäre die auch noch in die Seniorenresidenz gezogen und hätte dieses Teufelswerk unterstützt. Nun ja, und wenn nicht, dann hätte sie noch jahrelang in dem schönen Haus vor sich hingesiecht. Das wäre doch eine Schande gewesen! Jetzt ist der Wohnraum frei für junge Leute, mit Kindern hoffentlich!« Er gießt sich noch eine Rarität ein und füllt auch mein Glas.
Seins trinkt er auf ex und beugt sich zu mir. »Hier im Weinland Mittenrhein wohnen sowieso viel zu viele Alte. Sowohl im Weingau auf der rechten als auch in Weinhessen auf der linken Rheinseite.«
Sein Glas ist leer, er füllt es wieder auf, hält es gegen das Licht, schaut und trinkt wieder in einem Zug. »Schrumpelige Alte statt schöne Reiche.«
Etwas in seiner Stimme macht mir Angst. Doch ich erinnere mich daran, dass ich ihn liebe. Und liebe ihn wieder mehr, als er sich zurück an seinen Platz am anderen Ende des Schreibtischs begibt.
»Kurzum, liebe Mooonika«, sagt er, strahlt mich an und mein Herz beginnt wieder zu klopfen, »das haben Sie gut gemacht, aber das Soll ist noch nicht erfüllt. Die Frau Müller muss trotzdem noch weg. Lassen wir das mit Frau Schönlein als Test gelten.«
Er schüttelt den Kopf. »Was ich meine ist, dass wir uns jetzt nach dieser Übung sofort intensiv um die Frau Müller kümmern müssen, beziehungsweise, dass Sie sich um sie kümmern. Es ist sehr wichtig, Monika. Es geht nicht nur darum, der Überalterung im Weinland Mittenrhein die Stirn zu bieten, sondern um eine große, zukunftsweisende Sache: für die Welt, für die Region und für uns beide, Monika. Wir werden mit gekrönten Häuptern, Staatsmännern und Stars speisen. Wir werden in aller Munde sein mit unserem River-Rhine-Casino und dem Superiorhotel ›Himmelsleiter‹, Mooonika. Doch dafür muss sie weg, die gute Frau Müller.«
Für uns beide! Uns! Mooonika! Mehr brauche ich nicht zu wissen. Wie er jetzt da sitzt … So liebe ich meinen Harald. So strahlend, so begeisterungsfähig, so dynamisch, so männlich.
Ich trinke das Glas, das er mir zuletzt eingeschenkt hat, auf einmal aus. Denn ich weiß, was jetzt kommt.
»Mooonika, werden Sie sich so schnell wie möglich um Frau Müller kümmern?«
»Ja«, sage ich mit fester, schnapserfüllter Stimme.
4. Kapitel: Elisabeth
»Du bleibst hier und bewachst Klara. Ich laufe zum Auto zurück und hole meine Polaroidkamera.« Ich bin ganz Herrin der Lage, seitdem die Polizei auf meinen Notruf reagiert hat. In weniger als fünf Minuten werden sie hier sein.
»Und wieso bleib ich hier und nicht du?« Rosemarie ist normalerweise für klare Ansagen dankbar, aber heute ist sie seltsam störrisch.
»Meine Kamera, deine Freundin«, erkläre ich ungeduldig. »Und hier darf keiner mehr was anfassen. Dafür sind wir verantwortlich. Dies ist jetzt ein Tatort.«
Rosis Augen weiten sich als wäre sie auf einem LSD-Trip. »Anfassen? Wer denn? Hier sind doch nur wir.« Sie sieht sich in Panik um. »Glaubst du, der Mörder ist vielleicht noch hier? Und beobachtet uns?«
Dieses eine Mal habe ich für ihre ewige Fragerei keine Zeit, drehe mich auf dem Absatz um und gehe so schnell ich kann Richtung Auto.
»Oh nein, nicht mit mir! Ich bleibe hier keinen Augenblick allein! Ich bringe mich doch nicht in Gefahr!« Rosi sprintet auf dem Weg zum Gartentor an mir vorbei. »Mich wundert sowieso immer, warum bei den Krimis nie einer denkt, dass der Mörder noch im Haus sein könnte!«
Manchmal nervt es, immer die Vernünftigere, Geradlinigere, Lebenstüchtigere zu sein.
»Gut«, sage ich und bleibe stehen, »dann hol du die Kamera. Sie liegt auf dem Beifahrersitz. Und beeil dich, ich will die Fotos nicht erst schießen, wenn die Polizei da ist. Eine Polaroid hat kein Tele. Ein ganzes Spurensicherungsteam passt nicht durch die Linse. Und ich habe nur noch fünf Aufnahmen.« Natürlich weiß ich, dass man ein Panoramabild schaffen kann, indem man am Schluss einzelne Fotos aneinanderklebt, aber dafür braucht man Material. Und meine Zusatzpackungen Polaroidfilm liegen in einem Umzugskarton. Und ›4b/Schreibtisch & Gruscht‹, befindet sich bereits in Appartement 13 und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Ergo habe ich nur fünf Schuss. Ich korrigiere: Mir stehen nur noch vier Aufnahmen zur Verfügung. Eine habe ich ja bei der Hutschachtelaktion an der Ampel verplempert. Und das, wo es in der heutigen Zeit mit dem Nachschub für Sofortfilme so hapert. Ich werde meinen tunichtguten Neffen Leo, der in Frankfurt Reporter spielt, bitten, in diesem Spezialladen einkaufen zu gehen. Dann macht er zur Abwechslung mal etwas Sinnvolles. Für mich wird das allerdings wieder teuer werden. Ich seufze bei der Vorstellung, welche Phantasiepreise Leo diesmal für seine Gefälligkeit aufrufen wird. Jede vermögende ältere Frau hat ihren Peter.
»Hier!«, sagt eine Stimme hinter mir und ich fahre zusammen, als meine Freundin mir die Kamera in die Hand drückt. Rosi kichert. »Aha, dir war also auch nicht wohl bei dem Gedanken, dass der Mörder noch hinter der Hecke lauert.«
Ich spare mir die Antwort und beginne, Klara und ihr Schicksal konzentriert auf Platte zu bannen.
»Also, das wäre ihr jetzt nicht recht gewesen«, sagt Rosi und schnieft. »Sie mochte es überhaupt nicht, fotografiert zu werden. Und schon gar nicht ohne ihren Sonntagspullover aus Kaschmir und dann auch noch barfuß.«
Rosi sieht sich hektisch nach Klaras Hausschuhen um und ich erkenne sofort die Wichtigkeit dieser Aktion. Ein alter Schlappen liegt auf der großen Ligusterhecke, mehr als zwanzig Meter entfernt, ein anderer baumelt von der japanischen Zierkirsche.
»Liegenlassen, unbedingt liegenlassen«, warne ich und kombiniere: »Klaras Schlappen können uns Auskunft geben über die Wucht des Stoßes, der sie über die Brüstung warf.« Ich denke an unsere Lesemaschine – wenn die zu stramm eingestellt ist, segeln die Trauben bis zum Wingert unseres Nachbarn statt in den Auffangwagen. »Je weiter Klaras Schlappen geflogen sind, desto mehr Kraft wurde vom Täter aufgewendet.«
Rosis bewundernder Blick tut mir gut. So viel Ehrfurcht wurde mir nicht mehr entgegengebracht, seit mein Cuvée aus Goldriesling, Albalonga und Ruländer die Goldene Kammerpreismünze gewonnen hat. Damals, als wir diese alten Rebsorten noch angebaut haben. Alles weg, zugunsten des reinen Rieslings. Mein Sohn wollte das so und ich habe es trotz meiner inneren Ablehnung geschehen lassen. Riesling verkauft sich besser, sagt er und da hat er recht. Aber jetzt fehlt dem Weingut die Vielfalt und mir der Spaß. Seit der Umstellung haben wir auch keinen Preis mehr gewonnen. Das liegt an den Neidern, sagt Gernot. Und an mir. Mein Geschmack ist von gestern. Heute trinkt man moderne Weine. Als ich begriff, was er damit über mich gesagt hat, entschied ich mich für Appartement 13 der ›Himmelsleiter‹. Aus Protest. Und weil ich sicher war, mein Sohn und meine Tochter würden mich von diesem Schritt zurückhalten. Stattdessen boten sie mir an, meine Umzugskartons mit dem Firmensprinter nach Klosterley zu fahren. Aber das wollte ich nicht mehr. Ich habe auch meinen Stolz.
Ich verbiete mir jeden weiteren Gedanken an meinen Sohn, komme dadurch aber unweigerlich auf meine Tochter. Gesine verbreitet in der mit ihr befreundeten Frauenwelt des Weinlandes Mittenrheins Angst und Schrecken, indem sie behauptet, ich würde als Schwiegermutter mit Sicherheit genauso werden wie als Winzerin: unerbittlich. So etwas spricht sich natürlich rum. Gernot kann sich bei ihr bedanken, dass keine Frau mit ihm ausgehen will.
»Darf ich erfahren, was Sie hier tun?«, fragt jemand und ich lasse vor Schreck meine Kamera fallen, habe aber die Geistesgegenwart, beim Bücken die bereits geschossenen Bilder in meiner Jackentasche verschwinden zu lassen.
»Wir bewachen den Tatort. Hier sollte ja alles so bleiben, wie wir es vorfanden, als wir Sie anriefen, Herr Wachtmeister«, erklärt Rosi treuherzig und mit exakt dem Augenaufschlag, der ihr vier Ehemänner einbrachte.
»Polizeihauptwachtmeister«, korrigiert der Polizist schlecht gelaunt und ist völlig immun für ihre erotischen Signale. »Ludwig Petz.«
»Bei der Schutzpolizei verdient man schlecht, heb dir das Flirten für die Kommissare auf«, warne ich Rosi leise und stelle dann sie und mich ganz offiziell vor.
Unser Gegenüber honoriert das mit einer Generalmusterung statt mit einer Antwort. Ich gebe zu, wenn man Rosis knallbuntes, wadenlanges Afrikakleid, Marke Etoschabecken, und mich in Armbrechts Arbeitsanzug zum ersten Mal sieht, gibt es etwas zu gucken. Jetzt tritt auch noch Uniform 2 neben seinen Kollegen und starrt uns an wie das achte Weltwunder. »Wo wollen die beiden denn hin?«, fragt er unnötigerweise. »Fastnacht beginnt erst in fünf Monaten.«
»In deren Alter braucht man so lange, um rechtzeitig vor Ort zu sein, Kollege Hornbusch«, feixt der andere.
Meine Lippen werden schmal und meine Augen zu gefährlichen Schlitzen. Petz und Hornbusch wissen es noch nicht, aber ab jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Von Rosi und mir ist keine konstruktive Hilfe mehr zu erwarten.
Was jetzt folgt, ist höchst unerfreulich. Während Hornbusch routinemäßig ein Spurensicherungsteam und einen Arzt anfordert, führt Petz uns ein Stück vom Ort des Geschehens weg, als hätten wir kein Recht mehr da zu sein. Rosi bittet darum, dass der jüngere der beiden sich ihrer für das Verhör annimmt. »Vielleicht hat der ja bessere Manieren als Sie«, sagt sie.
»Wir verhören nicht bei der Polizei, wir vernehmen, und dies hier ist kein Wunschkonzert, gnädige Frau«, bellt Petz und zeigt damit, dass er die Situation eher störend als spannend findet. »Schon wieder ein verdammter Suizidversuch in meinem Zuständigkeitsbereich seit meiner Versetzung in diese gottverdammte weintrunkene Gegend – bis zu meiner Pensionierung haben wir dann alle Spielarten durch!«
»Versuch?«, fragt Hornbusch und tritt näher an die Leiche heran, »ja, lebt die Alte denn …?«
Ein kurzer scharfer Blick seines Vorgesetzten und der Rest des Satzes bleibt für immer ungesagt. Nicht schlecht. Schade, dass er sich zum Gegner gemacht hat. Er hätte gut zu uns gepasst. Noch etwas jung für meinen Geschmack, vielleicht knappe sechzig, aber mit Biss. Ich erkenne eine Führungspersönlichkeit, wenn ich sie sehe.
Und ich erkenne Schleimer und Schmarotzer und Parasiten. Einer von ihnen kommt gerade um die Hausecke. Peter Schönlein bleibt stocksteif stehen, als er unser Tableau entdeckt und ringt die Hände. Auch er scheint in der Pubertät hängen geblieben mit seinem Ich-bin-dagegen-Ökolook. Verwaschene Jeans, ungebügeltes T-Shirt, fettige Haare, ungeputzte Hornbrille. Die sind mir die liebsten. »Auftritt: Der Hauptverdächtige«, sage ich halblaut.
»Gut gespielt. Geradezu lebensecht wirkt er mit seinem Sozialfuzzi-Getue und Betroffenheits-Blabla.«, flüstert Rosi mir zu. Sie prahlt gerne mit ihren einschlägigen Erfahrungen an verschiedenen Bühnen Europas, an denen sie als Garderobenfrau im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen guckte. »Hätte ich nicht besser gekonnt.«
»Geht ja auch um einiges«, sage ich säuerlich. »Kommt jetzt auf mehr als Talent an, sich nicht erwischen zu lassen. Mörder erben nichts …«
»Du meinst, er ist nicht hier, um zu fragen, ob er für sie einkaufen kann, sondern weil ein Verbrecher immer wieder an den Ort seiner Tat zurückkehrt?« Rosi kriegt wieder ihre Kulleraugen.
»Ich will nichts gesagt haben.« Stattdessen schaue ich zu, wie Peter Schönlein sich mit einer dramatischen Geste zu seiner Großmutter auf die Erde werfen will. Als unsere Freunde und Helfer ihn zurückhalten, schluchzt er auf.
Das riecht nach echtem Schmerz. Schon bitter, wenn die einzige Geldquelle tot im Garten liegt. Genau so stelle ich mir meinen Neffen Leo vor, wenn er von meinem Ableben erfährt und schlagartig begreift, dass er in Zukunft seinen Lebensstil seinem eigenen Portemonnaie anpassen muss.
Von dieser Seite aus betrachtet, macht Peter als Mörder allerdings gar keinen Sinn mehr. Aber wer kommt sonst in Frage?
»Hilf mir mal auf die Sprünge, Rosi, wer steht bereit, um die Hände aufzuhalten, sobald Klara die Vergissmeinnicht von unten ins Licht drückt?«
»Also, ich weiß nur von Peter und seinem Vater.«
Oh ja, natürlich. Ich hüstele. Wilhelm Schönlein. Ganz nett der Mann. Seit sieben Jahren Witwer und mir sehr zugetan. Aber was soll eine Winzerin wie ich mit einem strikten Biertrinker?
Ich tue einen Moment so, als ob ich nachdenken würde, dann frage ich: »Und was fließt außer dem alten Knusperhäuschen noch so alles in die Erbmasse ein?«
»Als ich ihr geholfen habe, ihr Testament aufzusetzen, gab es noch die Wogelinde, die ihr Enkel erben soll«, erinnert sich Rosi.
»Stimmt.« Wie konnte ich den uralten Kabinenkreuzer Wogelinde vergessen, mit dem wir an so manchem Sonntag den Rhein gemütlich hinauf- und hinuntergeschippert sind? Ich denke an schönere Zeiten und daran, ob man den Erben dazu bekommen könnte, einen Vorschuss für das hübsche kleine Boot anzunehmen und ihm so über seine derzeitige Trauer hinwegzuhelfen. Für die Wogelinde würde ich glatt zwanzigtausend Euro springen lassen.
»Ganz sicher, Herr Petz. Meine Großmutter hätte niemals Selbstmord begangen. Dazu war sie viel zu lebenslustig«, erklärt Peter Schönlein gerade und ich bin angenehm überrascht. Also wenn er seine Großmutter so lieb verteidigt, dann erhöhe ich mal auf fünfundzwanzigtausend.
»Großmutter war immer der Meinung: Das Leben geht weiter«, höre ich den guten Jungen jetzt sagen. »So eine hält aus. Die macht keinen Selbstmord.«
Ich nicke Peter Schönlein anerkennend zu. Ja, so könnte man Klara Schönlein beschreiben. Ich lege in Gedanken noch ein paar Scheinchen für das bewegliche Inventar der Wogelinde drauf. Dreißigtausend also.
»Nein«, sagt Peter Schönlein bestimmt und redet, als wäre das, was er sagt, aller Welt klar gewesen, nur der Verblichenen nicht. »Sie war einfach nur tüdelig. Verstehen Sie? Die ist völlig unbeabsichtigt vom Balkon gefallen.«
»Bitte? Ich höre wohl nicht richtig!« Rosemarie will sich aufregen, aber ich gebe ihr ein Zeichen, sich nicht zu echauffieren und setzte zurück auf fünfundzwanzigtausend.
»Wenn Sie wüssten, was die in letzter Zeit so alles angestellt hat. Ich musste ständig nach dem Rechten sehen. Eigentlich konnte sie überhaupt nicht mehr alleine leben.« Er macht den Fehler, auf uns zu zeigen. »Die beiden Seniorinnen sind einsichtiger, die gehen freiwillig unter ständige Aufsicht, aber meine Oma …«
Ich höre, wie Rosi nach Luft schnappt und halte ihr vorsorglich den Mund zu. Danach nehme ich im Geiste weitere zehntausend Euro aus der Kasse. So ist das, wenn man handelt. Der Besitzer bestimmt den Preis.
»Stellen Sie sich das nur mal vor: Neulich habe ich ihre Hausschuhe im Kühlschrank gefunden.«
Jetzt ist es an mir, Klara zu verteidigen. »Ja? Na und? Haben wir Sommer? Ist es gerade sehr warm? Hatte Klara oft dicke Beine? Was ist da besser, als die Hausschuhe einen Moment in die Tiefkühltruhe zu stecken und dann wieder anzuziehen? Besser kann man sich gar nicht abkühlen!«
Uniform 1 und 2 gucken mich an, als könnten sie nicht ohne richterlichen Beschluss entscheiden, ob das nun eine clevere Idee ist oder nicht. Schade, dass ich für die beiden noch kein Konto eingerichtet habe, mit dessen Hilfe ich ihre Fähigkeiten bewerten und einordnen kann. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Oder ist das dann Beamtenbestechung?
Peter Schönlein sieht jedenfalls durch das Grübeln der Polizisten seine Glaubwürdigkeit in Gefahr und setzt noch einen drauf: »Und dann hat sie nie das Hörgerät reingemacht, wenn Leute kamen. Wie kann man in dem Alter noch so eitel sein, frage ich Sie?«
Rosemarie tut, als hätte sie den Satz nicht verstanden, der imaginäre Fleck auf ihrem Afrikakleid ist wichtiger.
»Ist Ihnen sonst noch irgendetwas an Ihrer Großmutter aufgefallen?«, fragt Petz. »War sie noch in vollem Umfang geschäftsfähig?«
Peter Schönlein wiegt seinen Kopf hin und her, als gäbe es darauf keine eindeutige Antwort. »Zumindest hatten mein Vater und ich in der Richtung noch nichts unternommen, aber über kurz oder lang wäre uns wohl nichts anderes übrig geblieben.«
Zack! Wieder fünftausend Euro weniger. Und wenn ich es so genau überlege, wird sich sicher auch ein Weg finden, an die Wogelinde zu kommen, ohne dafür auch nur einen roten Heller zu bezahlen.
Ich nehme Rosis Hand und ziehe sie vom Tatort weg. Mir reicht es. Ich weiß mein Geld für Klara besser anzulegen, als es ihrem Enkel in den Rachen zu werfen. »Wir ziehen uns in unsere Gemächer zurück«, rufe ich über die Schulter und beschließe, nicht unsere neue Adresse anzugeben. Sollen die uns ruhig suchen. »Wir wollen uns so selten wie möglich mit jungen Leuten umgeben, damit wir nicht einschlafen. Keine Spannkraft, keine schnellen Entscheidungen, keine Kombinationsgabe. Es ist so ermüdend, jungen Menschen zuzuhören.«
»Au revoir, Messieurs!«, beendet Rosi die Audienz ihrerseits und wir sitzen Sekunden später in Miguel, der Ente.
»Und was jetzt?«, fragt Rosi, deutlich enttäuscht, nicht mehr im Auge des Sturms zu sein.
»Jetzt, lieber Watson«, sage ich, als wäre es das Normalste der Welt, »jetzt fahren wir auf dem kürzesten Wege nach Gottesacker und zu guten, alten Freunden.«
Rosi zieht sofort den Kopf ein. »Bitte nicht«, sagt sie. »Nicht zu Özdemir & Schultze. Nicht zu denen. Es muss doch noch eine andere Detektei im Weinland Mittenrhein und Umgebung geben!«
»Vielleicht, aber sicher keine, deren Ergebnisse so zufriedenstellend sind.«
Rosi schweigt beleidigt und ich gebe zu, dass ihre Erinnerungen an die Erfolge dieser Detektei erheblich schlechter sind als meine. Während ich durch Özdemir & Schultze meinen Armbrecht dazu bringen konnte, mir für das Weingut freie Hand zu lassen und dafür seine Eskapaden erduldete, verbindet Rosi das Ende ihrer dritten Ehe und den Anfang einer wirklich anstrengenden vierten mit der Arbeit dieses Ermittlungsbüros.
Natürlich weiß auch ich, dass Özdemir aufgrund zu erfolgreicher Nachforschungen in der Offenbacher Bronx auf unbestimmte Zeit in die Türkei abtauchen musste und sein Partner eher der administrative Typ ist. Schultze hat zwar immer noch alle Fäden in der Hand, sitzt aber mit zwei gebrochenen Beinen im Rollstuhl, seit er bei einer Schlägerei in Wisselbrunnen von einem ertappten Ehemann als Schlaginstrument benutzt wurde.
Rollstuhl oder nicht: Ich will Schultze. Er kennt das Weinland Mittenrhein besser als jeder andere – von mir abgesehen. Ich wähle seine Nummer, die ich seit damals auswendig kenne. Er meldet sich nach dem zweiten Klingeln: »Hier ist die Privatdetektei Özdemir & Schultze, leider nehmen wir bis auf Weiteres keine Aufträge entgegen. Bitte rufen Sie die Auskunft an oder bemühen Sie die Gelben Seiten, um …«
»Schultze«, sage ich. »Wir sind’s. Rosemarie Perabo und Elisabeth van Ameln. Wir haben einen Auftrag für Sie.«
Schultzes Stimme klingt für meinen Geschmack etwas zu erleichtert, als er erwidert: »Es tut mir aufrichtig leid, aber ich bin nicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Unser Büro ist seit Wochen geschlossen.«
»Schultze, reden Sie keinen Unsinn, sondern aktivieren Sie für uns Ihren besten Ermittler«, sage ich und weiß, dass ich dem Mann jetzt den Satz sage, auf den er schon sein ganzes Leben gewartet hat: »Schultze, wir haben einen Mord.«
5. Kapitel: Leo
Mitten in der Nacht liege ich auf dem Bett und starre die Decke an. Um die Kleine mache ich mir keine Sorgen. Sie wird morgen früh mit einem dicken Kater in ihrer Bude aufwachen und sich wahrscheinlich weder an mich erinnern noch daran, dass sie Hakan, der Taxifahrer, nach Hause gebracht hat.
Sorgen mache ich mir um mich. Richtige Sorgen.