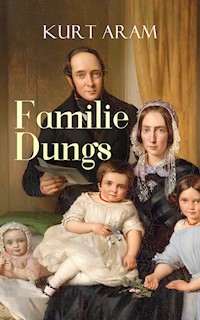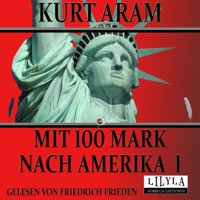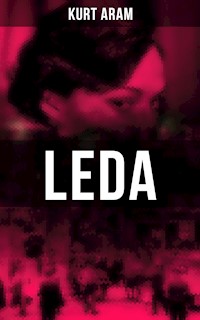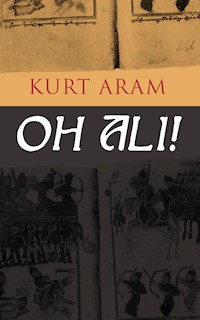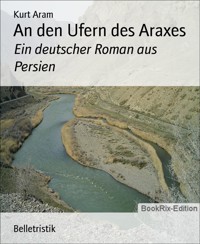Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dem historischen Roman "Oh Ali" von Kurt Aram tauchen wir ein in eine faszinierende Welt des alten Persiens. Der Autor entführt uns in die Zeit des persischen Reiches und erzählt die Geschichte von Ali, einem jungen Mann, der sich gegen die Mächte des Königs auflehnt. Aram's literarischer Stil ist fließend und packend, er schafft es, die Spannung konstant aufrechtzuerhalten und uns in die Welt seiner Figuren eintauchen zu lassen. Dieses Werk steht in einem literarischen Kontext, der sich mit historischen Romanen und epischen Erzählungen befasst, und hebt sich durch seine detaillierte Darstellung des antiken Persiens hervor. Kurt Aram, selbst ein Experte für persische Geschichte, hat mit "Oh Ali" sein umfangreiches Wissen und seine Leidenschaft für das alte Persien in diesem Werk vereint. Durch seine akribische Recherche und sein profundes Verständnis für die historischen Ereignisse der Zeit gelingt es Aram, eine fesselnde Geschichte zu erzählen, die den Leser in ihren Bann zieht. Für Fans historischer Romane und Liebhaber der persischen Geschichte ist "Oh Ali" ein absolutes Muss. Mit seiner packenden Erzählung und seinem historischen Tiefgang bietet dieses Buch ein einzigartiges Leseerlebnis, das lange im Gedächtnis bleiben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oh Ali: Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Die Hauptstadt des persischen Gouvernements, das im Norden nur durch den Araxes daran gehindert wird, mit russisch Transkaukasien zusammenzufließen wie Milch und Sahne, zählte etwa zehntausend Einwohner. Sie beanspruchten aber einen Raum, der in Europa für Zweihunderttausend hätte ausreichen müssen. Fast jedes Haus war von den ihm zugehörigen Blumen-, Gemüse- und Weingärten umgeben, die eine gemeinsame Mauer umfriedete. So konnte man auf einem guten Pferd zwei volle Stunden reiten, um die Stadt zu durchqueren, und sah dabei fast nur Mauern, hinter denen kleinere oder größere Baumgruppen neugierig zu dem Reiter hinüberblickten. Im Sommer versanken die Pferdehufe in feinem Staub, der unter ihnen in dicken gelben Wolken aufwirbelte, den Pferde-, Esel- und Kamelmist beizte. Im Winter zogen die Hufe Roß und Reiter nur mühsam durch den zähen Schlamm, der sie durchaus festhalten wollte, um nicht ganz auf jede Gemeinschaft mit dem Leben verzichten zu müssen. Den eigenen Füßen vertraute sich außerhalb der Mauern nur selten jemand an. Auch die Ärmsten besaßen einen Esel, der für sie die Beine rühren mußte, wenn sie draußen zu tun hatten.
Im Westen grenzte das Gouvernement an die Türkei. Aber Mutter Natur hatte vorsorglich einen hohen und wilden Gebirgszug zwischen die beiden Länder gelegt, ohne welchen sich Perser und Türken längst ausgerottet hätten. So sehr liebten sie sich. Auch bevölkerte sie diesen mächtigen Schutzwall noch mit Kurden, die weder Persern noch Türken wohlgesinnt sind. Den Sommer über treiben sie ihre Schafherden von Süden nach Norden durch die Berge, den Winter über rasten ihre gut bewaffneten Trupps, wo der erste Schnee sie gerade überrascht. Erst bei Tauwetter wandern sie weiter dem Araxes zu; und wie die Herden keinen Grashalm ungerupft lassen, so auch ihre Hirten keinen Perser oder Türken, der ihnen über den Weg kommt und kein stärker bewaffnetes Geleit mit sich führt. Vom Araxes wenden sie sich dann wieder südwärts. Stoßen sie dabei auf Trupps, die nach Norden unterwegs sind, so gebrauchen sie, wenn zwischen ihnen nicht besonders feierliche Verträge bestehen, fleißig die Flinten, um die Zahl der gegnerischen Hirten zu vermindern und so ihre eigenen Herden zu vergrößern.
Da die Stadt von der russischen Grenze nur drei und von der türkischen sogar nur eine Tagereise weit entfernt ist, und da die Karawanenstraße von Trapezunt am Schwarzen Meer nach Täbris, der Hauptstadt Nordpersiens, dicht an ihren Mauern vorbeiführt, so leben auch zahlreiche russisch-armenische Handelsleute, einzelne Türken und wohlhabende Kurden in ihr. Diese, die ihre engeren Stammesgenossen am besten kennen, haben sich am östlichen Ende der Stadt möglichst weit fort von den Bergen angesiedelt. Die russischen Armenier hingegen zwang die mohammedanische Übermacht, sich ganz im Westen der Stadt bei ihren persischen Glaubensgenossen niederzulassen, damit sie feindliche Überfälle aus den Bergen zuerst auszuhalten und abzuwehren hätten. Die Masse der einheimischen Perser hatte sich möglichst breit dazwischen gebettet.
Die natürliche Folge von alledem war, daß die Armenier ihren westlichen Stadtteil ganz festungsmäßig ausbauen mußten. Ihre einstöckigen, langgestreckten Häuser lagen nicht friedlich inmitten ihrer Gärten, sondern mit der Rückseite hart an den hohen Mauern, das Gesicht und alles Leben mit seinen Fenstern und Veranden nach innen gekehrt. Als Zugang gab es in den dicken Umfassungsmauern, die reichlich mit Schießscharten versehen waren, nur je ein niedriges schmales Tor aus schweren Holzbohlen, stark mit Eisen beschlagen. Die flachen Dächer konnten jederzeit durch lange Laufbretter miteinander verbunden werden, so daß man besonders bedrohte Stellen sofort mit bewaffneten Männern besetzen konnte; und die Gassen zwischen den hohen Mauern waren so eng, daß man sie zwar leicht von den Schießscharten unter Feuer halten konnte, aber in den Gassen selbst die Flinten zum Angriff so steil in die Höhe richten mußte, daß sie ohne Schwierigkeiten nur in den Himmel Löcher schössen, der damit noch nie erobert worden ist. So hatte die mohammedanische Stadt das ihrige dazu getan, daß ihre christliche Bevölkerung die kampftüchtigste wurde, was sie keineswegs beliebter machte.
Der größte Besitz im äußersten Westen der Stadt gehörte dem Fürsten Hakob Akunian, dem jüngsten Sproß eines alten armenischen Geschlechts aus Karabagh in russisch Kaukasien. Er hatte zwei Jahre in Paris studiert und war jetzt mit dreißig Jahren ein Mann, der als russisch-armenischer Bankier wie als kampferprobter Führer seiner Rassegenossen – eine Mischung, die im zivilisierten Europa nicht mehr vorkommt – von den Mohammedanern des Gouvernements gleicherweise beneidet, gehaßt und gefürchtet wurde. In Paris war im letzten Semester seines dortigen Aufenthalts Sureja sein Zimmernachbar geworden, der jüngste Bruder des Fürsten von Maku, des einzigen noch selbständigen Kurdenfürstentums, das mit seiner Spitze in die kurdischen Berge wie ein Dreieck hineinstößt, dessen eine Seite durch den Araxes gegen Rußland, dessen andere Seite mit wilden, zerklüfteten Bergketten gegen die Türkei geschützt wird, dessen Basis sich aber breit nach Persien hin öffnet.
In der Heimat wären Hakob und Sureja bald mit den Dolchen aufeinander losgegangen. In Paris wußten sie, was sie der europäischen Zivilisation schuldig waren, und ließen den Haß zwischen zwei Völkern, die sich seit Jahrhunderten bekämpften, unsichtbar unter gestärkten Hemdbrüsten weiterglimmen. Als sie dann durch gemeinsame Pariser Freunde einander vorgestellt wurden, benahmen sie sich so korrekt, wie es sich im Café de Paris gehörte. Bald fühlten sie sich als Asiaten unter Europäern näher zusammengehörig und streckten vorsichtig immer mehr Fühler nacheinander aus. Sie fanden sich im gemeinsamen Haß gegen die Türkei, die es schon unter Abdul Hamid vortrefflich verstanden hatte, die Kurden gegen die Armenier auszuspielen. Hakob Akunian und Sureja von Maku bereisten dann zusammen das übrige Europa, bevor sie nach Asien zurückkehrten. Da sie hierbei zu denselben Einsichten in europäische Kultur und Zivilisation gelangten und ihnen die Feindschaft gegen alles Türkische ohnehin geläufig war, blieb für einen Haß gegeneinander unter ihren immer noch gestärkten Hemdbrüsten kein Raum mehr. Er verglomm und erlosch. An seine Stelle trat schon in Moskau immer deutlicher der Plan, der sich dann in Tiflis zum erstenmal vorsichtig auf die Zunge wagte. Auf der letzten russischen Zollstation am Araxes wurden sie darüber einig, sich fortan dem erst reiflich im Herzen erwogenen, dann reichlich besprochenen Plan mit vereinten Kräften zu widmen, ohne daß dritte Personen bis auf weiteres etwas davon zu erfahren brauchten.
Hakob Akunian vermehrte seinen Besitz im Westen der Stadt. Sureja von Maku hatte sich ein weitläufiges Gehöft im Osten der Stadt gekauft.
An einem heißen Vorsommertag saß der kurdische Prinz bei dem armenischen Fürsten in einem kleinen, abgelegenen Raum des weitläufigen Hauses, der trotz der sengenden Sonne dämmerig und trotz der flimmernden Hitze im Freien kühl war. Den Boden deckte ein Täbriser Teppich, auf dem kein Schritt laut wurde. Nahe der Fensteröffnung stand ein Tisch mit zwei Stühlen. Auf dem Tisch arbeitete der Prinz an einer kleinen Wachsfigur. Im Hintergrund des kahlen, düsteren Raumes wurde ein amerikanischer Schaukelstuhl sichtbar, der sich nicht bewegte. Seitlich hinter ihm brannte eine hohe Wachskerze. Ihr Licht fiel auf ein altes Kurdenweib in schmierigen Kleiderfetzen, das in dem Schaukelstuhl lag, zwischen den gelben Händen ein gläsernes Gefäß mit Wasser. Es schien zu schlafen, obwohl die nackten Füße fest in einen hölzernen Block eingespannt waren.
»Macht ein Ende, Prinz«, sagte Hakob Akunian ungeduldig. Er vollführte mit Energie die Bewegung des Hängens, und seine schwarzen Augen funkelten.
»Nur Geduld, Fürst«, erwiderte Sureja und bosselte an der kleinen Wachsfigur weiter, deren Gesicht immer mehr die Züge des alten Weibes im Schaukelstuhl annahm. Aufmerksam verglich er, nickte zufrieden, trat zu dem alten Weib, schnitt ihm mit einer scharfen Klinge seines vielseitigen Taschenmessers die langen Finger- und Fußnägel ab, ohne daß die Schlafende sich rührte, und drückte die Nägel tief in die Hände und Füße der Wachsfigur. Er ließ eine kleine Schere an seinem Taschenmesser aufspringen und trennte einen größeren Fetzen des alten Leinenhemdes ab, das dem mit Schmutz und Schweiß bedeckten Weib an der Haut klebte, sowie einen Büschel Nackenhaare. Die Haare drückte er der Wachsfigur tief in den Kopf, und mit dem Hemdfetzen umwickelte er sie liebevoll wie eine Mumie.
»Diese Künste habt Ihr wohl in einem Teufelskloster in Kurdistan gelernt, Prinz?« fragte Hakob ungeduldig, neugierig und doch ein wenig geringschätzig.
»Und bei Dr. Durville in Paris wissenschaftlich vervollständigt, Fürst.«
Sureja trat wieder zu dem Weib im Schaukelstuhl und strich mit der flachen Hand dicht über dem Gesicht langsam einige Male von der Stirn bis zur Brust. Die Augen des Weibes öffneten sich und starrten gläsern, leicht vorquellend, ausdruckslos ins Leere.
Eindringlich und langsam sagte Sureja zu dem Weib: »In einer Stunde wirst du dich wieder zu Scharef Pascha aufmachen und ihm berichten, daß wir in acht Tagen zwei russische Generäle erwarten. Sie bleiben acht Tage. Scharef Pascha muß seine Expedition um drei bis vier Wochen verschieben. Dann wird sie Erfolg haben.« Dreimal wiederholte er die Sätze, bis sich die Lippen des Weibes leise mitbewegten.
»Das geht nicht, Prinz«, flüsterte der Fürst erregt. »Aufhängen! Im Hof steht ein Baum, der hat schon oft solche Früchte getragen.«
»Ich verstehe Sie nicht, Durchlaucht. Sie genossen doch länger als ich europäische Zivilisation. Man hängt niemand mehr auf. Das ist barbarisch, asiatisch. Man beraubt ihn nur für den Rest seines Lebens des freien Willens, wacht darüber, daß er sich nicht selbst tötet und sorgt durch geeignete Diät, Bewegung, Hygiene und Ärzte, daß ihm der Atem nicht vor der Zeit ausgeht. Das ist human, Durchlaucht, bei diesem Verfahren wird kein Tropfen Blut vergossen. Lernen wir von Europa, Durchlaucht.«
Der Kurde strich mit beiden Handflächen dicht über den ganzen Körper des Weibes vom Kopf bis zu den Füßen, bis sich der Körper in einem leichten Bogen aufbäumte, in dieser Lage verharrte und nur noch mit Nacken und Fersen auf dem Schaukelstuhl auflag, der sich leicht und gleichmäßig zu wiegen begann. Langsam, leise und eindringlich sagte er: »Wenn du weißt, wann Scharef Pascha aufbricht, verkleidest du dich wieder als altes Kurdenweib, kommst hierher, klopfst viermal laut an das Tor, sagst dreimal laut, zu dem Pförtner: ›Ich will für dich zum Opfer werden‹ und verschwindest nach Stambul. Am ersten Tag des nächsten Ramasan, in dem Augenblick, da die Sonne untergeht und die Freude erwacht, springst du von der Galatabrücke und ertrinkst ... Wiederhole, was ich dir gesagt habe.« Das Weib tat es.
Lächelnd wandte sich der Prinz zum Fürsten. »Sind Sie jetzt einverstanden, Durchlaucht?«
»Wenn ich nur daran glauben könnte, Prinz.«
»Daran erkennt man, daß Sie zu lange in Europa geblieben sind. Europas Wissenschaft ist im Begriff, die ältesten Zauberkünste Asiens bis in die feinsten Einzelheiten zu erforschen und ihre Technik auf das äußerste zu vervollkommnen. Aber die Europäer glauben nicht daran. Zu ihrem Glück, denn bei der allgemeinen Schulbildung wäre sonst bald keiner mehr seines Lebens sicher. Zu unserem Unglück, denn dann drückte Europa bald nicht mehr wie ein Alp auf uns. Ich aber erlaube mir, europäische Theorien mit alter asiatischer Praxis zu vereinen. Zu unserem Vorteil, Durchlaucht.«
Sureja trat wieder zu dem alten Weib und vollführte die Striche über seinem Körper, diesmal in umgekehrter Richtung, bis sich der Starrkrampf gelöst hatte.
»Merkwürdig, daß Sie immer noch glauben, als altes Weib verkleidet am sichersten zu sein«, murmelte der Fürst.
»Bei uns ehrt man noch in jedem alten Weib seine Mutter, in zivilisierten Ländern legt man weniger Wert darauf«, meinte der Kurde spöttisch und drückte einige Zentimeter von der Schlafenden entfernt Daumen und Mittelfinger der rechten Hand zusammen, als befände sich ein Stück Haut dazwischen, in das er kniff. Das alte Weib zuckte zusammen.
»Fabelhaft«, sagte Sureja. »Wenn Doktor Durville nicht Pariser wäre, verkaufte ich ihm diesen jungen Türken. Er müßte ihn mit Gold aufwiegen. In Europa findet er ein solches Phänomen kaum einmal. Hier laufen sie zu Hunderten herum.«
Er ließ aus seinem Taschenmesser einen Pfriem aufschnellen und bohrte ihn langsam über der rechten Hand im Schaukelstuhl in die Luft, als sei sie Leder. Der verkleidete Türke stieß einen leisen Schmerzensruf aus. Sureja nahm schnell das Gefäß mit Wasser aus den Händen des Schlafenden und stellte es auf den Tisch. Dann bohrte er mehrmals den Pfriem durch die Luft und setzte sich auf den noch freien Stuhl.
»Ich beneide Sie um die Gelegenheit, mein Fürst, Ihre Leute so bald gegen Scharef führen zu können.«
»Tüchtige Leute, aber noch zu wenig Disziplin. Ein paar preußische Unteroffiziere müßten sie erst noch vierzehn Tage unter die Finger bekommen.«
Sureja sprang lachend auf. »Vielleicht täten es auch ein paar russische? Reiten Sie nach Djulfa, drei Kosakenregimenter liegen am Araxes. Ich müßte russische Wachtmeister schlecht kennen, wenn sie Ihnen nicht für eine Handvoll weißes Geld gefällig wären.«
»Bei meiner Seele.« Auch Hakob sprang auf.
»Da es sich um ein Geschäft mit Christen handelt, mein Fürst, kann ich Ihnen zu meinem Bedauern den Weg nicht abnehmen.«
»Ich reite noch heute nacht.«
Der Fürst beugte sich aufmerksam über die rechte Hand des Türken im Schaukelstuhl. Auf dem Handrücken zeigte sich ein roter Fleck wie von einem Stich, der langsam anschwoll. »Gott ist groß!« entfuhr es dem Prinzen, »Doktor Durville ist wirklich ein großer Gelehrter.« Er strich dem schlafenden Türken mit der flachen Rechten wieder einige Male über den Körper von den Füßen bis zum Kopf.
»Vorwärts!« zischte Hakob.
»Schade, daß Sie nicht auch bei Doktor Durville experimentiert haben. Es gibt sechs Stadien des Tiefschlafs. Man muß den Mann langsam, von Stufe zu Stufe wieder zum Tagesbewußtsein bringen, wie man in Europa sagt. Sonst schadet man dem Mann. Schaden möchte ich ihm erst wieder, wenn er bei vollem Bewußtsein ist.«
Endlich war es soweit, und es kam wieder Leben und Farbe in Haut und Augen des Türken.
»Habt Ihr wohl geruht, Schwert des Staates?« fragte der Prinz höflich.
Der Türke blickte zur Decke und rührte sich nicht.
»Ich könnte einen Teppichbreiter rufen und Euch die Bastonade geben lassen. Eure Fußsohlen laden dazu ein. Aber ich bin ein Heiligensohn und ehre jedes alte Weib, wie es der heilige Prophet vorschreibt.« Der Prinz setzte sich und zog das Gefäß mit Wasser näher.
»Scharef lagert mit seinen Hunden noch bei Wan?«
Der Türke blickte stumm zur Decke.
»Ihr wollt nicht? So paßt einmal gut auf.« Der Prinz zog sein Taschenmesser und stach mit der größten Klinge schnell und tief in das Wasser.
»Oh Ali!« entfuhr es dem Türken.
»Ihr seid also gar kein echter Sunnit, sondern ein halber Schiit. Um so schlimmer für Euch.« Er senkte die Messerklinge langsam tief in das Gefäß mit Wasser und hielt sie darin fest.
Der Türke begann zu stöhnen und wand sich. Dicht hinter dem rechten Handgelenk quollen auf der Haut des Unterarms ein paar dicke, dunkle Blutstropfen auf. Er starrte wie entgeistert auf den Prinzen, dessen Messerklinge immer noch rief im Wasser stak. Jetzt drehte er sie langsam im Wasser um ihre Achse. Das Blut kam reichlicher wie aus einer breiter gewordenen Wunde.
Sureja nahm das Messer aus dem Wasser. »Ihr seht, ein Heiligensohn kann auch mit dem Satan im Bunde sein. Lagert Scharef Pascha mit seinen Hunden noch bei Wan?«
Der Türke biß Zähne und Lippen fest aufeinander.
»Es tut mir leid um dich, altes Weib. Sieh her!« Sureja hatte das Gefäß mit Wasser in beide Hände genommen und wiegte es langsam auf und ab. Der Türke wand sich unter Grimassen.
Sureja schüttelte das Gefäß mit Wasser heftiger. Der Türke stöhnte, schnappte mühsam nach Luft, und sein Gesicht färbte sich blaurot, als drohe ein Schlaganfall.
Sureja stellte das Gefäß auf den Tisch. Langsam erholte sich der Türke wieder.
»Laßt ein heißes Wärmbecken kommen«, flüsterte der Kurde dem Armenier zu. Dieser rief durch das Fenster nach dem Hof, und bald darauf brachte ein Diener ein glühendheißes Wärmbecken, das in einen kleinen Teppich gehüllt war.
Sureja spritzte mit den Fingern einige Tropfen aus dem gläsernen Gefäß in das Wärmbecken, daß sie zischend verdampften. Der Türke wimmerte.
Wütend sprang der Fürst auf. »Du bleibst immer noch stumm, du Hund? Jetzt werde ich dich heulen lehren!« Mit beiden Händen schöpfte er Wasser aus dem Gefäß und schleuderte es auf das Wärmbecken. Immer wieder. Der Türke schrie, und auf seiner Haut zeigten sich große Brandblasen.
»Lagert Scharef mit seinen Hunden immer noch bei Wan?« brüllte Sureja von Maku.
»Ah! Akh! ei wei! ei dad! ei aeman!« brüllte der Türke.
»Lagert Scharef noch bei Wan?«
»Ja, Herr! Ja, Satan!« stöhnte der Türke.
»Wie Gott will!« meinte Sureja befriedigt und trocknete sich die Hände.
Sureja näherte sich dem Türken, der wehrlos in seinem Schaukelstuhl lag, und öffnete den hölzernen Block, so daß die Füße des Gefangenen wieder frei wurden.
»Ihr seid frei, Sohn einer Hündin. Beeilt Euch, bevor ich mich eines anderen besinne. In Gottes Namen, Pfeiler des Königreichs.« Er verneigte sich hoheitsvoll.
Hakob Akunian hatte eine Pistole gezogen und brachte sie in Anschlag.
Wieder verneigte sich Sureja vor dem Türken. »Das Leben Ihres geehrten Erzeugers möge lang sein.«
Schwerfällig, mit zusammengebissenen Zähnen rutschte der Türke mühsam aus dem Schaukelstuhl und gab dem ihm fremdartigen Gegenstand, den er irgendwie für mitschuldig an der Marter halten mochte, unter einem leisen Fluch hinterrücks mit der linken Ferse einen kräftigen Tritt.
Hakob Akunian klatschte dreimal kräftig in die Hände. Im Rahmen der Tür erschien ein schwer bewaffneter Diener, der das alte Kurdenweib auf einen Wink des Fürsten auf die Arme nahm, durch den Hof trug und vor das Tor warf, das er hinter ihm sorgfältig verschloß und verriegelte.
»Und wenn er nicht wiederkommt, um den Aufbruch Scharefs zu melden?« fragte Hakob Akunian unruhig.
Sureja lächelte: »Da merkt man wieder, wie sehr ihr Christen Ungläubige seid, mein Fürst.«
»Und wenn er nicht nach Stambul geht und sich nicht von der Galatabrücke stürzt? ... dann haben wir einem heimtückischen Feind ohne Grund das Leben geschenkt.«
Der Kurde nahm die Mumie vom Tisch und bat um einen sicheren, verschließbaren kleinen Schrein. Er hielt die Mumie dem Fürsten dicht unter die Augen. »Dann durchbohre ich sie mit einem langen Nagel oder schmelze sie langsam auf einer heißen Pfanne. Dann ist der Feind tot.« Der Prinz lachte laut und zeigte das kräftige Gebiß eines Raubtiers. »Ich habe mehrere solcher Puppen in meinem Haus und schon mehr als einer mit Erfolg einen Nagel in die Eingeweide getrieben. Darauf könnt Ihr Euch verlassen, Fürst.« Er blies die Wachskerze aus.
Die beiden verließen den Raum, der finster wurde. Nur der Schaukelstuhl bewegte sich immer noch ruckartig, aber geräuschlos auf dem Täbristeppich. Immer noch beunruhigt von dem Fußtritt des Türken.
Zweites Kapitel
Hakob Akunian geleitete seinen Gast quer über den Hof, durch einen langgestreckten Gemüsegarten, dessen Beete mit Wassermelonen und Kürbissen wie mit Kinderköpfen bedeckt waren, zwischen denen sich lange grüne Gurken wie Schlangen dicht am Boden wanden, zu einer östlichen Seitenpforte.
In der Nähe der Mauer auf der staubigen Straße wartete ein Reiter mit Surejas Hengst Jussuf.
Der Prinz warf einen raschen Blick nach beiden Seiten. »Man hätte dem türkischen Hund jemand nachschicken sollen«, flüsterte er.
»Ich habe es nicht unterlassen, mein Prinz, und Riza ihm nachgeschickt.«
»Segen über dich!« sagte Sureja laut und trat zu seinem Pferd. Der Diener sprang aus dem Sattel.
In demselben Augenblick erhob sich die Stimme des Ausrufers zum Gebet auf der Galerie des nächsten Minaretts. Der Diener riß seine leeren großen Satteltaschen vom Pferd, breitete sie vor seinen Herrn als Ersatz für einen Gebetsteppich und warf sich selbst in den Staub. Auch Sureja fiel nieder, richtete sein Antlitz nach Mekka und vollzog sein Gebet. Hakob trat in die Büsche zurück. Er wußte, daß der Prinz kein Fanatiker war. Gerade bei Kurden findet sich das häufiger. Aber auch bei lauen Mohammedanern weiß man nie, ob sie nicht doch plötzlich beim Blick nach Mekka rabiat werden. Auch darin unterscheiden sie sich sehr von lauen Christen.
Als die Zeremonie beendet war, trat Hakob Akunian Sureja wieder näher, der sich in den Sattel schwang. Vom Pferde aus blinzelte er dem Christen spöttisch zu, und dann verabschiedete er sich um des Dieners willen in den besten persischen Höflichkeitsformeln, wobei Hakob dem Prinzen ironisch zulächelte. In Spott und Geringschätzung des wehr- und machtlosen Persiens waren sich beide einig.
»Werden Sie bald wieder in die Wohnung Ihres Sklaven Verherrlichung bringen?«
»So Gott will, werde ich bald wieder zu Ihren Diensten sein.«
»Ihre Freude mehre sich.«
»Ihr Schatten möge nicht abnehmen.«
Der kurdische Prinz sprengte von dannen. Der armenische Fürst schloß die Seitenpforte hinter sich und schlenderte nachdenklich zu seinen großen Weingärten, die nach Süden lagen.
Ein Glück, daß der türkische Spion noch vor der Mauer gefaßt worden war und so keine Gelegenheit hatte, einen Blick in die Weingärten zu werfen. Hier lagerten und übten seit einigen Wochen dreihundert Freiwillige, die Hakob Akunian aus allen armenischen Dörfern Nordpersiens möglichst unauffällig in kleinen Trupps hierher zusammengezogen hatte, seit kurdische Hirten aus den Bergen, die in Surejas Sold standen, die Nachricht brachten, Scharef Pascha ziehe bei Wan in Ostanatolien zu einem Raubzug nach Persien Hamidiekurden zusammen.
Wenn ihr besonders hoch bemessener Sold für einige Zeit ausblieb, suchten die Hamidiekurden sich selbst zu helfen, so gut es ging. Sie brandschatzten dann nicht nur die Armenier, sondern auch die Bergkurden und dezimierten ihre Herden. Die freien Kurdensöhne der türkischpersischen Grenzgebirge haßten sie tödlich, weil die Hamidiekurden nicht nur im türkischen Sold standen, sondern sich auch noch an den Herden ihrer Bluts- und Glaubensvettern so rücksichtslos vergriffen.
Um die Perser dabei nicht über Gebühr zu reizen, beschränkten sich solche Raubzüge der Kurden möglichst auf rein christliche Dörfer oder christliche Vororte. Wenn Sunniten die Christen ausplünderten und ihre Häuser zerstörten, konnte das den Schiiten doch nur recht sein. Haßten sie doch Armenier und Syrer, diese Ungläubigen, gleichermaßen. Der einzige Glaubensartikel, in dem beide mohammedanische Bekenntnisse einig waren.
Hakob Akunian schritt durch die Gruppen der Freiwilligen. Sie lagerten unter einzelnen Rebenstämmen, die besonders stark und den Tag über schattenspendend wie Bäume waren. Man begrüßte einander leise, nickte sich zu, flüsterte, und des Fürsten Wort lief von Gruppe zu Gruppe schnell und munter wie ein Füllen, das bald den Reiter tragen wird. »Nur noch ein wenig Geduld, bald ist es soweit.«
Der Fürst winkte einem lebhaften Priester in ergrautem Bart, mit unendlich guten, lachenden Augen. Er war der verehrte Liebling aller und hatte sich schon häufig als ebenso tollkühn wie verschlagen erwiesen, ohne je für seine Person eine Waffe zu benutzen. Einst war er vom Katholikos in Etschmiadsin, dem Papst der Armenier, nach Europa geschickt worden und hatte auch in Berlin zwei Jahre Theologie studiert. Damals gelobte er sich, niemand mehr zu töten, aber seinem Volk doch mit allen Kräften gegen alle Feinde beizustehen. Selbstverständlich trug er Waffen, aber benutzte sie nicht.
Hakob Akunian ging mit Vater Grigor ein wenig beiseite, um über den türkischen Spion zu sprechen. In diesem Augenblick erschien Riza und berichtete, noch ein wenig außer Atem, er sei dem alten Kurdenweib ins freie Feld gefolgt. Ein Pferd mit zusammengebundenen Vorderbeinen habe auf dasselbe gewartet. Der Türke sei nach Süden in der Richtung auf Salmas fortgaloppiert. Riza zog sich wieder zu seinen Leuten unter einen Weinstock zurück.
»Da er nach Süden abgebogen ist statt nach Norden, wie ich erwartete, was meint Ihr, Vater Grigor?«
»Dann ist Scharef ebenfalls nach Süden unterwegs.«
»Aber unter der Folter erklärte der Spion ausdrücklich, Scharef lagere noch bei Wan.«
»War sie scharf?«
Der Fürst lächelte. »Scharf und ungewöhnlich.«
»Dann will er den Weg von Derik nach Wan auskundschaften. Von dort aus suchen sie ja meist den Salmasdistrikt heim.«
»Ihr glaubt immer noch, es gilt Salmas, nicht uns?«
»Die Dörfer sind ärmer, die Häuser schwächer; und solange sie Delivan umgehen, haben sie es nur mit Armeniern zu tun. Ohne Konflikte mit Mohammedanern.«
»Aber hier wäre mehr zu holen.«
Der Priester lachte. »Aber schwerer zu kriegen.«
»Weshalb kam er dann überhaupt hierher?«
Der Priester lächelte verschmitzt: »Um nachzusehen, ob Ihr schlaft oder wacht, Hakob ... Er kann ja auch Riza bemerkt und nur einen Haken nach Süden geschlagen haben, um uns irrezuführen.«
»In Salmas haben sie heute nacht die Augen auf. Ich habe sie gestern gewarnt.«
»Dann werden wir ja morgen wissen, wohin er geritten ist.«
»Ich reite nach Djulfa. Für vier, fünf Tage. Seid wachsam, Vater Grigor.«
»Wann reitet Ihr?«
Der Fürst sah nach dem Himmel. »Sowie die Sterne leuchten. In zwei Stunden, denke ich.«
Nachdenklich meinte der Priester: »Wenn Scharef noch bei Wan lagert, braucht der Spion sechs Tage bis zu ihm. Ebensolange braucht Scharef mit seinen Leuten von Wan bis Derik, wenn sie zwischendurch nicht Rast machen, was sie sicher tun. Vor vierzehn Tagen werden sie schwerlich in Salmas oder hier sein. Wir haben Zeit.«
»Es braucht niemand zu wissen, daß ich fort bin.«
Sie schüttelten sich die Hände, der Priester schlug das Kreuz über dem Fürsten. Dieser antwortete stumm, lächelnd mit dem mohammedanischen Gruß, indem er mit der Rechten leicht Stirn, Mund und Brust berührte.
Im Pavillon neben dem Haus brannten schon Kerzen. Die Mutter des Fürsten las dort in einem französischen Roman, den unvermeidlichen Samowar auf einem kleinen Nebentisch, von dem aus ein Diener ständig für Tee und Gebäck sorgte. Der Sohn eilte zu ihr, küßte sie erst nach russischer Sitte auf beide Wangen, dann europäisch ihre ringgeschmückten Hände, und ließ sich auf dem nächsten Stuhl nieder.
Die Fürstin schlug den Roman zu, legte ihn beiseite und betrachtete den Sohn eine Weile stumm und aufmerksam.
Er lächelte ihr aufmunternd zu. Sie war eine große, stolze, energische Frau, der die meisten Schiffe auf dem Kaspischen Meer gehörten, und die seit zwanzig Jahren, seitdem sie Witwe war, die Kaiserlich Russische Post über den Kaukasus in Pacht hatte und musterhaft in Schwung hielt.
»Ein weiser Mann, der eine Schlange und einen Kurden sieht, läßt die Schlange laufen und tötet den Kurden«, sagte sie grollend mit tiefer Stimme.
Der Sohn lachte. »Wenn der weise Mann sich mit dem Kurden verbündet hat, töten sie die Schlange.«
»Können Wolf und Lamm sich verbünden?«
»Aber Mama, Lämmer sind wir doch gewiß nicht.«
»Dann ersetze das Lamm durch den Fuchs. Ein Kurde bleibt immer ein Wolf, wie schon sein Name sagt; und ein Fuchs kommt gegen ihn nicht auf, wenn die Beute geteilt werden soll.«
»Soweit sind wir noch lange nicht, Mama. Ich weiß ja, daß Sureja nicht nach deinem Geschmack ist ...«
»Kein Kurde ist nach meinem Geschmack!« unterbrach sie energisch.
»Aber wenn Wolf und Fuchs zusammen auf die Jagd gehen, ist die Chance größer, das Wild zu erlegen.«
»Und dann? Der Wolf frißt, und du kannst dir dann den Mund lecken.«
»Abwarten, Mama, abwarten.«
»Oh Ali!«
Diener brachten Essen. In der Nähe des Pavillons stellte sich der Schwerbewaffnete auf, der den Spion vor das Tor geworfen hatte.
Der Fürst rief ihm zu: »Gib Husein Gerste, Mähmäd, und dann sattle ihn. Ich reite in einer Stunde. Allein. Für vier, fünf Tage.«
»Nichts als Heiden, lauter Heiden«, brummte die Fürstin.
»Aber Mama, Husein ist mein neuer Hengst.«
»Natürlich auch ein Kurd?«
»Aus dem Gestüt des Kronprinzen, er ist schwerer als sonst die Perser. Mit arabischem Blut. Darauf verstehst du dich doch, Mama.«
»Unsere Orlower sind mir lieber.«
»Aber in den Bergen nicht zu brauchen.«
»Für den Mähmäd könntest du ruhig einen Russen nehmen, wenn es schon kein Armenier sein soll.«
Eine Weile aßen sie stumm, dann fragte die Fürstin: »Wieder Wolf und Fuchs zusammen?«
»Diesmal der Fuchs allein, Mama. Und ein paar Russen hoffe ich von dieser Jagd auch mitzubringen. Was sagst du nun, Mama?«
»Wenn ein Mann erst zwanzig ist, kann ihn kein Weib mehr hindern, ob sie jung ist oder alt, Dummheiten zu machen. Auch die Mutter nicht.« Sie steckte sich eine dicke Importe an. Der einzige Luxus, den sie sich gönnte.
Als Husein gesattelt im Hof auf und ab geführt wurde, verließen sie den Pavillon.
»Mein Husein schreit wenigstens nicht unausgesetzt wie deine Orlower«, neckte der Sohn.
»Auch das hat sein Gutes, Hakob. Wenn ich ausfahre, hört es ganz Tiflis schon von weitem, sagt: ›da kommt die Akunowa‹ und richtet sich danach.«
»Für die Jagd wäre das nichts, Mama«, neckte der Sohn.
Die Fürstin umschritt mit Kennermiene den schwarzen Hengst, der ungeduldig tänzelte und stieg. »Ein echter Kurd«, sagte sie, und ehe sich das Tier dessen versah, griff sie nach seinem Maul und entblößte die Zähne. Da sie gegen den Hengst nichts einwenden konnte, schwieg sie.
Mähmäd warf seinem Herrn einen weiten, losen, schwarzen Mantel aus zartester Lammwolle über die Schulter. Der Fürst wollte sich in den Sattel schwingen, und Mähmäd hielt schon die verschlungenen Hände unter den erhobenen linken Fuß seines Herrn, als dieser den Fuß noch einmal auf die Erde setzte, denn seine Mutter hatte unwillkürlich eine Bewegung auf ihn zugemacht. Sie standen ganz dicht voreinander, fast gleich groß, breit und sehnig, dunkelhaarig, dunkelhäutig, fest und energisch.
»Mache nicht mehr Dummheiten, als unbedingt nötig ist, mein Söhnchen, und Nachtschewan ist nicht weit von Djulfa. Als ich herfuhr, habe ich deinen Bankvorsteher mit einer Ohrfeige wecken müssen, so fest schlief er schon fünf Stunden vor Sonnenuntergang.« Sie küßte ihn auf beide Wangen, segnete ihn erst russisch, dann armenisch und sah ihm vom Tor aus nach. Dann kehrte sie zum Pavillon zurück, schlug wieder ihren französischen Roman auf, ließ sich Tee bringen und zündete eine neue, dicke Importe an.
Vier Stunden nach Sonnenaufgang stampfte Husein mit seinem Herrn in den letzten langen staubigen Hohlweg vor dem mohammedanischen Dorf mit seinem Posthaus für die Reitpost, wo Hakob Akunian einige Stunden zu ruhen gedachte. Das Fell des Hengstes glänzte feucht. Wenn der Reiter ihm aufmunternd den Hals klopfte, schäumte es unter den Händen, als sei das Tier eingeseift zum Rasieren. Den Mantel hatte der Fürst längst über die Satteltaschen in seinem Rücken geschnallt. Es wurde zu heiß, um noch lange weiterzureiten.
Der tief eingeschnittene Hohlweg war so schmal, daß kaum zwei Reiter aneinander vorbeikamen. Knarrte ein Büffelkarren auf seinen zwei riesigen Rädern, die nicht rund, sondern achteckig sind, durch den Hohlweg, gab es kein Vorbeikommen. Wollte es aber Allah, daß von der anderen Seite auch ein Büffelkarren eingefahren war, mußte einer von beiden wieder zurück. Es gab eine lange Diskussion zwischen den Fuhrleuten, wer zurück müsse, wenn sie beide Mohammedaner waren. Sie überschütteten einander mit einer Flut von Flüchen aus dem Persischen, und wenn irgend möglich, auch aus dem Türkischen und Russischen, den drei fluchreichsten Sprachen der Welt, sie gingen aufeinander los, hielten sich drohend die Fäuste und Ochsenstacheln unter die Nase und schäumten vor Wut. Dann hockten sie bei ihren Büffeln nieder, um neue Kraft zu schöpfen. Diese hatten sich längst gelegt, denn sie wußten Bescheid. Gemächlich ließen sie aus einem ihrer vielen Magen eine Futterkugel ins Maul aufstoßen, mahlten sie zwischen den Zähnen und schoben sie geruhsam und behaglich mit der dicken, rauhen Zunge von einer Backe zur anderen wie der Matrose seinen Priem, wenn er sonst nichts zu tun hat. Von Zeit zu Zeit gingen die Fuhrleute wieder aufeinander los, ohne aber jemals handgreiflich zu werden; und schließlich gab der nach, der es eiliger hatte, was er aber erst merkte, wenn schon ein bis zwei Stunden über dem leidenschaftlichen Disput vergangen waren. Nur wenn einer der Fuhrleute Christ war, mußte selbstverständlich dieser zurück.
Als Hakob Akunian in den Hohlweg einritt, hockte hoch oben an seinem Rand ein graubärtiger Bauer, ließ die nackten Füße, deren Nägel mit Henna gefärbt waren, in den Weg hängen, saugte an seiner Wasserpfeife, in deren Wasserbehälter bei jedem Zug ein paar Rosenblätter durcheinanderwirbelten, worauf er wie hypnotisiert starrte, und näselte leise einen monotonen Singsang dazu. Hinter ihm weidete an einem langen Strick, der angepflockt war, sein Grauschimmel. Der Bauer warf auf den Reiter nur einen mißtrauischen Blick aus den Augenwinkeln, ohne in seinem Singsang aufzuhören, ohne Gruß. Er hielt den anderen also für einen Christen.
Aber der Grauschimmel begann zu wiehern, erst leise grollend, dann lauter. Husein antwortete ebenso. Der Grauschimmel wieherte immer lauter in offener Feindseligkeit. Husein nicht minder. Plötzlich erschien der Schimmel am Rand des Hohlwegs, schreiend, den Boden stampfend. Husein schlug mit den Vorderbeinen in die Luft und seine Mähne sträubte sich. Erst jetzt wurde Hakob aufmerksam und rief dem Bauer zu. Der Schimmel hatte sich losgerissen. Der Bauer rührte sich nicht. Mit geblähten Nüstern streckte der Schimmel die Vorderbeine steif und schräg nach vorn, um sich in den Hohlweg hinuntergleiten zu lassen. Aber die Stelle war ihm zu steil, er trabte ein paar Schritte weiter, den Boden stampfend, den Schweif in weitem Bogen abgestellt.
Da sich der Bauer nicht von der Stelle rührte, auch dem Schimmel nicht rief oder pfiff, setzte sich Hakob fester in den Sattel. Eine unangenehme Lage, und schon deshalb nicht ungefährlich, weil er den Schimmel weder niederschießen noch niederstechen durfte, wenn er ihm auf den Leib rückte, da der Bauer dann das ganze, nahegelegene mohammedanische Dorf rebellisch gemacht hätte. Der Schimmel glitt den Abhang hinunter und kam schreiend mit gespitzten Ohren und entblößtem Gebiß näher. Er war ebenso groß wie Husein, aber leichter. Dafür aber durch keinen Reiter behindert. Einen Augenblick dachte der Fürst daran, abzuspringen und den Schimmel beim Strickrest zu greifen, der neben dem Maul herabhing. Aber wenn der morsche Strick wieder riß? Dann stand er zwischen den zwei wütenden Hengsten, und auch für Husein würde es ohne Verletzungen nicht abgehen, welche zum wenigsten die Weiterreise gefährdeten.
Die Hengste tanzten mit aufgestelltem Nackenhaar und entblößtem Gebiß unter hellen, schmetternden Schreien wie aus einer Trompete aufeinander zu. Der Fürst griff nach der schweren Reitpeitsche aus Büffelleder, In deren Griff eine Bleikugel eingelassen war. Bisher hing sie unbenutzt neben dem hölzernen, lederüberzogenen Qubul, dem Behälter für die Wasserpfeife, vorn am Sattel. Mit ihr konnte er den Schimmel vielleicht zur Raison bringen, ohne sein Leben zu gefährden. Die Hengste stiegen und schlugen mit den Vorderbeinen in die Luft. Husein drehte sich um seine Achse, fiel auf alle viere und feuerte mit den Hinterbeinen aus. Er erreichte aber den Gegner nicht, der auf den Hinterbeinen stand, des Rappen Kruppe mit den Vorderbeinen umklammerte und, die Zähne gefletscht, die Augen blutunterlaufen, nach dem Reiter biß, der ihm mit einer halben Seitenwendung nach rückwärts mit der Bleikugel im Griff der Reitpeitsche zwischen die Ohren hämmerte, ohne daß der Schimmel in seiner Wut etwas zu merken schien und dem Reiter mit dem schnappenden Maul immer näher rückte. Jetzt stieg auch Husein wieder, so daß der Schimmel von der Kruppe abglitt, warf sich herum, und nun suchten die beiden sich im Genick zu fassen und einander Hautfetzen aus dem Hals zu reißen. Wieder drehte sich Husein und feuerte dem Gegner die Hinterbeine in den Bauch, daß es in ihm dröhnte und kollerte. Aber da kein besseres Pferd in Persien beschlagen ist, schadete es nicht viel. Der Schimmel stand schon wieder auf den Hinterbeinen und ging auf den Rappen los. Die Vorderbeine wirbelten wie Trommelschlegel, denen der Reiter blitzschnell ausweichen muß, denn wenn sie ihn treffen, gibt es einen Schenkelbruch, einen Schädelbruch oder mindestens ein gebrochenes Schlüsselbein und eine verrenkte Schulter. Die Hengste schreien wie die Teufel, schnauben Feuer aus roten, geblähten Nüstern, die Augen quellen vor und drohen aus dem Kopf zu springen. Der Speichel schäumt in Flocken aus den Mäulern; und während Hakob Akunian sich duckt, den Oberkörper bald nach rechts oder links wirft, die Schenkel vorwärtsrückt oder nach rückwärts strafft, mit dem Bleiknopf der Reitpeitsche immer wieder zwischen die Ohren des Schimmels haut und die Zügel ganz locker läßt, denn sein Husein weiß von Natur besser als der Reiter, wie man solchen Gegner trifft, zuckt es ihm durch den Kopf: Schade, daß Rodin nicht hier ist, das wäre etwas für ihn, und damit wäre es doch für etwas gut.
Endlich taucht der Bauer hinter seinem Grauschimmel auf und reißt ihn so hastig und unerwartet an dem Strickfetzen, daß das Tier sich überschlägt und dann ganz verdutzt und dumm ohne Laut, leicht zitternd wieder auf alle viere kommt. Hakob zieht seinem Rappen eins mit der Peitsche über, der in gestrecktem Galopp an dem Schimmel vorbeisaust. Der Bauer steht so verdutzt in einer dicken Staubwolke, daß es eine ganze Weile dauert, bis er wütend hinter ihm dreinschimpft. Ärgerlich, immer noch vor sich hinfluchend und heftig hustend, kehrt er mit dem Schimmel zur Wasserpfeife zurück. Allahs Wege sind unbegreiflich. Gab es eine schönere Gelegenheit, daß einem Isävi, einem Christen, von einem mohammedanischen Grauschimmel alle Knochen im Leib gebrochen wurden, ohne daß ein Muselmann einen Finger dabei zu rühren brauchte? Oh Ali! Maschallah! Wie Gott will.
Am nächsten Tag stellte der Fürst für die heißesten Stunden sich und sein Pferd bei dem Telegraphisten Feddersen unter, einem Beamten des anglo-indischen Telegraphs, der hier schon seit zehn Jahren ohne viel Worte, aber zufrieden seinen Dienst tat. Sein Diensthaus, das aus zwei Räumen, einer kleinen Scheune und einer Dachkammer bestand, lag in einem kleinen, von ihm sehr gepflegten Garten, einsam und allein inmitten einer weiten Ebene, sechs Kilometer vom nächsten mohammedanischen Dorf, eine Tagereise von Djulfa entfernt, der nördlichsten anglo-indischen Telegraphenstation auf persischem Boden. Das Rede- und Anschlußbedürfnis des geborenen Friesen war nicht groß. Es genügte ihm schon im zweiten Jahr seines Hierseins vollkommen, einmal am Tag außerdienstlich seinem Telegraphen abzuhorchen, was in der Welt vorging. Nach fünf Jahren Dienst fand er sich neugierig wie ein altes Weib, lernte sich besser beherrschen und behorchte seinen Draht außerdienstlich nur noch alle acht Tage einmal. Die alte Mohammedanerin aber, die ihn aus dem nächsten Dorf mit Brot, Eiern, Reis, Büffelmilch, Zucker, Salz und Tee versorgte, traute sich mit ihren Neuigkeiten überhaupt nicht heraus, denn Feddersen Khan summten ja alle Neuigkeiten der Welt, die nahen und die fernen, in einem Draht Tag und Nacht durch die Stube. Herrlich mußte das sein. Doch diese Herrlichkeit kam nur einem so großen Herrn wie Feddersen Khan zu, nicht einem armen alten Dorfweib.
Alle Mohammedaner achteten Feddersen mit einer fast heiligen Scheu, denn er besaß von Natur einen rötlichen Vollbart, eine besondere Gunst Allahs, die nur wenigen zuteil wird; und andere Leute kamen nur selten des Wegs. So konnte er denn mit aller Ruhe und Umsicht seinen Garten betreuen, kurze Pfeife rauchen, seinen Kanarienvogel bewundern, der um so lauter wurde, je stärker der Telegraph summte, des Abends seines Flasche Wein trinken, die er sich aus dem Kaukasus besorgen ließ und in seinen Büchern blättern, die hauptsächlich aus Grammatiken bestanden. Pflege des Englischen war er seiner Stellung schuldig, für die er anständig bezahlt wurde. Persisch trieb er, um seiner Umgebung willen, damit er doch auch ein Wort sagen konnte, wenn Mohammedaner vorbeikamen. Nur Russisch studierte er aus Verehrung für den Zaren, weil er sich von seinem hessischen Schwager Weinsachverständige aus Geisenheim hatte kommen lassen, welche die russischen Weine so veredelten, daß es eine Lust war, sie zu trinken.
Den Fürsten Hakob Akunian mochte er gut leiden, weil er nicht vergessen hatte, ihm aus London ein Dutzend kurze Pfeifen mitzubringen, die reichen würden, bis er wieder an die Nordsee kam. Außerdem war ihm jederzeit jedes Mitglied der amerikanischen Baptistenmission in Täbris besonders willkommen. Erstens waren die Leute wenig schwatzhaft und zweitens Blutsvettern seiner Brotgeber wie er selbst. Auch gefiel es ihm sehr, daß diese Mission dreißig Personen zählte, die bisher in zehn Jahren zusammen nur drei mohammedanische Seelen gerettet hatten. Das war eine solide und gründliche Arbeit, die nichts überstürzte. Ganz nach seinem Geschmack.
Der Fürst traf den Telegraphisten im Schatten der Rückwand seines Hauses. »Guten Tag, Gospodin Feddersen.«
Feddersen reichte dem Gast die Hand, ohne etwas zu sagen, als wohnte er um die nächste Ecke, und man sähe sich jeden Tag mehrere Male. Nachdenklich sah er auf den Hengst.
»Worüber denken Sie nach, Gospodin?«
»Den Hengst kenne ich doch?«
»Ich hatte ihn schon vor einem halben Jahr, als ich das letztemal bei Ihnen war.«
Feddersen lächelte befriedigt. »Ich wußte es doch, als sei es gestern gewesen ...«
Der Fürst versorgte seinen Hengst in der Scheune, während Feddersen ins Haus ging, Essen zu richten.
Sie setzten sich an den kleinen Tisch und labten sich an einer der herrlichsten Sommergaben Allahs, dicker Milch von einer Büffelkuh. Da der Fürst seinen Gastgeber kannte, störte er ihn nicht durch Gespräche. Plötzlich legte Feddersen erschrocken den Holzlöffel hin und horchte. »Ist denn heute die ganze Welt unterwegs?« murmelte er beunruhigt und lauschte angestrengt.
»Ein Reiter, wie es scheint auf einem Maulesel«, meinte der Fürst.
Erleichtert griff Feddersen wieder nach seinem Löffel. »Er reitet vorbei.« Aber er irrte sich, es wurde an die Tür geklopft, und da der Reiter offenbar die Gewohnheiten des Hauses kannte, die Tür geöffnet, ohne das Herein abzuwarten.
Feddersen sprang auf und half dem Reiter, freundlich lächelnd, von seinem Tier. »Mr. Boxton.«
Der amerikanische Missionar, dem der Kopf über dem langen, schwarzen, zugeknöpften Rock blaurot angelaufen war vor Hitze, gab dem Maulesel einen aufmunternden Klaps, daß er sich ringsum sein Futter suche, wie es ihm behage, trat ein, begrüßte den Fürsten, den er kannte, und warf sich erleichtert auf einige Kissen an der Erde, da ein dritter Stuhl nicht vorhanden war. Feddersen reichte ihm ebenfalls einen Holzlöffel und eine Schüssel mit Dickmilch. Mr. Boxton rückte sich auf den Kissen möglichst bequem zurecht und schob die Schüssel in Reichweite auf den Boden, bis er sich ein wenig abgekühlt hätte.
Feddersen schien etwas sagen zu wollen, unterließ es aber, weil Mr. Boxton sofort mit dem Fürsten ein Gespräch begann, bei welchem er in jedem Satz mindestens zu Anfang und zu Ende einmal das Wort Durchlaucht, Hoheit, hohe Exzellenz anwandte, denn er liebte wie viele Amerikaner an anderen Leuten nichts so sehr als schöne Titel, und es gefiel ihm immer wieder, daß er endlich in einem Lande mit unendlich vielen, schönen und umfangreichen Titeln seine Arbeit verrichtete.
Mr. Boxton kam aus Salmas, wo er Chinin verteilt hatte, denn die Malaria gedieh überall infolge der Reisfelder noch üppiger als das Titelwesen, und Mr. Boxton war zugleich der Arzt der Baptistenmission in Täbris, und sein Chinin geschätzter als alle seine und seiner Brüder Predigten.
Mr. Boxton war sehr beunruhigt von den Gerüchten, die in Salmas über nahe bevorstehende Kurdenüberfälle umliefen. Er kam nur selten dorthin, denn es war weit von Täbris bis Salmas, und er wußte nicht, daß solche Gerüchte in Salmas zum Leben gehören wie das tägliche Brot.
Hakob Akunian machte ihm das klar, denn es lag ihm durchaus nichts daran, daß die amerikanische Mission womöglich den Generalgouverneur Amenisan mobil machte. Es gäbe diesem einen gar zu bequemen Vorwand, wieder einmal ein persisches Heer nach Salmas zu legen, das keinerlei Schutz bot, dafür aber um so gründlicher die ganze Gegend kahl fraß wie ein Heuschreckenschwarm.
»Mister Boxton«, begann Feddersen wieder.
»Ja?«
»Sie könnten mir einen Dienst erweisen.«
»Gerne.«
»Sie sehen doch das Loch in der Wand dicht am Boden?«
»Man kann es nicht gut übersehen, Mister Feddersen.«
»Ihre Schüssel steht ein bißchen dicht dabei. Sie erweisen mir einen Dienst, wenn Sie die Schüssel von dem Loch weiter fortrücken wollten.«
Wenn Feddersen einmal einen ganzen Satz sprach oder gar mehrere, war er nicht ganz leicht zu verstehen. Er mischte dann die Worte nach den Regeln einer nur ihm verständlichen Grammatik aus all den Sprachen, mit denen er sich abgab, aus Persisch, Russisch, Englisch und Friesisch, etwas wild durcheinander. Aber so viel verstand Mr. Boxton doch, daß er die Schüssel mit Milch näher an sich heranzog.
Hakob Akunian gab sich weiter alle Mühe, den Missionar dahin zu bringen, daß er von selbst auf den Gedanken kam, den Generalgouverneur keinesfalls mit den Gerüchten in Salmas zu belästigen. Hätte er ihn direkt darum gebeten, war der Erfolg zweifelhaft, denn einigermaßen verläßlich ist der Mensch nur seinen eigenen Gedanken gegenüber.
»Tun Sie mir den Gefallen, Mister Boxten, und essen Sie jetzt Ihre Schüssel leer«, begann Feddersen wieder.
»Aber was haben Sie denn, Gospodin Feddersen? Haben Sie Fieber, daß Sie so gesprächig werden?« fragte der Fürst.
Unruhig, errötend sagte der Telegraphist: »Ich möchte nicht, daß Mister Boxton vielleicht doch noch einen Schrecken bekommt.«
»Aber Mister Feddersen.« Der Missionar griff lächelnd zu Löffel und Schüssel.
»Ich danke Ihnen, Mister Boxton.«
Der Missionar schob die Schüssel bald wieder von sich. Er sei noch zu erhitzt.
»Dann erlauben Sie, daß ich die Schüssel solange auf den Tisch stelle.« Der Telegraphist nahm die Schüssel vom Boden.
»Haben Sie Ratten oder Mäuse in dem Loch?« fragte der Fürst.
Feddersen lächelte. »Das nun nicht gerade, Durchlaucht. Aber es ist da eine Schlange.« Mr. Boxton sprang entsetzt auf.
»Nun haben Sie sich doch erschreckt«, klagte Feddersen. »Sie ist noch nicht lange hier, aber es gefällt ihr, denn sie geht nicht wieder fort. Ein ganz nettes großes Tier, fast schwarz und macht fast gar keinen Lärm. Ich setze ihr immer Milch hin für den Durst. An mich hat sie sich schon ganz gut gewöhnt. Meist kommt sie nur, wenn es dunkel wird. Aber wenn Sie ihr eine so große Schüssel mit Dickmilch hinsetzen, Mister Boxton, kommt sie vielleicht jetzt schon, und ich weiß nicht, ob sie fremde Personen leiden mag. Vielleicht spuckt sie dann oder beißt. Ob sie giftig ist, weiß ich auch nicht. Abends kriecht sie ganz gerne ein bißchen herum, und ich sehe ihr ganz gerne zu, weil sie so gar keinen Lärm dabei macht.«
»Um des Himmels willen, Feddersen, wenn das Biest Sie nun beißt und giftig ist!«
»Ich glaube das nicht, Mister Boxton. Es ist mir jetzt eine ganz angenehme, stille Gesellschaft, wobei sich gut nachdenken läßt. Setzen Sie sich auf meinen Stuhl, Mister Boxton.« Feddersen warf sich zwischen die Kissen auf den Boden. Niemand hatte ihn schon solange und zusammenhängend sprechen hören.
»Essen Sie nur ruhig Ihre Milch, Mister Boxton«, sagte der Fürst und schwang die Reitpeitsche mit der Bleikugel im Griff.
»Nun ihr keine Milch mehr dicht vor der Nase steht, brauchen Sie keine Bange zu haben, nun kommt sie erst, wenn es dunkel wird.«
»Können Sie die Schlange nicht ein wenig aus dem Loch locken, Gospodin Feddersen? Ich kenne mich aus. Wir wüßten dann wenigstens, ob es eine Giftschlange ist und könnten sie unschädlich machen.«
»Ich möchte das auch ganz gerne wissen, Durchlaucht, aber sie kommt nicht, wenn man sie ruft, sondern nur, wenn sie Lust dazu hat. Wie alles, was in Persien geboren wird.«
Mr. Boxton aß seine Dickmilch schneller als unter normalen Verhältnissen und ließ das Loch mit der Schlange nicht aus den Augen.
Mr. Boxton verließ den Telegraphisten, als die Sonne noch recht hoch am Himmel stand, und der Fürst ritt weiter, als es Abend wurde, ohne daß die Schlange aus ihrem Loch hervorkroch. Maschallah! Wie Gott will.
Schon kurz nach Sonnenaufgang konnte sich Hakob Akunian mit seinem Hengst über die Araxesfähre nach Djulfa übersetzen lassen, denn niemand läßt ein gutes Pferd weiter aus der Hand, als der Zügel reicht. Sonst verschwindet einer mit ihm, ehe man sich dessen versieht; und ihm auf einem anderen Pferde nachfolgen ist um so aussichtsloser, je besser das gestohlene Pferd ist. Es rettet die Seele. Auch wenn sie einem Dieb gehört. Ihn abzuschießen geht nicht an, weil der Dieb eines Christenpferdes immer Mohammedaner ist. Christen stehlen nur Mohammedanern ein Pferd, wenn sie unbewaffnet sind, was aber bei Mohammedanern, deren Pferde zu stehlen sich lohnen würde, nicht vorkommt.
Noch an demselben Abend trat der Fürst mit fünf Unteroffizieren der russischen Grenzregimenter, die für vier Hände voll weißes Geld für vier Wochen krank gemeldet wurden, nachdem er sie in persische Kleider gesteckt hatte, wieder die Rückreise an. Die Wachtmeister, denen er sie abgemietet hatte, drängten selbst zu möglichst schneller Abreise. Zwei Generäle aus Tiflis wurden erwartet. Wenn der Teufel seinen Schwanz im Spiele hatte, konnten die hohen Exzellenzen sofort eine Parade abhalten, und dann mußten die fünf Unteroffiziere längst ordnungsgemäß als choleraverdächtig krank gemeldet sein.
Schon seit einem Jahre warteten hier drei Regimentsärzte auf die Cholera, die von Indien her kommen sollte. Aber sie kam nicht. Der Weg war ihr zu weit und beschwerlich. Die Exzellenzen in Tiflis aber waren schon ungeduldig geworden und drohten, die unfähigen Ärzte abzurufen, wenn sie nicht bald die Cholera entdeckten, von der höheren Orts nun einmal feststand, daß sie von Indien durchaus nach Rußland wollte.
Als Hakob Akunian mit seinen russischen Unteroffizieren in persischem Zivil am nächsten Tag über Mittag in einem Posthaus Rast machte, hockte unter dem Eingang ein altes, zerlumptes Kurdenweib. Für einen Augenblick stutzte er, ging aber, ohne anzuhalten, weiter. Daß ihm bei diesem Anblick sofort der türkische Spion einfiel, war nur zu begreiflich. Aber es gab mehr als ein zerlumptes Kurdenweib in diesen Dörfern. Als er sich jedoch in dem kahlen Raum für Reisende auf einer Holzpritsche ausstrecken wollte, wurde es ihm plötzlich fast gewiß, daß ihn Männeraugen und nicht Weiberaugen aus der schmutzigen Burqä angestarrt hatten. Er schlich sich wieder zur Tür, aber von dem alten Weib war nichts mehr zu sehen.
Ein zweites Erlebnis beunruhigte ihn bald von neuem. Er ritt absichtlich von Osten her in die Hauptstadt des Gouvernements ein und mußte so die ganze mohammedanische Stadt durchqueren, ehe er das Christenviertel erreichte. Auf diese Weise erfuhr Sureja am schnellsten, daß er wieder da war. Nach den Straßen zu gab es zwar keine Fenster, aber hier und da stand ein Tor offen, und wo es verschlossen war, lungerte sicher ein Teil der Dienerschaft am Tor und lugte durch Ritzen und Schlüssellöcher nach Neuigkeiten auf die Straße. Kein Telegramm erreichte so schnell und sicher sein Ziel wie eine Neuigkeit auf diesem Wege jedes Haus, zumal der armenische Bankier, Allah verdamme ihn, fünf Reiter hinter sich hatte, die kein Mensch kannte, trotzdem sie persische Tracht trugen. Nicht einmal ihre Fingernägel waren rot von Henna.
Der Fürst ritt schneller voran, denn seinen Hengst trieb es zum Stall. Als der schmale Weg eine scharfe Biegung machte, sah er am anderen Ufer des Baches, dem der Weg folgte, ein altes Weib, das Wäsche wusch, eine aufrechte Gestalt in der alles verhüllenden Burqä neben sich. Er sah darüber hinweg, wie es die Sitte gebot, und es war ja auch ein durchaus alltäglicher Anblick. Da sprang das alte Weib mit einem Satz hinter die aufrechte Gestalt und riß mit einem Ruck deren Burqä von der Stirn bis zu den Füßen weit auseinander. Vor ihrem schwarzen Hintergrund stand ein blutjunges, nacktes Mädchen. Ein leiser Schrei der Jungen, die vor allem ihr Gesicht zu decken suchte, ein schrilles Gelächter der Alten. Schon hatte das Mädchen die Burqä wieder um ihre Glieder geschlungen und entschlüpfte wie eine Eidechse durch eine schmale, niedrige Pforte hinter die schützende Mauer. Die Alte, die Wäsche zusammenraffend, hinterdrein.
Der Hengst setzte sich fast auf die Hinterbeine, so scharf hatte ihn der Reiter zurückgerissen. Er starrte auf die kleine Pforte, die sich geschlossen hatte. Was sollte das? Es war kein Zufall. Dahinter steckte eine bestimmte Absicht. Der Zufall war dabei nur zu Hilfe gekommen. Oder hatte man gar ausgekundschaftet, daß er um diese Zeit hier vorbeikommen wird? Hatte ihm einer schon vor der Stadt aufgelauert? Ein Köder war ausgeworfen, eine Falle gestellt. Galt es seinem Geld oder seinem Leben? Ein Kuppelversuch oder was sonst?
Die fünf Unteroffiziere kamen um die Biegung, und Hakob Akunian setzte Husein wieder in Bewegung. Auf seiner Netzhaut blieb das Bild so klar und deutlich bis in alle Einzelheiten, als er für einen Augenblick die Augen schloß, wie auf der Platte eines vorzüglichen Apparats für Momentaufnahmen und senkte sich langsam vom Gehirn immer tiefer in sein Blut. Er wußte nicht, wer hier wohnte. Unzweifelhaft Mohammedaner. Und das alte Weib kannte ihn. Das stand sofort bei ihm fest. Er mußte Mähmäd auf die Spur setzen. Man mußte den Gegner finden, der den Köder ausgeworfen hatte. Ein Freund war es gewiß nicht. Nur hemmungslose Geldgier oder hemmungsloser Haß konnten etwas so Ungewöhnliches wagen. Auch war es für den Fürsten klar, daß das alte Weib nur auf einen Befehl hin so gehandelt hatte. Ob das Mädchen mit im Komplott war, schien zweifelhaft. Aber traue einer den Weibern.
Drittes Kapitel
Die beiden Generäle aus Tiflis waren in geräumigen Tarantas, hinter sich eine bescheidene Kalesche mit zwei Popen, in Djulfa eingetroffen. Die Kosakenoffiziere rissen verwundert die Augen auf, und sehr schnell war der erwartungsvolle Respekt vor den hohen Exzellenzen dahin. Die beiden dicken Herren standen irgendwo am Ural, wo die Füchse sich gute Nacht sagen, Linienoffiziere. Nicht einmal dazu hatte es bei ihnen gereicht, daß sie zur Gendarmerie oder zur Geheimpolizei übertraten. Sie blieben wohl bei der Linie bis an ihr alkoholisches Ende. Und war es nicht der reine Hohn, daß sie zwei Popen nach Urmia in Persien zu geleiten hatten? Dem jüngsten Leutnant aus einem Garderegiment hätte man so eine Schande nicht angetan. Zwei Generäle als Begleitung für zwei ganz gewöhnliche Popen, über die sogar das gemeine Volk lacht, wenn sie nicht gerade im Amtskleid am Altar in der Kirche stehen!