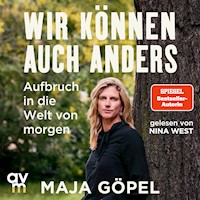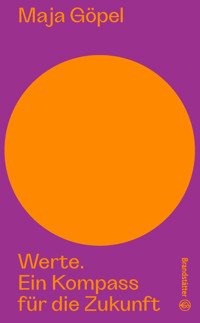
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Auf dem Punkt
- Sprache: Deutsch
Mit viel Neugier und Begeisterung für die menschlichen Möglichkeiten nimmt uns die Transformationsexpertin und Bestsellerautorin Maja Göpel mit auf eine Entdeckungsreise zu unseren Werten und wie sie in unserer Gesellschaft wirken: Wo kommen sie her, welche Werte wollen wir erhalten und schätzen, aus welchen können wir schöpfen – und welche stehen uns mitunter sogar im Weg? Welche Werte können helfen, mutig Veränderungen zu gestalten und in turbulenten Zeiten auf Kurs zu bleiben? Werte sind, das wird dabei klar, eine eigenwillige Sache: Ob wir die Freiheit durch gesellschaftlichen Zusammenhalt oder die Freiheit der Einzelnen als Leitwert ansehen, prägt unser Empfinden von Fairness und Gerechtigkeit. Ob wir einen Mehrwert in Form einer Steuer erheben oder über einen Unternehmenswert staunen – Geldwerte prägen unsere Sicht auf das Mögliche und Wünschenswerte. Auch Bewertungen wie Noten, Likes und Punkte platzieren uns im Verhältnis zu anderen und fordern unseren Selbstwert heraus. Stand und Status sind ganze Sammelbecken unserer Wertvorstellungen - aber nicht immer macht das Sammeln die Summe wertvoller. Wie wir Wohlstand bilanzieren und erhalten oder wie wertvoll gemeinsame Zeit ist: Die Antworten auf diese Fragen prägen unsere Entscheidungen und unser Zusammenwirken. Welche Werte also stehen heute im Vordergrund? Sind sie etwas Ethisches oder Ökonomisches, oder noch etwas ganz anderes? Über diese Fragen kommen wir miteinander ins Gespräch. Die Antworten darauf, das zeigt Maja Göpel, prägen unseren Blick auf die Welt - und damit unsere Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maja Göpel
Werte. Ein Kompass für die Zukunft
Unter Mitarbeit von Tanja Ruzicska Aus der Reihe »Auf dem Punkt« Herausgegeben von Hannes Androsch
Für Kristina
Die Frau mit dem Kompass
Inhalt
1 Mutiges Einchecken
2 Fortschrittlicher Wohlstand
3 Stilvolles Regulieren
4 Wertvolles Bilanzieren
5 Lebenswerter Anstand
Anmerkungen und Quellen
Literatur
Die Autorin
Impressum
1
Mutiges Einchecken
Die Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, wenn es Vergangenheit geworden ist.
William Somerset Maugham, Schriftsteller
Wie jeden Morgen sind wir heute mit einem großen Geschenk aufgewacht: Wir haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und auch heute werden unsere Entscheidungen prägen, wie wir uns fühlen, was wir in dieser Welt für möglich halten und letzten Endes ermöglichen.
Diese Freiheit begegnet uns in vielen und oft auch unbemerkten Momenten. In diesem Augenblick können Sie sich beispielsweise entscheiden, ob Sie dieses Buch lesen möchten oder nicht. Vielleicht stehen Sie gerade in einem Laden, es kann leise sein oder laut und Ihre Auswahl wird von der Anordnung der Bücher in der Auslage beeinflusst, oder Sie sitzen vor einem Bildschirm und lassen sich von einem Algorithmus lenken. Ob digital oder analog: Frühere Erfahrungen und Empfehlungen anderer Menschen spielen eine Rolle. In gestressten Momenten sind Cover und Titel wahrscheinlich wichtiger, als wenn Sie Zeit für die ersten Seiten finden. Und wenn Sie so ein Nerd wie ich sind, kommen Sie aus dieser Situation nie mit nur einem Buch heraus.
Wie auch immer Sie sich in der Regel neuen Büchern nähern, Ihre Entscheidung lebt buchstäblich den Moment mit, in dem sie getroffen wird: Informationen, Situationen und Personen, die Teil Ihrer Entscheidungsmomente sind, beeinflussen, was Sie tun werden. Umgekehrt wirkt Ihre Entscheidung sich auf die Personen, die Situation und die Information aus, die Teil des »entscheidenden« Moments sind. Manchmal geht es um simple Ja-Nein-Fragen: Esse ich schon wieder Nudeln, nur weil meine Kinder anderen geschmacklichen Wundern gern etwas skeptisch gegenüberstehen? Oder nehme ich mir die Zeit und bereite zwei verschiedene Gerichte zu? Spätestens, wenn die Kinder »hangry« werden, also vor Hunger maulen und streiten, merke ich, dass die Frage nach ausreichend Zeit ja nicht nur mich betrifft, sondern auch alle, auf die sich meine Entscheidungen auswirken. Und schon verschiebt sich der Fokus, welche Freiheit ich mir heute nehmen möchte: Gaumenfreude für den Preis von Tränen oder Nudeln für den Burgfrieden?
Nun habe ich das Glück des Mittwochs. An einem Mittwoch hat mein Partner, der sowieso viel besser kochen kann als ich, früher frei und angelt sich die Kochschürze. Der Mittwoch ist also der Anderstag, der eine Tag in der Woche, der einer anderen Versuchsanordnung folgt. Und schon wieder habe ich die Freiheit, zu entscheiden, ob ich mich auf den Anderstag freue und wir an den übrigen entspannt Nudeln oder Pfannkuchen essen, die gelingen nämlich mir besonders gut. Oder ob ich meine Aufmerksamkeit auf all die Abendessen lege, bei denen ich als arbeitende Mutter kulinarisch verzichten muss. Wie auch immer ich mich entscheide: Es wird meine Laune beeinflussen. Und damit die Stimmung im Haus.
Auch darum geht es mir in diesem Buch. Auf der Werteskala zwischen gut und schlecht ist die Stimmung im Haus Deutschland — und in vielen Teilen Europas — so mies, wie ich es noch nicht erlebt habe. Als Gesellschaftswissenschaftlerin bin ich es gewohnt, nach Ursachen dafür zu suchen. Nicht situative, sondern strukturelle Ursachen. Strukturell, weil es sich nicht um kurze Ausnahmesituationen handelt, die uns aufscheuchen und pariert werden können, sondern weil es eben um die Art und Weise geht, wie wir für gewöhnlich unsere Gesellschaft organisieren. Denn genau die wird infrage gestellt. Funktioniert das noch so, wie wir es bisher gemacht haben, oder brauchen wir etwas Neues? In den letzten Jahren ist diese Frage zum Dauerbrenner geworden: Eine weltweite Pandemie führt zu geschlossenen Grenzen, unterbrochenen Lieferketten, heftigen Eingriffen in das Alltagsleben und rasantem Anwuchs von Verschwörungstheorien. Der russische Angriffskrieg auf ein Nachbarland rüttelt die Grundpfeiler der bisherigen Verteidigungspolitik und Diplomatie durcheinander, genauso wie die einer sicheren Energieversorgung. Der Nahost-Konflikt spaltet uns in zwei Lager und die Wahl von us-Präsident Donald Trump hat gezeigt, wie viel schwerer es fällt, Brücken zu bauen, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht gesucht, sondern zunehmend aggressiv als unmöglich dargestellt wird. Was dabei mit der ohnehin schon wacklig wirkenden Weltordnung passiert, wird uns weiter in Aufregung halten. Durch diese Krisensituationen angetriebene Inflationsraten im zwischenzeitlich doppelstelligen Bereich sowie die Fragen, wie darauf reagiert werden sollte und wo das Geld dafür herkommen kann, spülen grundlegende polit-ökonomische Streits an die Oberfläche, was im Herbst 2024 sogar zum Bruch der deutschen Regierungskoalition führte. Immer neue Hitzerekorde, wütende Waldbrände oder Überschwemmungen, die sich über zuvor verdorrte Regionen ergießen, treiben nicht nur die Preise weiter hoch, sondern die Menschen aus ihren Lebensräumen. Geflüchtete stehen in Schlangen vor Wasserausgabestellen und Tourist:innen vor Flugschaltern in Richtung badewannenwarmer Meere.
Die Nachrichtenlage ist schwierig und der Umgang mit ihr immer skurriler: Artikel über elende Armut finden sich umzingelt von Werbebildern für Luxusgüter und Schönheitsprodukte, und die Plattformen, die eine barrierefreie soziale Kommunikation erlauben sollten, manövrieren uns in algorithmisch perfektionierte Aufmerksamkeitsfallen und von der Lösungssuche in die Schuldzuschreibung. Falls dann doch mal inhaltliche Diskussionen entstehen, kommt es höchstens zu einem Schlagabtausch, welches Wort und welche Schreibweise jetzt angemessen gewesen wären und warum die andere Person sicher keine ernstzunehmende Perspektive bietet. Nichts davon ist besonders hilfreich, um sich in Krisenzeiten gut und lösungsorientiert informiert zu fühlen. Nichts davon verschafft mir eine Übersicht, welche Handlungsoptionen angesichts großer Fragen auf dem Tisch liegen, oder unterstützt mich dabei, einzuschätzen, wo sich das eigene Engagement lohnt und wer vielleicht mitmacht. Statt Wirksamkeit wächst Wutsamkeit.
Wie also kann ein so zentraler Wert wie Freiheit in unseren liberalen Demokratien wieder mehr verbinden als spalten? Wer hat recht, wenn es um verschiedene Auffassungen von Freiheit geht, die sich sogar elementar widersprechen können? In einem Buch über Werte, das einen Kompass für die Zukunft verspricht, erwarten Sie möglicherweise eine klare Antwort auf solche Fragen. Aber genau das scheint mir heute das Problem. Irgendwer soll jetzt entscheiden, was richtig und falsch ist, wir sollen uns positionieren und das lautstark deklarieren: rechts oder links, Krieg oder Frieden, Freiheit oder Diktatur, richtig oder falsch. Damit gehen wichtige Zwischentöne verloren und oft auch der Blick auf realweltliche Veränderungen. Deshalb möchte ich mich in diesem Buch vor allem empirisch orientieren. Wir haben in Deutschland klare Zielwerte für gute gesellschaftliche Ergebnisse verabredet, sie finden sich in unserem Grundgesetz, aber auch in einer zentralen Nachhaltigkeitsstrategie, die für alle Regierungskonstellationen eine Richtschnur sein soll. Wohlstand, Sicherheit und Freiheit schillern als große Werte in der Debatte, aber ausbuchstabieren, wie genau sie erreicht werden sollen, tun wenige. Anstatt uns also weiter dabei zu überbieten, wer diese Werte angeblich kaputtmacht oder nicht, könnten wir auch mit klarem Blick die Wirkung der Mittel beleuchten, mit denen wir sie (angeblich) ansteuern. Also: Wie wirken unsere Antworten auf die Krisen unserer Zeit?
Die Nachrichtenverarbeitung der rechtspopulistischen AfD zum Beispiel wirkt effektiv in Richtung schlechte Laune. Das haben Forscher:innen des Wissenschaftszentrum Berlin (wzb) herausgefunden, als sie den Gemütszustand von Personen, die dieser Partei folgen, mit demjenigen von Personen verglichen haben, die anderen Parteien nahestehen.1 Ich kann Ihnen empfehlen, das einfach selbst mal auszuprobieren. Meine Erfahrungen mit den X-Accounts von Beatrix von Storch und Alice Weidel führten schon nach nur fünf Minuten zu einem Grummeln im Bauch angesichts der dort als katastrophal portraitierten Lebenssituation in Deutschland. Wenn Sie dreißig Minuten durchhalten, baut sich daraus ein richtiggehend miserables Gefühl auf, weil Sie gebetsmühlenartig auch noch darauf hingewiesen werden, dass niemand außer dieser Partei die Absicht oder Fähigkeit hätte, daran etwas zu ändern. Zuvorderst wird natürlich den Regierungspolitiker:innen jede Kompetenz oder Motivation abgesprochen, außer vielleicht Freiheitsberaubung und Diktatur. Überhaupt geht es nicht mehr darum, wie Dinge und Gegebenheiten zusammenhängen und sich entwickeln, sondern um die Skandalisierung von einzelnen Zahlen oder Personen. Überall Nutznießer und Unverschämtheiten, Deutschland schafft sich ab und die Vermögenden wandern schon mal aus.
Je länger wir derlei hören, desto mehr wächst der Eindruck, dass alle auschecken, die können. Und schon wird nicht nur meine Laune schlechter, mit der Zeit wächst auch die empfundene Ohnmacht, weil die gesellschaftlichen Probleme eben nicht allein gelöst werden können. Mehr Selbstwirksamkeit verspricht dann eher die Verteidigung des Bekannten — eben, weil es bekannt ist. Das wissen Populist:innen genau, auch die aus Parteien ohne nachweislich rechtsextreme Hetzer:innen. Daher bezeichnen sie auch die meisten Vorschläge für Veränderungen als Zumutungen — Mut zu Veränderungen ist so nicht vorgesehen.
Oder hatten Sie schon mal Lust auf etwas Neues, wenn angeblich alles Ordentliche und Gute in der Vergangenheit schlummert, während das Heute gefühlig, empörend und mit wenig hinterfragten Zahlen dramatisiert wird?
Reift in Ihnen die Entscheidung heran, kreativ in die Gestaltung von Zukunft einzuchecken, wenn Sie ständig hören, dass alle anderen ohnehin nichts verändern wollen oder nur an sich selbst denken und aus der Veränderungsnotwendigkeit auschecken, was wiederum als normal oder liberal zu verstehen sei? Bei mir nicht. Miese Stimmung und Misstrauen setzen nicht besonders viel Tatendrang frei. Stattdessen entsteht ein Effekt mit dem bezeichnenden Namen »Pluralistische Ignoranz« — oder einfach Gruppenblindheit. Diesen Begriff haben die Sozialpsychologen Floyd Allport und Daniel Katz bereits 1931 geprägt, als sie sich mit Gruppendynamiken beschäftigten und verstehen wollten, warum sich Menschen öffentlich anders verhalten, als sie privat für richtig halten würden.2 Wie stark leben die jeweiligen Situationen und verfügbaren Informationen also unsere freien Entscheidungen mit? Pluralistische Ignoranz, fanden Allport und Katz heraus, entsteht in den Situationen, in denen eine weitverbreitete — also von vielen geteilte — Fehleinschätzung darüber vorliegt, wie »die anderen« wohl denken oder sich verhalten mögen. Diese Fehleinschätzung beeinflusst die Entscheidung, was wir in einer bestimmten Situation tun, maßgeblich. Nachvollziehbar, als Herdentiere möchten wir ja gern dazugehören. Und in vielen Situationen, so entscheiden zumindest die meisten Personen, lohnt sich mein eigener Aufwand erst, wenn auch die Mehrheit mitzieht. Nur viele kleine Schritte können Großes bewegen.
Gruppenblindheit führt also dazu, dass der gesellschaftliche Mut zur Veränderung rasant unterschätzt wird. Schauen wir beispielsweise in die usa: Mindestens vier Fünftel der Amerikaner:innen (80–90 Prozent) verschätzen sich bei der Annahme, wie stark die gesellschaftliche Unterstützung für Klimapolitik sei. Weit über zwei Drittel der Amerikaner:innen (66–80 Prozent) begrüßen Maßnahmen wie einen co2-Preis, eine vollumfängliche Erneuerbare-Energien-Strategie oder sogar den Green New Deal. Aber wenn sie gefragt werden, was sie glauben, wie viele ihrer Landsleute diese Politik unterstützen, dann liegt dieser Wert bei schlappen 37–43 Prozent.3 Das wäre natürlich keine Mehrheit und gerade bei Republikaner:innen ist die Abweichung deutlich größer als bei Demokrat:innen.
Der Effekt funktioniert aber auch andersherum. In diesem Fall halten wir eine Minderheitenmeinung für die Mehrheitsmeinung. Eine Umfrage vom Institut für Demoskopie Allensbach unter ostdeutschen Mitbürger:innen ergab bei den Brandenburger Landtagswahlen im September 2024, dass sich ein knappes Drittel der Menschen (32 Prozent) als »Bürger:innen zweiter Klasse« empfinden. Das ist sicher kein gutes Ergebnis. Aber noch viel eindrucksvoller ist etwas anderes: Auf die Frage, ob sie dächten, dass sich Ostdeutsche insgesamt als Bürger:innen zweiter Klasse fühlen, bestätigten fast zwei Drittel (59 Prozent) der Befragten diese Annahme.4 Schon wieder unterscheidet sich der Wert der eigenen Wahrnehmung von dem der Einschätzung, was bei »den anderen« so los ist, um fast das Doppelte. Als Forscher:innen der Humboldt Universität daraufhin Personen zu ihrer Unterstützung der AfD und zu ihrer Einschätzung der ostdeutschen Wirtschaft befragten, stellte sich etwas Überraschendes heraus: Bei den Befragten, die über ihre Fehleinschätzung aufgeklärt wurden — die also die Umfrage zu sehen bekamen, nach der sich die Mehrheit gar nicht schlechter behandelt fühlt —, sank die Unterstützung für die AfD.5
Um der pluralistischen Ignoranz ein Schnippchen zu schlagen, sollten wir also immer wieder anständig hingucken. Denn gerade populistische Strateg:innen zeichnen sich dadurch aus, möglichst offensiv zu erklären, für »das Volk« zu sprechen — gern auch schon zu Zeiten, in denen die Parteien noch bei 10 Prozent liegen. »Der Osten ist blau« sagte Alice Weidel nach den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.6 Dabei war er auch nach den letzten Zuwächsen noch zu über zwei Drittel (69 Prozent) andersfarbig.7
Eingebaute Mehrheitsdeklarationen finden sich aber auch in den ritualisierten Arten der Fragestellungen, mit denen Ideen für ein Andersmachen konfrontiert werden: »Ja aber, wie wollen Sie denn die Leute dazu bringen, auf ihren Fleischkonsum zu verzichten?« Wenn wir uns die Effekte des heutigen Fleischkonsums anschauen, wäre eine etwas offenere Frage vielleicht diese: Warum halten Gesellschaften an einer gesundheitsschädigenden Ernährung fest, für die massenhaft Tiere gequält, Leiharbeiter:innen ausgebeutet, Böden und Grundwasser verseucht werden und die Regenwälder im globalen Süden für das Soja vernichtet werden, das hier in die Rinder gesteckt wird? Da haben wir noch nicht einmal über die Klimakrise gesprochen, denn die ist ja inzwischen ein absolutes Reizthema geworden. Verrückt, oder? Einer der wichtigsten Hebel für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen liegt in dem, was wir täglich auf dem Teller haben, aber es wird zur »moralischen Keule«, diese Bilanzen dazu zu legen. Dabei findet sich doch erst im genauen Hingucken ein Hinweis darauf, was wir eigentlich tun können. Mathe nervt also, wenn es um lieb gewonnene Alltagsrituale geht, insbesondere die Männer, das ist statistisch signifikant. In den sozialen Medien wurde die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wüst beschimpft, als sie dem internationalen Vorbild der Planetary Health Diet des renommierten Lancet Journals folgte und sich zu einer Empfehlung durchrang, den Fleischkonsum deutlich zu verringern.8
Da verwundern die Befunde zahlreicher Umfragen nur wenig, nach denen sich die Deutschen seit der Corona-Krise verstärkt Sorgen darum machen, dass ein rasant zunehmender Egoismus um sich greife. Interessanterweise zeigen die intensiveren und nach sechs gesellschaftlichen Typen geclusterten Befragungen der Organisation More in Common im Jahr 2022, dass gerade die beiden Gesellschaftstypen, die in ihrer Perspektive wütend oder enttäuscht auf die Gesellschaft schauen, den Egoismus »der anderen« am höchsten bewerten. Sie machen auch primär die aktuelle Bundesregierung für Krisen wie die Inflation verantwortlich, die anderen vier Gesellschaftstypen hingegen ziehen verstärkt situative Faktoren oder Akteure wie die russische Regierung in Betracht.9 Dazu kommt bei allen sechs Typen die Sorge, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wegrutsche und damit auch die großen Herausforderungen nicht bewältigbar seien. Im Umkehrschluss gedeiht die pluralistische Ignoranz und damit die Überzeugung, dass nur noch eine Strategie bleibt: wenigstens die eigene Position zu sichern und jede politische Veränderung misstrauisch abzulehnen. Ein klassisch sich immer weiter verstärkender Kreislauf, der Demokratien die Handlungsfähigkeit nimmt und von demokratiefeindlichen Akteur:innen gerne bespielt wird.
Denn gehen wir davon aus, dass jede:r nur an sich denkt und ohnehin niemand mitmachen will, sehen wir eine bedauernswerte Scheinrealität, in der Mehrheitsfloskeln wie »die Leute wollen eben,« »die Bürger:innen akzeptierten nicht,« »die Wirtschaft wird,« »die Politik kann nicht« uns gruppenblind machen. Solche Redeweisen beenden jede differenzierte und informierte Diskussion und klammern auch die Gründe aus, warum es sinnvoll erscheint, den Status quo zu ändern oder warum wir ihn so schwer gehen lassen wollen. Mit der Zeit schrauben dann auch die Veränderungswilligen ihr Engagement wieder zurück: Wenn ich zwar selbst etwas tun würde, die anderen aber nicht mitziehen, habe ich wenig davon: In der Summe kann die gesellschaftliche Veränderung ja doch nicht erreicht werden, um die es mir geht.
Gerade in Zeiten struktureller Krisen wird es aber zu einem handfesten Problem, wenn der Status quo sich als Normalität präsentiert, von der möglichst nicht abzuweichen sei. Denn wie die Bezeichnung »strukturelle Krise« schon sagt, sind es ja Strukturen, also die aktuellen Regeln, Standards und Routinen in der Politik, der Wirtschaft, in der Bildung oder im Sozialsystem, die nicht mehr liefern. Wollen wir also Krisen überwinden, statt sie mit Symptombehandlungen so lange kurzzeitig abzufedern, bis nichts mehr zum Abfedern da ist, dann brauchen wir eine neue Normalität. In der lebt es sich dann auch wieder sicherer. Nur braucht es dafür eben mutige Veränderungen.
Wenn aber Veränderung so viel Mut verlangt, wo sollen wir den hernehmen? Ich denke, dass wir ihn in den Werten finden, mit denen wir leben oder leben wollen, weshalb sie im Zentrum dieses Buches stehen. Zum einen große Zielwerte, die in Gesellschaften immer wieder den Diskurs bestimmen, also wie eine Art Nordstern funktionieren, wenn es um die Frage nach dem Wesentlichen und Wichtigen geht. Zum anderen aber die vielen kleinen Wertentscheidungen, die wir täglich treffen und mit denen wir dazu beitragen, ob gesellschaftliche Zielwerte erreicht werden können oder nicht. Dabei zählen nicht nur Geldwerte, die unsere Debatte über das prägen, was wir (uns) »leisten« können, sondern eben auch soziale Werte wie das Vertrauen, dass die anderen mitziehen. Und auch die Umgangsformen, mit denen wir auf Krisen reagieren, haben einen großen Effekt darauf, ob wir »die anderen« als Kooperationspartner:innen oder als Bedrohung wahrnehmen. Aber es geht mir nicht nur um Werte, sondern auch um die Wirkung unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Instrumente. Sie beginnt mit einem sorgfältigen Hinschauen, mit welchen Bewertungen diese Instrumente unsere Entscheidungen beeinflussen, welche davon zielführend erscheinen, wo sie Freiheiten einschränken und wo noch Potenziale für ein Andersmachen zu heben sind. Dann öffnen sich neue Möglichkeitsräume und auch neue Allianzen, mit denen Zukunftsgestaltung wieder versöhnlicher werden kann. Hier liegt aus meiner Sicht ein wichtiger Schlüssel, um aus der Hemmspirale in die Überholspur zu finden. Kommen wir über diese wesentlichen Dinge ins Gespräch, können wir dem Effekt der pluralistischen Ignoranz die Stirn bieten und pluralistische Relevanz entfachen, also den jeweils nächstmöglichen Schritt ins Auge fassen und in Bewegung kommen.
Denn hören wir den Psycholog:innen und Sozialwissenschaftler:innen zu, dann entsteht erst durch sorgfältiges Hinschauen und lösungsorientiertes Handeln genau das, was uns in Krisenzeiten am besten hilft: Kohärenzerfahrung und Resilienz. Das sind die Schlagworte, mit denen eine effektive Anpassungsfähigkeit an sich stark verändernde Lebenssituationen beschrieben wird. Spoiler: Wütend Probleme und Personen anzuschreien, ist nicht Teil des Rezeptes. Stattdessen hilft gemeinsame Sehschärfe, aus der drei Wissensarten entstehen. Zunächst geht es um einen guten Grad an Verständniswissen. Klingt trocken, hilft aber, Veränderungen einzuordnen. Also beispielsweise einzuschätzen, ob sie vorübergehend oder dauerhaft sind und was dies für die eigene Situation bedeutet. Hier können wir uns in freien Gesellschaften glücklich schätzen, dass es einen ganzen Wissenschaftsapparat gibt, der Zusammenhänge professionell erforscht und vermittelt. Umgekehrt sollten alle, die diesen Apparat mit Leben füllen, sich ihrer Rolle auch bewusst bleiben und nicht in selbstreferentiellen Publikationslawinen versinken, deren Inhalte kein Mensch außerhalb der Zunft versteht oder als relevant empfindet. Zugang zu qualitativ abgesichertem Wissen einfach und barrierefrei bereitzustellen, ist eine zentrale Aufgabe für liberale Demokratien und nicht zuletzt deshalb unter Beschuss durch Kräfte, die sie schwächen wollen. Haben wir ausreichend Verständniswissen, kann darauf Handlungswissen aufsetzen, mit dem wir Möglichkeiten herausfinden, wie sich die Situation verändern lässt und welche Ressourcen dafür hilfreich sind, seien es soziale Unterstützung, finanzielle Mittel oder zusätzliche Kompetenzen. Kohärenzerfahrung (also ein Gefühl der Stimmigkeit) oder Resilienz wird auf einer dritten Ebene durch Sinnerfahrung unterfüttert, also dem Eindruck, dass es sich lohnt, das eigene Verhalten zu ändern. Raus aus der Ohnmacht, hin zur Selbstwirksamkeit. Dass in diesem Wort vor allem auch ein Tun, nämlich wirken steckt, verdeutlicht die eindeutige Botschaft der Forschung: Der Schlüssel zur erfolgreichen Krisenüberwindung liegt in aller Regel darin, sich selbst zu verändern. Zumindest ein Stück weit oder zumindest so lange, bis eine neue Alltagspraxis wieder Stabilität bieten kann. Gesellschaftlich kommt das Pluralistische dazu, denn — Sie ahnen es schon — hier wird die Sinnerfahrung von der Einschätzung »der anderen« beeinflusst und ob auch sie bereit zu Veränderungen sind. Denn bei aller intrinsischen Motivation kommt eine neue Normalität erst durch Kooperation auf, das zeigt sich schon bei so bescheidenen Beispielen wie einer neuen Versuchsanordnung für Gourmetküche am Anderstag. Deshalb ist es so wichtig, wie wir sozialen Herdentiere uns die Welt erzählen, Herausforderungen beschreiben und die damit verbundenen Ziele und Ergebnisse vermessen. Nicht umsonst hat der Begriff des Narrativs so eine Konjunktur. »Nur was erzählbar, vermittelbar, argumentierbar ist, kann realisiert werden, kann Vertrauen stiften und eine überzeugende Strahlkraft entwickeln«,10fasst der Kommunikationsexperte Bernhard Fischer-Appelt zusammen.
Und genau das unterscheidet Menschen von anderen Lebewesen auf dieser Welt: Wir erzählen Geschichten, in denen unser Selbstwert, aber auch »die anderen« eine wichtige Rolle spielen. Wir erzählen sie so lang und so überzeugend, dass wir sie in Standards, Routinen und Regeln festhalten, mit denen wir unsere Kooperation organisieren. Wir definieren Kennzahlen, mit denen wir aushandeln und darstellen, welche Werte und Wirkungsweisen wie wichtig sind. Diese Zahlen und Erzählungen begegnen uns dann wiederum als die gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer wir unsere freien Alltagsentscheidungen vollziehen: Wir unterhalten Kindergärten mit bestimmten Betreuungszeiten, zahlen Steuern in unterschiedlichen Höhen, leben in Städten mit mehr oder weniger Grünflächen und Parkplätzen und werden in der Auswahl von Büchern, die wir lesen, von Verkaufsorten und Covern begleitet. Es gibt immer wieder Phasen, in denen das relativ krisen- und konfliktarm funktioniert und die Regeln oder Abmachungen aus der Vergangenheit die Entscheidungen der Gegenwart gut orientieren, also die vielen kleinen freien Entscheidungen