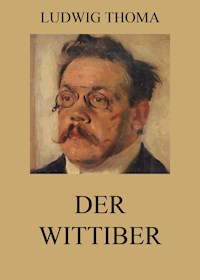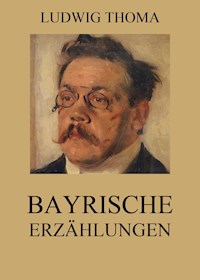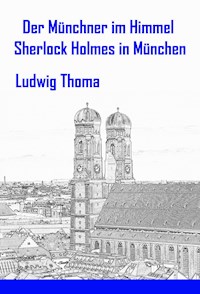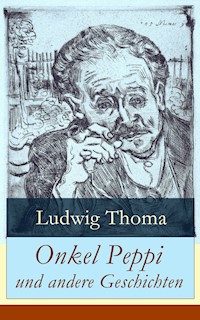
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Onkel Peppi und andere Geschichten" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ludwig Thoma (1867-1921) war ein bayerischer Schriftsteller, der durch seine ebenso realistischen wie satirischen Schilderungen des bayerischen Alltags und der politischen Geschehnisse seiner Zeit populär wurde. Ludwig Thoma bemühte sich in seinen Werken darum, die herrschende Scheinmoral bloßzustellen. Ebenso prangerte er kompromisslos Schwäche und Dummheit des spießbürgerlichen Milieus und das chauvinistische und großmäulige Preußentum mit seinem Pickelhauben-Militarismus an. Er stieß sich auch am Provinzialismus und der klerikalen Politik seiner Zeit im Königreich Bayern, was sich beispielhaft in Jozef Filsers Briefwexel niederschlägt. Als brillant werden die mit Humor und Satire gewürzten Erzählungen oder Einakter aus dem bäuerlichen und kleinstädtischen Lebenskreis in Oberbayern angesehen. Die unsentimentalen Schilderungen agrarischen Lebens in den Romanen sind wohl deshalb besonders lebensnah gelungen, weil Thoma aus seiner Rechtsanwaltstätigkeit eine Fülle praxisnaher Einblicke in die Lebensumstände auf dem Lande gewinnen konnte. Eines seiner populärsten Werke, die Lausbubengeschichten, geht im Wesentlichen auf Erlebnisse während seiner Schulzeit und die in Prien am Chiemsee verbrachten Ferien zurück. Inhalt: Der heilige Hies Der Postsekretär im Himmel Das Volkslied Kabale und Liebe Solide Köpfe Anfänge Der Hofbauer Der Klient Die Richter Der Vertrag Assessor Karlchen Die Eigentumsfanatiker Der Wilderer Die Dachserin Die Probier Monika Der Heiratsvermittler Der Truderer Onkel Peppi
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Onkel Peppi und andere Geschichten
Ein Klassiker der bayerischen Literatur gewürzt mit Humor und Satire
Inhaltsverzeichnis
Der heilige Hies
Merkwürdige Schicksale des hochwürdigen Herrn Mathias Fottner von Ainhofen, Studiosi, Soldaten und späterhin Pfarrherrn zu Rappertswyl
(1904)
Wer sechs Roß im Stall stehen hat, ist ein Bauer und sitzt im Wirtshaus beim Bürgermeister und beim Ausschuß. Wenn er das Maul auftut und über die schlechten Zeiten und über die Steuern schimpft, gibt man acht auf ihn, und die kleinen Leute erzählen noch am andern Tag, daß gestern der Harlanger, oder wie er sonst heißt, einmal richtig seine Meinung gesagt hat.
Wer fünf Roß und weniger hat, ist ein Gütler und schimpft auch. Aber es hat nicht das Gewicht und ist nicht wert, daß man es weiter gibt.
Wer aber gar kein Roß hat und seinen Pflug von ein paar magern Ochsen ziehen läßt, der ist ein Häusler und muß das Maul halten. Im Wirtshaus, in der Gemeindeversammlung und überall. Seine Meinung ist für gar nichts, und kein richtiger Bauernmensch paßt auf den Fretter auf.
Der Besitzer vom Schuhwastlanwesen, Haus Nummer acht in Ainhofen, mit Namens Georg Fottner, war ein Häusler. Und ein recht armseliger noch dazu. Ochsen hat er einen gehabt, Kühe recht wenig, aber einen Haufen Kinder. Vier Madeln und drei Buben; macht sieben nach Adam Riese, und wenn das Essen kaum für die zwei Alten langte, brauchte es gut rechnen und dividieren, daß die Jungen auch noch was kriegten.
Aber auf dem Lande ist noch keiner verhungert, und auch beim Schuhwastl brachten sie ihre Kinder durch. War eines nur erst acht oder neun Jahre alt, dann konnte es schon ein wenig was verdienen, und vor aus nach der Schulzeit hatte es keine Gefahr mehr.
Die Madeln gingen frühzeitig in Dienst, von den Buben blieb der ältere, der Schorschl, daheim, der zweite, Vitus mit Namen, kam zum Schullerbauern, und der dritte – von dem will ich euch erzählen.
Mathias hat er geheißen, und kam lange nach dem sechsten Kinde auf die Welt, und recht unverhofft.
Der Fottner war damals schon fünfzig Jahre alt, und sein Weib stand in den Vierzigern. Da hätte es nach der Meinung aller Bekannten recht wohl unterbleiben können, daß sie zu den sechsen noch ein siebentes Kind kriegten.
Dieses war in den ersten Lebensjahren schwächlich und kleber beisammen; seine Eltern meinten oft, es hätte den Anschein, als sei es nicht gesund und würde bald ein Englein im Himmel. Das geschah aber nicht; der Mathias gedieh, wurde späterhin Pfarrer und wog in der Blüte seines Lebens dritthalbe Zentner, und kein Pfund weniger.
Zum geistlichen Beruf kam er unversehens, und durch nichts anderes, als die Gewissensbisse des oberen Brücklbauern von Ainhofen.
Der hatte viel Geld, keine Kinder, und eine schwere Sünde auf dem Herzen, die ihn bedrückte. Vor Jahren hatte er in einem Prozeß mit seinem Nachbarn falsch geschworen und dadurch gewonnen.
Er machte sich zuerst wenig daraus, denn er hatte vorsichtigerweise beim Schwören die Finger der linken Hand nach unten gehalten. Die ehrwürdige Tradition sagt, daß auf diese Art der Schwur von oben nach unten durch den Körper hindurch in den Boden fährt und als ein kalter Eid keinen Schaden tun kann.
Aber der Brücklbauer war ein zaghafter Mensch, und wie er älter wurde, sinnierte er viel über die Geschichte nach und beschloß, den Schaden gut zu machen. Das heißt, nicht den Schaden, den der Nachbar erlitten hatte, sondern die Nachteile, welche seine eigene unsterbliche Seele nehmen konnte.
Weil man nichts Gewisses weiß, und weil vielleicht der allmächtige Richter über den kalten Eid anders dachte und sich nicht an die Ainhofener Tradition hielt.
Also überlegte er, was und wieviel er geben müsse, damit die Rechnung stimme und seine Schlechtigkeit mit seinem Verdienst gleich aufgehe.
Das war nicht einfach und leicht, denn niemand konnte ihm sagen, mit so und soviel Messen bist du quitt, und es war möglich, daß er sich bloß um eine verzählte und alles verlor.
Der Brücklbauer war bei seinen irdischen Geschäften nie dumm gewesen und hatte oft zu wenig, aber nie zuviel hergegeben.
Bei diesem himmlischen Handel aber dachte er, das Mehr sei besser, und da er schon öfter in der Zeitung gelesen hatte, daß nichts eine bessere Anwartschaft auf das Jenseits gäbe, als Mithilfe zur Abstellung des Priestermangels, so beschloß er, auf eigene Kosten und ganz allein einen Buben auf das geistliche Fach studieren zu lassen.
Seine Wahl fiel auf Mathias Fottner, und das reute ihn noch oft.
Er hätte es sich besser überlegen sollen, wie es mit den geistigen Gaben des Schuhwastlbuben beschaffen war.
Und er hätte sich viel Verdruß und Angst erspart, wenn er sich Zeit gelassen und einen anderen ausgesucht hätte.
Es pressierte ihm zu stark, und weil der Lehrer nicht dagegen redete und der alte Fottner gleich mit Freuden einschlug, war es ihm recht.
Er nahm sich wohl ein Beispiel ab am Ainhofer Pfarrer und meinte, was der könne, müßt nicht schwer zum Lernen sein. Nun war der Mathias nicht geradenwegs dumm; aber er hatte keinen guten Kopf zum Lernen, und seine Freude daran war auch nicht unmäßig.
Als man ihm sagte, daß er geistlich werden sollte, war er einverstanden damit, denn er begriff zu allererste daß er alsdann mehr essen und weniger arbeiten könne.
So kam er also nach Freising in die Lateinschule. Die ersten drei Jahre ging es. Nicht glänzend, aber so, daß er sein Zeugnis im Pfarrhof herzeigen konnte, wenn er in der Vakanz heim kam.
Und wenn der Herr Pfarrer las, daß der Schüler Mathias Fottner bei mäßigem Talente und Fleiße genügende Fortschritte gemacht habe, dann sagte er jedesmal mit seiner fetten Stimme: magnos progressus fecisti, discipule!
Der Mathias verstand es nicht; sein Vater, welcher daneben stand, auch nicht, aber danach fragte der Pfarrer nicht.
Er sagte es nur wegen der Reputation, und damit gewisse Zweifler sahen, daß er ein gelehrter Herr sei.
Wenn man in Ainhofen darüber redete und sich erzählte, daß der Fottner Hies schon lateinisch könne, wie ein Alter, dann freute sich niemand stärker, wie der Brücklbauer.
Das ist begreiflich. Denn er hatte auf die Gelehrsamkeit des Schuhwastlbuben spekuliert, und beobachtete dieselbe mit gespannter Aufmerksamkeit, wie eine andre Sache, in die er sein Geld hineinsteckte.
Er freute sich also im allgemeinen, und ganz besonders, als Hies im dritten Jahre mit einer Brille auf der Nase heimkam und schier ein geistliches Ansehen hatte.
Das gefiel ihm schon ausnehmend, und er fragte den Lehrer, ob er in Anbetracht dieses Umstandes, und weil der Hies doch lateinisch könne – mehr, als man für das Meßlesen braucht – ob es da nicht möglich sei, daß die Zeit abgekürzt werde.
Als ihm der Lehrer sagte, solche Ausnahmen könnten nicht gemacht werden, fand er es begreiflich; aber wie der Schulmeister versuchte, ihm die Gründe zu erklären, daß ein Pfarrer nicht bloß das Meßlesen auswendig lernen, sondern noch mehr können müsse, wegen der allgemeinen Bildung und überhaupt, da schüttelte der Brücklbauer den Kopf und lachte ein wenig. So dumm war er nicht, daß er das glaubte. Zu was tät einer mehr lernen müssen, als was er braucht? Ha?
Aber die Sache war halt so, daß die Professer in Freising den Hies recht lang behalten wollten, weil sie Geld damit verdienten.
In diesem Glauben wurde er sehr bestärkt, als der Schüler Mathias Fottner in der vierten Lateinklasse sitzen bleiben mußte. Wegen dem Griechischen. Weil er das Griechische nicht lernen konnte.
Also hat man es deutlich gesehen, denn jetzt fragt der Brücklbauer einen Menschen, zu was braucht ein Pfarrer griechisch können, wenn Amt und Meß auf lateinisch gehalten werden?
Das mußten schon ganz feine sein, die Herren in Freising, recht abdrehte Spitzbuben.
Er hatte einen mentischen Zorn auf sie, denn dem Schuhwastlbuben konnte er keine Schuld geben.
Der Hies sagte zu ihm, er hätte es nie anders gedacht und gewußt, als daß er auf das studieren müsse, was der Pfarrer von Ainhofen könne. Den habe er aber seiner Lebtag nie was Griechisches sagen hören, und deswegen sei er auf so was nicht gefaßt gewesen.
Dagegen ließ sich nichts einwenden; auf der Seite vom Hies war der Handel richtig und in Ordnung. Die Lumperei steckte bei den andern, in Freising drinnen. Der Brücklbauer ging zum Pfarrer und beschwerte sich.
Aber da hilft einer dem andern, und der Bauer ist allemal der Ausgeschmierte. Der Pfarrer lachte zuerst und sagte, das sei einmal so Gesetz, und er habe es auch lernen müssen; wie aber der Brücklbauer daran zweifelte und meinte, wenn das wahr sei, dann sollte der Pfarrer einmal auf griechisch zelebrieren, er zahle, was es koste, da wurde der Hochwürdige grob und hieß den Brücklbauern einen ausgeschämten Mistlackel. Weil er um eine richtige Antwort verlegen war, verstehst?
Jetzt lag die Sache so, daß der Brücklbauer überlegen mußte, ob er es noch einmal mit dem Hies probieren oder einen andern nach Freising schicken sollte, der sich von vornherein auf das Griechische einließ.
Wenn er das letztere tat, hernach dauerte es wieder um drei.Jahre länger, und das Geld für den Schuhwastlbuben war völlig verloren. Und außerdem konnte kein Mensch wissen, ob sie in Freising nicht wieder was andres erfinden würden, wenn sie den neuen Studenten mit dem Griechischen nicht fangen könnten. Deswegen entschloß er sich, den Hies die Sache noch einmal probieren zu lassen, und ermahnte ihn, daß er sich halt recht einspreitzen sollte.
Das tat der Fottner zwar nicht, denn er war kein Freund von der mühsamen Kopfarbeit, aber sein Professor war selber ein Geistlicher und wußte, daß die Diener Gottes auch ohne Gelehrsamkeit amtieren können. Deswegen wollte er nicht aus lauter Pflichteifer dem Hies Schaden zufügen und ließ ihn das zweite Jahr mit christlicher Barmherzigkeit vorrücken.
Der Hies kam als Schüler der fünften Lateinklasse heim und sah aus wie ein richtiger Student.
Er zählte bereits siebzehn Jahre und war körperlich sehr entwickelt.
Den Kooperator von Aufhausen überragte er um Haupteslänge, und alle seine Gliedmaßen waren grob und ungeschlacht. Auch verlor er zu der selbigen Zeit seine Knabenstimme und nahm einen rauhen Baß an.
Wenn er mit seinen Studienfreunden, dem Josef Scharl von Pettenbach und dem Martin Zollbrecht von Glonn zusammenkam, dann zeigte es sich, daß er weitaus am meisten trinken konnte und im Bierkomment schon gute Kenntnisse hatte.
Er besaß ein lebhaftes Standesgefühl und sang mit seinen Kommilitonen die Studentenlieder, als »Vom hoh’n Olymp herab ward uns die Freude« oder »Drum Brüderchen er-her-go biba-ha-mus!« so kraftvoll und laut, daß der Brücklbauer am Nebentische über die studentische Bildung des Schuhwastlbuben erstaunte.
Und als der Hies seinen Besuch im Pfarrhofe machte, bat er nicht wie in früheren Jahren die Köchin, sie möchte ihn anmelden, sondern er überreichte ihr eine Visitenkarte, auf welcher mit säuberlichen Buchstaben stand:
Mathias Fottner stud. lit. et art.
Heißt studiosus litterarum et artium, ein Beflissener der schönen Wissenschaften und Künste.
Der alte Fottner war stolz auf seinen Sohn, auf dem schon jetzt der Abglanz seiner künftigen Würde ruhte, der vom Pfarrer zum Essen eingeladen wurde, der mit dem Kooperator spazieren ging und mit dem Lehrer und dem Stationskommandanten tarokte.
Und der Brücklbauer war es auch zufrieden, wenn er schon hier und da den Aufwand des Herrn Studenten etwas groß fand. Aber er sagte nichts, denn er fürchtete, daß er zuletzt noch auslassen könnte, wenn er ihm gar zu wenig Hafer vorschütten würde.
So verlebte Hies eine lustige Vakanz und zog neu gestärkt im Oktober nach Freising.
Leider ging er einer trüben Zeit entgegen. Der Ordinarius der fünften Klasse war ein unangenehmer Mensch: streng, und recht bissig und spöttisch dazu.
Wie er das erstemal den himmellangen Bauernmenschen sah, der sich in den Schulbänken wunderlich genug ausnahm, lachte er und fragte ihn, ob er auch am Geiste so hoch über seine Mitschüler hinausrage. Daß dies nicht der Fall war, konnte kein Geheimnis bleiben, und dann nahmen die Spötteleien kein Ende. Anfangs gab sich der Professor noch Mühe, Funken aus dem Stein zu schlagen; wie er es aber nicht fertig brachte, gab er die Hoffnung bald genug auf.
Dem Mathias Fottner war es ganz recht, als man seine Meinung über den gallischen Krieg des Gajus Julius Cäsar nicht mehr einholte und die griechischen Zeitwörter ohne seine Mitwirkung konjugierte.
Er lachte gutmütig, wenn in seinen Schulaufgaben jedes Wort rot unterstrichen war, und er wunderte sich über den Ehrgeiz der kleinen Burschen vor und neben ihm, die miteinander stritten, ob etwas falsch oder recht sei.
Aber freilich, bei einer solchen Gesinnung war das Ende leicht zu erraten, und im August stand der Brücklbauer vor der nämlichen Wahl, wie zwei Jahre vorher, ob er sein Vertrauen auf den Schuhwastlbuben aufrecht halten sollte oder nicht.
Das heißt, er hatte eigentlich die Wahl nicht mehr, denn jetzt, nach sechs Jahren, konnte er nicht mehr gut ein neues Experiment mit einem anderen machen.
Also tröstete er sich mit dem Gedanken, daß ein gutes Roß zweimal zieht, und biß in den sauren Apfel.
Das Gesicht hat er dabei wohl verzogen, und seine Freude am Hies war um ein schönes Stück kleiner geworden; es regten sich arge Zweifel in seinem Herzen, ob aus dem langen Goliath ein richtiger Pfarrer werden könnte.
Seine üble Laune war aber nicht ansteckend, wenigstens nicht für den Herrn Mathias Fottner.
Dieser war während der Vakanz ein guter Gast in allen Wirtshäusern auf drei Stunden im Umkreis; und wenn ihm auswärts das Geld ausging, dann bedachte er, daß neben jeder Kirche ein Pfarrhof steht, ging hinein und bat um ein Viatikum, wie es ihm zukam als studioso litterarum, einem Beflissenen der schönen Künste und Wissenschaften.
Dabei traf er wohl hier und da einen jungen Kooperator, Neomysten oder Alumnus, welcher mit ihm Freisinger Erinnerungen austauschte und nach der zehnten Halben Bier in die schönen Lieder einstimmte: »Vom hoh’n Olymp herab ward uns die Freude« und«Brüderchen, er-her-go bi-ba-hamus!«
Als er im Oktober wiederum in seiner Bildungsstätte eintraf, war sein Kopf um ein gutes dicker, sein Baß erheblich tiefer, aber sonst blieb alles beim alten.
Den Gajus Julius Cäsar hatte er in der Zwischenzeit nicht lieben und die griechischen Zeitwörter nicht schätzen lernen; sein Professor war so zuwider wie früher, und das Schlußresultat war nach Ablauf des Jahres wiederum, daß der Hies nicht aufsteigen durfte.
Zugleich wurde ihm eröffnet, daß er das zulässige Alter überschritten habe und nicht noch einmal kommen dürfe. Jetzt war Dreck Trumpf.
Jetzt hatten alle das Nachsehen; der alte Fottner, welcher so stolz war, der Wirt, welcher sich schon auf die Primiz gefreut hatte, und die katholische Kirche, der diese stattliche Säule verloren ging.
Aber am meisten der obere Brücklbauer von Ainhofen, dem das ganze Geschäft mit unserm Herrgott verdorben war. Kreuzteufel, da sollst nicht wütig werden und fluchen!
Sieben lange Jahre hatte er brav zahlen müssen, nichts wie zahlen, und nicht wenig; das dürft ihr glauben. Man sah es dem Schuhwastlbuben von weitem an, daß er in keinem schlechten Futter gestanden hatte. Und alles war umsonst; auf dem himmlischen Konto des Brücklbauern stand immer noch der kalte Eid, aber kein bissl was auf der Gegenrechnung.
Denn das war doch nicht denkbar, daß unser Herrgott die studentische Bildung des Hies sich als Bene aufrechnen ließ.
So eine miserablige, ausgemachte Lumperei muß noch nie dagewesen sein, solange die Welt steht!
Diesmal ging die Wut des Brücklbauern nicht bloß gegen die Freisinger Professoren; der Pfarrer hatte ihn aufgeklärt, daß es beim Hies überall gefehlt habe, ausgenommen das Taroken und Biertrinken. Der Haderlump, der nichtsnutzige!
Jetzt lief er in Ainhofen herum, mit der Brillen auf der Nasen, und einem Bauch, der nicht schlecht war. Er sah aus, wie noch mal ein richtiger Kooperator, der schon morgen das Meßlesen anfängt. Derweil war er nichts, absolut gar nichts.
Der einzige, der bei diesen Schicksalsschlägen ruhig blieb, war der ehemalige stud. lit. Mathias Fottner.
Hätte er länger und mehr studiert gehabt, dann möchte ich glauben, daß er diese Seelenruhe von den sieben Weisen des Altertums gelernt habe.
So muß ich annehmen, daß sie ihm angeboren war.
Er hatte sich wohl keinen klassischen Bildungsschatz für sein künftiges Leben erworben, aber er rechnete so, daß ihm für alle Fälle sieben fette Jahre beschieden waren, die ihm keiner mehr wegnehmen konnte. Auch der Brücklbauer nicht mit seiner Wut.
Zu was soll der Mensch sich mit Gedanken an die Zukunft abmartern? Die Vergangenheit ist auch was wert, noch dazu so eine lustige, wie die im heimlichen Kneipzimmer des Sternbräu gewesen war! Wo er mit seinen Kommilitonen beisammen saß und nach und nach die Fertigkeit erlangt hatte, eine Maß Bier ohne Absetzen auszutrinken.
Wo er alle feinen Lieder des Kommersbuches gesungen hatte, das«Crambambuli« und das »Bier la la«, und nicht zu vergessen das ewig schöne »Drum Brüderchen er-her-go bi-bahamus!«
Solche Erinnerungen bilden auch einen Schatz für das Leben; und wenn es die luftgeselchten Bauernrammel in Ainhofen auch nicht verstehen, lustig war es doch!
Und gar so schlecht konnte auch die Zukunft nicht werden.
Vorerst entschloß er sich, zum Militär zu gehen; seine drei Jahre mußte er doch abdienen, und da war es besser, wenn er sich gleich jetzt meldete. Auf diese Weise ging er dem Brücklbauer aus dem Weg und hatte seine Ruhe. Er stellte sich beim Leibregiment und wurde angenommen.
Und wenn der Brücklbauer wollte, konnte er jetzt in München vom Hofgarten aus den Flügelmann der zweiten Kompagnie mit Stolz betrachten.
Der Kopf, der so dick und rot aus dem Uniformkragen ragte, der war auf seine Kosten herausgefressen, und wenn er auch gut anzusehen gewesen wäre über dem schwarzen Talar mit der Tonsur hinten drauf, so mußte doch jeder gerechte Mensch zugeben, daß er auch so nicht schlecht aussah, über den weißen Litzen und der blitzblauen Uniform.
Freilich, gottgefällig war der jetzige Beruf des Schuhwastlbuben nicht; aber ihm selber gefiel er. Die Kost war nicht schlecht, und die Einjährigen zahlten dem langen Kerl gern eine Maß Bier, wenn er sich als Kommilitone vorstellte und sich rühmte, daß er nicht der Schlechteste gewesen sei, wenn die Herren confratres eine kleine Saufmette hielten.
Und weil er sich auch bei den Leibesübungen anstellig zeigte, errang er die Gunst des Herrn Hauptmanns und wurde schon nach acht Monaten wohlbestallter Unteroffizier.
Das wäre nun alles recht und schön gewesen, und die ganze Menschheit, eingeschlossen die zu Ainhofen, hätte mit dem Lebensschicksale des Mathias Fottner zufrieden sein können.
Aber im Herzen des Brücklbauern saß ein Wurm.
Der fraß an ihm und ließ ihm keine Ruhe bei Tag und Nacht.
Wenn andern Menschen alle Aussichten verloren gehen, dann binden sie seufzend einen schweren Stein an ihre Hoffnungen und versenken sie in das Meer der Vergessenheit.
Ein zählebiger Bauer handelt nicht so; der überlegt sich noch immer, ob er nicht einen Teil zu retten vermag, wenn er das Ganze nicht haben kann.
Und wie sich die ärgste Wut des Brücklbauern gelegt hatte, fing er wieder an zu sinnieren und Pläne zu schmieden.
Weil es sich aber um eine Sache der Gelehrsamkeit handelte, war er sich selber nicht gescheit genug; er beschloß deswegen, gleich in die rechte Schmiede zu gehen und bei einem Pfarrer um Rat zu fragen.
Dem Ainhofener traute er nicht; von damals her, wo er ihm wegen dem Griechischen so aufgelegte Lügen erzählt hatte.
Aber in Sünzhausen, vier Wegstunden entfernt, saß einer, der hochwürdige Herr Josef Schuhbauer, zu dem man Vertrauen fassen konnte.
Das war ein ganz feiner; ein Abgeordneter im Landtag, dreimal so katholisch wie die anderen Seelenhirten und ein hitziger Streithammel, der die Liberalen auf dem Kraut fraß und den Ministern die gröbsten Tänze aufspielte, bis er endlich die einträglichste Pfarrei im ganzen Bistum erhielt. Zu dem ging er, denn der wußte ganz gewiß ein Mittel dafür, daß ein so robuster Lackl, wie Mathias Fottner war, der Kirche nicht verloren ging.
Also fragte er ihn, ob man nicht das Gymnasium Freising mit einem ordentlichen Stück Geld abschmieren könnte, oder den Bischof, oder sonst wen.
»Ein verdienstliches Werk ist es immer«, sagte der hochwürdige Herr Schuhbauer, »wenn man sein Geld für katholische Zwecke anlegt, aber in dem Fall hilft es nicht viel, denn das Reifezeugnis für die Universität kriegt man bloß durch eine Prüfung. Wenigstens so lang die weltliche Macht – leider Gottes – in die Schulbildung noch was drein zu reden hat. Aber was anderes geht, Brücklbauer«, sagte er, »wenn du den Fottner Hies durchaus geistlich haben willst. Da ist in Rom ein Collegium Germanicum, in welchem deutsche Jünglinge ausgebildet werden von den Jesuiten. Die nehmen es sehr genau mit dem Glauben, aber wegen der Bildung, da drücken sie ein Aug zu, im Interesse des Glaubens.«
»Hm«, meinte der Brücklbauer, »ob aber die Messen, die wo so einer lest, der wo aus Rom kommt, die nämliche Kraft haben?«
»Ehender noch eine größere, wenn das überhaupts möglich wär«, sagte der Hochwürdige, »denn, Brücklbauer, du darfst nicht vergessen, daß die Schul in Rom ganz in der Näh vom heiligen Vater ist.«
»Ob sie aber da auch das Griechische und solchene Schwindelsachen verlangen?«
»Nur scheinshalber. Durchfallen tut deswegen keiner, wenn er fest im Glauben ist und seine Sach in Richtigkeit und Ordnung zahlt. Aber, Brücklbauer, bei uns in Deutschland kann der Mathias Fottner nicht Pfarrer werden.«
»Ja, warum nachher net?«
»Weil die Malefizpreußen ein Gesetz dagegen gemacht haben.«
»Dös san aber scho wirkli schlechte Menschen.«
»Da hast recht; noch viel schlechter, als du glaubst. Der Fottner würde halt wahrscheinlich ein Missionar werden müssen. Das müßte dich mit Freude erfüllen, denn das ist schier noch verdienstlicher, als wenn er bei uns Pfarrer wird.«
»Is dös aber aa g’wiß? Net, daß i no mal de großen Ausgaben hätt’, und es waar bloß a halbete Sach.«
»Es ist gewiß und unbestreitbar, denn immer waren die Glaubensboten am höchsten geehrt.«
Der Brücklbauer war glücklich und ging kreuzfidel von Sünzhausen heim.
Jetzt mußte noch alles recht werden, und sein Plan ging ihm hinaus.
Die sollten schauen in Freising, wenn der Schuhwastlhies trotz alledem noch ein geistlicher Herr wurde, oder gleich gar ein Glaubensbote, der die Hindianer bekehrt, und dem seine Messen noch mehr gelten.
Und die Ainhofener, die ihn jetzt alleweil im Wirtshaus fragten, was sein lateinischer Unteroffizier mache, die sollten die Augen noch aufreißen.
Gleich am nächsten Tag fuhr er nach München. Keine Freude ist vollkommen, und die Palme des Sieges ist niemalen mit leichter Mühe zu erringen.
Das erfuhr der Brücklbauer, als er dem königlichen Unteroffizier Mathias Fottner seinen Plan mitteilte.
Dieser erklärte rundweg, daß er weder studieren noch zu den Hindianern gehen wolle.
Als ihm der Alte vorstellte, daß er ganz wenig studieren müsse, meinte er, gar nichts sei noch besser, und als der Brücklbauer ihm hoch und teuer versicherte, daß er ein Heiliger würde, genau so wie die gipsernen Manner in der Ainhofener Kirche, gab er zur Antwort, daß ihm das ganz wurscht sei.
Es half alles nichts. Der Brücklbauer mußte abziehen, unverrichteter Dinge und mit seinem alten, beißenden Wurm im Herzen. Trotzdem, er gab die Hoffnung nicht auf, er steckte sich hinter den alten Fottner und versprach ihm die schönsten Sachen für seinen Hies.
Lange war es umsonst, aber nach etwa zwei Jahren griff der Himmel selber ein und schuf eine günstige Wendung.
Der Hauptmann der zweiten Kompagnie des königlichen Infanterie-Leibregiments wurde Major. An seine Stelle trat ein giftiger Herr, welcher Mannschaft und Unteroffiziere gleichermaßen schuhriegelte und dadurch ein Werkzeug der Kirche wurde.
Denn Mathlas Fottner entschloß sich, als er zum zweiten Male mit Mittelarrest bestraft wurde, fernerhin nicht länger zu dienen und seine Absichten auf Kapitulation gänzlich aufzugeben. Gerade in dieser Zeit erhielt er einen Brief von seinem Vater, welcher folgendermaßen lautete:
Lieber Hias!
Nach langem warden will ich Dir entlich Schreiben, das gesting der Brigglbauer wider da Gewest is und indem Du ein Heulicher werden kunzt und doch gar nichts zun lernen brauchsd als wiedasd nach Rom gest. lieber Hias, thus Dir gnau überlegen wanst Du Bfarrer wurzt bei die Hindianer aber die brims. die Brimins ist beim Würth und intem der Brigglbauer sagt, er zalt Dir noch egsdra dreitausad March wannst firti bist. Lieber Hias, thus Dir fein gnau überlegen, was fir eine freute es War fir Deinen Vater. Düssen Brief habe ich Nicht geschriben. Die Zenzi hat es geschrieben. Ich muß mein schreiben schließen, denn das Licht hat nicht mehr gebrand. Under viele Grüße verbleibe ich Dein Dich liebender Vater. Gute Nacht! Schlaf wohl und Träume Süß. Auf wiedersehn macht Freude. Schreibe mihr sofort den ich kanz nicht mehr erwarten auf Andwort.«
Der Brief tat seine Wirkung. Der Unteroffizier Fottner bedachte, daß es bei den geistlichen Herren in Rom nicht schlecht zu leben sei, jedenfalls besser, als in der Kaserne unter einem Hauptmann, der mit dem Arrest so freigebig war. Also sagte er zu, und wie nach dem Manöver seine Dienstzeit abgelaufen war, ging er nach Ainhofen und ließ sich vom Brücklbauern das Versprechen wegen der dreitausend Mark schriftlich geben.
Als diese Sache in Ordnung war, und er noch dazu ein schönes Reisegeld bekommen hatte, fuhr er nach Rom.
Sieben Jahre sah man ihn nicht wieder, sieben Jahre lebte er als Fottnerus Ainhofenensis im Germanischen Kolleg unter den milden Jesuiten, welche an diesem viereckigen Klotz aus Leibeskräften feilten und schliffen. Eine schöne Politur bekam er nicht, aber die ehrwürdigen Väter dachten, für die Wilden langt es schon, und sagten ihm, daß die Kraft des Glaubens die Wissenschaft recht wohl ersetzen könne.
Mathias Fottnerus dachte auch was und sagte nichts.
Sieben Jahre saß der alte Schuhwastl in seinem Hause Nummer acht zu Ainhofen und freute sich über die künftige Heiligkeit seines Sohnes; sieben Jahre rechnete der Wirt im vorhinein aus, wieviele Hektoliter Bier bei einer schönen Primiz getrunken werden, und sieben Jahre lang ging der Brücklbauer alle Monate zum Expeditor nach Pettenbach und ließ eine Postanweisung abgehen nach Roma, Collegio Germanico.
Die Leute wurden alt und grau; bald war eine Hochzeit und bald ein Begräbnis; der Haberlschneider brannte ab, und der Kloiber kam auf die Gant.
Die kleinen Ereignisse mehrten sich in Ainhofen wie die großen in der Welt.
Bis eines Tages der Pfarrer – der neue Pfarrer, denn der alte war vor drei Jahren gestorben – von der Kanzel verkündete, daß am 25. Juli, am Tage des heiligen Apostels Jacobus, der hochwürdige Primiziant Mathias Fottner seine erste heilige Messe in Ainhofen zelebrieren werde. Das war eine Aufregung und ein Staunen in der ganzen Gegend! In allen Wirtshäusern erzählte man davon, und der alte Brücklbauer, der, seit ihn der Schlag getroffen hatte, nur selten mehr ausging, hockte jetzt alle Tage in der Gaststube und gab die Trümpfe zurück, die er früher hatte einstecken müssen.
Acht Tage vor der Primiz kam Mathias Fottner an. Im geschmückten Wagen wurde er von der Bahnstation abgeholt, dreißig Burschen gaben ihm zu Pferd das Geleit.
Eine halbe Stunde von Ainhofen entfernt stand der erste Triumphbogen, der mit frischen Fichtenzweigen und blauweißen Fähnlein geschmeckt war.
Am Eingange des Dorfes stand wieder einer, desgleichen in der Nähe des Wirtshauses. Vom Kirchturme wehte die gelbweiße Fahne, die Böller krachten auf dem Hügel hinterhalb dem Stacklanwesen, und das Aufhausener Musikkorps ließ seine hellklingenden Weisen ertönen.
Da hielt der Wagen vor dem elterlichen Anwesen des Primizianten; Mathias Fottner stieg ab und erteilte seinem Vater, seiner Mutter und seinen Geschwistern den ersten Segen.
Ich muß sagen, er hatte ein geistliches Ansehen und Wesen. Seine Augen hatten einen sanften Blick, sein Kinn war bereits doppelt, und die Bewegungen seiner fetten Hände hatten etwas Abgerundetes, schier gar Zierliches.
Seine Sprache war schriftdeutsch, mit Betonung jeder Silbe; er sagte jetzt, daß er gesättigt sei, und daß man ihm viele Liebe betätiget habe.