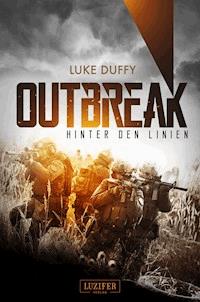Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Outbreak
- Sprache: Deutsch
Das Festland ist verloren, erobert von den Armeen der lebenden Toten, die nun auf Erden wandeln und sich wie eine Seuche über das Ödland ausbreiten, welches früher einmal unsere Zivilisation gewesen war. Während sich die wenigen Überlebenden auf kleinere Inselgruppen zurückgezogen haben und sich an diesen wie Ratten in einem Meer des Schreckens festklammern, stellen nun jene gefräßigen Schatten der Menschheit die dominante Spezies auf dem Planeten dar. In den Flüchtlingslagern breiten sich Hungersnöte und Krankheiten aus und gefährden das Überleben der wenigen Menschen. Die Überreste der Regierung und der Streitkräfte sehen sich zu einer Offensive gezwungen, um wieder etwas Boden von den infizierten Horden der Untoten zurückzuerobern. Und so findet sich ein Team mutiger Soldaten schnell an der Frontlinie eines großen Gegenschlags wieder, beauftragt mit einer Mission, welche ihre verfaulenden Gegner erfolgreich zurückdrängen könnte. Von nun an kämpfen sie nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Menschheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OUTBREAK 2
Operation London
This Translation is published by arrangement with SEVERED PRESS, www.severedpress.com Title: THE DEAD WALK THE EARTH II. All rights reserved. First Published by Severed Press, 2014. Severed Press Logo are trademarks or registered trademarks of Severed Press. All rights reserved.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE DEAD WALK THE EARTH II Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann Lektorat: Astrid Pfister
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-357-2
Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
»Lauf, Chris«, drängte sie ihn mit angsterfüllter Stimme. »Du musst laufen.«
Von hinten hörte sie ihren Bruder panisch keuchen. Er wimmerte und schnaufte vor Hast. Tränen rollten an seinen Wangen hinunter und vermischten sich mit dem dicken Schleim, der unaufhörlich in Fäden aus seiner Nase strömte, während er weinend hinter ihr her über den unbefestigten Weg stolperte. Sie rannten jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit, eigentlich waren es nur ein paar Minuten, doch er tat sich aufgrund seiner Korpulenz schwer, mit ihr schrittzuhalten. Er hatte das Gefühl, sein Brustkorb würde langsam zerdrückt werden, und er konnte kaum atmen, so erbittert er auch nach Luft rang. Das Lungenstechen war jetzt nahezu unerträglich geworden. Sein strapaziertes Herz drohte vor lauter Anstrengung zu explodieren, weil es so viel sauerstoffhaltiges Blut in einem so ungesunden Kreislauf aus verstopften Adern zirkulieren lassen musste.
»Ich kann nicht mehr«, schnaufte er jämmerlich. »Ich bin einfach zu dick.«
Das wusste sie durchaus, denn die Unfähigkeit ihres Bruders, auf sich achtzugeben, war ihr schon seit Jahren ein großes Ärgernis. Nun da ihre weitere Existenz davon abhing, sich, falls notwendig, sehr schnell zu bewegen, stellte sich die Tatsache, dass er sich seit Ewigkeiten selbst schädigte und kein Maß kannte, als lebensbedrohlich für sie beide heraus.
Der Lärm, den ihre Verfolger verursachten, wurde nun lauter. Mittlerweile mussten es Hunderte sein, da ihr aufgebrachtes Stöhnen und Schreien weitere Untote aus der Umgebung anlockte. Sie musste unbedingt ein Versteck für sich und ihren Bruder finden, doch es gab meilenweit überhaupt nichts, was infrage kam. Das einzige Gebäude, das sie in der Gegend gesehen hatten, war ein altes Landgasthaus, und genau dort hatten sie sich Ärger eingehandelt.
Christopher war in seiner ständigen Fressgier in das Lokal geplatzt, bevor seine Schwester dazu gekommen war, sich die Gegend genauer anzuschauen. Von außen hatte es einen verlassenen und ruhigen Eindruck gemacht und weder in dem beschaulichen Wald noch auf den Straßen ringsherum war Bewegung zu sehen gewesen. Durch das Zwitschern der Vögel in den Bäumen und das Brummen, der in der Luft schwirrenden Insekten, hatte die unmittelbare Umgebung nahezu friedlich gewirkt, weshalb er dazu verleitet worden war, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, während ihn seine Unersättlichkeit zu einem vorschnellen Handeln getrieben hatte.
Ohne auf Tina zu warten, die gerade erst die Uferböschung heraufgekommen war, nachdem sie ihr Boot festgemacht hatte, war er in der Hoffnung, eine Fülle von in Kneipen üblichen Knabbereien zu entdecken, durch die Eingangstür gestürmt. Stattdessen war er aber buchstäblich in eine Wand aus fleckiger Haut und leblosen Augen gerannt. Sie hatten ihn bemerkt, sobald er von der Sonne beschienen durch den Türrahmen getreten war. Sein gedrungener, zitternder Leib und sein furchtsames Gewinsel, als ihm bewusst geworden war, dass er einen Fehler begangen hatte, hatten genügt, um die Meute in einen wahren Blutrausch zu versetzen. Sie waren daraufhin auf ihn zugestürmt und dann aus dem Gebäude gestürzt.
Binnen weniger Sekunden hatten sie den beiden den Fluchtweg zum Boot abgeschnitten, sodass Tina letzten Endes nichts anderes übrig geblieben war, als ihren entsetzten Bruder auf einem Pfad hinter sich her zu schleifen, der in den Wald führte. Sie hatte keine Ahnung, wohin sie überhaupt liefen, doch stehen bleiben durften sie dennoch nicht. Die Untoten waren ihnen bereits dicht auf den Fersen und holten allmählich immer weiter auf, soweit sie dies einschätzen konnte.
»Lauf einfach weiter«, knurrte sie Chris an.
Als sie einen Blick zurückwarf, sah sie das schmerzverzerrte Gesicht ihres Bruders. Seine Haut war bereits dunkelrot und seine Kleidung klatschnass. Wegen der Hitze an diesem Tag hatte er sie bereits durchgeschwitzt, bevor sie hier angekommen waren. Kein Zweifel, dass er sich wirklich abmühte, eines seiner stämmigen Beine vor das andere zu setzen, aber sein armseliges Stöhnen machte Tina zusehends wütender. Sie hielt kurz an, bis er blindlings an ihr vorbeiwankte. Wenn sie ihn nicht ziehen konnte, dann würde sie eben versuchen, ihn zu schieben.
Eilig steckte sie das schwere Brecheisen in ihren Gürtel, dann stieß sie Chris vorwärts, indem sie die Hände gegen seine schweißfeuchten Schulterblätter drückte. Sein Selbstmitleid äußerte sich in einem ununterbrochenen Schluchzen, das scheinbar immer lauter und hastiger wurde, während sie den Weg fortsetzten, angetrieben von ihren eigenen starken Beinen.
Sie stemmte sich mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, gegen ihn, wobei er so gut wie gar keine Eigen-Initiative zeigte, sondern sich Tinas Händen sogar noch widersetzte.
An ihre Grenzen zu gehen, war ihr nicht fremd. Als Sportlehrerin in der British Army konnte sie schneller laufen und schwerer heben als die meisten anderen Menschen, denen sie begegnete. Sie liebte es, ihren Körper auf die Probe zu stellen, und zwang sich gern dazu, die Schwelle durchschnittlicher Ausdauer zu überschreiten. Doch mit dem Tod im Nacken und einem Bruder, der ihr einfach nicht entgegenkommen wollte, würde sie letzten Endes nicht durchhalten können. Auf sich allein gestellt, würde sie die schwerfälligen Leichen ohne Weiteres abhängen können, von denen sie gerade gejagt wurden, doch das würde bedeuten, Christopher im Stich lassen zu müssen, und dazu sah sie sich im Moment noch außerstande.
»Verdammt, Chris, du musst mir ein bisschen helfen. Sie kommen immer näher.«
»Ich kann nicht mehr«, keuchte er gequält. »Ich schaffe das einfach nicht.«
Sie fing nun an, ihn zu schlagen. Zuerst belief es sich auf sachte Klapse zum Anspornen gegen den nassen Stoff seines T-Shirts, doch als das Grunzen und Schnauben hinter ihnen anschwoll, dauerte es nicht lange, bis sie Chris regelrecht verprügelte. Während sie ihn weitertrieb und ihre Oberschenkelmuskeln vor angesammelter Milchsäure schmerzten, schlug sie auf die üppige Speckschicht ein, die seine Schulterknochen bedeckte.
»Und ob du das kannst, Mann! Denn wenn nicht, lasse ich dich einfach hier, Chris«, schnauzte sie ihn an, obwohl auch ihr langsam die Puste ausging. »Legst du es etwa darauf an? Du weißt, was die mit dir tun werden. Du hast gesehen, was dann passiert. Willst du etwa so sterben?«
Er weinte hemmungslos, doch ihre Worte schienen offenbar Wirkung zu zeigen. Aus der fieberhaften Vorstellung, dass seine Schwester ihn aufgeben könnte, und dass eine Horde Monster ihn bei lebendigem Leib fressen könnte, schöpfte er die nötige Energie zum Weiterlaufen. Nach wie vor flossen Tränen an seinen hochroten, pummeligen Wangen hinunter, während sein Schnaufen und Ächzen einem das Gefühl gab, er sei dem Kollaps nahe, aber irgendwie schaffte er es trotzdem, noch einen Zahn zuzulegen.
»Genau so, Chris«, sprach Tina ihm von hinten Mut zu, da sie spürte, wie sich sein Widerstand verringerte und der Druck auf ihre Beine abnahm. »Lauf weiter, du kriegst das hin. Halt einfach die Beine in Bewegung, dann wird alles gut, Chris.«
Das Stöhnen und Heulen der Infizierten hallte mittlerweile durch den ganzen Wald. Sie schienen sie zwei nun aus allen Richtungen zu bedrängen, und die Befürchtung, umzingelt zu werden, versetzte Tina schlagartig in Panik. Falls irgendwelche von denen hier auf dem Weg vor ihnen auftauchten, konnte sie nichts dagegen unternehmen. Sie konnten nicht mehr umkehren, also würden sie in der Falle sitzen. Ihre Gedanken begannen zu rasen. Sie hatte keine Ahnung, wo sie momentan waren oder wohin sie liefen. Nur eines wusste sie: Anhalten kam auf keinen Fall infrage.
Hundert Meter weiter, machte Christopher erneut Anstalten, sich gegen ihr Vorwärtsdrängen zu wehren. Er hatte seine Reserven jetzt vollständig aufgebraucht, weshalb nur noch Tina verhindern konnte, dass seine Beine endgültig erlahmten. Sein Kopf sank erschöpft zur Seite und er bekam die Füße kaum noch vom Boden gehoben. So fest sie auch auf seine Schultern schlug und egal, wie vehement sie ihm auch drohte: Er war einfach nicht mehr imstande, sich aus eigenen Stücken zu bewegen. Ihr Bruder war zu einer gewaltigen, leidlich mobilen Masse geworden, die man herumschubsen musste, um sie vor dem endgültigen Stillstand zu bewahren.
Auf einmal sah sie etwas. Zwischen den Bäumen vor ihnen entdeckte sie ein Gebäude. Es war groß und dunkel, aber eindeutig von Menschen erbaut worden und feststehend. Bei einem erneuten Blick über ihre Schulter stellte Tina fest, dass die Infizierten nur noch dreißig Meter zurücklagen.
Ihre ungestümen Verrenkungen und der Krach, den sie machten, während sie die beiden Geschwister mit ihren ausdruckslosen milchigen Augen fixierten, vermittelte Tina das Gefühl, dass durch deren Adern flüssiger Stickstoff anstatt Blut floss. Sie ließen nicht nach – ganz im Gegenteil, sie holten mehr und mehr auf. Christopher hingegen wurde von Sekunde zu Sekunde langsamer, weshalb es nicht mehr lange dauern würde, bis die Verfolger mit ihren Zähnen nach ihnen schnappen würden.
»Mein Gott, Chris!«, schrie Tina zugleich entsetzt und frustriert. »Du musst mir helfen. Sie sind bereits direkt hinter uns.«
Doch ihr Bruder war einfach nicht in der Lage, ihrer Forderung nachzukommen. Ihr allein oblag es nun, sie beide zu retten. Trotz der brennenden Schmerzen beim Atmen und der sich überschlagenden Gedanken, begann Tina, nach einem Weg zu suchen, der sie durch das Gewirr aus Zweigen und Wurzeln zu dem Gebäude führen würde.
»Links entlang. Geh nach links«, befahl sie, aber Chris veränderte seine Richtung nicht.
Indem sie besonders fest gegen seine rechte Schulter drückte, gelang es ihr schließlich, ihn zu lenken und ihn ein klein wenig von seiner Bahn abzubringen. Sie lotste ihn daraufhin auf das Gebäude zu, das sie auf der linken Seite durch das Baumdickicht hindurch erkennen konnte. Ihr Bruder verließ den Pfad und seine Füße scharrten durch das Unterholz, weshalb er, als er weiter trottete, über Zweige stolperte und gefallenes Laub aufwühlte. Er hörte auch nicht eine Sekunde mit seinem bedauernswerten Gewimmer und Gebrabbel auf, geschweige denn, dass er eigenständig handeln oder seiner Schwester hätte hilfreich sein können. Dennoch weigerte sich Tina, einfach aufzugeben. Sie besaß nun wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer, der ihr zum Durchhalten genügte.
Sie gingen jetzt dazu über, sich geduckt und im Zickzack durch das Dickicht zu schlagen. Dornen und dünne Äste stachen in ihr ungeschütztes Fleisch und peitschten in ihre Gesichter, aber sie nahm die Schmerzen überhaupt nicht wahr. Bald waren es nur noch wenige Meter bis zu der grauen Mauer des Bauwerks, obwohl Tina rasch erkannte, dass es in einer Senke stand, weshalb sie noch eine Böschung hinuntersteigen und an einem Grundstückszaun entlanggehen mussten, um es betreten zu können. Ohne zu bremsen, stieß Tina ihren Bruder das steile Gefälle hinab.
Durch sein Gewicht gewann Chris an Schwung und nach ein paar hastigen Schritten trippelte er schnell von der niedrigen Anhöhe auf den Maschendrahtzaun zu, der das gesamte Gebäude umgab. Panisch kreischend ruderte er mit seinen Armen, während seine Beine ihn immer weiter mitrissen, bis er schließlich mit einem hörbaren Klingeln gegen das rostige Metallgeflecht stürzte und beim Zurückprallen kurz vom Boden abhob. Der Zaun rappelte laut bei dieser heftigen Erschütterung und die Vibration wanderte daran entlang, während Christopher rückwärts segelte und unsanft auf dem Boden landete. Er schlug unglücklich auf und stöhnte laut, wobei der rote Sand, den sein wuchtiger Körper beim Aufkommen aufgewirbelt hatte, in einer kleinen Wolke hochstieg.
Tina stieß beinahe mit ihrem Bruder zusammen, schaffte es dann aber doch noch, über ihn zu springen, als er vor ihren Füßen niederging wie ein nasser Sack, der vor Schweiß und Urin triefte. Einen Augenblick lang blieb er einfach nur liegen, rief nach seiner Mutter und zog die Knie an, als er die Beherrschung über seine Körperfunktionen verlor.
Links neben der Stelle, wo Christopher gelandet war, sah Tina einen Zaunpfahl, der sich verbogen hatte, sodass er aus seiner Halterung gerutscht war. In einem weiteren Anflug von Hoffnung drehte sie sich um und fing an, auf die bebende Menschenmasse vor ihr einzutreten.
»Los, hoch mit dir«, brüllte sie bei jedem Treffer.
Sie trat immer fester zu und spürte ein ums andere Mal, wie das weiche Gewebe rings um die stattliche Taille ihres Bruders herum abwechselnd nachgab und sich wieder glättete.
»Steh endlich auf, du Fettsack!«, schrie sie genervt.
Christopher brüllte auf, weil seine Schwester einfach nicht von ihm abließ. Ihre Tritte taten wirklich weh, allerdings nicht annähernd so sehr wie ihre Worte und der Tonfall, der damit einherging. So hatte er sie noch nie zuvor schimpfen gehört, schon gar nicht mit ihm. Sie war stets fürsorglich, verständnisvoll und behutsam mit ihm umgegangen, schien jetzt aber nur noch Hass für ihn zu empfinden.
»Troll dich endlich, du Nichtsnutz. Sie sind gleich hier, und ich werde dich, wenn nötig, für sie hierlassen«, schrie sie ihm vor Zorn spuckend ins Gesicht. »Kapierst du? Ich lass dich hier, ohne Scheiß.«
Am oberen Rand der Böschung erschien nun der erste Infizierte. Seine abgehärmten Züge und die knochigen Schultern gerieten in Sicht. Eingetrübte Augen durchforsteten die Umgebung, während er grunzend und schnaubend verharrte. Schließlich entdeckte er die beiden. Laut stöhnend schwang er sich mit nach vorn gestreckten Händen den Hang hinunter. Den Mund sperrte er dabei so weit auf, dass seine schwarze Zunge zwischen den Zähnen hin und her wackelte, solange der zittrige Laut anhielt, den er in seiner gierigen Erwartung ausstieß.
Die beiden durften jetzt keine Zeit mehr verlieren. Sie waren in die Enge getrieben worden und Tina ahnte, dass sie gleich sterben würden. Ihr Bruder weinte laut, und sowohl sein Selbstmitleid als auch seine Angst nahmen weiter zu, sein Schreien wurde allerdings fast von dem ohrenbetäubenden Kreischen der Untoten übertönt, die gerade drauf und dran waren, sich auf sie zu stürzen, aber momentan noch durch das Gehölz oben am Hang trampelten.
Tina fiel keine Alternative ein, also machte sie sich darauf gefasst, zu kämpfen. Sie rückte nicht von der Stelle, sondern zog stattdessen das Brecheisen aus dem Gürtel und umklammerte die Stange fest. Ihr Herzschlag hämmerte in ihren Ohren und ein letzter Rest Energie brachte ihren Körper in Wallung, der dafür sorgte, dass Adrenalin in ihre Blutbahn ausgeschüttet wurde.
Der erste Infizierte wollte gerade angreifen, konnte aber offenbar genauso wenig wie Christopher bremsen und holperte deshalb rapide auf sie zu. Mit der Einsicht, dass sie sich die Fliehkraft zunutze machen konnte, trat Tina aus dem Weg, sodass der verwesende Leib an ihr vorbeischnellte und gegen den Zaun krachte. Er prallte gegen dieselbe Stelle wie ihr Bruder kurz zuvor, doch dieses Mal hielten die korrodierten Metallpfosten dem Aufprall nicht stand. Geschwächt von Christophers Gewicht knickte der Zaun nun unter dem überwältigenden Druck endgültig ein. Es klirrte einmal durchdringend, dann fiel der Pfosten mit einem heftigen Knall um, und mit ihm auch ein Großteil des verrosteten Geflechts. Dessen Aufhängung ächzte kurz und Drahtstücke sirrten, als sie sich ruckartig unter der Spannung, unter der sie gestanden hatten, lösten.
Die bereits stark verrottete Leiche bewegte sich weiter auf das Gelände zwischen der Gebäudemauer und dem Grundstückszaun zu. Sie schlug mit dem Gesicht auf einen betonierten Weg auf, der um die Anlage herumführte, und rutschte anschließend über die harte Oberfläche, wobei sich das faule Fleisch schichtweise abschälte, bis man eindeutig die Knochen knirschen hörte.
Plötzlich spürte Tina, wie sie zurückgezogen wurde, fuhr instinktiv herum und holte mit ihrer Waffe aus, um sich zu verteidigen. Aber es war nur ihr Bruder. Einen flüchtigen Moment lang starrte sie ihm erschrocken in die Augen, denn irgendwie hatte er den Willen und die Kraft dazu aufgebracht, wieder auf die Beine zu kommen, und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
»Los, Tina«, rief er und half ihr durch das Loch im Zaun. Er führte sie nun auf eine Feuertür im Gemäuer zu.
Sie sprangen über den Untoten, der sichtlich Mühe hatte, sich wieder aufzurichten. Er zuckte auf dem gepflasterten Gehweg vor sich hin und fuchtelte mit den Armen. Als er seinen Kopf anhob, erkannten die beiden, welchen Schaden sein Gesicht genommen hatte. Am Schädel, dessen Knochen zertrümmert oder gänzlich zermahlen waren, haftete nur noch eine blutige breiige Masse, gerade noch so festgehalten von zerfledderten Muskeln und Sehnensträngen. Die Augen fehlten ganz, ebenso die meisten Zähne, trotzdem versuchte er, Bruder und Schwester anzugreifen, als er sie witterte.
Christopher sprang daraufhin mit seinem vollen Gewicht gegen die Tür, doch sie war fest verriegelt. Seine Bemühungen – er rammte sie immer wieder mit einer seiner wulstigen Schulter – konnten dem dicken Stahl allerdings kaum etwas anhaben. Immer wieder warf er seinen Körper vergeblich gegen das undurchdringliche Hindernis.
»Das bringt nichts«, klagte er zwischen seinen Versuchen. »Sie gibt einfach nicht nach.«
Oben an der Böschungskante hatte sich jetzt eine Schar verrunzelter Leiber mit fratzenhaften Gesichtern versammelt. Sie bemerkten die beiden Lebenden, die sich an der Feuertür abarbeiteten, sofort und torkelten daraufhin an der Schräge hinab auf sie zu. Zum Glück waren sie nicht intelligent genug, um nach der Lücke zu suchen, durch die Chris und Tina das Gelände betreten hatten. Stattdessen stürzten sie sich einfach auf die Teile des Zauns, die noch mehr oder weniger intakt waren. Sie kreischten und schnappten mit ihren Mündern nach ihnen und krallten ihre spindeldürren Finger in die Drahtmaschen. Aufgebracht rüttelten und zerrten sie an der Barriere, die sie auf Abstand hielt und gaben Tina damit Zeit, um sich eine neue Vorgehensweise zu überlegen.
Die Tür ging zwar nicht auf, doch in einem lichten Augenblick verschwand ihre Panik kurz und sie konnte endlich wieder einen klaren Gedanken fassen. Wenn diese Tür stabil genug war, um ihrem Kraftaufwand standzuhalten, dann konnte man annehmen, dass das Gebäude so sicher war, dass sie sich eine Weile darin verstecken konnten.
»Das führt doch zu nichts, Chris, wir kriegen sie nicht auf«, sagte sie, packte einen seiner Arme und drehte sich um. »Komm mit … dorthin.«
Tina orientierte sich an dem Gehweg, der um das Gebäude herum nach rechts führte. Die Infizierten vor dem Zaun vollzogen ihre Bewegung mit und folgten ihnen, während sie immerzu auf das Drahtgewebe einschlugen, das sie von ihrer Mahlzeit trennte. Aus der weiteren Umgebung trafen immer mehr von ihnen ein und stürmten ebenfalls die Hügel hinunter, um sich an der Jagd zu beteiligen. Der Krach, den sie dabei erzeugten, klang gespenstisch, und konnte einen beinahe taub machen, und ihr Verwesungsgeruch verpestete die ganze Luft. Der Gestank nach Zersetzung war auf dem schmalen Streifen rings um das Gebäude herum so intensiv, dass Tina beim Laufen sogar würgen musste.
Am Ende des Weges bog sie schließlich um die Mauerecke und zog ihren Bruder dabei hinter sich her. Nun da die Gefahr ein Stück weit gebannt war, verhielt er sich wieder wesentlich passiver und musste von ihr hinterhergezogen werden.
Tina blieb an der nächsten Ecke stehen und beobachtete ein paar Sekunden lang den Bereich an der Vorderseite. Er war weitläufig, es gab einen Stellplatz mit mehreren Wagen, die vereinzelt hier und dort standen, und ein Blick nach links an der Fassade offenbarte, dass sie offenbar in einem Industriekomplex welcher Art auch immer gelandet waren. An der entgegengesetzten Seite der Parkfläche standen weitere Gebäude, die genauso aussahen wie das, an dessen Mauer sie sich gerade verbargen, und weiter vorn konnte man mehrere Unternehmenslogos erkennen.
Bei einem davon handelte es sich um ein Haushaltswarenlager, ein anderes war der Hauptsitz eines Herstellers von Büroartikeln. Es gab zwar noch mehr, doch da sich Tina nicht zum Einkaufen hier aufhielt, schenkte sie dem Ganzen keine weitere Beachtung. Sie mussten unbedingt ein Versteck finden, und eines fiel ihr besonders deutlich auf … von Infizierten fehlte hier jede Spur; das Areal war anscheinend komplett verlassen.
»Dort entlang«, flüsterte sie und wagte sich vorsichtig ins Freie.
»Ich muss mich ausruhen, Tina. Ich kriege keine Luft mehr.«
»Wir ruhen uns aus, wenn wir …«
Ein lautes Knirschen, das mit dem Ächzen von Metall einherging, ertönte aus der Ecke, die sie gerade erst umrundet hatten, und deutete darauf hin, dass der Zaun nun endgültig zusammengebrochen war. Durch das Getrappel der Untoten auf den kaputten Metall-Elementen und dem Beton sah sie sich in der Annahme bestätigt, dass sie auch weiterhin verfolgt wurden.
»Lauf, Chris, sie sind schon wieder im Anmarsch«, rief sie und sprintete an der Gebäudefront entlang zu einer Tür, die sie für den Haupteingang hielt.
Christopher rannte tatsächlich hinterher, ohne zurückzufallen. Nach etwa dreißig Metern zog sie ihn in eine Halle hinein, die in einen geräumigen Empfangsbereich führte. Nachdem er hineingestürzt und gegen einen schweren Tisch mitten im Raum gestoßen war, schlug sie die Tür zu und schob mehrere Riegel vor, um diese zusätzlich zu sichern. Anschließend trat sie zurück und kauerte sich im Schatten neben dem Eingang nieder. Sie bedeutete ihrem Bruder, das Gleiche zu tun, damit sie außer Sicht blieben.
Die aufgekratzten Infizierten torkelten auf ihrer Suche nach den beiden jetzt kreuz und quer über den Parkplatz. Einige schlichen zwischen den Fahrzeugen herum, schauten durch die Scheiben hinein und trommelten dagegen, während andere über das weite Gelände auf die anderen Gebäude zuliefen. Direkt vor dem Eingang, hinter dem Tina und Christopher Unterschlupf gefunden hatten, schob sich eine große Gruppe an der Mauer entlang, bis sie die Tür erreichten, deren dickes Glas sie aber am Betreten des düsteren Inneren hinderte.
Nur wenige Zentimeter rechts neben Tina drückten bereits Dutzende Untote ihre Gesichter gegen die Scheiben und starrten in die halbdunkle Rezeption hinein. Sie sah, wie sich die gruseligen Schatten unzähliger Köpfe und Schultern auf dem Teppich vor ihr langzogen, während sie sich vor dem Eingang scharten. Die Tür bebte ein wenig, als sie mit ihren fauligen Körpern dagegen liefen, um ein Lebenszeichen von ihrer Beute zu erhaschen, doch der Weg hinein war sicher von innen verschlossen.
Tina kniff ihre Augen fest zusammen und betete, dass sie nicht beim Betreten des Gebäudes beobachtet worden waren oder die Infizierten bald ihr Interesse verlieren und woanders nach ihnen suchen würden. Sie presste sich weiterhin an die Wand, während sie dem nervenzerfetzenden Fauchen der Ungeheuer lauschte, die unmittelbar vor dem Gebäude lauerten.
Christopher harrte direkt neben ihr aus. Seine Brust hob und senkte sich hektisch, begleitet von einem gequälten Keuchen. Tina wusste, sie würden nicht weit kommen, wenn sie entdeckt wurden. Ihr Bruder war auf keinen Fall in der Lage, die Flucht fortzusetzen. Er stand kurz vor dem Zusammenbruch und seine Knie zitterten bereits unkontrolliert. Jedes Mal, wenn draußen ein Raunen durch die Menge ging oder es an der Tür pochte, zuckte er unwillkürlich zusammen und schluchzte leise auf. Er war sowohl körperlich als auch emotional am Ende.
Es dauerte eine Viertelstunde, bis Tina wieder unbeschwert atmen konnte und den Mut aufbrachte, sich zu rühren. Vorsichtig kroch sie auf den Türrahmen zu und schaute durch das dicke Panzerglas. Dabei achtete sie allerdings darauf, nicht zu viel von ihrem Körper zu zeigen und weitgehend im Schatten zu bleiben.
Sie sah einen Haufen Untoter, die bei strahlendem Sonnenschein vor dem Gebäude patrouillierten.
Sie liefen nicht mehr hektisch herum oder kreischten aufgeregt. Vielmehr schlurften sie ziellos umher, rempelten einander an oder stießen gegen die Autos, die verstreut auf dem Platz vor den Lagerhallen standen.
Chris und sie saßen zwar fest, waren aber wenigstens vorerst sicher. Tina hoffte, dass es keine weiteren Eingänge ins Gebäude gab, die ihre Jäger nehmen konnten. Sie schaute ihren Bruder an, der mittlerweile am Boden zusammengesunken war. Er saß mit dem Rücken an der Wand gelehnt da, die Beine hatte er vor sich ausgestreckt, und sein Kopf ruhte mit dem Kinn auf der Brust. Ihr wurde schnell klar, dass er eingeschlafen war, als sie das kratzige Sägegeräusch hörte, das aus seinen verschleimten Nasenlöchern drang und sah, wie Speichel von seinen bebenden Lippen rann.
Nachdem sie ihn kurz beobachtet hatte, schüttelte sie den Kopf. Sie musste dringend die Räumlichkeiten durchkämmen und diese absichern, doch nun wurde ihr bewusst, dass sie dabei ganz allein sein würde. Mit ihrem Bruder war gerade nichts anzufangen und er könnte in seinem Zustand weder sich selbst noch ihr helfen. Darum beschloss sie, ihn einfach schlafen zu lassen.
Er wäre mir sowieso bloß hinderlich, dachte sie. Auf diese Weise stand er ihr wenigstens nicht im Weg herum, und sie wusste genau, wo er gerade war.
Indem sie weiter das helle Licht im Auge behielt, das durch die Türscheiben fiel und ein breites Rechteck auf den Boden warf, bewegte sie sich langsam an den Wänden des Raums entlang und versuchte, im Dunkeln zu bleiben. In der Mitte des großen Empfangstischs stand ein Computer mit Drucker, die beide bereits Staub angesetzt hatten, neben mehreren Aktenordnern und Büchern. Alles machte noch einen ordentlichen Eindruck, weil es auf der Arbeitsfläche gestapelt lag und nichts darauf hindeutete, dass an diesem Ort etwas vorgefallen war.
Tina sah ein, dass es ein zweckloses Unterfangen war, konnte es aber trotzdem nicht lassen, den Hörer des Telefons abzuheben und an ihr Ohr zu halten. Wie zu erwarten, war die Leitung tot, aber nachdem sie jahrelang mit einer harmlosen Zwangsstörung gelebt hatte, wusste sie, dass sie, wenn sie ihrem Drang nicht nachgegangen wäre, nicht eher Ruhe gefunden hätte, bis sie das Verlangen schließlich doch befriedigt hätte, und in dieser heiklen Situation durfte sie sich auf keinen Fall durch solche Belanglosigkeiten ablenken lassen.
Die Türen, die links und rechts in mehrere Büros führten, sahen nicht so aus, als seien sie gewaltsam geöffnet oder verrammelt worden. Das Interieur wirkte unberührt und ungenutzt. Dies deutete sie als positives Zeichen, weshalb ihr die neue Umgebung zusehends mehr behagte.
Als sie um den Tisch herumging, fiel ihr Blick auf etwas an der Wand … einen Haken mit einer Ausweishülle daran. Sie streckte sich nach oben aus, nahm sie herunter und hielt sie gegen die Sonne, die grell durch die Glastür schien. Auf dem Foto lächelte ihr eine junge, blonde Frau entgegen, deren Name schwarz gedruckt darunter stand.
»Michelle Potts«, las Tina laut und fuhr mit einem Daumen über das Bild. »Wo bist du jetzt wohl, Michelle?«
In der oberen rechten Ecke des Ausweises stand auch der Firmenname, und Tina riss fassungslos ihre Augen auf, als sie verstand, wo sie hier hingeraten waren – ins Versorgungsdepot einer Supermarktkette.
Während der vergangenen vier Monate hatte sie mit Christopher von der Hand in den Mund gelebt und geplündert, wo es nur ging. Sie waren auf einem kleinen Flussboot untergekommen und von einem Dorf zum nächsten gefahren, wobei sie die Kanäle und Seitenarme wie ein Netz aus Wassergräben durchquert hatten, den Anker ihres engen Zuhauses mit Abstand von den Ufern ausgeworfen und sich vom Festland ferngehalten hatten, wo es vor den Opfern der Epidemie nur so wimmelte. Fast jedes Geschäft und Lokal, das sie entdeckt hatten, war entweder schon geplündert worden, oder voll mit Infizierten, weshalb sie sich unmöglich hatten nähern können. Die Ausbeute war deshalb stets kärglich gewesen. Sich nun zufällig im Lager eines bekannten Supermarktes wiederzufinden, das bisher vollkommen unangetastet zu sein schien, entfachte in ihr neue Hoffnung.
Tina wollte sich allerdings zuerst mit eigenen Augen Gewissheit verschaffen. Nachdem sie noch einmal nach ihrem Bruder geschaut hatte und sicher war, dass er rein gar nichts von seiner Umgebung mitbekam, trat sie durch eine der Türen, die rechts aus dem Empfangsbereich führten.
Dahinter lag ein langer, schmaler Flur, die Wand links zog sich bis zum Ende, wohingegen sich rechts mehrere kleine, halbprivate Bürowaben aneinanderreihten, die durch dünne Raumteiler voneinander abgetrennt waren. Dieser Bereich war gut ausgeleuchtet, weil die Sonne durch mehrere breite Fenster mit Blick auf die Parkfläche schien. Das Licht drang durch die Jalousien jedes Büros und wurde von den hell gestrichenen Wänden reflektiert.
Tina ging langsam bis zum anderen Ende, blieb aber vor allen Waben stehen, um zuerst nach Geräuschen aus dem Inneren zu lauschen. Erst dann steckte sie vorsichtig den Kopf hinein. Die meisten Büros standen leer, doch einige waren auch mit Schreibtischen, Schränken und Stühlen möbliert. Doch in keinem davon sah sie Anzeichen von der Panik und dem Chaos, von denen die meisten Häuser und Gewerbe ergriffen worden waren. Das Wichtigste für sie war allerdings, dass alle Bürofenster intakt waren.
Schließlich erreichte sie die hintere Tür des schmalen Flurs. Diese war dick und schwer, weshalb sie sehr fest drücken musste, um sie öffnen zu können. Dahinter herrschte vollkommene Dunkelheit. Da der Flur hier keine Fenster besaß, durch die natürliches Licht hätte einfallen können, blieb Tina kurz in der Tür stehen und lauschte in die Finsternis hinein. Es roch unverkennbar nach Asche, und als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie mehrere Türen an einer Seite des Ganges erkennen. Dank der Sonne, die durch die Fenster hinter ihr schien, konnte sie vage sehen, dass mikroskopisch feine Partikel von etwas Verkohltem in der Luft waberten.
In einem Teil des Gebäudes hatte es offenbar gebrannt, doch es war aus irgendeinem Grund nicht vollkommen von den Flammen verzehrt worden. Tina konnte nicht abschätzen, ob dies den massiven Feuertüren zu verdanken war oder zu einem frühen Zeitpunkt im Zuge der Katastrophe geschehen war, als es noch Strom gegeben und die Sprinkleranlage noch funktioniert hatte. Obwohl das eigentlich gar keine Rolle spielte, beschäftigte sie diese Frage dennoch.
Letzten Endes sammelte sie sich und trat ein. Es roch hier extrem streng nach verbranntem Holz und geschmolzenem Kunststoff, und als sie die Tür vorsichtig hinter sich schloss, wirbelte ein schwacher Luftzug winzige Flocken aus Asche auf, die ihr sofort in die Nase drangen. Sie blieb still stehen und konzentrierte sich darauf, gleichmäßig zu atmen, während sie auch noch auf die leisesten Geräusche achtete. Irgendwann hatten sich ihre Augen an die Düsternis gewöhnt und sie tastete sich langsam weiter vorwärts, um herauszufinden, was sich hinter den Türen verbarg.
Die Wände waren schwarz verrußt und von der Hitze verzogen, die sich offenbar in diesem Flur entwickelt hatte. Beim Auftreten knirschten spröde Bodenplatten, die aufgrund der hohen Temperaturen gerissen oder zerbrochen waren. Das Geräusch wirkte in der Dunkelheit umso lauter, weshalb Tina sich bei jedem Schritt verkrampfte.
Die erste Tür führte in eine Abstellkammer hinein, und nach einem kurzen Schrecken, weil etwas Borstiges ihre Finger streifte, begriff Tina, dass es sich nur um einen Besen handelte. Sie ging hastig zum nächsten Raum weiter.
Darin konnte sie nichts sehen, doch es stank so sehr, dass sie annahm, dass es eine Personaltoilette war. Neben dem Geruch von verkohltem Holz und versengtem Beton nahm sie auch jene typische Mischung aus stehendem Urin und Reinigungsmitteln wahr, doch dass sie nichts von dem üblen Odeur verwesender Menschen roch, erleichterte Tina sehr. Sie hatte ihn in letzter Zeit viel zu oft gerochen, und so abstoßend er auch auf ihre Sinne wirkte, brachte er vor allem ihren Verstand aus der Fassung. Nachdem sie die Tür geschlossen hatte, setzte sie ihren Weg durch den dunklen Gang fort.
An der Schwelle unter der vorletzten Tür sah sie erneut einen Lichtstreif. Sie drehte vorsichtig den Knauf, ohne ein Geräusch zu verursachen, öffnete sie und stieß plötzlich auf gleißende Helligkeit. Da sie mehrere Minuten lang gar nichts hatte sehen können und sich nur auf ihre Nase und Ohren hatte verlassen können, blendete sie dieser hell erleuchtete Raum unfassbar. Während sie hektisch blinzelte und sich eine Hand über die Augen hielt, hob sie mit der anderen das Brecheisen.
Es war eine Cafeteria. Auf jeden Fall hatte man den Bereich einmal in dieser Funktion benutzt. Ordentlich aufgestellte Tische und Stühle nahmen die gesamte Fläche ein. Alle waren von dem Rauch und durch die Hitze schwarz verkohlt, die den Raum buchstäblich entzündet hatte. Den einst weißen Anstrich der Wände schraffierten nun dunkle Streifen, wo die Flammen an ihnen gezüngelt hatten. Schwarz und verschmiert reichten sie bis unter die Decke, deren Schaumstoffplatten ebenfalls verschmort waren und nun wie Stalaktiten aus Plastik in ihren Rahmen hingen.
Am hinteren Ende befand sich eine Theke mit Wärmeplatten und anhand des Schadens in jenem Teil der Cafeteria ging Tina davon aus, dass sich das Feuer dort konzentriert hatte. Mitten in dem ganzen Schutt glaubte sie, auch mehrere Leichen zu entdecken. Diese waren allerdings bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und praktisch eins geworden mit einer Masse aus verklumpter Asche und ausgehärtetem Kunststoff. An mehreren Stellen ragten bleiche Hand- oder Beinknochen aus dem Wust auf, und je länger Tina dort hinstarrte, desto mehr erkannte sie. Einige der verkohlten Leiber bewegten sich anscheinend noch. Beinahe unmerklich zwar, doch es war keine Einbildung … dürre Finger, die zuckten und wackelnde Beine.
Als sie dies beobachtete, wusste sie nicht so recht, ob sie hinauslaufen oder bleiben sollte. Doch letzten Endes machte sie sich klar, dass diese Menschen keine Bedrohung mehr für sie darstellten. Irgendwie hatten sie das Feuer überstanden, waren aber zu schwer verletzt, um sich aufraffen zu können. Tina fragte sich, ob sie schon vor der Feuersbrunst infiziert gewesen waren oder erst nach ihrem Tod in den Flammen reanimiert worden waren. Obgleich sie es gern gewusst hätte, lag es ihr fern, genauer nachzuforschen.
Die hintere Wand der Cafeteria verfügte über eine Reihe breiter Fenster, die die gesamte Breite einnahm. Die Scheiben waren allerdings trüb und vom Rauch beschmiert, doch an ein paar Stellen konnte man noch hindurchschauen und erkennen, dass davor ein leerer Abschnitt der Parkfläche lag. An dieser Gebäudeseite deutete nichts auf weitere Untote hin, und Tina hoffte, dass es sich dabei um die Parkplätze der Angestellten oder um eine Lieferannahme ohne öffentlichen Zugang handelte. Bei Bedarf würde sie diesen Bereich als möglichen Fluchtweg in Erwägung ziehen können.
Die letzte Tür auf dem Flur führte zu einer Plattform mit einem Blick auf ein gewaltiges Warenlager. Dort herrschte wegen der Fenster hoch oben an der Decke nur wenig Licht, weshalb sie nur ein paar Meter weit sehen konnte. Von ihrer erhöhten Position aus beschränkte es sich auf wenige Reihen aus gestapelten Gütern, die jedoch nach einem kurzen Stück bereits unkenntlich wurden, weil sie im Schatten verschwanden. Tina konnte die Ausmaße der Halle aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse nicht einschätzen, rechnete aber damit, dass sie sehr beachtlich war, einfach, weil es sich dabei um ein Versorgungsdepot einer großen Supermarktkette handelte und auch wegen der Länge der Außenmauern.
Leider schienen die Flammen auch das Lager nicht verschont zu haben. Es roch hier drin genauso streng nach Feuer wie in der Cafeteria und dem Flur. Viele der Regale in Tinas Nähe waren zusammengebrochen, und ihr Inhalt lag von der hohen Hitze zerstört auf dem Boden herum. Mehr zu erkennen war zwar unmöglich, doch sie ahnte, dass der Rest der Halle dem gleichen Schicksal anheimgefallen war.
Sie blieb kurz an der Tür stehen und horchte eine Weile. Nie hätte sie voraussehen können, ob sich in dem Lager Infizierte aufhielten, und die einzige Möglichkeit, sich zu vergewissern, bestand darin, sich selbst bemerkbar zu machen. Vorerst aber wollte sie ihre Anwesenheit nicht preisgeben.
Nachdem sie die Tür sorgfältig verschlossen hatte, kehrte sie zu der Rezeption zurück. Dort hielt sie hinter dem Empfangstisch inne und schaute verstohlen durch die gläserne Eingangstür hinaus auf den Parkplatz. Die Untoten waren immer noch da, suchten jedoch nicht mehr gezielt nach ihr und Chris. Sie irrten stattdessen wieder stumpfsinnig herum.
Ihr Bruder saß noch immer zusammengesackt an der Wand und schnarchte laut. Sein dicker Bauch ging dabei auf und nieder, während er tief und laut atmete.
»Nutzloser Bastard«, murrte Tina leise im Vorbeigehen und näherte sich nun einer offenen Tür zu seiner Linken.
Diese führte zu einer Treppe, über die man mehrere Großraumbüros erreichen konnte. Die Geschäftsführer und ihre Assistenten hatten es sich zweifellos gutgehen lassen, denn kostspielige Möbel und Deko-Gegenstände schmückten alle Zimmer. Die Ausstattung jedes Büros war eher Bankleitern angemessen als den Arbeitsplätzen eines Supermarktversorgungsdepots.
In einer kleinen Küchenzeile am Ende eines Korridors, der die Führungsbüros unterteilte, fand Tina einen Kühlschrank voller verdorbener Lebensmittel. Angewidert wegen des Gestanks verzog sie ihr Gesicht, doch plötzlich fielen ihr in einer Halterung drei Flaschen Wasser auf, die sie schnell herausnahm, bevor sie die Tür des Geräts zuschlug.
In den Schränken entdeckte sie leider auch nur schimmelige Brotlaibe und Kuchen neben anderen nicht identifizierbaren Speisen, die mit der Zeit ungenießbar geworden waren. Damit konnte niemand mehr etwas anfangen, aber fünf Dosen Thunfisch und drei Beutel Trockenobst kamen kurz darauf der Entdeckung eines verloren geglaubten Schatzes gleich. Tina freute sich unglaublich über ihren Fund. Nun konnten sie hier übernachten und hatten sogar etwas zu essen und konnten sich ausruhen. Allerdings musste sie sich hundertprozentig vergewissern, dass wirklich keine Infizierten in dem Gebäude waren.
Also würden die Geschwister sich heute hier verstecken und ihre Situation am Morgen noch einmal neu bewerten.
Kapitel 2
Die Welt war nun ein vollkommen anderer Ort. Obwohl es nur vier Monate her war, dass die Epidemie die überlebenden Menschen dazu gezwungen hatte, sich zu verschanzen, um den umherstreifenden Untoten entgehen zu können, sah die Landschaft erheblich verändert aus. Es gab kein von Menschen errichtetes Bauwerk mehr, das sich die Natur nicht bereits einverleibte. Farben verblassten, spitze Kanten stumpften allmählich ab. Kräuter und Wildblumen wuchsen aus allen Rissen und Rillen und breiteten sich langsam über den Ruinen der Zivilisation aus.
Die zwei saßen auf dem Hügel und betrachteten die kurze Geschäftsstraße, die an einer weitreichenden Appartementanlage endete. Von ihrer Warte aus sahen sie in jeder Richtung über eine beträchtliche Entfernung hinweg Schatten, die auf den Straßen herumstolperten oder träge verharrten, während sie zu Boden starrten.
»Ist sehr ruhig hier, nicht wahr?«, brummte Bull.
»Stimmt«, antwortete Danny, während er über das Meer aus Dächern blickte. »Ehrlich gesagt, finde ich das ganz angenehm.«
Bull schaute ihn kurz verdutzt an, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße richtete.
»Na ja, wenn man die Tatsache ausblendet, dass so ziemlich überall, wohin man schaut, Tote herumlaufen, wirkt eigentlich alles recht friedlich«, fuhr Danny zur weiteren Erklärung fort.
Bull nickte. Er verstand schon, worauf sein Gefährte hinauswollte, und musste ihm nach kurzem Überlegen, bei dem er die früheren Umstände mit den jetzigen verglich, durchaus recht geben. Es war wesentlich ruhiger auf der Welt geworden. Der unschöne Lärm, den die Gesellschaft verursacht hatte, war komplett verschwunden, er war abgelöst worden von dem leisen Murmeln der Natur. Allerdings konnte er sich noch so sehr bemühen … die wirkliche Lage ausgesprochen lange zu verdrängen, fiel ihm äußerst schwer.
Ein lautes Poltern, gefolgt von einem tiefen Grollen, das vom Fuß des Hügels her kam, holte ihn abrupt wieder in die Gegenwart zurück. Sie hatten während der letzten Stunden vor der Mittagssonne geschützt, im Schatten eines Baumes gesessen. Es war im Moment Hochsommer und gerade dörrte eine Hitzewelle die Erde aus, während der sich die Menschen immer noch wie gewohnt bedeckt hielten.
Unten am Hang markierte eine Reihe am Straßenrand geparkter Fahrzeuge die Grenze zwischen dem Land und dem urbanen Raum. Auf dem Fahrersitz eines Autos saß die halb verweste Leiche eines Mannes und drehte noch immer am Lenkrad. Er zog und drückte an der Schaltung oder an den Funktionshebeln herum und hatte es sogar geschafft, den Sicherheitsgurt über seine aufgerissene Brust anzulegen.
»Das sind nicht gerade die Hellsten, stimmt`s?«, meinte Bull.
»Der sitzt bestimmt schon mehrere Wochen dort«, erwiderte Danny. »Du weißt ja, wie beharrlich sie sind.«
»Eher dämlich«, hielt Bull dagegen. »Was treibt denn Bill Gates im Moment?«
Danny drehte sich mit dem Feldstecher vor dem Gesicht nach rechts. Weiter oben an der Straße auf einer Bank vor einem Schaufenster, in dem immer noch neue Elektrogeräte und Software als Sonderangebote auslagen, hockte ein weiterer wiederbelebter Toter. Er hielt einen Laptop in der Hand und tippte wiederholt auf der Tastatur herum, so als arbeite er an irgendeinem Textdokument oder schreibe gerade eine E-Mail. Hin und wieder machte er auch einen verwirrten Eindruck und begann, an der Unterseite des Computers herum zu nesteln, als ob er überprüfen wollte, ob das Gerät noch mit einer Steckdose verkabelt war.
»Das Gleiche wie immer«, entgegnete Danny, während er die Gestalt beobachtete. »Ich glaube, er versucht immer noch, sich an sein Facebook-Passwort zu erinnern.«
Bull lachte neben ihm leise, dann wälzte er sich auf den Rücken und stieß einen langen Seufzer aus, wobei er zu den Ästen hinaufschaute, die sich sanft im Wind über ihnen wiegten. Ihm wurde immer langweiliger, weshalb er sich wünschte, die Zeit würde schneller vergehen, und den Abend herbeisehnte, damit sie wieder in die Gänge kommen konnten.
»Wahrscheinlich wird keiner von uns diese Wette gewinnen, Danny. Diese Dinger sind so dumm, dass sie einfach dortbleiben werden, bis ihnen alle Gräten abfaulen.«
Sie waren jetzt seit fast drei Wochen auf Patrouille. Ihre Aufgabe bestand darin, den Hafen von Portsmouth auszukundschaften und herauszufinden, ob der Flugplatz Farnborough noch immer intakt war. Zu ihren weiteren Pflichten gehörte die Sichtung der verschiedenen Strecken, die nach Norden in Richtung London führten. Indem sie nachts reisten und tagsüber rasteten, geisterten Bull, Danny und Marty wie Gespenster durch die desolate Landschaft. Sie zogen von Ort zu Ort und sammelten die erforderlichen Informationen. Sie mieden sowohl die Lebenden als auch die Untoten, hatten sich aber oft in unmittelbarer Nähe beider wiedergefunden. Ihre Anweisungen waren eindeutig … sie sollten Kontakte jeglicher Art um jeden Preis vermeiden.
Im Dunkeln verborgen hatten sie Überlebenden beim Plündern zugesehen und ihr Möglichstes getan, um selbst am Leben zu bleiben. Zweifelsohne gab es noch viele andere gesunde Menschen im Land, doch ihnen war bewusst, dass deren Zahl von Tag zu Tag schrumpfte. Denn niemand konnte sich ewig verstecken und wenn man sich auf eines verlassen konnte, dann darauf, dass man über kurz oder lang von Infizierten aufgespürt wurde.
Die Schnelligkeit oder Intelligenz der Untoten gab einem nie Anlass zur Sorge, dies taten eher ihre Vielzahl und ihre Zähigkeit. Wenn sie eine lebendige Person sahen oder ein Versteck entdeckten, liefen auf einmal ganze Heerscharen von Verwesenden am jeweiligen Ort zusammen. Nur wer eine starke Verteidigung und genügend Fluchtmöglichkeiten besaß, hatte eine Überlebenschance, sobald er entdeckt wurde.
Während sich Marty eine Mütze Schlaf genehmigte, behielten Danny und Bull die Infizierten in den Straßen weiter im Auge. Zunächst hatten sie sich einen kindischen Spaß daraus gemacht, die wandelnden Leichen nach bekannten Prominenten zu benennen und abwechselnd zu raten, welchen Reanimierten der andere meinte. Als ihnen dies zu fade geworden war, hatten sie darauf gewettet, welcher der beiden Infizierten – »Bill Gates« mit dem Laptop oder »Michael Schumacher« in dem Wagen – zuerst sein Interesse an dem verlor, was er gerade tat, und zu etwas anderem überging.
»Ich habe Simon Cowell nirgendwo mehr gefunden«, sagte Danny nun ruhig, den das Spiel immer weniger reizte.
»Er hat sich garantiert längst verzogen, Kumpel. Man konnte ihn ja schließlich nicht übersehen. Er hatte seine Hose fast bis zum Hals hochgezogen und einen Bürstenschnitt, der Grace Jones stolz gemacht hätte.«
»Dann weiß nur Gott, wie er mir entwischt ist.«
»Ich mache jetzt wohl mal unser Dornröschen wach«, erwiderte Bull, richtete sich auf und setzte sich in Bewegung, um zu dem Baum zu kriechen, an dessen Stamm ein schnarchendes Häuflein lag.
Als er auf Marty hinabsah, betrachtete er bewusst die geladene Pistole, die sein schlafender Freund fest in einer seiner Hände hielt. In Anbetracht der gegenwärtigen Weltlage konnte es schon ausreichen, jemanden mit unvermittelten Geräuschen oder einer kleinen Bewegung zu wecken, um eine Impulsreaktion zu provozieren, und Bull wollte nicht unbedingt von einem seiner Mitstreiter erschossen werden, nur weil dieser verwirrt aus dem Schlaf schreckte. Darum hielt er sich dicht über dem Boden, als er neben ihn rutschte, und positionierte sich so, dass er seinen Gefährten im Bedarfsfall die Waffe entwenden konnte.
»Marty«, flüsterte er behutsam, während er einen Arm ausstreckte, und rüttelte dann an der Schulter des Schlafenden.
Dieser fuhr schreckhaft hoch. Bull betrachtete ihn ein paar Sekunden lang, wobei er auf die Pistole in dessen Hand achtete, doch Marty machte keine Anstalten, sie zu heben.
»Deine Schicht hat begonnen, Sportsfreund.« Bull bezog sich auf die Wachablösung.
»Was, jetzt schon?«
»Nein, erst nächsten Dienstag. Ich dachte nur, ich könnte mir einen kleinen Scherz erlauben, indem ich dich schon früher wecke. Steh schon auf, du Lusche.«
»So'n Scheiß, Mann«, nölte Marty schlaftrunken.
Bull kroch zu Danny zurück, während ihr Freund langsam immer mehr zu sich kam. Er drehte sich noch einmal nach ihm um und beobachtete einen Moment lang, wie Marty sich streckte und am Kopf kratzte. Anschließend blickte er auf seine Armbanduhr und schließlich blinzelnd zur Baumkrone hinauf, um zu erkennen, wo die Sonne gerade stand. Dämmern würde es erst in ein paar Stunden, weshalb er mit dem Gedanken spielte, sich wieder hinzulegen, umzudrehen und weiterzuschlafen.
»Komm ja nicht auf die Idee«, wisperte Bull von drüben. »Du bist jetzt mit Aufpassen an der Reihe, während ich mir etwas zwischen die Kiemen schiebe.«
Marty rieb seine Augen und machte sich daran, zu den anderen beiden zu kriechen. Nachdem er sich dicht neben ihnen auf den Bauch gelegt hatte, spähte er durch den Feldstecher den Hügel hinab.
»Und, geht da unten was ab?«
»Gar nichts.« Bull schüttelte seinen Kopf. »Bist du dir sicher, dass es sich lohnt, hinunterzusteigen?«
Marty zuckte mit den Achseln. »Ein Blick kann ja nicht schaden. Das ist die letzte bebaute Gegend, bevor wir zur Abholstelle gelangen, also wäre es fahrlässig, wenn wir hier nicht ausgiebig herumschnüffeln würden. Außerdem ist Danny derjenige, der auf Gedeih und Verderb hinunter will.«
»Ich bin gar nicht weit von hier aufgewachsen«, erklärte dieser ruhig, als er bemerkte, dass Bull ihn fragend anschaute.
»Du kommst uns jetzt aber nicht auf die sentimentale Tour, oder Danny?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte er gleichmütig. »Davon einmal abgesehen, finden wir vielleicht etwas Nützliches an dem Checkpoint am anderen Ende der Straße.«
Bull drehte sich nach rechts um, wo eine Absperrung zusammengestürzt war. Von Schüssen durchsiebte Militärfahrzeuge standen dort mit zerbrochenen Scheiben und platten Reifen. Kein Motorengeräusch, kein Licht, die Türen offen, und die Soldaten längst verschwunden. Dutzende Leichen lagen an der Stelle herum, und man erkannte, dass die Truppe tapfer gekämpft hatte. Obwohl es sinnlos gewesen war, denn die Infizierten hatten die Reste der Verteidigung einfach mit ihren verrotteten Füßen niedergetrampelt und sich an den überforderten Militärs gütlich getan.
Während die Dunkelheit hereinbrach, bereiteten sich die drei zum Aufbruch vor. Intuitiv und ohne Worte, überprüften sie, ob ihre Waffen funktionierten und ihre Ausrüstung gesichert, alle Taschen befestigt und alle Gurte arretiert waren.
»Sollte etwas passieren und wir werden getrennt, kommt wieder genau hierher«, flüsterte Marty den anderen zwei zu und zeigte auf den Baum. »Das ist unser Notfallsammelpunkt. Wartet zehn Minuten, falls möglich, und lauft dann zur Abholstelle.«
Danny und Bull gaben mit hochgestreckten Daumen zu verstehen, dass sie die Anweisung zur Kenntnis genommen hatten.
Marty trat jetzt vor die beiden anderen und begann, sie den grasbewachsenen Hang hinunter zu der Autoreihe zu führen. Im Westen war der Himmel noch blassblau und hell genug, sodass sie sich auf dem Weg die Straße hinunter, zurechtfanden und nicht allzu sehr auffielen. Allerdings wussten sie, dass sie diese Annehmlichkeit nicht mehr allzu lange nutzen konnten, denn die Sonne war längst hinter dem Horizont verschwunden, und es wurde rasch dunkler. Ebenso rapide sank die Temperatur, die bei Tag sehr hoch gewesen war, und die Luft wurde durch den kühlen Wind fast frisch, während die Finsternis über den Abendhimmel rollte und die Umgebung in unterschiedliche Blau- und Grautöne färbte.
Danny bildete die Nachhut und genoss die abendliche Kühle auf seiner geröteten Haut. Während sie liefen, konnte er links undeutlich »Schumacher« erkennen, der immer noch zuckend am Steuer des Autos saß. Der Typ würde wohl niemals Leine ziehen. Was er tat, nahm ihn offensichtlich vollkommen in Beschlag.
Deinetwegen habe ich jetzt fünf Snickers verloren, dachte Danny.
Als sie den Fuß des Hügels erreichten, versteckten sie sich hinter den geparkten Wagen und schlichen daran entlang auf das andere Ende der Straße zu. Links von ihnen, wo die Vororte der ländlichen Kleinstadt an die unberührte Natur grenzten, lauerten die Infizierten. Die Geräusche, wenn sie auf den düsteren Hauptstraßen, über Trümmer stolperten, hallte durch die engen Gassen der Appartementanlage. Ihre Stimmen, das Stöhnen und das Schreien, trugen sich weit in der Stille hinein, die sie umgab. Die Dunkelheit schien zu bedingen, dass man nächtliche Geräusche auch aus größerer Entfernung hören konnte, weshalb die drei Männer jeden Schritt umso vorsichtiger machen mussten.
Alle paar Meter blieben sie stehen, um sich in der Umgebung zu orientieren und zu überprüfen, ob sie entdeckt worden waren. Marty fragte sich allmählich, warum er sich dazu verpflichtet gefühlt hatte, Danny diese nostalgische Neugier durchgehen zu lassen, allerdings waren sie jetzt schon fast da, und weiterzugehen war genauso leicht wie Umkehren.
Hinter einem Auto verharrte das Trio kurz und wartete, dass das letzte Licht stetig schwächer wurde. Am Himmel über ihnen glitzerten bereits die ersten Sterne, und als sich ihr natürliches Nachtsehvermögen einstellte, erkannten sie immer mehr Einzelheiten in ihrem Umfeld. Nach einer Weile konnten sie deutlich in beide Richtungen schauen, und soweit es sich bestimmen ließ, befanden sich keine Infizierten in ihrer unmittelbaren Umgebung.
Nachdem sie hinter der Wagenreihe vorgetreten waren, machten sie sich auf den Weg zu den dunklen Geschäften und dem Checkpoint zu ihrer Rechten. Danny hielt nun wieder an und überblickte das Areal, um seine Freunde decken zu können. Als er sich sicherheitshalber nach hinten umdrehte, schrie er vor Überraschung beinahe auf.
Überall am Horizont erschienen plötzlich menschliche Silhouetten. Er brauchte nicht genauer hinzusehen, um zu wissen, dass es sich dabei um unzählige Infizierte handelte. Woher kamen die? Er hatte keine Ahnung, doch sie bewegten sich auf die Häuser zu, weshalb Danny und die anderen innerhalb kürzester Zeit zwischen dem Land und der Stadt eingeschlossen sein würden … in die Zange genommen von Untoten.
Er drehte sich zu seinen Begleitern zu und zischte leise, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Marty erstarrte und schaute zu ihm, um herauszufinden, was los war. Er erkannte die Gefahr sofort, und auch Bull erblickte die Untoten. Die drei zogen sich hastig hinter das nächste Fahrzeug zurück.
»Woher zum Geier kommen denn die auf einmal?«, fragte Bull aufgeregt, während er über das Autodach zum Hügel hinüberschaute.
Danny schüttelte den Kopf.
»Weiß der Teufel, Mann, aber es wird keine Minute dauern, bis die Straße hier vor ihnen überquillt.«
Immer mehr von ihnen kamen über die Hügelkuppe, während die ersten Reihen zügig den Hang hinunterstiegen und sich der Autoreihe näherten. Sie torkelten, strauchelten und grunzten auf dem Weg zur Siedlung.
»Das ist ja eine ganze Horde«, flüsterte Bull erschrocken.
Marty drehte sich zu der Straße und den Gebäuden um. Ihnen blieb wohl nichts anderes mehr übrig, als sich zu bemühen, nicht gesehen zu werden und zu hoffen, dass der Schwarm an ihnen vorbeizog. Er fand keine Erklärung dafür, wie oder warum die Untoten plötzlich aufgetaucht waren, und war überzeugt davon, dass seine Freunde und er nichts getan hatten, um sie anzulocken.
»Kommt«, wisperte er und erhob sich mit eingezogenem Kopf.
Da die ersten Infizierten keine fünfzig Meter mehr von ihnen entfernt waren, mussten sie unbedingt sofort handeln. Denn würden sie hierbleiben, würden sie bestimmt entdeckt werden. Marty hoffte, dass dies nicht bereits geschehen war.
Er führte Bull und Danny zu dem nächsten offenen Gebäudeeingang. Sein Plan bestand darin, sich im Schatten zu halten und dort auszuharren, bis die Prozession der Untoten die Gegend verlassen hatte, sodass sie umkehren konnten.
Nur wenige Meter von ihnen entfernt, liefen mehrere düstere Gestalten durch die lichtlose Straße. Dadurch, dass sie sich ruhig und mit Bedacht fortbewegten, hofften die drei Männer, den Infizierten entgehen zu können, die sie bis jetzt immer noch nicht wahrgenommen hatten. Die Masse der Leiber vom Hügel, drängte sich schon unbeholfen und mit lautem Gepolter und Gekratze, zwischen den Autos hindurch, was natürlich weitere Untote aus der Umgebung anlockte.
Unvermittelt hob »Bill Gates« nun den Blick von seinem Computer und schaute einen Augenblick lang verwundert, als Dannys dunkle Umrisse an ihm vorbeihuschten. Aus dem wehmütigen Stöhnen, das der Kehle der Leiche entstieg, wurde schnell ein Gurgeln, als die Machete des Lebenden auf dessen Schädel niederging, der daraufhin dumpf knacksend aufbrach. Als Danny die Klinge aus der fauligen Hirnmasse des Mannes zog, schmatzte es laut, aber er reagierte leider zu langsam, als er nach dem Laptop griff, der dem Monster aus den Händen glitt. Deshalb schlug dieser laut auf dem Boden auf.
Das Geräusch war wie ein Alarmsignal. Alles um ihn herum wurde still, auch die drei Lebenden. Die untoten Hundertschaften in der Nähe drehten langsam ihre Köpfe und starrten in die Richtung, aus der der Krach gekommen war, dann ertönte ein Scharren, als sie sich alle über den Beton schlurfend, auf die Lärmquelle zubewegten.
»Kacke«, fluchte Bull, wandte sich ab und lief auf die erstbeste Front der unheilvoll wirkenden Geschäfte zu.
Es war zwar schon Abend, aber nicht annähernd dunkel genug, um ungesehen zu bleiben. Nachdem der Computer auf den Boden gefallen war, ruhten alle Augen in der Gegend fest auf den drei Kämpfern. Es bedurfte nur eines einzigen Aufschreis des nächststehenden Infizierten, der erkannt hatte, dass es sich hier um lebendige Menschen handelte, um das gesamte Pack unter Strom zu setzen, und schon eilten sie heran.
Innerhalb weniger Sekunden war der erste Untote bei den Männern und griff an. Danny drehte sich um, um zu fliehen, als ein gleißender Blitz die Umgebung erhellte, und es gleichzeitig markerschütternd krachte – ein Schuss mit Hochgeschwindigkeitsmunition. Marty war zuerst zum Feuern gekommen. Seine Kugel explodierte nicht weit von Dannys Kopf entfernt und zerfetzte seinen vordersten Gegner. Kaum, dass der Körper umkippte und kraftlos auf den Boden knallte, folgte dem ersten Schuss auch schon ein zweiter, und dann noch ein dritter.
»Hierher zu mir … rein mit euch!«
Während sich Danny und Marty umdrehten, um zum Eingang des Geschäfts zu laufen, eröffnete Bull das Feuer auf die Nächsten Infizierten, die er im Dunkeln erkennen konnte. Sie schienen bereits überall zu sein. Einige rannten, andere bewegten sich sprunghaft, und Bull pickte sich diejenigen heraus, von denen seines Erachtens nach die größte Gefahr ausging. Er traf zielgenau und die Leuchtspurgeschosse flammten grellrot auf, wenn sie aus dem Lauf seines Gewehrs platzten und Gewebe und Knochen durchschlugen.
Der Andrang aus der nächtlichen Dunkelheit riss nicht ab. Sie trampelten trotz großer Löcher in den Köpfen über Gefallene und schoben sich aus allen Richtungen vorwärts.
»Die wissen verdammt noch mal definitiv, dass wir hier sind«, rief Bull panisch, während das Heulen der Infizierten überall in der Gegend immer eindringlicher wurde.
Marty war drinnen und hastete in den hinteren Teil des Lokals, wo er hoffte, einen weiteren Ausgang zu finden. Danny blieb vorne und half Bull beim Eindämmen des Ansturms, indem sie unzählige weitere Untote fällten.
»Von dir aus links, Dan, links!«
Er drehte sich gerade noch rechtzeitig um, andernfalls wäre ihm gar nicht aufgefallen, dass sich ihm eine der Leichen an der Außenmauer des Geschäfts näherte. Sie war nur noch ein paar Meter weit weg und hätte ihn aus dem toten Winkel heraus angegriffen. Er fuhr herum und drückte ab, konnte aber nicht richtig zielen. Die Kugel verfehlte den Untoten und sauste in die Dunkelheit hinaus, während sich der Infizierte auf Danny stürzte. Dieser feuerte erneut. Der Schuss war akkurat, hätte aber auch unmöglich vorbeigehen können, da der Untote seinen Mund praktisch direkt vor den Lauf hielt. Die Patrone drang durch den Schädel ein und versprühte weitflächig verrottenden Hirnbrei. Der Körper fiel gegen den Türrahmen und blieb anschließend verdreht vor Danny liegen.
»Dort entlang«, rief Marty aus der Tiefe des Raumes, in dem es absolut stockdunkel war.
Bull machte sich gemeinsam mit Danny auf den Weg und ließ sich von der Stimme ihres Freundes durch die sprichwörtliche Schwärze leiten. Marty stand an der Tür im Nebenzimmer und winkte sie zu sich.
»Wir verschwinden hinten raus auf die Parallelstraße«, flüsterte er, während sie an ihm vorbeitraten. »Da sie uns jetzt aus den Augen verloren haben, schaffen wir es vielleicht, uns heimlich aus diesem Gangbang zu verdrücken.«
Bull ging vor. Er fuhr immerzu mit dem Zeigefinger über den Abzugsbügel seines M-4, wollte aber nur dann feuern, wenn es sich wirklich nicht mehr vermeiden ließ. Sie waren jetzt außer Sicht der Untoten, also würde sich Besonnenheit in dieser Situation am ehesten auszahlen. Zu versuchen, sich den Weg hinaus freizuschießen, hatte keinen Zweck, denn dazu besaßen sie einfach zu wenig Munition. Sie mussten unbedingt ein Versteck finden und darauf spekulieren, sich davonschleichen zu können, sobald die Luft rein war.
Hinter ihnen strömten nun die ersten Infizierten in das Lokal hinein. Das Echo ihrer Schritte pflanzte sich im Dunkeln fort und rief jede Leiche in der näheren Umgebung auf den Plan. Auf der Straße hinter der Reihe von Geschäften verbargen sich die drei jetzt im Schatten eines Hauses und beobachteten, wie Hunderte Untote an ihnen vorbeizogen.
Durch jede Tür und hinter jedem Gebäude kamen sie hervor. Einige gingen, andere rannten, schlugen um sich und jaulten aggressiv. Manche von ihnen waren schon zu stark angeschlagen, weshalb sie sich kaum noch bewegen konnten, also schleppten sie sich durch die Straße, um sich dem marschierenden Haufen Gammelfleisch anschließen zu können. Das ganze Gebiet bebte nun vor unermüdlichem Stöhnen. Summende Insekten flogen in dichten, dunklen Wolken, deren Form sich immerzu änderte, um die Leichname herum.
»Ich finde, wir sollten die Idee knicken, hier herumzuschnüffeln«, flüsterte Bull in Martys Ohr, während er den passierenden Strom Verwesender im Auge behielt.
Die nächsten waren nur noch wenige Meter von der Stelle entfernt, wo die Männer verharrten. Sie taumelten weiter, folgten blind den Anführern und näherten sich unaufhaltsam der Straße.
Marty nickte.
Die drei kauerten sich an der Mauer des Hauses hinter einem breiten Abfallbehälter nieder. Der Krach auf der Straße hinter ihnen ließ sie fast glauben, dass die Untoten die Häuser auf der Suche nach Lebenden mit bloßen Händen auseinandernehmen würden. Fensterscheiben brachen mit erschreckendem Klirren, und immer wieder erklang zersplitterndes Holz, wenn Türbalken einstürzten oder Möbel umgeworfen wurden, als die Meute durch den Ort wütete.
Die Männer sagten nichts, stellten sich aber insgeheim alle dieselbe Frage: Wie lange würde es wohl dauern, bis der Leichenmob auf die Parallelstraße übergriff und durch den Garten kam, in dem Marty, Danny und Bull gerade in Deckung gegangen waren?
»Wir müssen hier weg, Marty«, rief Danny während das Krachen und Knirschen hinter ihnen immer lauter wurde.
Doch Marty schüttelte den Kopf.
»Es sind immer noch zu viele von ihnen im Weg. Sie werden uns sehen.«
»Scheiß drauf, Marty. Die sehen uns doch so oder so, wenn sie …«
Danny verstummte plötzlich und warf einen Blick zurück. Er strengte seine Augen an, um etwas in der Dunkelheit erkennen zu können, und erblickte eine Leiche, die in die schmale Gasse gestolpert kam, die sie drei erst wenige Momente zuvor genommen hatten. Er stand auf und ging ein paar Schritte auf sie zu, während er seine lange Machete zog und überlegte, wie er sie angreifen sollte. Es war eine Frau. Er konnte ihre Gesichtszüge zwar nicht erkennen, doch ihre Stimme trug noch immer feminine Züge, obwohl sie nur noch grunzte und röchelte. Als sie ihn bemerkte, streckte sie beide Arme nach ihm aus, und er sah, dass diese in Stümpfen statt in Händen endeten. Danny zielte sorgfältig und stieß ihr die Klinge mitten ins Gesicht, während er seinen Fuß nach vorne anhob. Als er den Schädel der Frau bis zum Heft der Waffe aufgespießt hatte, versetzte er ihr einen kräftigen Tritt gegen die Brust, sodass sie rücklings in die Dunkelheit fiel.
»Wie ich schon sagte«, fuhr er fort, während er wieder neben den anderen in die Hocke ging. »Sie sehen uns sowieso, wenn sie aus der Straße kommen und hier über unsere Ärsche stolpern. Wir müssen sofort hier weg, Kumpel!«