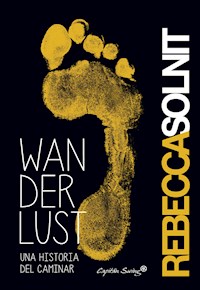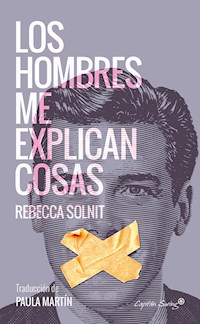9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Ich liebe dieses Buch, und viele andere werden das auch tun. Ein berauschender Streifzug durch Orwells Leben und seine Zeit – und durch das Leben und die Zeit der Rosen.» Margaret Atwood «Ein Buch über Abgründe und Erdbeeren – ein Buch über das Pflanzen von Rosen trotz des Zustands der Welt.» Der Spiegel «Neben meiner Arbeit interessiert mich am meisten das Gärtnern», schrieb George Orwell 1940. Mit Erstaunen erkennt Rebecca Solnit nach einem Besuch im Garten von Orwell, wo seine Rosen noch heute blühen, dass es die Natur war, die Orwell Kraft gab, unermüdlich anzuschreiben gegen Faschismus und Totalitarismus. Die Verquickungen von Macht und Schönheit führen Rebecca Solnit aus Orwells Garten zu den drängenden Fragen unserer Gegenwart, die sie bereits in den dreißiger Jahren angelegt sieht. Sie findet koloniale Hinterlassenschaften in Blumengärten, erkennt in Stalin mit seiner Besessenheit, Zitronen am Polarkreis züchten zu wollen, einen Vorläufer der «Klimaskeptiker» und sieht in der Rosenindustrie ein Paradebeispiel globalisierter Ausbeutung. Rebecca Solnit macht sich unerschrocken auf in neue Gefilde – ihre Lektüre sensibilisiert für unsere Welt, spendet Trost und stellt sich, trotz allem unerschütterlich optimistisch, den Herausforderungen unserer Zeit. «Orwells Rosen» ist eine bemerkenswerte Reflexion über Lebenslust und Schönheit als Widerstandsakt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rebecca Solnit
Orwells Rosen
Über dieses Buch
«Ich liebe dieses Buch, und viele andere werden das auch tun. Ein berauschender Streifzug durch Orwells Leben und seine Zeit – und durch das Leben und die Zeit der Rosen.» Margaret Atwood
«Neben meiner Arbeit interessiert mich am meisten das Gärtnern», schrieb George Orwell 1940. Mit Erstaunen erkennt Rebecca Solnit nach einem Besuch im Garten von Orwell, wo seine Rosen noch heute blühen, dass es die Natur war, die Orwell Kraft gab, unermüdlich anzuschreiben gegen Faschismus und Totalitarismus.
Die Verquickungen von Macht und Schönheit führen Rebecca Solnit aus Orwells Garten zu den drängenden Fragen unserer Gegenwart, die sie bereits in den dreißiger Jahren angelegt sieht. Sie findet koloniale Hinterlassenschaften in Blumengärten, erkennt in Stalin mit seiner Besessenheit, Zitronen am Polarkreis züchten zu wollen, einen Vorläufer der «Klimaskeptiker» und sieht in der Rosenindustrie ein Paradebeispiel globalisierter Ausbeutung.
Rebecca Solnit macht sich unerschrocken auf in neue Gefilde – ihre Lektüre sensibilisiert für unsere Welt, spendet Trost und stellt sich, trotz allem unerschütterlich optimistisch, den Herausforderungen unserer Zeit. «Orwells Rosen» ist eine bemerkenswerte Reflexion über Lebenslust und Schönheit als Widerstandsakt.
Vita
Rebecca Solnit, Jahrgang 1961, ist eine der bedeutendsten Essayistinnen und Aktivistinnen der USA. Sie ist Mitherausgeberin des Harper’s Magazine und schreibt regelmäßig Essays für den Guardian. Für ihre Werke erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den renommierten National Book Critics Circle Award. Ihr Essay «Wenn Männer mir die Welt erklären», auf dem der Begriff «mansplaining» beruht, ging um die Welt. Auf Deutsch erschienen von ihr zuletzt «Unziemliches Verhalten. Wie ich Feministin wurde» und «Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens».
Michaela Grabinger lebt in München. Zu den von ihr übersetzten Romanen und Sachbüchern zählen Werke von Anne Tyler, Meg Wolitzer, Elif Shafak, Michael Crichton, David Graeber, Alain de Botton und Ece Temelkuran.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Orwell's Roses» Copyright © 2021 by Rebecca Solnit
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Orwell's Roses» bei Viking, New York.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München,
nach dem Original von Penguin Random House
Coverabbildung Design: Jon Gray
ISBN 978-3-644-01415-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
IDer Prophet und der Igel
D. Collings, Die Ziege Muriel, 1939 (Porträt Orwells in Wallington.)
1Tag der Toten
Im Frühling 1936 pflanzte ein Schriftsteller Rosen. Ich hatte das seit mehr als dreißig Jahren gewusst, dachte aber erst an einem Novembertag vor einigen Jahren gründlich darüber nach, als ich mich auf ärztliche Anweisung hin eigentlich zu Hause in San Francisco hätte erholen sollen, stattdessen aber im Zug von London nach Cambridge saß, um mit einem Schriftstellerkollegen über eines meiner Bücher zu sprechen. Es war der 2. November, und dort, wo ich herkomme, feiert man diesen Tag als día de los muertos, den Tag der Toten. Meine Nachbarn zu Hause errichten den Verstorbenen des zurückliegenden Jahres zu diesem Anlass Altäre, die sie mit Kerzen, Speisen, Ringelblumen, Fotos und Briefen der Toten dekorieren, und abends ziehen die Leute durch die Straßen, erweisen den Dahingeschiedenen vor den im Freien stehenden Altären ihren Respekt und essen pan de muerto, das Brot der Toten. Einige haben sich nach der mexikanischen Tradition, die den Tod im Leben und das Leben im Tod sieht, ihr Gesicht wie blumengeschmückte Totenköpfe geschminkt. In vielen katholischen Ländern geht man an diesem Tag auf den Friedhof, richtet die Gräber her und schmückt sie mit Blumen. Wie früher zu Halloween werden auch hier die Grenzen zwischen Leben und Tod durchlässig.
Ich aber saß in einem Frühzug, der soeben King’s Cross in nördlicher Richtung verlassen hatte, und beobachtete durchs Fenster, wie sich Londons dichte Bebauung in immer niedrigere und weiter voneinander entfernt stehende Häuser auflöste. Dann fuhr der Zug über Ackerland mit grasenden Schafen und Kühen, Weizenfeldern und kleinen Gruppen kahler Bäume, eine wunderschöne Szenerie selbst unter dem winterlich grauen Himmel. Ich hatte einen Auftrag, vielleicht sogar eine Mission. Ich hielt für Sam Green, Dokumentarfilmer und einer meiner besten Freunde, Ausschau nach Bäumen – nach einem Cox-Orange-Pippin-Apfelbaum beispielsweise und anderen Obstbäumen. Sam und ich tauschten uns schon seit Jahren in vielen Gesprächen und noch mehr E-Mails über Bäume aus. Wir liebten sie beide, vielleicht würde er darüber irgendwann einen Dokumentarfilm drehen, oder wir würden zusammen ein Kunstprojekt daraus machen.
Bäume hatten Sam in dem schwierigen Jahr nach dem Tod seines jüngeren Bruders 2009 Trost gespendet, und ich denke, wir liebten beide ihre Ausstrahlung unerschütterlicher Beständigkeit. Ich war in einer sanften kalifornischen Hügellandschaft mit verschiedenen Eichenarten, Lorbeerbäumen und Rosskastanien aufgewachsen. Viele einzelne Bäume, die mir in meiner Kindheit vertraut waren, erkenne ich immer noch wieder, so wenig haben sie sich verändert und ich mich dagegen so sehr. Am anderen Ende des Countys liegt Muir Woods, der berühmte Wald aus uralten Küstenmammutbäumen, die unangetastet blieben, als die Wälder rundherum abgeholzt wurden, siebzig, achtzig Meter hohe Bäume, auf deren Nadeln sich an nebligen Tagen die Luftfeuchtigkeit niederschlägt und von dort als Sommerregen zu Boden tropft, der nur unter dem Dach der Baumkronen fällt, nicht im Freien.
In meiner Jugend waren Scheiben aus den Stämmen von Mammutbäumen mit einem Durchmesser von oft mehr als dreieinhalb Metern beliebte Ausstellungsstücke in Museen und Parks. Die Jahresringe dienten als Zeittafeln, auf denen Kolumbus’ Ankunft in Amerika oder die Besiegelung der Magna Carta, manchmal auch Jesus’ Geburt und Tod markiert waren. Der älteste Küstenmammutbaum in Muir Woods ist 1200 Jahre alt, sodass er schon die Hälfte seiner Jahre gelebt hatte, als die ersten Europäer*innen in der Gegend auftauchten, die sie dann Kalifornien nannten. Ein Baum, den man morgen pflanzen und der genauso lang leben würde, stünde noch im 23. Jahrhundert n. Chr. und wäre doch jung im Vergleich mit den Grannen-Kiefern ein paar hundert Kilometer weiter östlich, die fünftausend Jahre alt werden können. Bäume laden dazu ein, über die Zeit nachzudenken und in ihr zu reisen wie sie, indem man stillsteht und zur Seite und nach unten ausgreift.
Das Gegenteil von Krieg, falls es so etwas gibt, sind wohl Gärten. In Wäldern, auf Wiesen, in Parks und Gärten finden viele Menschen einen besonderen Frieden. Der Surrealist Man Ray floh 1940 vor den Nazis aus Europa und verbrachte die folgenden zehn Jahre in Kalifornien. Im Zweiten Weltkrieg besichtigte er die Sequoia-Wälder der Sierra Nevada und schrieb über diese Bäume, die dickere Stämme als die Küstenmammutbäume haben, aber nicht ganz so hoch sind: «Ihr Schweigen ist beredter als die tosenden Sturzbäche und die Niagarafälle, als der Wiederhall des Donners im Grand Canyon und als das Explodieren von Bomben – und es enthält keinerlei Drohung. Die tuschelnden Blätter der Mammutbäume, hundert Meter über unseren Köpfen, sind zu weit entfernt, als dass man sie hören könnte. Mir fiel ein, wie ich in den ersten Monaten nach Ausbruch des Krieges bei einem Spaziergang durch den Jardin du Luxembourg unter einer alten Kastanie stehen geblieben war, die wahrscheinlich schon die Französische Revolution miterlebt hatte – wie ein Zwerg kam ich mir vor und wünschte, ich könnte mich in einen Baum verwandeln, bis wieder Frieden wäre.»
Als Sam im Sommer vor meiner Englandreise in San Francisco war, sahen wir uns die Bäume an, die Mary Ellen Pleasant gepflanzt hatte, eine schwarze Frau, die um 1812 als Sklavin geboren wurde, Heldin der Underground Railroad und Bürgerrechtsaktivistin war, aber auch zur Geldelite San Franciscos gehörte. Als wir unter ihren Eukalyptusbäumen standen, die mir wie Zeugen einer ansonsten unerreichbaren Vergangenheit erschienen, lag Pleasants Tod mehr als ein Jahrhundert zurück. Die Bäume hatten das herrschaftliche Holzhaus überdauert, das Schauplatz mancher Dramen im Leben dieser Frau gewesen war. Ihre Stämme waren so dick, dass sie den Gehweg wegdrückten, und sie überragten die meisten Gebäude in der Umgebung. Die abgelöste graubraune Rinde hing in Spiralen herab, die sichelförmigen Blätter lagen auf dem Gehweg verstreut, und in den Kronen murmelte der Wind. Der Anblick dieser Bäume rückte die Vergangenheit wie nichts sonst in greifbare Nähe: Etwas Lebendes, gepflanzt und gehegt von einem Lebewesen, das längst tot war; die Bäume aus Pleasants Lebzeiten waren noch zu unseren lebendig und würden es wohl auch nach unserem Tod sein. Sie veränderten die Gestalt der Zeit.
Das etruskische saeculum bezeichnet die Lebensdauer des jeweils ältesten lebenden Menschen, also um die hundert Jahre. Im weiteren Sinne steht es für die Zeitspanne, die noch lebenden Menschen in Erinnerung ist. Jedes Ereignis hat sein Säkulum. Es endet mit dem Tod beispielsweise des letzten Menschen, der im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte, oder des letzten, der noch eine Wandertaube gesehen hat. Das Säkulum der Bäume ist anders – eine längere Zeitskala, eine tiefere Kontinuität, die Schutz vor unserer Vergänglichkeit bietet, so wie ein Baum im wörtlichen Sinn Schutz unter seinen Ästen gewährt.
In Moskau gibt es Bäume, die im Zarenreich gepflanzt wurden, wuchsen, im Herbst ihr Laub abwarfen, den Wintern trotzten, die im Frühling während der Russischen Revolution blühten, die Schatten spendeten in den Sommern des Stalinismus, der Säuberungen, der Schauprozesse, der Hungersnöte, des Kalten Kriegs, der Glasnost und des Zerfalls der Sowjetunion, die in den Herbstmonaten während des Aufstiegs von Stalinbewunderer Wladimir Putin ihre Blätter verloren und Putin, Sam, mich und alle, die an jenem Novembermorgen mit mir im Zug saßen, überleben werden. Die Bäume erinnerten sowohl an unsere Vergänglichkeit als auch an ihre Beständigkeit, die die unsere so weit übertraf, und standen aufrecht wie Wächter und Zeugen da.
Als wir damals im Sommer bei mir zu Hause saßen und über Bäume sprachen, erwähnte ich einen von George Orwell verfassten Essay, den ich schon seit Langem besonders schätzte. Der mit leichter Hand verfasste, poetisch anmutende kurze Text war im Frühjahr 1946 in Orwells Kolumne «As I Please» in der Tribune erschienen, einer sozialistischen Wochenzeitschrift, für die er von 1943 bis 1947 ungefähr achtzig Beiträge schrieb. Der Essay vom 26. April 1946 mit dem Titel «A Good Word for the Vicar of Bray», Ein gutes Wort für den Pfarrer von Bray, ist ein Triumph der Abschweifung. Am Anfang steht die Beschreibung einer Eibe in einem Kirchhof in Berkshire. Angeblich hatte den Baum ein Pfarrer gepflanzt, der wegen seiner Sprunghaftigkeit in politischen Dingen Berühmtheit erlangt und in den Religionskriegen wiederholt die Seiten gewechselt hatte. Diese Sprunghaftigkeit sicherte dem Mann sein Überleben und ermöglichte es ihm, ganz wie ein Baum zu bleiben, wo er war, während viele andere fielen oder flohen.
Orwell schreibt über den Pfarrer: «Doch nach der langen Zeit sind von ihm nur ein satirisches Lied und ein wunderschöner Baum geblieben, der den Blick vieler Generationen zur Ruhe brachte und alle schlimmen Auswirkungen der politischen Prinzipienlosigkeit dieses Menschen sicherlich wettmacht.» Von da aus springt Orwell zum letzten König von Burma und erwähnt dessen angebliche Vergehen, um gleich darauf über die Bäume zu sprechen, die der König in Mandalay pflanzte – «Tamarinden, die einen angenehmen Schatten warfen, bis sie 1942 von den Brandbomben der Japaner zerstört wurden». Orwell war Polizeibeamter in Diensten des Britischen Empire gewesen und muss sowohl diese Bäume in den 1920er Jahren als auch die von ihm beschriebene riesige Eibe im Kirchhof von Bray, einem Dorf westlich von London, selbst gesehen haben.[*]
«Wer einen Baum pflanzt», schreibt er weiter, «insbesondere einen langlebigen Laubbaum, macht der Nachwelt ein Geschenk, das kaum Geld und fast keine Mühe kostet, und schlägt der Baum Wurzeln, wird er die sichtbare Auswirkung alles Übrigen, was dieser Mensch in seinem Leben an Gutem oder Bösem getan hat, weit übertreffen.» Dann erwähnt er die preiswerten Rosen und Obstbäume, die er zehn Jahre zuvor selbst gepflanzt und sich eben erst wieder angesehen hatte. Er betrachte sie, schreibt er, als sein bescheidenes botanisches Geschenk für die Nachwelt. «Einer der Obstbäume und ein Rosenstrauch sind eingegangen, aber der Rest gedeiht. Insgesamt sind es fünf Obstbäume, sieben Rosen- und zwei Stachelbeersträucher, alles für zwölf Shilling und einen Sixpence.[*] Die Pflanzen haben kaum Arbeit gemacht und keine weiteren Ausgaben verursacht. Nicht einmal gedüngt wurden sie, abgesehen von dem, was der eine oder andere Ackergaul vor dem Gartentor hinterließ und hin und wieder von mir in einen Eimer eingesammelt wurde.»
Die letzte Zeile hatte in mir das Bild des Autors mit einem Eimer heraufbeschworen und dahinter ein Gartentor, an dem Pferde vorbeitrabten, aber wo und wie er damals lebte und warum er Rosen zog, darüber machte ich mir keine Gedanken. Doch der Essay hatte mich seit der ersten Lektüre beeindruckt und bewegt. Ich hielt ihn für die flüchtige Spur eines noch nicht ausgereiften, noch nicht entfalteten Orwells, eine Spur dessen, der er in weniger turbulenten Zeiten vielleicht hätte sein können. Doch da irrte ich mich.
Sein ganzes Leben war durchsetzt von Kriegen. Er wurde am 25. Juni 1903 geboren, gleich nach dem Burenkrieg, und kam während des Ersten Weltkriegs ins Jugendalter (ein patriotisches Gedicht, das er mit elf schrieb, war sein erster publizierter Text). Die Russische Revolution und der Irische Unabhängigkeitskrieg tobten bis in die zwanziger Jahre und in sein frühes Erwachsenenleben hinein. In den dreißiger Jahren sah er den Feuersturm des Zweiten Weltkriegs nahen, kämpfte 1937 im Spanischen Bürgerkrieg, lebte während der deutschen Luftangriffe in London und wurde selbst ausgebombt, prägte 1945 den Begriff Kalter Krieg und erlebte in den letzten Jahren vor seinem Tod am 21. Januar 1950, wie dieser Kalte Krieg und die damit verbundenen Atomwaffenarsenale immer bedrohlicher wurden. Diese Konflikte und Bedrohungen beanspruchten einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit – aber nicht die gesamte.
Auf den Essay über das Bäumepflanzen war ich in einem dicken, hässlichen, mit vielen Eselsohren verunzierten Taschenbuch mit dem Titel The Orwell Reader, Das Orwell-Lesebuch, gestoßen. Ich hatte es mit ungefähr zwanzig in einem Antiquariat günstig gekauft und im Lauf mehrerer Jahre nach und nach durchgelesen, wurde nach und nach mit Orwells Stil und Ton vertraut und lernte seine Ansichten über andere Autoren, über Politik, Sprache und Schreiben kennen; ein Buch, das mich schon so früh faszinierte, dass es mich auf dem verschlungenen Weg, der mich selbst zum Schreiben von Essays führte, stark beeinflusste. Orwells 1945 erschienene Fabel Farm der Tiere hatte ich schon als Kind gekannt; ich las den Roman zuerst als eine Tiergeschichte und betrauerte den Tod von Boxer, dem treuen Pferd. Dass es sich um eine Allegorie handelte, die den Niedergang der Russischen Revolution hin zum Stalinismus meinte, wusste ich damals nicht.
Als Teenager hatte ich 1984 gelesen und war in meinen Zwanzigern auf Mein Katalonien gestoßen, Orwells Augenzeugenbericht über den Spanischen Bürgerkrieg. Letzteres Werk hatte großen Einfluss auf mein zweites Buch, Savage Dreams, weil es beispielhaft zeigt, wie man die Unzulänglichkeiten der eigenen Seite ehrlich betrachten und dennoch loyal bleiben kann und wie sich persönlich Erfahrenes bis hin zu Zweifel und Unbehagen in eine politische Erzählung einbetten lässt – wie man also im Großen, Historischen Raum für das Kleine, Subjektive schaffen kann. Doch obwohl Orwell einer meiner wichtigsten literarischen Einflüsse war, wusste ich über ihn nur das, was er in seinen Büchern preisgegeben hatte und was an Vermutungen kursierte.
Der Essay, von dem ich Sam erzählt hatte, war ein Loblied auf das Säkulum der Bäume und drückte die Hoffnung aus, dass die Menschen etwas zur Zukunft beitragen und, mehr noch, ihr sogar im Jahr nach den ersten Atombombenabwürfen ein gewisses Vertrauen entgegenbringen würden. «Schon ein Apfelbaum lebt ungefähr hundert Jahre. Der Cox, den ich 1936 gepflanzt habe, wird also aller Voraussicht nach noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein Früchte tragen. Eichen und Buchen können mehrere Jahrhunderte alt werden und Tausenden, ja Zehntausenden Menschen Freude bereiten, bevor man sie schließlich zersägt. Was nicht heißen soll, dass man sich mittels privater Wiederaufforstung aller Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft entledigen kann. Trotzdem ist es vielleicht keine schlechte Idee, sich jede unsoziale Handlung, die man begeht, im Tagebuch zu notieren und dann zur richtigen Jahreszeit eine Eichel in den Boden zu drücken.» Das ist der Ton, den man in seinem Werk häufig findet, ein lässiges Schlendern vom Besonderen zum Allgemeinen und vom Kleinen zum Großen – in diesem Fall von einem bestimmten Apfelbaum zu den universellen Fragen von Wiedergutmachung und Vermächtnis.
Als ich Sam in dem Gespräch über Bäume an jenem Sommertag von Orwells Garten erzählte, wurde er neugierig, und wir setzten uns an meinen Computer, um herauszufinden, ob die fünf Obstbäume noch existierten. Schon nach wenigen Minuten hatten wir die Adresse des Häuschens, in das Orwell im April 1936 gezogen war, und zoomten es auf einer Onlinekarte heran. Allerdings zeigten die Luftaufnahmen nur undeutliche grüne Laubkleckse, was wir in Erfahrung bringen wollten, war nicht zu erkennen.
Sam schrieb einen Brief an die unbekannten Bewohner des Häuschens, dessen Umgebung sehr viel ländlicher war, als ich sie mir all die Jahre seit meiner ersten Lektüre des Essays vorgestellt hatte. Er betonte in seiner unnachahmlichen Ausdrucksweise, wir seien keine «Spinner», und fügte die Links zu seiner und meiner Website hinzu, um zu zeigen, dass wir nachweislich Leute waren, die sich schon lange für abseitige Fakten interessierten und historische Berührungspunkte recherchierten. Als ich ein paar Haltestellen vor Cambridge in Baldock, Hertfordshire, aus dem Zug stieg, hatten wir noch immer keine Antwort auf unseren Brief erhalten, und die Aussicht, gleich an die Tür des Häuschens zu klopfen, machte mich leicht zittrig und nervös. Aber ich freute mich trotzdem darauf.
Hinter mir lag ein anstrengendes Jahr. Ich war nicht nur erschöpft, sondern auch ernsthaft krank und hätte mich eigentlich zu Hause erholen sollen. Doch obwohl ich mir das ganze Jahr hindurch unsicher gewesen war, wie viele Lesereisen ich absolvieren sollte, hatte ich einen britischen Vertrag unterschrieben, der im seitenlangen Kleingedruckten einen Passus enthielt, dem zufolge ich mindestens zehntausend Pfund zu zahlen hätte, falls ich nicht auftauchte. Mir war also nichts übrig geblieben, als nach London zu fliegen und über Politik und Ideen zu sprechen, während ich ständig befürchtete, auf der Straße in Ohnmacht zu fallen oder auf offener Bühne zusammenzubrechen. Da ich nun schon so weit reisen würde, hatte ich mich bereit erklärt, auch nach Manchester zu fahren, um den Norden nicht zu vernachlässigen, sowie nach Cambridge zu einer Podiumsdiskussion mit meinem alten Freund und Kollegen Rob Macfarlane.
Nun war ich kurz davor zu finden, was ich auf dieser am liebsten abgesagten Reise gar nicht gesucht hatte. Als ich dem Taxifahrer die Adresse nannte, wusste er sofort den Weg. Die Fahrt, die in dem alten Marktflecken begann und durch die sanfte Hügellandschaft von Hertfordshire führte, hätte ruhig länger dauern dürfen, da mich die bevorstehende Ankunft nervös machte und die Felder, an denen wir in hohem Tempo vorbeifuhren, bezaubernd waren. Doch schon nach kurzer Zeit hatten wir das Dorf Wallington erreicht – oder das, was ich davon zu sehen bekommen würde: einen von kleinen Häusern gesäumten Feldweg. Der Taxifahrer deutete auf einen Mann, der draußen stand, und sagte: «Da ist ja Graham. Kommen Sie, ich stelle Sie ihm vor.»
Fast rechnete ich mit einer Abfuhr oder einem Vorwurf – wahrscheinlich fühlt sich jeder, der das frühere Haus eines berühmten Autors bewohnt, im Belagerungszustand. Ich sah mich schon verstohlen über irgendwelche Zäune hinweg nach Obstbäumen Ausschau halten oder höchstens ein, zwei Fragen an der Tür stellen, doch Graham Lamb, ein schmaler älterer Herr mit grauen Locken und schottischem Akzent, begrüßte mich fröhlich. Er erinnerte sich an Sams Brief, bat um Entschuldigung für die ausgebliebene Antwort – er sei noch dabei, Unterlagen zusammenzutragen, die er uns schicken wollte –, führte mich hinter das Haus in den Garten, wo seine Lebensgefährtin Dawn Spanyol gerade arbeitete, und machte uns miteinander bekannt.
Dawn war auf das Haus gestoßen, als es einige Jahre zuvor zum Verkauf stand, und hatte Graham davon erzählt, der es sich sofort ansah. Da es klein, eng und somit für Ferienaufenthalte der Verwandtschaft ungeeignet war und deren Kriterien hinsichtlich der Nähe zum Meer, zu Pubs und Geschäften in keiner Weise erfüllte, hatten sie es vom Fleck weg gekauft. Immerhin sei ihr Häuschen früher ein Laden und das Haus nebenan ein Pub gewesen, scherzten die beiden, und Graham gefiel das literarische Erbe, Dawn der Garten. Außerdem stehe es in einem Dorf voller Menschen, die irgendwann einmal ganz woanders leben würden. Die Obstbäume gab es nicht mehr; man hatte sie in den Neunzigern gefällt, um den Schuppen vergrößern zu können. Doch Nigel, der Nachbar, lebte schon viel länger dort. Wir gingen hinüber, sagten Hallo, flanierten ein bisschen durch seinen Garten und spähten von der anderen Seite in den von Graham und Dawn hinüber. Die Obstbäume waren ihm zwar in Erinnerung, gehörten in sein Säkulum, aber er wusste kaum etwas darüber zu sagen, außer dass sie früher dort drüben gestanden hatten, wo jetzt nur noch feuchte, halb vermoderte und von Efeu überwucherte Stümpfe zu sehen waren, möglicherweise die letzten Spuren einiger dieser Bäume.
Wir gingen ins Haus, wo mir Graham eine dreißig oder vierzig Jahre alte Luftaufnahme in Farbe zeigte. Auch auf diesem Foto waren alle Bäume nur grüne Kleckse, aber man erkannte, dass die Obstbäume damals schon nicht mehr standen. Die Wände im Haus waren weiß verputzt und von dunklen Holzbalken durchzogen, die Zimmer klein, die Decken niedrig. Das Ganze war so malerisch und anheimelnd, dass ich es kaum mit Orwell zusammenbrachte, denn in den meisten Beschreibungen wirkt das Haus eher düster. Außerdem verfügte es 1936 über keinerlei modernen Komfort – es gab kein Gas, keinen Strom, keine Innentoilette, und das inzwischen reetgedeckte Dach bestand noch aus Blech. Trotzdem wohnte Orwell sehr gern dort, soweit ich weiß. Graham zeigte mir den niedrigen Türrahmen zwischen der Küche und dem Zimmer daneben, in dem Orwell gearbeitet hatte, und den Raum dahinter, der zu Orwells Zeit ein Dorfladen gewesen war und nun als Wohnzimmer diente. Der groß gewachsene Autor musste sich jedes Mal gebückt haben, um nicht mit dem Kopf an den Sturz zu stoßen. Die Tür hatte Schlitze, durch die er vom Schreibtisch aus in den Laden hineinsehen konnte, wenn Kundschaft hereinkam.
Die Bäume im Garten waren verschwunden, doch nachdem wir mit Nigel gesprochen, die Stümpfe besichtigt und das Foto betrachtet hatten, hieß es plötzlich, Orwells Rosen seien noch da. Die überraschende Mitteilung ließ mich aufhorchen, und meine leichte Enttäuschung über die verschwundenen Obstbäume wich aufgeregtem, beschwingtem Interesse. Wir gingen zurück in den Garten, wo sogar noch an diesem Novembertag zwei große wuchernde Rosensträucher blühten, der eine mit zaghaft geöffneten blassrosa Knospen, der andere mit nahezu lachsfarbenen Blüten, deren Blätter unten einen goldgelben Rand aufwiesen. Diese angeblich achtzig Jahre alten Rosen – Lebewesen, gepflanzt von der lebendigen Hand (und dem Spaten) eines Menschen, der schon den Großteil ihrer Existenz tot war – strotzten vor Leben. Graham erzählte mir, die Rosen gediehen so üppig, dass die Schullehrerin Esther Brookes, die das Häuschen 1948 nach Orwells Mietkündigung gekauft hatte, die Knospen eines der beiden Sträucher als Eintrittskarten für das Dorffest verwendet habe. 1983 wusste sie zu vermelden, die von Orwell gepflanzte Albertine-Rose sei «das Glanzstück des Gartens» und «blüht noch immer».
Orwells Rosen blühten auch im November 1939, als er in seinem Haushaltstagebuch notierte: «Den restlichen Phlox heruntergeschnitten und die Chrysanthemen, die es umgeweht hat, zusammengebunden. Jetzt im Winter kann man nachmittags kaum etwas tun. Chrysanthemen voll erblüht, hauptsächlich dunkelrot-braun und ein paar hässliche lila-weiße, die ich nicht behalten werde. Die Rosen versuchen noch immer zu blühen, ansonsten keine Blüten mehr im Garten. Die Bergastern sind hinüber, habe sie zum Teil heruntergeschnitten.» Fast alle, die Orwell noch kannten, sind tot, doch die Rosen bilden eine Art Säkulum, das auch ihn umfasst. Plötzlich war ich ganz unversehens bei ihm und bei einem lebenden Relikt des Essays, und meine bisherigen Annahmen über ihn waren hinfällig.
Die Unmittelbarkeit der Verbindung dieser beiden Pflanzen mit ihm und dem lang zuvor verfassten Essay über Rosen und Obstbäume, über Beständigkeit und die Nachwelt versetzte mich ebenso in Hochstimmung wie die Tatsache, dass dieser Mann, der so berühmt für seine hellsichtigen Analysen von Totalitarismus und Propaganda war, für seine Haltung gegenüber unschönen Fakten, für seine schnörkellose Prosa und für bedingungslose Treue zu seiner politischen Einstellung, Rosen gepflanzt hatte. Dass ein Sozialist, ein Utilitarist oder überhaupt ein pragmatischer oder praktisch veranlagter Mensch Obstbäume pflanzt, ist nicht erstaunlich: Sie haben einen konkreten ökonomischen Wert und produzieren die notwendige Ware Essen, wenn nicht sogar mehr. Aber eine Rose zu pflanzen – im Fall des von Orwell 1936 neu angelegten Gartens anfangs sogar sieben Rosensträucher, denen weitere folgten –, kann vieles bedeuten.
Ich hatte über diese Rosen, auf die ich mehr als dreißig Jahre zuvor in meiner Lektüre gestoßen war, nicht gut genug nachgedacht. Sie waren Rosen, aber sie waren auch Saboteure meiner lang anhaltenden konventionellen Sicht auf Orwell und damit die Aufforderung, tiefer zu schürfen. Sie verkörperten die Frage, wer er gewesen war und wer wir waren und wie Freude, Schönheit und Stunden ohne messbares praktisches Resultat zum Leben eines Menschen – vielleicht jedes Menschen – passten, dem gleichzeitig Gerechtigkeit, Wahrheit, die Menschenrechte und der Versuch, die Welt zu verändern, am Herzen lagen.
2Flower-Power
Es gibt zahlreiche Biografien über Orwell, und sie haben mir alle geholfen bei der Arbeit an diesem Buch, das sich aber nicht zu ihnen gesellt. Mein Buch besteht aus Streifzügen mit immer demselben Ausgangspunkt: der Geste des Rosenpflanzens, ausgeführt von einem Schriftsteller. Deshalb ist es auch ein Buch über die Rose, einmal als Bewohnerin des Pflanzenreichs, dann aber auch als eine Blume, um die herum ein riesiges Gebäude menschlicher Resonanzen von Lyrik bis zu Industrie entstanden ist. Rose – der Begriff bezeichnet eine häufig vorkommende Wildpflanze, umfasst aber auch die zahlreichen Arten einer Pflanze, die weithin domestiziert ist und Jahr für Jahr die Züchtung neuer Varianten erlebt, was sie obendrein zu einem glänzenden Geschäft macht.
Rosen bedeuten alles und damit fast nichts. Sie wurden für große Aussagen benutzt, vom mittelalterlichen Philosophen Petrus Abaelardus, dem die Rose bei der Untersuchung der Allgemeinbegriffe als Beispiel diente, bis zu Gertrude Steins «Rose is a rose is a rose». Die Ethnologin Mary Douglas schrieb, so wie alles ein Symbol für den Körper sei, sei der Körper ein Symbol für alles andere. Dasselbe gilt für die Rosen in der westlichen Welt. Ihre bildliche Omnipräsenz macht sie buchstäblich zur Tapete; dargestellt werden sie überall, ob auf Unterwäsche oder Grabsteinen. Faktisch existierende Rosen finden beim Liebeswerben, bei Hochzeiten, Begräbnissen, Geburtstagen und vielen anderen Gelegenheiten Verwendung, stehen also für Freude, Trauer und Verlust, für Hoffnung, Sieg und Vergnügen. Nachdem der schwarze Bürgerrechtler und Kongressabgeordnete John Lewis im Sommer 2020 gestorben war, wurde sein Sarg von einem Pferdegespann über die Brücke in Alabama gezogen, auf der Bundespolizisten Lewis bei einem Protestmarsch fast zu Tode geprügelt hatten. Die auf der ganzen Wegstrecke verstreuten roten Rosenblütenblätter symbolisierten jenes Blutvergießen.
Sie treten aber nicht nur als Ornament auf, sondern sprießen auch in Aphorismen, Gedichten und Popsongs. Blumen sind oft Sinnbild von Vergänglichkeit und Sterblichkeit, beispielsweise auf den weit verbreiteten Vanitas-Gemälden im Europa des 17. Jahrhunderts mit ihren detailreich ausgeführten Bouquets, die häufig zusammen mit Totenschädeln, Obst und anderen Gegenständen abgebildet sind, die an die Untrennbarkeit von Blüte und Verfall, Leben und Tod gemahnen. In Liedern stehen Rosen oft für die Liebe und für den geliebten Menschen als etwas Kostbares, das sich nicht nehmen oder halten lässt. «La vie en Rose», «Ramblin’ Rose», «My Wild Irish Rose», «(I Never Promised You a) Rose Garden», «A Rose Is Still a Rose», «Days of Wine and Roses» – alles berühmte Songs vergangener Jahrzehnte. In «A Good Year for the Roses» von 1970, dem wundervoll schwermütigen Hit des Countrysängers George Jones, sind die unverdrossen weiterblühenden Rosen beständiger als seine darin besungene Ehe.
Zu den Besonderheiten der Rosen gehören ihre Dornen, die wohl mit ein Grund dafür sind, dass diese Blumen gelegentlich zu kapriziösen Schönheiten oder Femmes fatales vermenschlicht werden, etwa die selbstgefällige Rose, das Liebesobjekt in Antoine de Saint-Exupérys Der kleine Prinz. In der Grimm’schen Fassung des Märchens Dornröschen sterben die erfolglosen Verehrer in der Dornenhecke, die den Turm mit der schlafenden Prinzessin umgibt, doch kaum erscheint der richtige Kandidat, verwandeln sich die Dornen in Blüten. Während die Blüte verlockend wirkt, schrecken die Dornen ab oder fordern einen Preis für die Verlockung. «Wahrheiten und Rosen haben Dornen», heißt es in dem alten Aphorismus, und das Gedicht «Roses Only», Nur für Rosen, von Marianne Moore, das sich, wie überhaupt erstaunlich viele Gedichte, direkt an die Rose richtet, endet mit den Worten: «Die Dornen sind das beste Teil an dir.» Mittelalterliche Theologen mutmaßten, im Garten Eden habe es Rosen gegeben; Dornen seien ihnen allerdings erst nach dem Sündenfall gewachsen.
Obwohl die Blüten als die Sexualorgane der Pflanzen häufig sowohl über männliche als auch über weibliche Geschlechtsteile verfügen, werden sie meist als weiblich dargestellt, und was als weiblich gesehen wird, gerät oft in die Ecke des Dekorativen, Belanglosen. Vielleicht ereilt dieses Schicksal Blumen, die man abschneidet, um sie als Altar- oder Tischschmuck zu verwenden, weil sie aus dem Lebenszyklus der Pflanze herausgerissen werden und keine Frucht, keine Samen, keine nächste Generation mehr hervorbringen können. Wahrscheinlich sind Schnittblumen aber gerade wegen ihrer Nutzlosigkeit – abgesehen von der Freude, die sie bereiten – das ideale Geschenk, das die Großzügigkeit und den Antiutilitarismus des Gebens verkörpert. Doch Blumen haben Macht, und unser aller Leben ist mit ihnen verflochten, ob uns das bewusst ist oder nicht.
Es gibt eine kulturelle Sicht auf Blumen, die sie als zart, banal und entbehrlich wahrnimmt – und eine wissenschaftliche, der zufolge Blütenpflanzen mit ihrem Erscheinen auf der Erde vor etwa zweihundert Millionen Jahren eine Revolution einleiteten, die Landfläche von der Arktis bis in die Tropen dominieren und für den Menschen überlebenswichtig sind. «Wie die Blütenpflanzen die Erde eroberten» heißt ein kürzlich erschienener wissenschaftlicher Artikel. Die Blüten sind die Fortpflanzungsorgane der als Angiospermen bezeichneten Pflanzen, die Samen das Ergebnis dieser sexuellen Reproduktion. Und sie, die Samen, spielten in oben erwähnter Revolution eine mindestens ebenso große Rolle. Angiosperme bedeutet Bedecktsamer, und diese «Bedeckungen» – häufig eine äußere Schutzhülle, immer ein Nahrungspäckchen im Inneren des Samens, das die entstehende Pflanze versorgt, gegebenenfalls Flügel, Kletten oder andere Hilfsmittel, die der Ausbreitung dienen – eröffneten Fortpflanzungsmethoden, die belastbarer, vielfältiger und mit größerer Mobilität verbunden waren als die früherer Pflanzen. Die Blütenpflanzenarten verfügten über variantenreichere Überlebens- und Verbreitungstechniken; außerdem eigneten sich die Samen gut als Nahrung für andere Lebewesen. In einem Essay, der mich als Jugendliche stark beeindruckt hat, behauptete der Paläontologe und Schriftsteller Loren Eiseley vor mehr als einem halben Jahrhundert, dass die Blütenpflanzen die Evolution der Säugetiere und Vögel enorm vorangebracht hätten.
«Das rasch reagierende, hochentwickelte Hirn der warmblütigen Vögel und Säugetiere verlangt reichlich Sauerstoff und konzentrierte Nahrung, sonst überdauern sie nicht», erklärte er in einem Kapitel seines Buchs Die ungeheure Reise, das mit «Blumen verändern die Welt» überschrieben ist. «Aber erst die blühende Pflanze konnte solche Energien liefern, und ihr Auftreten veränderte daher den Gesamtcharakter des Lebens. Kein Wunder, dass erst mit den Blumen auch die Vögel und Säuger erschienen.» Insekten, die mit Blumen koevolutionierten, erhielten für ihre Bestäubungsdienste Pollen und Nektar; das Gleiche galt für Vögel und Fledermäuse, die ja bei der Nahrungsaufnahme an Blüten ebenfalls bestäuben. Derartige Beziehungen wurden so wichtig, dass bestimmte Arten in wechselseitige Abhängigkeit gerieten und einige gewissermaßen monogame Beziehungen miteinander entwickelten, etwa der Stern von Madagaskar, eine Orchidee mit einem langen Sporn, der nur von einer ganz bestimmten Falterart mit einem entsprechend langen Saugrüssel bestäubt werden kann, oder die Blaugrüne Palmlilie, die sich seit vierzig Millionen Jahren ausschließlich auf den Falter Tegeticula yuccasella als Bestäuber verlässt, während die Samen der Pflanze diesem Falter als einzige Nahrung für seine Raupen dienen. Auch für viele andere Arten bilden Samen eine wichtige Nahrungsquelle – nicht zuletzt für den Menschen, denn Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst und Gemüse wie Kürbisse, Tomaten, Paprika und der ganze Rest sind, was wir oft vergessen, samentragende Früchte. Auch Samen selbst haben Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil entwickelt, beispielsweise Beeren, die von Vögeln gefressen werden, die dann die unverdauten Samen weit von der Mutterpflanze entfernt aussäen. Durch die einander ergänzenden Beziehungen zwischen Angiospermen und Tieren entstand Eiseley zufolge eine größere Komplexität und Vernetzung, und die konzentrierte Nahrung beschleunigte die Evolution der Säugetiere.
Während ich dies schreibe, nasche und nippe ich hin und wieder an meinem Frühstück, das sich schon lange aus folgenden Bestandteilen zusammensetzt: Tee aus indischen Teeblättern, Toast aus Weizen, Roggen und irgendwelchen anderen Körnern, Milch, Butter, Joghurt von Kühen aus der Region, deren Weiden ich gut kenne, sowie Honig von Bienen – eine idyllische Landschaft auf einem Teller. Der Großteil unserer Nahrung stammt entweder von angiospermen Pflanzen oder, im Fall einer nichtveganen Ernährung, von Tieren, die sich von Angiospermen ernährt haben. Dass auch wir Menschen die Blumen so anziehend finden, ist wahrscheinlich evolutionär bedingt. Unser Leben ist eng mit ihnen verbunden, wir haben sie domestiziert und gezüchtet, damit sie sich vermehrten und unterschiedliche Größen, Formen, Farben und Düfte entwickelten. Unser Leben hängt zwar nicht gerade von Blumen, durchaus aber von Blütenpflanzen ab.
Rosen sind nirgendwo auf der Erde ein wichtiges Nahrungsmittel für den Menschen, aber ihre Blütenblätter tauchen in mittelalterlichen Rezepten auf, und aus ihren Früchten werden bis heute Tees und andere Getränke hergestellt. Das britische Ministerium für Ernährung (in dem Orwells Ehefrau Eileen O’Shaughnessy Blair arbeitete) rief im Zweiten Weltkrieg dazu auf, Hagebutten zu sammeln, um das Land, das keine Nahrungsmittel und vor allem keine Zitrusfrüchte mehr importieren konnte, mit Vitamin C zu versorgen. Bis 1942 waren angeblich zweihundert Tonnen und somit 134 Millionen Hagebutten zusammengekommen, die meist zu Sirup verarbeitet wurden. Das Ministerium veröffentlichte aber auch Rezepte für selbst gemachte Hagebuttenmarmelade, wie sie in Deutschland bis heute gern gegessen wird. Und natürlich werden Rosen für Parfüms und Duftöle verwendet.
Sie gehören zur Familie der Rosaceae, der Rosengewächse, die mehr als viertausend Arten umfasst, darunter Äpfel, Birnen, Quitten, Aprikosen, Pflaumen, Pfirsiche, aber auch die stacheligen Brombeeren und Himbeeren, deren Blüten denen der Wildrosen ähneln. Die Wildrosenblüte hat, wie die Obstbaumblüte, fünf Blätter. Die bekannten vielblättrigen Formen entwickelten sich in China, Europa und im Nahen Osten durch zufällige Mutationen. Im dritten Jahrhundert v. Chr. schrieb der Philosoph Theophrast: «Die meisten haben fünf Blütenblätter, doch einige zwölf oder zwanzig und wieder andere noch sehr viel mehr. Denn es soll welche geben, die sogar hundertblättrig genannt werden.» Auch Plinius d.Ä. erwähnte dreihundert Jahre später hundertblättrige Rosenblüten.
Im Lauf der vergangenen Jahrhunderte haben Rosenzüchter Varianten dieser Formen hervorgebracht, sodass heute Tausende unterschiedliche Rosen existieren, von alten Moschus-, Damaszener- und Albarosen bis hin zu den unzähligen aktuellen Versionen der Teerosen-Hybriden, von kleinen Rosen bis hin zu wuchtigen Kohlrosen. Es gibt einzeln und in Büscheln blühende Rosen, Strauch- und Kletterrosen, reinweiße und leicht düster wirkende mauvefarbene und violette sowie ein riesiges Spektrum an Karmesin-, Pink-, Rot- und Gelbtönen und Düfte mit süßlicher, würziger, zitroniger, myrrhenähnlicher und moschusartiger Note. Noch als Schmuck stehen Rosen für das Leben, für Fruchtbarkeit, Sterblichkeit, Vergänglichkeit und Verschwendung und gehen als Zeichen all dessen in Kunst, Ritual und Sprache ein.
3Flieder und Nazis
Am 2. April 1936, wenige Monate vor seinem dreiunddreißigsten Geburtstag, war Orwell gerade in Wallington eingetroffen. Er hatte das Haus erst kurz zuvor gemietet; nun legte er einen Garten an und damit ein Leben. Jener Frühling war eine Zeit zwischen zwei Reisen, die ihn politisch wachrütteln und auf den Weg zum politischen Journalisten, Essayisten und zuletzt einflussreichen Autor bringen würden. Zum ersten Mal ließ er sich nieder und bezog ein Haus, in dem er länger als in jedem anderen bleiben und zum ersten Mal so leben würde, wie er wollte: mit einem Garten, einer Frau, auf dem Land und vorwiegend vom Schreiben.
Orwells Leben war auffällig episodisch, was häufig geografisch bedingt war. Geboren wurde er in Nordindien, wo sein Vater zurückblieb, während der Sohn seine ersten Kindheitsjahre mit seiner Mutter in mehreren hübschen englischen Kleinstädten verbrachte. Das Zusammenleben mit ihr und seinen beiden Schwestern endete, als er als Achtjähriger für fünf Jahre auf ein Internat geschickt wurde, wo er aufgrund des zur Hälfte erlassenen Schulgelds schikaniert, bloßgestellt und auf ein Stipendium für den kostenlosen Besuch einer Eliteschule hin gedrillt wurde. Noch immer traurig und verbittert darüber schrieb er seine Erinnerungen an diese Erlebnisse gegen Ende seines Lebens nieder. Mit dreizehn wurde ihm ein Stipendium für Eton zuerkannt, die berühmteste Eliteschule des Landes. Dort verbrachte er weitere vier Jahre und gewöhnte sich einen Akzent an, der ihn zum Außenseiter unter den Armen machte, nicht aber zugehörig zu den Reichen. Weil er sich danach keine Stipendien mehr erarbeiten konnte oder wollte und seiner Familie das Geld für ein Universitätsstudium fehlte, musste er sich Arbeit suchen.
Mit neunzehn trat er in den Dienst der britischen Polizei in Burma ein und blieb fünf Jahre. Auf einem Foto, das ihn mit den Kollegen zeigt, wirkt er in seiner militärisch anmutenden Uniform stattlicher und besser gekleidet als jemals sonst in seinem Leben. Sein Job bestand darin, die lokale Bevölkerung zum Gehorsam gegenüber einer ungeliebten Kolonialverwaltung zu zwingen. Später schrieb er darüber in seinem Roman Tage in Burma sowie in den Essays «Einen Elefanten erschießen» und «Einen Mann hängen». 1927 kehrte er aus einem krankheitsbedingten Heimaturlaub nicht mehr zurück. Dreizehn Jahre später schrieb er über seine Tätigkeit in Burma: «Ich quittierte den Dienst teilweise deswegen, weil das Klima meine Gesundheit ruiniert hatte, teilweise, weil ich bereits vage Vorstellungen vom Bücherschreiben hegte, hauptsächlich aber, weil ich auf keinen Fall länger einem Imperialismus dienen konnte, den ich inzwischen als einen ziemlich großen Volksbetrug durchschaut hatte.» Dass er bald darauf nach Paris fuhr, hing wahrscheinlich mit seinen literarischen Ambitionen und den niedrigen Lebenshaltungskosten in Frankreich zusammen. Darüber hinaus hatte er beschlossen, die von seinen Eltern vorgegebene Richtung umzukehren und sozial abzusteigen, nicht nur in Armut zu leben, sondern, gewissermaßen als Sühne für seinen kolonialen Lebensabschnitt, auch freiwillig Umgang mit Armen zu pflegen und sich für die Gesellschaftsschichten zu engagieren, die er in der Schule und im Polizeidienst zu meiden gelernt hatte.
In seinem ersten Buch, dem pikaresken Bericht Ganz unten in Paris und London, beschreibt er sein Leben in der Welt der Schnorrer, Abzocker und Hungerleider. Auch in zwei Essays thematisiert er die Zeit unter den Mittellosen. «Wie die Armen sterben» ist eine Schilderung von zwei Wochen im März 1929, die er wegen einer schweren Lungenentzündung in der allgemeinen Abteilung eines Pariser Krankenhauses verbracht hatte, wo er unter Vernachlässigung seiner körperlichen Bedürfnisse mit barbarischen, völlig veralteten Methoden behandelt wurde. Ende 1929 kehrte er nach England zurück und wohnte zunächst bei seinen Eltern. In «Hopfenpflücken» berichtet er von der harten Arbeit und seinen Begegnungen mit anderen Erntehelfern auf einer Farm in Kent 1931 – «Leute aus East End (hauptsächlich Hausierer), Zigeuner und umherziehende Landarbeiter, denen sich ein paar Landstreicher zugesellen» –, von der miesen Bezahlung, den schlimmen Lebensbedingungen, seiner Freude an der Arbeit selbst und von Betätigungen wie dem Apfelklau. «Sie waren von der Sorte, die […] kein Hauptwort benutzt, ohne es mit ‹fucking› zu untermalen», heißt es in dem Erlebnisbericht, «aber ich habe nie Menschen getroffen, die freundschaftlicher und feinfühliger waren.» Von 1932 bis 1935 arbeitete er als Lehrer in verschiedenen Provinzschulen und als Aushilfskraft in einer Londoner Buchhandlung – schlecht bezahlte Jobs, die er nicht nur an sich hasste, sondern auch weil sie ihm die Zeit und Kraft zum Schreiben raubten.
Seine anderen Aufenthaltsorte – das strenge Internat, Eton, Burma, Paris, später Spanien während des Bürgerkriegs, London in den Jahren der Armut und dann wieder im Zweiten Weltkrieg, schließlich die abgelegene schottische Insel, auf der er in den letzten Lebensjahren so viel Zeit wie möglich verbrachte – haben wesentlich mehr Beachtung gefunden als Wallington. Es stimmt, Burma, Paris, London und Spanien wurden zu Schauplätzen seiner Bücher und passten besser zu dem Bild von Orwell, das in den Büchern über ihn, die ich nach meiner Begegnung mit den Herbstrosen las, immer und immer wieder gezeichnet wird. Im Vordergrund stehen sein politisches Engagement, die konfliktreichen Beziehungen mit Leuten aus seiner Klasse, der ungewöhnlich große Scharfblick, mit dem er erkannte, wie sich Propaganda und Autoritarismus gegenseitig beförderten und Rechte und Freiheiten bedrohten, sowie seine Atemwegsprobleme, an denen er mit sechsundvierzig starb. Eines dieser Bücher trägt den Titel Orwell: Wintry Conscience of a Generation, Orwell: Freudloses Gewissen einer Generation. Es ist ein ernstes und düsteres Porträt, Grau in Grau.
Mag sein, dass ihn sein schonungslos prüfender Blick auf das Unmenschliche und die damit verbundenen aktuellen und künftigen Gefahren tatsächlich definiert, doch darüber hinaus wird er charakterisiert, als wäre er gewesen, was er sah, oder als hätte er nichts als das gesehen. Als ich zu seinen Büchern zurückkehrte, nachdem mich die Rosen stutzig gemacht hatten, fand ich einen anderen Orwell, einen mit anderen Blickwinkeln, die einen Ausgleich zu seinem kalten Blick auf politische Ungeheuerlichkeiten bilden. Ich fand es beispielsweise erstaunlich, wie oft er von vergnüglichen Dingen erzählt: von dem Wohlgefühl, ja geradezu der Gemütlichkeit bei sich zu Hause, von obszönen Postkarten, von seinem Spaß an amerikanischen Kinderbüchern aus dem 19. Jahrhundert, von britischen Autoren wie Dickens, von «guten schlechten Büchern» und vielen anderen Dingen, vor allem aber von Tieren, Pflanzen, Blumen, Landschaften, Gartenarbeit, dem Leben auf dem Land – Freuden, die in seinen Büchern immer wieder auftauchen, selbst noch in 1984 in den poetischen Schilderungen des Goldenen Landes mit seinem Licht, seinen Bäumen, Wiesen, Vogelstimmen und dem Gefühl von Freiheit und Erlösung.
Dieser weniger bekannte Orwell brachte mir einen Essay von Noelle Oxenhandler in Erinnerung, eine Reflexion über den Wert des Wartens und der Langsamkeit. Die Autorin streift darin das Leben von Jacques Lusseyran, der als Kind erblindet war und sich während der Besatzung von Paris als Siebzehnjähriger der Résistance anschloss. «Ebenso sehr wie seine heroischen Taten beeindruckte mich das Innehalten davor», schreibt sie und schildert, wie Lusseyran das besetzte Paris erkundete und Swing tanzen lernte, denn, so berichtete er in seinen Erinnerungen, «dieser Tanz war wirklich geeignet, Teufel auszutreiben». Oxenhandler und Lusseyran zufolge ist es ratsam, wenn nicht sogar unverzichtbar, als Vorbereitung auf die eine zentrale Aufgabe im Leben etwas ganz anderes zu tun, das scheinbar in keinem Zusammenhang damit steht.
Orwell besaß ein Gespür für dieses andere und das Talent, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. In seiner letzten Lebensphase schrieb er nicht nur konzentriert an 1984, sondern verwendete auch enorm viel Zeit, Kraft, Fantasie und Geld auf einen Garten an der abgelegenen Nordspitze einer schottischen Insel. Dieser Garten wuchs sich mit dem Vieh, dem angebauten Gemüse, den Obstbäumen, dem Traktor und den vielen Blumen darin fast zum Bauernhof aus. Was ermöglicht es einem Menschen, etwas zu tun, das größten Wert für andere hat und für ihn selbst das wichtigste Vorhaben im Leben ist? Andere – gelegentlich auch man selbst – empfinden es als banal, unwichtig, ichbezogen, sinnlos oder als reine Ablenkung. Die Liste ließe sich um weitere abschätzige Begriffe ergänzen, mit denen das Messbare das Nichtmessbare schlechtmacht.
Dieser weniger bekannte Orwell weckt in mir auch die Erinnerung an eine berühmte buddhistische Parabel. Ein Mensch wird von einem Tiger verfolgt, stürzt auf der Flucht über eine Klippe und bekommt eine kleine Pflanze zu fassen, die ihn vor dem Fall in die Tiefe bewahrt. Nach und nach lösen sich die Wurzeln des Erdbeerpflänzchens aus dem Fels, gleich wird es jeden Halt verloren haben. Es trägt eine einzige, herrliche reife Erdbeere. Was, fragt die Parabel, sollte der Mensch in diesem Augenblick tun? Die Antwort lautet: die Beere mit Genuss essen. Die Geschichte lehrt, dass wir jederzeit und früher als erwartet sterben können: Tiger sind oft in der Nähe, Erdbeeren nur hin und wieder. Orwells Tiger war seine schlechte Gesundheit; er war sich der ständigen Nähe des Todes immer bewusst.
Er litt die meiste Zeit seines Lebens an wiederkehrenden Atemwegserkrankungen. Als Kleinkind litt er mehrfach an Bronchitis, was offenbar zu einer Bronchiektasie führte, einer Schädigung der Atemwege, die eine erhöhte Anfälligkeit für Lungeninfektionen mit sich brachte. Als Kind wie als Erwachsener erkrankte er häufig an Lungenentzündung und Bronchitis. Oft ging es ihm so schlecht, dass er ins Krankenhaus musste und erst nach Wochen oder Monaten genesen war. Während seines Aufenthalts in Spanien 1937 (anderen Berichten zufolge bereits zehn Jahre früher in Burma) steckte er sich mit Tuberkulose an und kämpfte seitdem mit gefährlichen Lungenblutungen, Atemnot, allgemeiner Schwäche und Erschöpfung. Er verbrachte viel Zeit in Kliniken und Sanatorien, bevor sich sein Zustand so sehr verschlimmerte, dass er sein ganzes letztes Lebensjahr im Krankenhaus lag, wo er im Januar 1950 mit sechsundvierzig Jahren an Tbc starb.
Manche ängstigt oder deprimiert der Schatten des Todes, andere bringt er dazu, das Leben intensiver zu leben und als weniger selbstverständlich zu betrachten, und Orwell gehörte offensichtlich zur zweiten Kategorie. Er war in vielem asketisch, ein Kämpfer, der körperliche Beschwerden nicht mied, sondern an seine Grenzen ging, bis ihn sein Zustand ans Bett fesselte; immer wieder stand er auf, und er griff nach der seltenen Erdbeere. «Er rebellierte gegen seinen biologischen Zustand, und er rebellierte gegen die sozialen Zustände; beides hing eng zusammen», sagte ein Freund über ihn.
Was nicht heißt, dass er keine Fehler gehabt hätte. Nach dem Tod seiner Frau beklagte er, ihr nicht die gebotene Freundlichkeit und Treue entgegengebracht zu haben. Er hielt an so manchem Vorurteil seiner Klasse, race und Nationalität fest, war geprägt durch sein Geschlecht, seine Heterosexualität und seine Zeit. Entsprechende Herabsetzungen und Hohn treten besonders in seinen frühen Schriften zutage. Das Einprügeln auf andere war für ihn offenbar Mittel zur Selbstfindung und Selbstwerterhöhung; es ließ erst nach, als der Schriftsteller und Mensch Orwell selbstbewusster und humaner geworden war.
Seine Texte sind gelegentlich brillant, oft zweckmäßig, unglaublich prophetisch und mitunter schön, aber nie gefällig. Und natürlich findet sich die eine oder andere Voreingenommenheit oder ein blinder Fleck. Doch so wenig vorbildlich er in manchen Dingen war, so mutig und engagiert war er in anderen. Er konnte alles Englische lieben und zugleich das Britische Empire und den Imperialismus hassen und über beide viel sagen, trat für Außenseiter und Benachteiligte ein und verteidigte die Menschenrechte und die menschliche Freiheit auf bis heute vorbildliche Weise.
Orwell hat nie ein Buch über Wallington geschrieben, außer vielleicht den streng allegorischen Roman Farm der Tiere, der in der Nähe eines Dorfs namens Willingdon angesiedelt ist und dessen Handlung sich in der großen Scheune der Manor Farm abspielt – die Scheune der realen Manor Farm steht noch immer pechschwarz und sehr imposant gleich um die Ecke von Orwells Häuschen. Doch in fast allen seinen Büchern werden das ländliche England und die Freude daran heraufbeschworen, und diese Freude hat viel mit Wallington und den Gegenden zu tun, in denen er als Kind, Heranwachsender und junger Mann Wanderungen und Angelausflüge unternommen, botanisiert, Vögel beobachtet, gegärtnert und gespielt hat. Seine Kindheit war, so scheint es, unterteilt in die Freiheit und das Vergnügen des Draußenseins und die Reglementierung und Qual in den Schulen, die er vom achten bis zum achtzehnten Lebensjahr besuchte.
Mit elf machte er einmal auf einer Wiese einen Kopfstand, um von drei anderen Kindern, die in der Nähe standen, beachtet zu werden. Der Trick funktionierte. Jacintha Buddicom, eines dieser Kinder, hat über die Freundschaft der drei Geschwister mit Orwell geschrieben; sie sahen sich immer in den Ferien, wenn er zu seiner Familie nach Shiplake, Oxfordshire, zurückkehrte, und verbrachten mehrere Sommer viel Zeit miteinander, spielten und erforschten die Gegend. Sie unternahmen «nicht besonders lange Spaziergänge», angelten, beobachteten Vögel und sammelten Vogeleier. Sie erinnert sich, wie begeistert er von Büchern und vom Lesen war, dass er Gespenstergeschichten erzählte, die Natur erkundete und nicht bloß Schriftsteller, sondern «ein berühmter Autor» werden wollte.
In seinem Roman Auftauchen, um Luft zu holen von 1939 scheint etwas von dem Zauber auf, den diese Landschaft für ihn gehabt haben muss. «Wir machten immer endlose Spaziergänge – auf denen wir natürlich ständig irgendetwas aßen –, den Heckenweg hinter den Gärten hinab, über Ropers Wiesen zum Mühlenhof, wo ein Teich mit Wassermolchen und kleinen Karpfen war (als wir ein wenig älter wurden, fischten Joe und ich dort), und dann zurück über die Straße von Upper Binfield, sodass wir an dem Süßwarenladen vorbeikamen, der sich am Stadtrand befand.»
Für Sätze wie den folgenden aus 1984