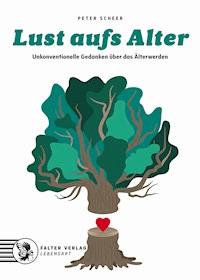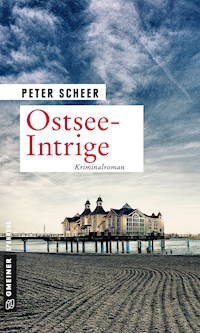
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Der österreichische Kinderarzt Prof. Blumenfeld soll auf der Ostseeinsel Rügen eine Rehaklinik aufbauen. Doch er wird nicht warm mit den Norddeutschen. Als er kurz darauf beschuldigt wird, für den Tod eines Kindes verantwortlich zu sein, übernimmt der Stralsunder Kommissar Lüdewitz die Ermittlungen. Auf dem Weg zu einem Treffen mit ihm wird Blumenfeld unfreiwillig Zeuge einer Autodiebesbande. Eine rasante Verfolgungsjagd von Rügen bis nach Österreich beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Peter Scheer
Ostsee-Intrige
Kriminalroman
Zum Buch
Zwischen Ostsee und Österreich Der österreichische Kinderarzt Prof. Blumenfeld soll auf der Ostseeinsel Rügen eine Rehaklinik aufbauen. Doch er wird nicht warm mit den Norddeutschen. Als er kurz darauf beschuldigt wird, für den Tod eines Kindes verantwortlich zu sein, übernimmt der Stralsunder Kommissar Lüdewitz die Ermittlungen. Der Vorwurf gegen den Arzt erweist sich jedoch bald als Intrige, woraufhin sich eine Freundschaft zwischen den beiden Männern entwickelt. Für Blumenfeld ist die Bekanntschaft mit dem belesenen Kommissar Dr. Horst Lüdewitz ein Lichtblick. Auf dem Weg zu einem Treffen mit ihm wird Blumenfeld unfreiwillig Zeuge einer Autodiebesbande und damit zur Zielscheibe des organisierten Verbrechens. Lüdewitz heftet sich an Blumenfeld und nimmt die Spur der Diebesbande auf. Eine rasante Verfolgungsjagd von Rügen bis nach Österreich beginnt. Doch der erfahrene Kriminalhauptkommissar unterschätzt die Gefahr. Das rächt sich. Können Blumenfeld und Lüdewitz dem Tod entrinnen?
Der in Tel-Aviv geborene Peter Scheer ist im Alter von drei Jahren nach Österreich gekommen. In Wien studierte er Medizin und Philosophie. Der Kinder- und Jugendarzt, der auch als Managementtrainer tätig ist, lebte viele Jahre in Wien, bevor er nach Graz gerufen wurde. Dort baute er die Abteilungen Psychosomatik und Psychotherapie an der Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche auf. Wissenschaftliche Papers waren seine tägliche Arbeit, persönlich gehaltene Sachbücher das Zubrot. »Ostsee-Intrige« ist Scheers Krimi-Debüt.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ORK / photocase.de
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5884-2
Widmung
Ich widme dieses Buch meiner lieben Frau, die mir eine strenge und liebevolle Partnerin war und hoffentlich noch lange sein wird.
I. Ouvertüre
Jetzt waren es schon zwei Monate, dass Ignaz Blumenfeld entlang der Lagunen fuhr. Morgens von Glowe nach Breege auf der Schaabe und nachmittags zurück. Manchmal wollte er ein Lied pfeifen, aber da er nicht pfeifen konnte und wenn er pfiff, dann falsch, hörte er die Musik lieber im inneren Ohr. Der Weg war nicht lang. 9,7 Kilometer, flach, manchmal Gegenwind.
Angezogen völlig falsch: Statt Radleruniform – Läuferklamotten. Lange Hose, Unterhose aus Kunststoff, die Innenschenkel neben dem Sack mit Vaseline eingeschmiert, Kunststoffleibchen, Funktionsjacke mit leichtem Windstopp. Stattdessen hätte er eine gefütterte Hose anhaben müssen, Radlersocken mit Stützfunktion, windabweisende Jacke mit seitlichen Einnähern, die sich eng an den Körper legte, und Helm, Schuhe mit Klixbindung, und das alles möglichst von einem Hersteller, der sicher nicht Tchibo heißen sollte. Eine Kollegin überholte ihn. Physiotherapeutin wahrscheinlich. Perfekt gestylt, nicht in Radleruniform, aber in Sportdress. Sie grüßte und sagte: »Ich muss Sie leider gleich wieder verlassen. Ich beginne meine Therapie um 8.00 Uhr.«
»Ich auch«, antwortete er und ließ sie ziehen. Schwerer Fehler. So benahm sich kein Chefarzt, und so schaute er auch nicht aus.
»Fehler passieren überall«, musste sich Kriminalhauptkommissar Lüdewitz heute Morgen schon zum zweiten Mal anhören. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte ihm einen Ermittlungsauftrag wegen Verdachts auf fahrlässiges Handeln gegen den Chefarzt der Kurklinik Breege übermittelt. Darin stand vom Tod eines elfjährigen Knaben zu lesen, der an einem durch eine abgelaufene Injektion ausgelösten Mangel an Blutplättchen litt. Zwei Wochen nach einem Erholungsaufenthalt in der Klinik auf Rügen spielte er Fußball. Da er für sein Alter groß gewachsen war, war er der Kopfballspieler vor dem Tor. Zuerst hatte Jannes den Kopfball angenommen. Der Ball ging wirklich ins Kreuzeck. Mitten im Jubel hatte sich Jannes an den Kopf gegriffen, etwas von »fließen« gemurmelt und war langsam in sich zusammengesunken. Die Buben waren starr vor Schreck. Sie liefen zu Jannes’ Mutter Frau Silversteed nach Hause. Bis der Krankentransport am Fußballplatz war, vergingen weitere zehn Minuten, in denen der Atem des Jungen zuerst hechelnd war, dann ganz schwach wurde und langsam verebbte. Die Mutter rief Jannes beim Namen. Der konnte oder wollte keine Antwort geben. Dann der Transport in die Klinik. Dort stellte man fest, dass die Zahl der Thrombozyten unter 5.000 gefallen war, weswegen der Neurochirurg die Gehirnblutung nicht operieren konnte. Erst nach Gabe eines Thrombozytenkonzentrats, das erst nach 40 Minuten eintraf, konnte operiert werden. Da war es aber schon für alles zu spät. Jannes’ Hirn hatte bereits solche Schäden wegen Sauerstoffmangels und durch die Einblutung erlitten, dass die nächsten acht Tage, die er auf der Intensivstation im künstlichen Koma gehalten wurde, nur mehr ein verlängertes Abschiednehmen für seine Mutter und seinen Bruder gewesen waren. Jannes erwachte nicht mehr, und als das EEG nur mehr die Nulllinie zeigte, boten die Ärzte Frau Irma Silversteed an, die Geräte abzuschalten. Sie musste das glücklicherweise nicht allein entscheiden, sondern war nur Partei in einem Prozess, den die Ethikgruppe1 des Krankenhauses überhatte. Sie beratschlagten nach Einsicht aller Befunde und nach der Untersuchung des Patienten, ob ein Weiterleben an den Maschinen als sinnvoll angesehen werden konnte. In Jannes’ Fall war die Entscheidung leicht gewesen. Wenn er auch noch ein Kind war, so war die Prognose auf eine wenigstens teilweise Wiedererlangung eines erträglichen Lebens negativ. Er würde bestenfalls wie der israelische Premier Ariel Sharon einige Jahre im Koma existieren können. Das wollte man weder dem Kind, seiner Familie noch dem Krankenhausträger zumuten. Also ließ man Jannes zehn Tage nach seinem Kopfball, der zu einem Tor geführt hatte, sterben. Da sein Tod eine Unfallfolge war, wurde der Leichnam gerichtlich obduziert und eine Unfallmeldung an die Polizei gemacht. Sie war offizieller Auslöser der Erhebungen.
Die Staatsanwaltschaft hatte ermittelt, dass der bestehende Thrombozytenmangel von der Mutter bei der behandelnden Ärztin der Rügen-Klinik angegeben worden war. Die Ärztin, Frau Anita Hafer, hatte nach Aussage der Mutter die vom Kinderarzt vorgeschriebene Kontrolle der Blutplättchen verweigert und hätte gesagt, dass das Kind nur Begleitperson des kleinen Bruders und der Mutter wäre, also gar nicht Patient der Klinik, und daher keine Kostenübernahme durch die Kasse möglich wäre und auch nicht durch die Klinik. Der Chefarzt sei danach von der Mutter befasst worden, hätte aber die Auffassung seiner Mitarbeiterin mitgetragen, ebenso wie der Klinikdirektor Herr Franz-Josef Knopfke, an den sich die Mutter in ihrer Sorge gewandt hatte. Wieso der Ermittlungsauftrag der Staatsanwaltschaft nur den Chefarzt betraf und nicht auch die anderen Beteiligten, verstand Lüdewitz nicht. Daran hatte er sich seit der Wende wieder gewöhnt. Früher verstand er manche Aufträge nicht, weil er das Parteiinteresse nicht kannte, dem zu folgen war, und nun verstand er sie manchmal nicht, weil höhere wirtschaftliche Überlegungen handlungsleitend waren. Ihm sollte es recht sein. Er hatte die DDR überstanden, so würde er auch noch die Wertvorstellungen der Bundesrepublik überstehen‚ und dann eine viel bessere Pension bekommen, als er sie damals gehabt hätte. Insgesamt jedoch gleich viel, musste er sich korrigieren. Denn da in der DDR alles preisgeregelt war, war alles billig oder zumindest erschwinglich. Vor allem konnte keiner reisen. Höchstens in die sozialistischen Bruderstaaten, etwa nach Varna ans Schwarze Meer oder nach Kuba, allerdings nur, wenn man Kaderpersonal war. Das war er nie gewesen, weshalb die Karriere des jungen Juristen auch in Stralsund geendet hatte und nicht in der Hauptstadt oder überhaupt einer größeren Stadt. Für ihn reichte Stralsund als Wohn- und Arbeitssitz, wo er ganz Rügen beobachten konnte. Er wusste, wer kam und wer ging, auch wenn der oder die mit Bus, Boot oder Zug auf die Insel kamen. Selbst seit die neue Brücke gebaut worden war und die Menschen zu allen Tages- und Nachtzeiten kommen und gehen konnten. Heute war das völlig unkompliziert, und wenn man nachts nach Rügen fuhr, konnte man fast übersehen, dass man den Strelasund überquerte. Zwar gab es den Rügendamm bereits seit 1936/37, aber der hatte nur die Landstraße Nummer 86 und eine Bahnverbindung. Anfällig gegen Sturm, Regen und Wind, war er auch vor Überschwemmungen nicht sicher. Die alte Brücke blieb nach dem Bau der neuen bestehen, und er benutzte sie lieber als die neue. Einerseits hatte er einen guten Blick auf das neue Bauwerk und andererseits war es Lüdewitz’ Trampelpfad, obwohl er doch noch gar nicht so alt war. Das 2007 fertiggestellte Bauwerk auf seinen stolzen Säulen, die als Y-Pylonen ausgeführt waren, war ein Prachtstück, welches das Erreichen Rügens noch leichter machte. So war Rügen an den internationalen Verkehr angeschlossen, Autos flitzten vor allem im Sommer hin und her. Dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20.10.2007 die Brücke offiziell eröffnet hatte, behielt er in bester Erinnerung. Sie war seine Abgeordnete, wenn sie auch mehr weltpolitisch dachte und handelte, als eine lokale Abgeordnete es tun würde. Er musste aber zugeben, dass sie sehr wohl auf ihren Wahlkreis, der zum Teil seiner Verantwortung unterstand, schaute. Die Rügenbrücke war nur ein Beispiel der Fortentwicklung in der Region.
Er kannte fast alle Einheimischen seit Jahrzehnten, und die neuen Verbrecher, die aus den Großstädten und dem Osten kamen, lernte er bald kennen. Er hatte wenig andere Interessen außer seinem Beruf. Schon als Kind war er neugierig gewesen und kannte gern die Geheimnisse der anderen. Nun, da er fast vier Jahrzehnte in Häusern, Kästen und versteckten Kommoden hatte nachschauen dürfen und viele Geheimnisse gesehen hatte, begann er, sich zu langweilen. Nicht weil er das Interesse verloren hatte, sondern weil sich die Einfälle so oft wiederholten: kleine sexuelle Perversionen, Dildos, Latex, mal eine nebeneheliche Freundin oder ein Freund, versteckte alte Liebesbriefe, die nur mehr dazu geeignet waren, die bestehende Beziehung zu belasten oder zu zerstören; selten Kriegserinnerungen oder eine nicht mehr erlaubte politische Gesinnung, entweder Nationalsozialismus oder Kommunismus. Er war frei von allen: weder verheiratet noch sonst wie gebunden; nicht homosexuell, aber nicht praktizierend hetero; nie in einer Partei gewesen: für die Nazis zu jung, für den Kommunismus zu sehr an den Menschen und ihrem Gemeinschaftssinn zweifelnd und für den Kapitalismus als Beamter im Staatsdienst zu arm. Daher bewohnte er eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern, wenig Erinnerungsstücke, mal ein Bild der Eltern, Vater war aus dem Krieg nicht zurückgekommen, Mutter war Pfarrersköchin und daher vor dem Kommunismus gefeit, der römisch-katholische Pfarrer wie ein Vater, auch, so vermutete er, in der Beziehung zu seiner Mutter leidlich glücklich, allerdings ohne den Segen der Heiligen Kirche. Jetzt, kurz vor der Pensionierung, außer langen Spaziergängen im Naturschutzgebiet und an der See keine Hobbys, die man angeblich brauchte, um in der Pension nicht zu vertrotteln. Vielleicht einmal eine Mohntorte in der Teestube in Putbus, die von zwei jungen Zugewanderten geführt wurde und die jeden Winter am Rande des Konkurses stand, den zu verhindern er mithalf. Ein herrlich einsames und sinnloses Leben in großer innerer Freiheit und voller Philosophie. Marc Aurel – das war sein Philosoph. An der Spitze der Macht des größten Weltreichs, das die Antike je gesehen hatte, und doch mit Selbsterkenntnis und dem Wissen um die eigene Ersetzbarkeit und Flüchtigkeit. So hätte er sich viele Staatsmänner gewünscht, so sollten sie sein, und Angela Merkel kam diesem Ideal ziemlich nahe. Entscheidungsfreudig, zur Sache, klar und kein Wort zu viel; realistisch in der Frage, ob sie Freunde hatte, und ihren Werten treu, auch wenn es politisch nicht immer klug war – sie war Marc Aurel ziemlich nahe. Er hatte ihr das bei einem Empfang in Schwerin mal gesagt, dass er sie in die Nähe seines Lieblingsphilosophen stellte. Das gehörte zu seinen Erinnerungsstücken, Schriftstücke von Ulbricht oder Bormann gab’s bei ihm zu Hause nicht. Wenn es sie gegeben hätte, hätte er sie auf dem Flohmarkt verkauft, der gerade jetzt vor Weihnachten in Stralsund stattfand.
Einbrüche in Strandhäuser, Diebstahl von Strandkörben, Fahrraddiebstahl und selten genug ein paar Verbrecher verhaften, das war alles, was er zu tun hatte. Vor Weihnachten auch mal einen Taschendieb oder einen Banküberfall, meistens von einem verzweifelten Einzeltäter, der mit Hartz IV seinen Kindern keine Geschenke machen konnte.
Heute einen Chefarzt zu verhören war das Tollste, was er seit Langem machen sollte. Er musste sich vorbereiten. Die Krankheit, an der das Kind letztlich verstorben war, kannte er nicht. Er hatte schon von Blutplättchen gehört, und die Erziehung im Pfarrerhaus hatte seine Liebe zu den klassischen Sprachen so weit geweckt, dass das Wort »Thrombozyten« ihn nicht abschreckte. Deren Funktion war ihm da schon weit unklarer. Die Übersetzung »Gerinnselzellen« und die deutsche Bezeichnung »Blutplättchen« halfen ihm nicht weiter. Also nachlesen, und weil es kaum noch Nachschlagewerke gab, halt Google. Blutplättchen werden von meist im Knochenmark lebenden Zellen, den Megakaryozyten (also den Großkernigen, übersetzte er sich) gebildet und aus diesen ausgestoßen. Sie leben dann circa zehn Tage im Blutkreislauf, ernähren sich aus dem Zucker des Bluts und geben im Bedarfsfall Gerinnungssubstanzen ab, Faktoren, die einen zusätzlichen Weg der Blutgerinnung ermöglichen neben der klassischen inneren oder äußeren. Sie sind quasi ein zweites System, welches das Verbluten verhindern soll und kann. Um dieses System beinahe lahmzulegen, verschreibt man Herzkranken Acetylsalicylsäure. Lüdewitz erkannte in dieser Bezeichnung »die« Erfindung der Firma Bayer, nämlich das Aspirin, das von Millionen Menschen in kleiner Dosierung von 50 bis 100 Milligramm zur Verhinderung von Gerinnseln in den Herzkranzgefäßen eingenommen wird. So ist das Patent der Firma Bayer und ihres Namensgebers nach mehr als einem Jahrhundert noch immer eine Stütze der deutschen Pharmaindustrie.
Das alles hatte Jannes offensichtlich nicht gehabt. Er fand die Krankheit aber unter »idiopathischer Thrombozytopenie«. Meist nach einem Infekt bekamen manche Kinder eine Störung der Herstellung dieser Blutplättchen, es war wie eine Selbstzerstörung der Megakariozyten oder auch nur der Thrombozyten. Jedenfalls sank die Anzahl an Blutplättchen je Kubikmilliliter von normal 200 bis 400.000 auf unter 12.000. Da konnte es schon vorkommen, dass nach einem Sturz eine innere Blutung auftrat, wie es eben bei Jannes gewesen war.
Jetzt hatte er noch mehr Fragen: Nicht nur, dass der Ermittlungsauftrag allein Professor Doktor Ignaz Blumenfeld betraf und nicht auch die Ärztin Anita Hafer oder den Klinikdirektor Franz-Josef Knopfke. Er wusste auch nicht, wieso Jannes’ Mutter Irma Silversteed ihren Jungen hatte Fußball spielen lassen, obwohl sie doch besorgt gewesen war und keinen aktuellen Befund von ihm hatte. Sie konnte nicht gewusst haben, ob sich die Zahl der Blutplättchen normalisiert hatte.
Wie von allen Menschen wusste Lüdewitz auch von Professor Doktor Ignaz Blumenfeld schon viel. Der war zwar erst vor zwei Monaten nach Rügen gekommen, aber seine umtriebige Frau Letta hatte überall Wohnungen gesucht und besichtigt, und das reichte schon, um auf den Radar von Horst Lüdewitz zu kommen. Anspruchsvoll war das Ehepaar. Es war ihnen unbekannt, dass der Norddeutsche, und insbesondere der von dem Dritten Reich und danach von der DDR geprägte, immer zuerst die Arbeit sah. Nur wegen der und für die Arbeit durfte man leben. Die war das Wichtigste. Nicht die Freizeit oder der Lohn. Beides hatte im Verborgenen stattzufinden. Ein Segelboot etwa konnte ruhig teuer sein, aber nach außen musste es bescheiden aussehen. Keine goldenen Wimpel, aber ohne Weiteres ein in einem Stück gegossenes Boot, das ging. Letta wollte aber ein schönes Haus an der Lagune mit direktem Seezugang. So was, wie die Touristen im Sommer für zwei Wochen mieten, wenn sie aus Hamburg oder Berlin kamen. Oder aus München, wenn die Kinder lungenkrank waren. Nicht nur das, Professor Blumenfeld benahm sich nicht wie ein Chefarzt. Er trug kein Sakko und keine Krawatte, kam mit dem Fahrrad zum Dienst und besuchte wie Lüdewitz die Teestube in Putbus. Dort hatte man sich zufällig an einem Spätherbstnachmittag getroffen und über den Mohnkuchen unterhalten, weil Blumenfeld lustigerweise Schlagsahne zum Kuchen bestellte. René, der Besitzer, riet ihm ab, weil ohnehin jede zweite Schicht des Kuchens aus bester dänischer Butter bestand. Blumenfeld nahm trotzdem Schlagsahne, die er auf Österreichisch »Schlagobers« nannte, dazu. Das wäre selbst Lüdewitz zu viel Fett gewesen, und er mochte es fett, wie man ihm leicht ansehen konnte. Jedenfalls waren sie beide beim Kuchen allein, denn Letta war schon abgereist und Blumenfeld und Lüdewitz die einzigen Gäste. So ergab sich ein kleines Gespräch, der Herr Professor war nicht so steif, wie Lüdewitz das von deutschen Professoren kannte, und außerdem machte er gern einen kleinen Spaß oder erzählte einen jüdischen Witz. Der ging ihm so leicht von den Lippen, sodass sich die Frage, welchen Glaubens er sei, erübrigte. Lüdewitz erinnerte sich nur an einen Juden, den er gekannt haben könnte. Den Chef des DDR-Geheimdienstes Markus Wolf. Er war froh, den nicht gekannt zu haben. Von solchen Menschen hielt er sich gern fern. Blumenfeld aber schien ihm ganz anders zu sein: offen und freundlich, verschmitzt und gebildet. Da hatte er bei Lüdewitz einen Stein im Brett. Dass sie in der Teestube bei René dann über eine Stunde sitzen geblieben waren und Lüdewitz einen Menschen traf, der seine Hochachtung vor Marc Aurel teilte und auch noch 32 Jahre in Wien gewohnt hatte – das hatte ihn sehr gefreut. Die Großeltern Blumenfelds hatten ihre Wohnung in der Wipplingerstraße, nur etwa 300 Meter von Marc Aurels Wirkungsstätte entfernt. Noch besser hatte ihm gefallen, dass Blumenfeld keine Anstalten machte, wie das heute üblich war, mit Lüdewitz, der seinen Vornamen Horst nie mochte, per Du zu werden, sodass sie sich Horst und Ignaz hätten nennen müssen. Schauriger Gedanke, selbst jetzt im Nachhinein, wo er Blumenfeld bald würde vernehmen müssen. Da war ihm gar nicht wohl dabei. Er konnte sich nicht helfen, die Sache stank. Wieso gerade der Neuankömmling, der Jude? Wieso waren nicht die Mutter, der Klinikdirektor oder Frau Hafer die Beschuldigten?
Die beste Vorbereitung auf eine Vernehmung war noch immer die Kenntnis der Umgebung. Also beschloss Lüdewitz, die Nachtkrankenschwester Lorle, seine langjährige Nachbarin aus Stralsund, morgen früh zum Frühstück, bevor sie schlafen ging, zu treffen. Mal ein bisschen umhören, dachte er sich und schaute noch mal nach, ob der Staatsanwalt Herr von Borkensteed einen Termin gesetzt hatte. Hatte er nicht, also: Morgen war auch noch ein Tag.
Über all diesen Recherchen und Überlegungen war es Mittag geworden. Wie jeden Tag war die Mittagsmahlzeit im Leben des Alleinlebenden die wichtigste Mahlzeit. Sie wurde in einem der nahe gelegenen Lokale in Stralsund eingenommen. An sich mochte Lüdewitz Fisch, aber seit der nur mehr aus Züchtungen in der Nordsee kam, wollte er ihn nicht mehr. Nicht weil er was gegen die Antibiotika hatte, die der Fischzucht zugesetzt werden mussten, er schmeckte sie nicht. Aber es grauste ihn. Er stellte sich dann die schönen Lachse vor, wie sie ihr kurzes Leben lang in einem Sack kreisten und den wenigen Sauerstoff atmeten, der durch den Ventilator in das Wasser gepresst wurde. Also Fleisch: Die Haltung der Schweine in Mecklenburg war noch einigermaßen so, wie er es aus seiner Kindheit kannte. Das hatte er immer gegessen, und da er nicht auf ein langes und gesundes Leben sparte, würde er es auch noch die paar Jahre essen. Er ging daher aus seinem Büro, das in der Kriminalkommissariat Stralsund in einem alten und nicht renovierten Plattenbau aus der DDR-Zeit untergebracht war. Lediglich die EDV-Leitungen waren neu hinzugekommen. Er ging 20 Minuten bis zum Hauptplatz. Neben dem Rathaus stand ein altes, schön renoviertes Fachwerkhaus, das Touristen anzog und in dem ein schlechtes Lokal schlechtes Essen anbot. Er war wegen der schönen Räume ein-, zweimal hineingegangen. Sie hatten nur Essen, das aus der Tiefkühltruhe kam, der Koch, wenn es denn einen gab, hatte nur das Aufwärmen und Abbraten erlernen müssen, sonst nichts. Nebenan in dem anderen Fachwerkhaus gab es das scheinbar unvermeidliche Chinalokal. Die roten Lampions am Eingang und die winkende Katze machten sich beim Stadtspaziergang in der alten Hansestadt sicher gut. Dort gab es »Chappi-Futter«, wie er das bei sich nannte. Hunde- und Katzenfutter, fertig verpackt. Nur der Reis wurde in einem Reiskocher gedünstet. Alles andere musste die taiwanesische Familie – bei schwerer krimineller Strafandrohung – beim Lieferanten kaufen, selbst die Marge war klar definiert. Selbstständige Lohnsklaven, dachte er sich. Dass es so was gibt. Die Alternative, ein Brötchen zu essen, verwarf er. Im Edeka-Markt gab es zwar frische Brötchen mit Schinken, Mettwurst oder Hering mit Zwiebeln, aber das war kein Mittagessen für ihn. Er wich den abgestellten Kübeln aus, die zur Entsorgung der verschiedenen Abfälle wie Glas und Papier am mittelalterlichen Hauptplatz aufgestellt waren. Er ging in die Imbissstube nebenan, die zwar von einem Deutschtürken betrieben wurde, aber klassisches deutsches Essen anbot. »Kassler Rippchen mit Kraut und Kartoffeln«, las er auf dem Schild vor dem Eingang. Das konnte er essen, ohne dass ihm schlecht wurde, vielleicht mit einem Bier. Zwar wäre er danach müde und kaum mehr arbeitswillig, aber er würde seine verbleibenden Stunden absitzen und recherchieren, was so viel hieß, wie dass er die Wege der Autos, die in den letzten Monaten vermehrt auf Rügen gestohlen worden waren, verfolgte. Er gab aus den Zulassungsscheinen die Motor- sowie die Fahrgestellnummer und das Kennzeichen ein. Dann suchte das System das Auto. Wenn es mittels eines dieser Merkmale fündig wurde, zeigte es an, ob es zum Beispiel in Polen verkauft worden war. Die polnischen Kollegen machten das Gleiche. Daten eingeben und nachschauen, ob eines dieser Autos oder Teile davon registriert worden waren. Keine Tätigkeit, bei der man sich sehr anstrengen musste. Jeder Affe konnte das machen, sagte sich Lüdewitz. Er freute sich in solchen Momenten, dass seine Arbeit manchmal aus solchen Tätigkeiten bestand. Die tolleren, moderneren Methoden wie die Verfolgung der Autos mittels GPS oder die Suche nach eingebauten und versteckten GPS-Diebstahlsendern überließ er lieber den jüngeren Kollegen aus Flensburg. Das ging ganz einfach. Er musste nur eine Nachforschung nach einer strafbaren Handlung anfordern. Das konnte zum Beispiel Schnellfahren in der Spielstraße entlang der Lagune, wo die Geschwindigkeitsbeschränkung acht Kilometer pro Stunde betrug, sein. (Weshalb die Autofahrer immer von den Radfahrern milde belächelt wurden, wenn diese sie überholten.) Die Kollegen suchten dann die GPS-Daten. Waren diese vorhanden, so meldeten sie die Bewegungen des Kraftfahrzeugs, selbst wenn es Deutschland verlassen hatte. Eine interne Revision, ob es sich tatsächlich um die Suche nach einem Verkehrssünder und nicht um die Arbeitserleichterung eines älteren Kommissars gehandelt hatte, gab es nicht. Überdies war diese Art der Suche in Flensburg, wo die Eintragungen der Punkte im Führerschein in Evidenz gehalten wurden, Routine und daher mühelos. Lüdewitz hingegen hätte sich zuerst in das Suchsystem der deutschen Polizei einloggen müssen, hierauf nach dem ersten Passwort ein zweites eingeben müssen, um zu einem schlechteren GPS-Portal zu kommen. Dort hätte er die Kennzeichennummer und die anderen Merkmale des Fahrzeugs eingeben müssen, um die Suche zu beginnen. Das hätte ihm aber noch lange keinen Zugang zu den Daten der großen deutschen Autohersteller wie BMW, Audi, VW oder Mercedes gegeben. Diese waren mit den von ihnen gelieferten Autos dauernd im Kontakt und konnten, obwohl das gegen Datenschutzbestimmungen verstieß und daher nur als Hintergrundfolie in den IT-Abteilungen lief, jederzeit den Aufenthaltsort jedes ihrer Fahrzeuge bestimmen. Dies nannte sich Notfallhilfe und wurde nicht erst, wie Fahrzeughalter meinten, nach manueller oder automatischer Aktivierung des Notfallsystems aktiviert. Nein, es war immer aktiv, nur durfte es bei den Herstellern niemand lesen und keine Schlüsse aus den Daten ziehen oder die Daten weiterverkaufen, was natürlich ein Riesengeschäft wäre, wie sich Lüdewitz einmal von einem BMW-Mitarbeiter, der in Born am Darß ein Häuschen hatte, erklären ließ. Denn diese Daten könnten zu Werbezwecken, sogenannter personalisierter Werbung, ebenso verwendet werden wie zur Erstellung von Bewegungsprofilen und sogar dazu, dass man dem Kunden rechtzeitig neue Reifen oder einen Service fürs Auto anböte, was die Kundenbindung erhöhen würde. All das kam Lüdewitz seltsam vor, und er war froh, dass er nur sehr wenig von sich im sogenannten Netz preisgab. Zu seiner Zeit wurden Netze vor allem beim Fischen verwendet, manchmal auch von Hexen, die einen darin fangen wollten, oder von Spinnen. Alles keine angenehmen Vorstellungen. Wenn jemand zu Lüdewitz sagte, er sei gut vernetzt, dann rann ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Er sah sich als Fisch und nicht als Fischer in diesen Netzen. Dass sein Name und sein Bild auf der Homepage der Polizei waren, war ihm mehr als genug, und er freute sich, dass er keine zusätzlichen Kurse und akademischen Titel hatte, die dort angegeben werden mussten, außer seinen juristischen Doktor. Kriminalhauptkommissar Doktor Horst Lüdewitz, geboren 27.11.1950 in Strerow, Leiter der Dienststelle Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern (wozu denn das, dachte er sich, Mecklenburg ist weit weg und die Junker lange ausgestorben oder nach England gezogen). Lebenslauf: unverheiratet, keine Kinder. Zusatzausbildungen: keine Angabe. Literatur: keine Angabe. Diensteintritt (inklusive Polizeischule): 22.01.1974. E-Mail: [email protected]. Das war’s. Mehr gab’s über ihn nicht zu lesen. Privatadresse war bei der Polizei ohnehin nicht vorgesehen. Die Post, die bei der angegebenen E-Mail-Adresse ankam, schaute er circa einmal pro Woche an, um nachzusehen, ob es dort was Spannendes gab. Da er alle Erlässe und Einladungen zu Antritts- und Verabschiedungsfeiern in Neubrandenburg bekam, musste er mehr löschen als lesen. Das machte er gern an ruhigen Tagen.
Die Kollegen aus Flensburg konnten allerdings die Daten der Autohersteller nur dann einsehen, wenn es einen Gerichtsbeschluss gab. Dieser konnte nur vom Staatsanwalt Herrn von Borkensteed erwirkt werden und hatte ein Offizialdelikt zur Voraussetzung, also zum Beispiel Diebstahl oder Raub. Bis es Hinweise auf ein solches Delikt gab, musste Lüdewitz eine Diebstahlsmeldung von den Besitzern aufnehmen, dem Staatsanwalt weiterleiten und dann einen Ermittlungsauftrag bekommen. Das klang so mühsam, wie es war, und – da er nun Professor Doktor Blumenfeld befragen sollte, wollte er jedenfalls nicht heute Herrn von Borkensteed damit belangen. Der könnte zu Recht annehmen, dass Lüdewitz keine große Freude mit der Befragung Blumenfelds hatte, und ihn auffordern, den Ermittlungsauftrag wegen des Kunstfehlerverdachts (Unterlassung von Hilfeleistung in einer Krankenanstalt an Pfleglingen und Unmündigen) unverzüglich durchzuführen und einen Bericht abzufassen. Das alles schmeckte Lüdewitz nach dem Essen der Kassler Rippchen gar nicht, und so beschloss er, zuerst den einfachen Weg der Anfrage wegen Verkehrsübertretung nach Flensburg zu senden. Das war simpel und machte Spaß. Er musste nur aufpassen, dass er nicht mehr als sechs bis acht Autos angab, sonst kamen die in Flensburg darauf, dass da was nicht stimmen konnte, und fragten nach.
Lüdewitz hatte letzten Sonntag wieder einmal den »Tatort« geschaut. Er liebte das. So was von unrealistischer Polizeiarbeit, er musste immer schmunzeln. Lachen war auf dem Fischland ungewöhnlich und kam nur in Extremsituationen vor. Schmunzeln war schon ganz toll und herrlich entspannend. Da hatte die Kollegin Film-Krimininalhauptkommissarin Blum von ihrem Doktor nach zwei übergangenen Herzinfarkten Ruhe verordnet bekommen. Lüdewitz wäre zumindest in Kur gegangen oder in eine der herrlichen Rehabilitationskliniken auf Rügen oder im Schwarzwald. Egal. Eben wohin ihn die Kasse geschickt hätte. Aber Frau Blum machte weiter, ermittelte, traf Hanna Schygulla, die ihm als ältere Dame und als Anführerin einer Mörderbande von gleichaltrigen Frauen fast noch besser gefiel als in den früheren Filmen von Rainer Werner Fassbinder oder als Lili Marleen. Sicher, damals war sie jung, verführerisch. Die rauchige Stimme und das Verlebte, das Anrüchige hatte sie behalten, und Lüdewitz war froh, dass nicht er gegen sie ermitteln musste. Er wäre ihrem Charme ebenso erlegen wie Frau Blum. Dass aber Frau Blum nicht ihre Dienstmarke wegwarf und sich den Frauen anschloss, die der Gerechtigkeit wegen mordeten, das mochte er genauso wenig verstehen wie dass der Krimi nicht am Anfang endete. Es wäre bei ihm nicht erst am Ende des Films das Ende der Konstanzer Ermittler gewesen, sondern am Anfang. Lüdewitz fragte sich, wer das glauben konnte. Wer dachte sich einen Beamten aus, der nie schlief, nie aß, kein Privatleben hatte und am Ende seiner Karriere – und ein solches lag offensichtlich bei Frau Blum vor – einsehen musste, dass sein unentwegter Kampf gegen das Verbrechen und für Gerechtigkeit in Krankheit, Einsamkeit und Verzweiflung endete? Lüdewitz war da mit sich ganz im Reinen, dass er kein solcher Beamter war und auch nicht sein wollte. Beamte wurden erfunden, um Einrichtungen des Staates zu schaffen und zu verwalten, die beständig, unabhängig von den jeweiligen politischen Verwerfungen ihre Arbeit machten und gegenüber dem Bürger jene Obrigkeit vertraten, die nun mal an der Macht war und die Gesetze machte. Nirgends stand, dass der Beamte dabei zugrunde gehen oder seine Gesundheit opfern sollte. Nirgends stand, dass der Beamte – egal ob im Steueramt, in der Gesundheitsverwaltung oder bei der Polizei – erst in Pension gehen konnte, wenn er krank war. Sicher: Lüdewitz hatte keine Familie. Es hatte sich nicht ergeben. Die Frauen, in die er sich als junger Mann verliebt hatte, hatte er damals nicht heiraten wollen. Später waren sie verheiratet, und beim zweiten Aufguss mit den Kindern des ersten Mannes wollte er sie nicht mehr. Eine Fremde kam in Stralsund oder auf der Insel Rügen sowieso nicht infrage. Die hätte sich nie in diese Einsamkeit eingelebt und in die Stummheit der Fischköppe, wie die Bewohner von den anderen Deutschen, sogar von den Hamburgern, die auch nicht für ihre Redseligkeit bekannt waren, spöttisch genannt wurden. So blieb er allein und hatte in jungen Jahren manchmal im Sommer das für Touristen betriebene Bordell in Schwerin besucht. Seit dort fast ausschließlich Rumäninnen arbeiteten, die offensichtlich Sexsklavinnen waren, konnte er das mit seiner Stellung nicht mehr vereinbaren. Er hatte das Kapitel Sex gestrichen. Komisch, nach einiger Zeit ging das mühelos‚ und er trauerte dem Fortpflanzungstrieb nicht nach.
Professor Blumenfeld hatte fünf oder sechs Kinder, erinnerte er sich. Vielleicht eine Berufskrankheit, lächelte er in sich hinein und ertappte sich dabei, wie er sich während seiner Autospielereien doch mit dem heutigen Ermittlungsauftrag beschäftigte. Hin und wieder schaute er auf die Uhr, um das Ende der Dienstzeit im Auge zu behalten. Er wollte heute pünktlich nach Hause gehen, um morgen früh seine Nachbarin zum Frühstück zu treffen, wie er es ausgemacht hatte. Ausgerechnet jetzt kam seine Sekretärin, Frau Sophie Fleck, zur Tür herein. Es war vermessen, sie »seine« zu nennen, sie war dem Kriminalkommissariat zugeordnet und für alle und alles zuständig. Für ihn hatte sie naturgemäß eine besondere Bedeutung. Seit dem Tod seiner Mutter war sie seine stabilste und am längsten dauernde Beziehung. Über Sophie, weil sie Fleck hieß, hatte man sich lustig gemacht. Vor vielen Jahren, als sie einmal einen Fleck vom Ansaugen eines ihrer jugendlichen Freunde am Hals hatte, war der Name »Fleck« besonders betont worden. Heute waren sie beide aus dem Alter raus und dachten selten an die alten Zeiten. Was geblieben war, war eine große Vertrautheit, die sicher auch daher stammte, dass sie beide Fischköppe waren. Sie lächelte fast. Außer Lüdewitz hätte niemand dieses Lächeln sehen können. Für Außenstehende war sie eine Frau in den besten Jahren, mit Lippen, die wie ein Strich den Raum zwischen Nase und Kinn teilten. Aber Lüdewiz konnte es an ihren Augen sehen und sogar eine Andeutung von Lachfältchenanspannung in den Augenwinkeln entdecken. Das musste in dieser Region genügen, das war fast eine Entsprechung eines lauthalsen Lachens eines Italieners oder so, dachte Lüdewitz und war froh, nie in Italien gewesen zu sein und auch nie hinfahren zu wollen. Er hatte dem Altkanzler Schröder misstraut, der den Deutschen von Italien vorschwärmte. Das war sicher kein Kanzler für Mecklenburg, vielleicht für die Bayern, die nach Lüdewitz’ Meinung ohnehin keine richtigen Deutschen waren. Bismarck, der das sicher gleich wie er gesehen hatte, konnte angesichts des wahnsinnigen Ludwig II. einfach nicht ausweichen und musste Bayern zu einem Teil Deutschlands machen. Das verstand Lüdewitz zwar, aber er musste es nicht mögen.
Sophie hielt eine neue Diebstahlsmeldung in Händen. »Von Borkensteed«, sagte sie‚ »möchte, dass du das bearbeitest, wenn du die Sache Blumenfeld erledigt hast. Ein toller Wagen«, fügte sie hinzu. »Dass man so was baut. Das gehört doch gar nicht auf die Straße, das ist doch für die Rennbahn. Ein echter Goldfasan!«, schloss sie. Goldfasan? Goldfasan? Das Wort passte Lüdewitz gar nicht hierher. Goldfasane nannte man doch die deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs, wegen des goldenen Eichenblatts auf rotem Grund auf ihren Spiegeln. Dass man dabei auch noch an das Gestelzte dachte und sich ein bisschen lustig machte, kam dazu. Wieso kam Sophie auf diesen Begriff? Lüdewitz beschloss, sich das zu merken. Er hatte schon oft gemerkt, dass die spontanen Einfälle Sophies wichtige Hinweise enthielten.
Lüdewitz nahm die Anzeige in die Hand: Mercedes, 4,2 Liter, 65 AMG, 4matic, Front- und Heckspoiler, Schiebedach, Automatik, Überlänge, hellbeige Lederpolsterung, Nussbaumarmaturenbrett, Eiskasten und DVD-Player, ohne Drosselung. Somit wusste er schon viel über dieses Fahrzeug. Der Besitzer fuhr, wenn er es ausfahren wollte, vorwiegend nachts zwischen 0.00 und 6.00 Uhr, um allen Geschwindigkeitskontrollen auf deutschen Autobahnen, auszuweichen. Überdies musste der Besitzer reich sein, denn die Anzeige belief sich auf 268.000 Euro Neuwert. Da das Fahrzeug zwei Jahre alt war, schätzte er seinen Marktwert auf circa 160.000. Allerdings musste man erst einen Käufer finden, der so viel Geld hatte und trotzdem ein »altes« Auto wollte. Vor allem verstand er eines nicht: Dieses Auto stach aus Hunderten heraus wie ein Albinozebra aus seiner Herde. Wer würde das Auto kaufen wollen, selbst wenn die Motornummer geändert, das Fahrgestell neu gemacht und die Zulassungsnummer neu wäre? Wer würde dieses Risiko eingehen? Er beschloss, diese Anzeige selbst zu verfolgen. Sie wies auf einen reichen Käufer oder einen Auftrag hin oder einen Rachefeldzug gegen einen Gaunerkollegen. Das konnte schon zu einer größeren Spur führen und vielleicht dabei helfen, die Autobande vom Kopf her aufzurollen. Zu Sophies Enttäuschung legte er daher die Anzeige auf den Stapel zu seiner Rechten und stand auf. »Genug für heute«, sagte er, »Feierabend!« Nun lächelte er. Natürlich so, wie es sich gehörte: unsichtbar.
1Die Ethikgruppe eines Krankenhaus setzt sich aus Experten der verschiedenen Spezialgebiete der Medizin zusammen, die bei Entscheidungen über Leben oder Tod den behandelnden Ärzten und den Angehörigen bei der Beurteilung der Aussichten (Prognose) beratend zur Seite stehen.
II. Umlandrecherche
Lüdewitz war kein Morgenmensch. Er stand schwer auf und war morgens nicht hungrig. Schwester Lorle war da ganz anders. Sie kam vom Nachtdienst, wollte essen und dann schlafen. Nachmittags holte sie ihren Sohn von der Kita ab, den ihre Mutter hingebracht hatte. Da wollte sie frisch und fröhlich sein und die unendliche Energie Kais genießen. Eigentlich wollte sie sich an Kai freuen, den sie allein mit der Hilfe ihrer Mutter aufzog. So sehr sie sich das vornahm, es gelang ihr seltener, als sie das wollte. Kai ähnelte zu sehr seinem Vater. Aufgeweckt, fröhlich, unbedarft und so gar nicht aufs Fischland passend. Dunkle Locken über blauen Augen, schon jetzt ein Mädchenschwarm. Der dann so eine, wie sie es gewesen war, verführen und schnell wieder verlassen würde. Mit einem Kind zurücklassen, das zwar wunderschön war, aber eine Belastung, und keineswegs das Leben zuließ, das sie sich gewünscht hatte. Eine Aufgabe eben. Die Bezahlung als Nachtschwester war schlecht, aber das Beste, was es in der Gegend gab. Sie arbeitete fünf Nächte von 19.00 bis 6.30 Uhr durch und war dann in der Pause von zwei Nächten so kaputt, dass sie manchmal wieder ihre Mutter bemühen musste, um eine Nacht durchschlafen zu können. Kai kam sonst jede Nacht, in der er die Mutter spüren konnte, zu ihr ins Bett und wollte kuscheln. Wirklich ganz der Vater. Wie hatte sie das geliebt, als sie den Süddeutschen erst kurze Zeit kannte. Bei Kai war es ihr fast immer zu viel. Heute von Lüdewitz zum Frühstück eingeladen zu werden, war ein Fest. Sie gingen in Lüdewitz’ Stammlokal, von René und Simon – einem schwulen Schweizer Paar – betrieben, die eigentlich zum Surfen auf die Insel gekommen waren.
»Was darf ich Ihnen bestellen?« Ganz Gentleman der alten Schule. So empfand sie es und fühlte sich als Frau wahrgenommen. »Frühstück, was sonst?«
Lüdewitz bestellte also ein Frühstück, nicht ohne den ihm so lieben Fragen der Schweizer Rede und Antwort zu stehen.
»Café creme oder Café au lait?«
Er nahm wie immer Café creme, der seiner Meinung nach ein verlängerter Schwarzer mit Kaffeeobers war. Das Obers ließ er stehen, er trank schwarz, ohne Zucker. Lorle langte kräftig zu. »Sie wollen doch sicher was aus der Klinik wissen, Herr Kommissar«, sagte sie zwischen zwei Bissen.
»Ich wollte hören, wie es so mit dem neuen Chefarzt geht«, antwortete Lüdewitz.
Lorle freute sich über die Frage. Sie konnte den Chefarzt nur loben. Er war eingestellt worden, um die Klinik in eine Psychosomatische Klinik umzuwandeln. Er sollte einen neuen Umgang mit den Patienten und deren Eltern lehren, vorzeigen und so eine neue Art von Klinik herstellen. Er hatte gleich begonnen, mit den Schwestern und dem anderen Personal seine Vorstellungen zu teilen. Allerdings wollten das weder die Klinikleitung noch das Personal. Die lebten unter der Knute des Geldes. Alles war zu teuer. Es durften nie zwei Schwestern gleichzeitig Dienst machen, weil das unnötig war und zu viele Kosten erzeugte. Ebenso war es bei den Erziehern und Lehrerinnen. Die wurden mit 24 Kindern in einen Container oder einen Klassenraum gesteckt und hatten dort zweimal vier Stunden zuzubringen. Wenn es an manchen Tagen zu stark regnete, gab es nicht einmal die entlastenden Strandspaziergänge. Wenn es eine Durchfallendemie gab, dann bekamen alle Kinder trotz der Händedesinfektionsstationen vor den Toiletten und den Speisesälen das Virus, weil sie so zusammengepfercht waren.
Der Chefarzt hatte sich sofort für einen Kontakt aller mit allen eingesetzt. Er war mit den Patientinnen frühstücken gegangen, er hatte eine offene Tür für alle. Sie sah, dass seine Art der Kommunikation auf Rügen für viele Mitarbeiter schwer zu ertragen war. Er war offen und fröhlich, hielt nicht viel von vorgegebenen Regeln und freute sich, wenn Patienten zu ihm kamen. Ganz das Gegenteil der bisherigen Praxis. Frau Hafer und Frau Schostikova, die eine DDR-erfahren, die andere Bulgarin, beide ohne wissenschaftlichen Abschluss und ohne Ehrgeiz, sahen Patienten als Belästigung an. Sie hatten sie so behandelt, wie die armen Patienten es gewohnt waren: schlecht. Was diese wollten, wurde übergangen, sie wurden gemäß der Einweisungsdiagnose behandelt. Diese war immer Asthenie, also »Nervenschwäche«, manchmal hatten die Mütter auch Rückenschmerzen, die diagnostiziert wurden, weil Frau Hafer gerne mit Lokalanästhetikum Nerven infiltrierte, was Schwester Lorle als Sadismus ansah.
Die beiden Ärztinnen hatten Professor Blumenfeld so schlecht wie möglich behandelt. Er hatte das schlechteste Zimmer bekommen, ohne entsprechende Einrichtung. Er hatte keine Informationen bekommen, wann, was und wo. Der Arzt, der bis zur Berufung Blumenfelds den Chefarzt vertreten hatte, Herr Professor Ehrlichmann aus Heidelberg, war in diesem Trott noch der Beste. Der Versuch Blumenfelds, einmal ein Lächeln oder eine Gemeinsamkeit herzustellen, war allerdings gescheitert. Als Ehrlichmann die Schwestern noch mehr drückte, ihnen sogar die wöchentliche Besprechung als Luxus strich, hatte Blumenfeld das abgelehnt – vor den Schwestern – und wirklich gesagt, dass das gegen sein Konzept der Zusammenarbeit gerichtet sei. Danach hatte sie sogar Ehrlichmann aus dessen Behandlungszimmer laut werden gehört, zornig sei er zum Klinikdirektor gegangen. Der sei ihr überhaupt nicht koscher. Wozu der noch mal den Klinikdirektor machte, nachdem er schon in Pension gewesen war und bereits eine Krebserkrankung überstanden hätte, das verstünde sie nicht.
Lüdewitz erinnerte sich an den »Tatort« im Fernsehen vom letzten Sonntag. Wieder so einer wie die Frau Blum, dachte er sich. Einer, der nur die Arbeit kennt und sonst nichts. Wie denn das Verhalten vom Klinikdirektor gegenüber Blumenfeld sei, wollte er wissen. »Scheußlich«, war die schnelle Antwort. Nichts, aber auch gar nichts zwischen den beiden lief rund. Nun bekam es Lorle mit der Angst zu tun. Sie durfte Lüdewitz ja keine Auskünfte geben. Das war sicher ein Kündigungsgrund. Es stand in ihrem Dienstvertrag, dass sie nach außen nichts über die Klinik und das, was ihr dort bekannt wurde, sagen durfte. Wenn sie von der Polizei vernommen wurde, musste sie das unverzüglich der Klinikleitung mitteilen, die ihr einen Anwalt stellen würde. Der würde, so vermutete Lorle, vor allem die Interessen der Klinik und deren Besitzer im Auge haben, die ja schließlich auch seine Auftraggeber wären. Erschrocken sah sie Lüdewitz an. Was er denn jetzt mit dem täte, was sie ihm gesagt hätte. Ob er denn wisse, dass sie damit ihre Existenz gefährde und dass es keinen vergleichbaren Job auf Rügen gäbe und sie alleinerziehende Mutter wäre und sie Kai mit der Hilfe ihrer Mutter, die eine kleine Pension hätte, durchbringen müsse. Lüdewitz sah Angst in Lorles Augen. Was sollte er tun? Klar, beruhigen. Niemand würde ihren Namen erfahren, er würde sie in keinem Protokoll erwähnen, ihre Unterhaltung hätte zwar der Wahrheitsfindung gedient, aber er würde sie, seine Informantin, nie erwähnen. Das Wort war schlecht gewählt, im Moment, in dem er es ausgesprochen hatte, wusste er es schon. Kommunikation ist aber nicht umkehrbar‚ und ein ausgesprochenes Wort kann nicht wieder zurückgenommen werden. »Informantin«, murmelte Lorle erschreckt. Das seien doch die, die zuhauf in Stasiakten gefunden worden waren und mit denen sie Abgeordnete der Linken noch Jahre, nachdem die einmal in den Akten erwähnt worden waren, konfrontierten. »Informantin«, murmelte sie immer wieder und lief aufs Klo. Lüdewitz befürchtete, dass sie dort das Frühstück wieder von sich gab. Er beschloss, sich selbst zu schädigen. Er würde tatsächlich keine Erwähnung des Frühstücks im Akt machen, auch nicht ohne Lorles Namen, und daher die Zeche aus eigener Tasche und nicht aus Bundesmitteln zahlen. Das konnte er sich leisten, und das war er Lorle schuldig. Sofort als sie aus dem Klo kam, berichtete er ihr von seinem Entschluss. Farbe kam in ihr Gesicht zurück, aber sie wollte sofort gehen und bat Lüdewitz, sie nicht zu begleiten oder irgendwo anzusprechen. Höflich, wie sie war, bedankte sie sich noch für das gute Frühstück, von dem Lüdewitz aufgrund ihres Mundgeruchs sicher war, dass es das Lokal nicht verlassen würde. Es war im Klo geblieben und jetzt Fischfutter.
III. Besuch im Polizeipräsidium
Gleich nach dem Kaffee mit Lorle ging Lüdewitz ins Amt. Seine Vermutung war bestätigt worden. Keiner hatte Ignaz Blumenfeld hier gewollt. Der Generaldirektor in Hannover hatte an dem belesenen Juden Gefallen gefunden. Sowohl der Verwalter, der sich jetzt Klinikdirektor nennen durfte, als auch dessen Sekretärin Frau Irmgard Hopf, aber auch die zwei unbedarften Ärztinnen aus dem »realen Sozialismus«, sie alle fürchteten den, der ihnen so offensichtlich überlegen war. Witzig, belesen, erfolgreich, in der Welt bekannt und in ihr zu Hause, kein Fischkopp, sondern ein sich gut ausdrückender, fröhlicher Mensch – alles, was sie nie waren und was ihn zum Feind machte. Sogar die Stalinsche Formulierung: »Es geht um die Klassenherkunft«, die dieser bei den Schauprozessen in den 30er-Jahren gegen die jüdischstämmigen Mitglieder des Zentralkomitees der KPdSU verwendet hatte, fiel ihm wieder ein. Lüdewitz war sich mehr und mehr sicher, dass die nicht promovierte Ärztin Hafer, die vielleicht selbst gern Chefärztin geworden wäre, hinter dem Kindstod stand und dass Blumenfeld sie aus falsch verstandener Loyalität gedeckt hatte. Die Rolle der anderen Beteiligten war ihm unklarer. Wieso hatte der Klinikdirektor, den Blumenfeld ausdrücklich gefragt hatte, ob er ihn wolle, nicht Nein zu ihm gesagt? Wieso hatte der Generaldirektor Blumenfeld nicht mehr geschützt, indem er ihm zum Beispiel die täglichen Beschwerden Hafers weitergeleitet hatte. Vieles war offen, und aus seinem anfänglichen Staunen über den begrenzten Ermittlungsauftrag war Verwunderung geworden. Er erklärte sich diesen Auftrag aber ganz einfach: Von Borkensteed, der für ihn ungefähr so ein rotes Tuch war, wie Blumenfeld es für die Mannschaft in der Klinik gewesen sein musste, hatte irgendein Interesse, das er wahrscheinlich nie erfahren würde. Es konnte mit Geld, mit Karriere oder beidem zusammenhängen.
Lüdewitz musste sich eingestehen, dass er Stralsund nur mehr sehr selten verließ. Er hielt praktisch keinen Kontakt zu seinen unmittelbaren Vorgesetzten. Selbst seine Kolleginnen kannte er nur vom Telefon. Er bedauerte, dass die Dienststelle in Stralsund zu einer Halbtagsbeschäftigung von Frauen mit Kindern geworden war, ebenso wie die Gerichte. Er verstand meist Männer besser und war in einer Polizei groß geworden, die fast nur aus Männern bestand. Dass seine Vorgesetzte Ulla Ravensburger, Polizeipräsidentin von Neubrandenburg, eine Frau war, fiel ihm schwerer zu ertragen, als dass die Bundeskanzlerin eine Frau war. Die ist so wenig Frau wie ich, sagte er sich, sodass er sie schon wieder verstand. So beschloss er, gleich in seinen E-Mails nachzuschauen, wann wieder ein Treffen in Neubrandenburg stattfinden würde. Er hatte – so gestand er sich ein – ganz gegen seine Anlagen schon manches Mal auf ein gutes Wort von von Borkensteed gewartet, auf irgendeine Anerkennung oder ein Lob. Der rief allerdings nur an, wenn er sich beschwerte: zu langsam, zu ungenau, der Bericht zu spät und anderes mehr. Lüdewitz wollte schon gar nicht mehr ans Telefon gehen, wenn Sophie sagte, dass von Borkensteed dran wäre. Er beschloss, den Spieß umzudrehen und von Borkensteed zu loben. Vielleicht bräuchte der Herr Staatsanwalt auch mal ein gutes Wort, wie Lüdewitz insgeheim gern eins gehabt hätte.
In der Tat: Schon heute Abend wurde eine Kollegin, mit der er auf der Polizeischule gewesen war, in den Ruhestand verabschiedet. Ullas Rede würde er gut überstehen und dann gab’s Brötchen und Bier, vielleicht sogar Schaumwein. In der DDR war das immer so gewesen. Da gab’s zuerst lauwarmes Bier mit Bockwurst, dann für die Führungsriege Krimsekt und Kaviar vom Stör auf pampigem Weißbrot mit Mayo. Da man damals noch keine Alkomaten hatte, fuhren die Polizisten betrunken heim. Schrottete einer den Dienstwagen, so wurde der von Häftlingen repariert. Ersatzteile für einen Lada waren immer vorrätig, wenn nicht, schweißte man einfach welche. Er freute sich auf die Kollegin, das Bier und die Fahrt. Er beschloss sogar, früher zu fahren und seinen alten Freund Rudi zu besuchen, der im Altersheim wohnte. Dazu musste er einen Umweg machen. Das Altersheim lag nicht in den einst so billigen kleinen Häusern der inneren Stadt, sondern war ein Funktionsbau am Rande der Stadt. Kein Blick, daher nannte es sich Waldesruh. Lüdewitz meinte schon von Weitem, den Geruch nach alten Windeln und mobilen Leibschüsseln wahrzunehmen. Selbst der kleine Wald, wenn man die vom Ostseewind verkrüppelten Lärchen so nennen wollte, konnte ihn nicht trösten. Er machte diesen Gang aus Pflichtgefühl und weil er sehen wollte, wie es mit ihm einmal zu Ende gehen würde. Rudi zu besuchen war ein Reinfall, Rudi erkannte ihn kaum mehr und klagte fortwährend. Vor allem übers Essen. Es war aber trotzdem irgendwie gut: Rudi hatte gesund gelebt, viel Sport getrieben und sich über Horst lustig gemacht. »Wirst schon noch sehen, wo du mit deiner Lebensführung hinkommst!«, hatte er oft gesagt. Jetzt sah Lüdewitz, wo Rudi mit der seinen hingekommen war, und beschloss, weiter so zu leben wie bisher.
Der Weg nach Neubrandenburg war langweilig. Vor allem, wenn man ihn kannte. Für die Fremden war es aufregend, durch die Wälder zu fahren, in denen Kaiser Wilhelm II. ebenso gejagt hatte wie Hermann Göring. Beidseits der Straße Auwald. Die Straße etwas erhöht, wie auf einem Damm, um die kleinen Abflussschwierigkeiten zu beherrschen, die durch das mangelnde Gefälle zustande kamen. Lange, gerade Straßen, die zum Schnellfahren verleiteten, weshalb alle paar Hundert Meter am Straßenrand kleine Kreuze aus Holz oder Metall standen, an denen künstliche Blumen und eine kleine Tafel hingen. Angehörige hatten das Bedürfnis, an dem Todesort eine dauernde Erinnerung an den lieben Verstorbenen zu hinterlassen. Oder es war einfach nur Mode geworden. Der Straßenverkehr forderte mehr Opfer als alle terroristischen Attacken und viele andere Gefahren, vor denen sich die Menschen fürchteten, wie zum Beispiel Haiattacken oder Überfälle im dunklen Wald. Unsere Instinkte hatten mit den realen Gefahren einfach nicht mitgehalten. So konnte man es sagen, dachte sich Lüdewitz gerade, als ihn ein Raser überholte und auf der geschwindigkeitsbeschränkten Landstraße, wo man 100 Kilometer pro Stunde fahren durfte, mit 160 an ihm vorbeibrauste. Nicht ohne ihm den Vogel zu zeigen. Aus alter Gewohnheit merkte sich Lüdewitz das Kennzeichen und gab es an die nächste Verkehrsleitstelle durch. Nach vier Kilometern, als er auf die Schnellstraße auffuhr, sah er befriedigt, wie der Raser gestoppt worden war und die Kollegen das Auto kontrollierten. Pech gehabt, dachte er sich, man weiß nie, wo ein Polizist sitzt. Fast hätte nun er dem anderen den Vogel gezeigt, aber so was machte ein Kriminalhauptkommissar nicht.
Die Verabschiedung war moderner geworden. Lüdewitz konnte das sagen, weil er seit der Wende bei keiner mehr gewesen war. Früher waren sie verpflichtend, weil man den Mitgliedsbeitrag zur Polizeigewerkschaft persönlich einzahlen musste. Einfach eine Form obrigkeitlicher Kontrolle. Lüdewitz wurde damals routinemäßig gefragt, ob er sich nicht mit der SED assoziieren wollte, aber die Kollegin, die das beim Inkasso fragen musste, lächelte in derselben unsichtbaren Weise, wie in Mecklenburg-Vorpommern (MV) gelächelt wird. Heute waren viele Zivilisten anwesend oder jedenfalls Menschen, die Lüdewitz dem Zivil zugeordnet hätte. Damals gab’s ein oder zwei Männer, die keine Uniform trugen – Geheime. Heute trug selbst die Polizeipräsidentin keine Uniform. Ulla Ravensburger kam auch gleich auf ihn zu: »Das ist aber fein, dass du es wieder mal geschafft hast, aus Stralsund zu uns zu kommen!«, sagte sie durchaus herzlich, sogar herzlicher, als professionell nötig gewesen wäre. »Schau«, rief sie der frischgebackenen Pensionärin zu, die gerade Sekt ausschenkte, »der Lüdewitz ist wieder mal bei uns!« Man umarmte sich, Küsschen, Küsschen, nicht der Bruderkuss des Kommunisten, sondern der vorbeiflirrende Wangenkuss der neuen Zeit.
Da entdeckte Lüdewitz von Borkensteed, der mitten unter den Kolleginnen stand und ein Glas Sekt in der Hand hielt. Er hätte ihn fast nicht erkannt, so hatte der zugenommen. Wie wenn er sich im Fett einsülzen will, dachte Lüdewitz. »Gut schauen Sie aus«, sagte er daher zum Staatsanwalt. »Wie geht’s immer so?«
Der lächelte säuerlich. »Ich kenne Sie nur von der Stimme«, antwortete er, »wir sehen einander ja nie. Sagen Sie, wie ist der Ermittlungsgang bei dem Fall in der Klinik?«
Lüdewitz war erstaunt. Das war selbst für Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen ungewöhnlich, dass man statt Small Talk auf einer Feier gleich mit der Tür ins Haus fiel.
»Das freut mich«, antwortete er, »dass Sie immer dranbleiben. Darf ich fragen, wieso sich der Verdacht eines Offizialdelikts nur gegen den Chefarzt richtet?« Wenn der Herr es so wollte, dass alles in der Öffentlichkeit besprochen werden sollte, das konnte er auch.
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht«, kam gleich die Replik. »Sie sollten doch nur eine Einvernahme machen.«
Lüdewitz wurde ziemlich heiß. Vielleicht war es der enge Anzug, vielleicht der Sekt, jedenfalls sagte ihm der Staatsanwalt wie einem Lehrling, dass er nicht denken, sondern nur erfüllen, folgen sollte. Das würde heute nichts mit der Verbesserung der Beziehungen, das war ihm klar. Er hatte gelernt, Feinde zu bekämpfen. Er wollte ihnen aber nicht in einer unübersichtlichen Schlacht begegnen, sondern Situationen schaffen, in denen er gewinnen konnte.
Da setzte von Borkensteed schon nach, mit schwerer Zunge, wie Lüdewitz sogleich bemerkte: »Sind Sie etwa mit Blumenfeld bekannt? Befangen? Hat man sich auf Rügen unter Intellektuellen angefreundet?«
Lüdewitz wusste nicht, was er sagen sollte, also blieb er bei der Wahrheit: »Wir treffen uns manchmal eher zufällig in einem Schweizer Kaffeehaus mit einer guten Mohntorte, so was bekommt man sonst dort nicht.«
»Aha«, tönte es da mit feuchter Aussprache, »also doch. Hab mir so was gedacht. Werden also private Erhebungen gemacht?«
Aus einem harmlosen Wunsch, dem Gegenüber mal was Nettes zu sagen, war ein Vernichtungskampf geworden. Lüdewitz hatte nicht vor, ihn weiterzuführen. Also drehte er sich um und ging zu der Kollegin, die der eigentliche Anlass seines Kommens gewesen war.
»Wir können ihn alle nicht leiden«, sagte Paula, die neben ihr stand, gleich zur Begrüßung. »Er will nicht hier sein, kommt aber nicht weg, säuft und ist einfach ein Kotzbrocken, wie es im Buche steht!«
Lüdewitz grinste, so wie man eben in MV grinste.
Paula fragte: »Wie lang hast du denn noch?«
»Zweieinhalb Jahre.«
»Planst du eine Kur?«
Es war klar: Paula fand, dass man sich am Ende des Dienstes nicht noch aufreiben sollte. Sie sah blendend aus, fand Lüdewitz. Sie war immer eine fesche Frau gewesen, als junge sogar Leistungssportlerin der Polizei, und hatte Preise bei internationalen Turnieren gewonnen, die den ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat im gewünschten Licht darstellten. Sie hatte dann geheiratet, einen Richter, soviel sich Lüdewitz erinnerte, viel älter als sie, den sie nach einigen Jahren zu Grabe getragen hatte. Schade, dachte er sich, damals hätte man nachhaken können. Sie schien seine Gedanken lesen zu können:
»Ja, da hat man ein Leben für Frieden und Gerechtigkeit gegeben und erwartet nun ein einsames Alter. Komisch, nicht?«
Lüdewitz war sprachlos, mehr als sonst. Die plötzliche Gemeinsamkeit gegen von Borkensteed, die alten Erinnerungen und die Anziehung, die er schon immer empfunden hatte, und nun das. Das war ziemlich viel auf einmal für den ans Alleinsein gewöhnten Kommissar. »Willst du mich mal in Stralsund besuchen? Wir können aufs Fischland fahren. Jetzt waren die Kraniche zwar schon da, aber am schönsten ist es bei uns, wenn es für die Touristen gar nichts gibt. Keine Sonne, keinen Strand und keine Kraniche. Da gehören Rügen und das Fischland wieder uns.«
»Ich komme aus Wüstrow«, sagte Paula darauf, »mir musst du gar nichts erzählen. Jetzt, wo Wüstrow eine Künstlerkolonie geworden ist, kommen schon Fremde, um Fremde anzuschauen. Da brauche ich gar keine Flüchtlinge, mir reichen schon die reichen Touris, die überall rumstehen und gaffen.«