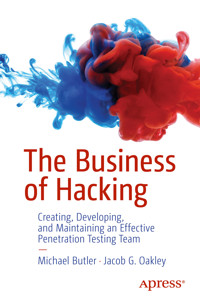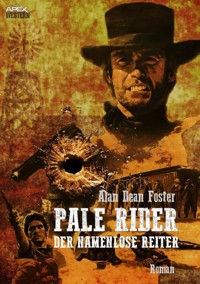
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Sie nennen ihn den Prediger – ihn, den namenlosen Reiter, der gekommen ist, um eine kalifornische Goldgräberstadt in gesetzloser Zeit von Gewalt und Terror zu befreien: Er ist ein harter, kompromissloser Revolvermann und Streiter Gottes in einer Person, und mit dem Colt in der Hand nimmt er die Herausforderung des reichen Minenbesitzers Lahood an, der die unabhängigen Goldsucher aus Carbon Canyon vertreiben will...
Der Apex-Verlag veröffentlicht diese Roman-Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1985 (Produktion und Regie: Clint Eastwood) in seiner Reihe APEX WESTERN als durchgesehene und bearbeitete Übersetzung, ergänzt um ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
ALAN DEAN FOSTER
Pale Rider -
Der namenlose Reiter
Apex Western, Band 4
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
PALE RIDER – DER NAMENLOSE REITER
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Ein 'bleicher Reiter' im Land des Goldes. Alan Dean Foster's Pale Rider
Das Buch
Sie nennen ihn den Prediger – ihn, den namenlosen Reiter, der gekommen ist, um eine kalifornische Goldgräberstadt in gesetzloser Zeit von Gewalt und Terror zu befreien: Er ist ein harter, kompromissloser Revolvermann und Streiter Gottes in einer Person, und mit dem Colt in der Hand nimmt er die Herausforderung des reichen Minenbesitzers Lahood an, der die unabhängigen Goldsucher aus Carbon Canyon vertreiben will...
Der Apex-Verlag veröffentlicht diese Roman-Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1985 (Produktion und Regie: Clint Eastwood) in seiner Reihe APEX WESTERN als durchgesehene und bearbeitete Neuausgabe, ergänzt um ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth.
PALE RIDER – DER NAMENLOSE REITER
Harry Moore und Smithee, meinen Lieblingspredigern, gewidmet;
beide arbeiten allerdings eher nach der herkömmlichen Methode.
Erstes Kapitel
Man nannte Conway Spider - die Spinne.
Hierfür gab es verschiedene Gründe, in erster Linie rührte es jedoch daher, dass er darauf bestand, denn seinen richtigen Vornamen empfand er als äußerst unpassend für seine derzeitige Beschäftigung. Gerüchte wollten wissen, seine Eltern hätten ihn Percy getauft, doch niemand in Kalifornien wagte, ihm das ins Gesicht zu sagen.
Der Spitzname entsprach seiner Art sich zu bewegen ebenso gut wie zu seiner Persönlichkeit. Er war Anfang 50, von der Sonne in der Sierra braungebrannt, klein und sehnig wie ein Arapahoe-Pony; die meiste Zeit rannte er auf seinem Claim hin und her. Während die Mehrzahl der anderen Goldgräber damit zufrieden war, an ihren Long Toms zu arbeiten - den langen Waschrinnen, die den Carbon Creek säumten - oder geduldig am sandigen Ufer saßen und ihre Goldwaschpfannen schwenkten, war Conway in ständiger Bewegung. Mal arbeitete er mit der Waschpfanne, mal grub er mit der Schaufel den Kies des Baches um, mal untersuchte er die größeren Felsbrocken nach Farbadern im Gestein. Geschickt durchwühlte er die Kiesel und Schieferstücke, mit denen seine Waschpfanne gefüllt war, und von Zeit zu Zeit legte er eine kurze Pause ein, um voller Zuversicht seinen beiden erwachsenen Söhnen zuzuwinken.
Conway war in der Lage, mit einer Hand winken und mit der anderen weiterhin die Waschpfanne schwenken. Aufgrund dieses einzigartigen Talents hatte er eine gewisse Berühmtheit erlangt. Nur wenige Digger hatten ein solch kräftiges Handgelenk und das Fingerspitzengefühl, um eine Goldwaschpfanne mit nur einer Hand zu bedienen. Aber irgendwie gelang Conway dieser schwierige Balanceakt.
Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der er freudig Neuankömmlingen seine Kunst vorgeführt hatte, wenn sie ihm dafür eine Mahlzeit spendierten. Doch das war schon ziemlich lang her. Nicht, weil er keine Lust mehr dazu gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Die traurige Tatsache war, dass seit mehreren Monaten kein Fremder mehr in den Carbon Canyon gekommen war.
Und dafür... gab es einen Grund.
Es war nach außen gedrungen, was in Carbon vor sich ging, und jene Goldsucher, die von Carbons unbestreitbaren Goldvorkommen in Versuchung hätten geführt werden können, hatten auch von der Gefahr gehört, in welcher die Digger im Carbon Canyon schwebten.
Man nannte Conway also Spider, und der Name blieb ihm. Dafür sorgte er schon selbst, denn in den Minenstädten, die sich an die westlichen Hänge der Sierra Nevada reihten, so wie Perlen den Hals von Lola Montez zierten, hätte ein Niemand wie Percy vermutlich nicht sehr lange gelebt. Man kann nicht alle Kämpfe überleben, und Conway war schon über fünfzig. Er war also Spider, und er war froh darüber.
Er legte die Waschpfanne für einen Augenblick zur Seite, suchte in seiner Werkzeugtasche, bis er einen Becher aus Blech fand, und tauchte ihn in den Bach. Das Schmelzwasser von den Bergen war kühl und erfrischend. Das beste Wasser der Welt, dachte Conway, und wenn man zufällig ein kleines Kieselchen mitschlürft, nun, vielleicht kommt man auf diese Weise an dein Gold.
Der alte Digger kicherte und rief sich die Geschichte von der Rache des Chinesen in Erinnerung. Unten in Placerville hatten sich ein paar Männer geweigert, einem angesehenen Sohn des Himmels, der eine Wäscherei betrieb, für die Wäsche eines ganzen Monats zu bezahlen. Weil sich kein Sheriff um die Belange der chinesischen Einwanderer kümmerte - es sei denn, sie waren durch Zufall in eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einem Weißen verwickelt -, blieb es dem Betrogenen überlassen, auf eigene Faust für Schadenersatz zu sorgen. Das hatte der Mann namens Chang getan, und wenn er auch niemals sein Geld erhalten hatte, so hatte er sich doch zumindest gerächt.
Irgendwer hatte das Gerücht in Umlauf gebracht - wer wohl? -, dass die drei Betrüger ihr Gold unter dem Abort auf ihrem Claim vergraben hatten, wo niemand auf die Idee kommen würde, danach zu suchen. Natürlich schlich sich eines Nachts eine Horde von Möchtegerndieben dorthin. Sie rissen das Toilettenhäuschen nieder und suchten nach dem versteckten Goldschatz. Keiner der drei Digger war in der Lage, den Überfall zu verhindern. Am nächsten Morgen machten sich die enttäuschten und erheblich stinkenden Eindringlinge ohne Beute davon, und die Besitzer des Claims mussten die Überreste der unerwünschten Ausgrabung selbst beseitigen. Anschließend brauchte ihre Kleidung tatsächlich eine Reinigung, und die Sache stank ihnen noch lange Zeit danach.
Eine Zigarette, das wäre jetzt goldrichtig, dachte Conway. Doch niemand rauchte unten am Creek. Das Rauchen war ein Vergnügen, das ausschließlich dem Feierabend Vorbehalten war. Das Tageslicht musste für das Waschen des Goldes genutzt werden. Wegen der hohen Berge, die den Canyon säumten, waren die Tage hier kürzer, und das Licht war bei weitem zu kostbar, als dass man es mit vielen Ruhepausen verplempern würde. Dafür war noch Zeit genug, wenn die Arbeit getan war. Wenn man sich hinsetzte und rauchte, konnte einem der Reichtum an den Füßen vorbei den Bach hinabfließen. Das Goldwaschen war kein Job für Faulenzer.
Nicht, dass man durch harte Arbeit zwangsläufig reich wurde. Der Carbon Canyon hatte seine Versprechen nach dem ersten großen Fund noch nicht eingelöst. Und Versprechen auf schnellen Reichtum gab es viele: Da waren zahlreiche Färbungen im Gestein, die auf Goldadern schließen ließen, und es gab gerade genug Goldstaub, um einen Digger zum Bleiben zu veranlassen. Es war immer noch jungfräuliches Gebiet, unberührt vom Goldrausch des Jahres '49, als die Glücksritter die Nuggets manches Mal nur aufzusammeln brauchten. Man musste einfach Ausdauer haben und sich durch die obere Kiesschicht hindurcharbeiten, um an das goldführende Gestein darunter zu gelangen. Ein Jeder wusste das, und deshalb hatte der Carbon Canyon nach Conways erstem Fund so viele gute Leute angelockt.
Doch jetzt waren seit einiger Zeit keine Neuankömmlinge mehr aufgetaucht. Conway stieß einen Grunzlaut aus und ließ seinen Blick von dem reißenden Wasser des Creeks hinauf zu der nahen Ansammlung von Gebäuden wandern.
Es war nichts Besonderes, eine kleine Ansiedlung, doch das Versprechen war da, ein anderes, jedoch auf seine Art nicht weniger verheißungsvolles, als es der Bach enthielt. Einige Familien hatten bereits anstelle ihrer ursprünglichen Buden aus Brettern und Teerpappe solide Gebäude aus Baumstämmen und Latten errichtet. Diese Leute bauten feste Häuser statt Camps, die zum baldigen Abbruch bestimmt waren. Rauch stieg aus einigen Kaminen, wenn die Frauen, die ihren Männern westwärts gefolgt waren, in ihren Küchen werkelten. Ihre Anwesenheit war ein weiterer Beweis für den Beginn der Lebensfähigkeit der Gemeinde. Frauen ließen sich nicht in einem Goldgräber-Camp häuslich nieder, wenn sie dort nicht ständig leben wollten. Ihre Einstellung steckte die Männer an; auch ihnen stand der Sinn nach Beständigkeit. Es ist einfach, von einem Claim zum anderen zu ziehen, doch es fällt schwer, ein Heim aufzugeben.
Solche Gedanken erinnerten Conway an seine eigene Frau. Er entsann sich, wie er sie verloren hatte und wie lange das bereits zurücklag.
Ein dumpfes Grollen übertönte das Plätschern des Baches und riss ihn aus seiner Melancholie. Mit gerunzelter Stirn stand er auf und spähte bachabwärts. Sommergewitter waren etwas Alltägliches in dieser gebirgigen Gegend. Zu dieser späten Jahreszeit brauten sich jedoch selten Gewitter über den Gipfeln zusammen, und er konnte keine einzige Wolke entdecken. Natürlich musste das nichts bedeuten. Manchmal genoss man gerade seinen Lunch unter einem wolkenlosen, klaren Himmel und war dann binnen einer Minute gezwungen, in Deckung zu rennen, weil ein Platzregen niederging, der ausgereicht hätte, um Noah am Bart zu zupfen. So war eben das Wetter in der Sierra.
Irgendwo sang eine Spottdrossel. Zwei Eichelhäher jagten einander durch Kiefernzweige. Wieder das Grollen, dieses Mal lauter und andauernd. Kein Donner. Etwas anderes. Doch es konnte Donner sein. Spider Conway betete darum, als er seine Goldwaschpfanne zur Seite legte und mit zusammengekniffenen Augen durch den Canyon spähte. War das eine Staubwolke, die von den niedrigeren Hügeln aufstieg, oder war es Dunst vom Creek? Doch Dunst und Nebel bildete sich nur am frühen Morgen am Bach, wenn die Sonne sich noch hinter den Berggipfeln versteckte. Jetzt war es beinahe Mittag.
Megan Wheeler hörte das Geräusch ebenfalls.
Sie wandte sich um und schaute den Creek hinab. Megan Wheeler war fünfzehn Jahre alt und ging auf die sechzehn zu; einige sagten, sie sei fünfzehn und ginge auf die zwanzig zu. Sie stand an der Schwelle zwischen Kind und Frau. Megan war mit einer frühreifen Schönheit gesegnet, die sowohl die pulsierende Sinnlichkeit ihrer Mutter als auch das gute Aussehen ihres Vaters in sich barg, der Frau und Tochter schon vor langer Zeit verlassen hatte.
Mit beiden Händen schleppte sie einen schweren Wassereimer. Etwas Wasser schwappte heraus, als sie herumfuhr, um durch den Canyon zu spähen. Der Hund, der hinter ihr her getrottet war, blieb ebenfalls stehen und schaute seine Herrin fragend an. Es war ein kleiner Hund, der auch ausgewachsen nicht sehr groß sein würde, ein Argument, mit dem Megan ihre Mutter dazu überredet hatte, das Tier zu behalten.
Wie Megan war er voller Energie und Neugier, halb ausgewachsener Hund, halb Welpe. Er wandte den Blick nicht zum Canyon, doch seine gespitzten Ohren zeigten, dass er das immer lauter werdende Grollen ebenfalls wahrgenommen hatte.
Hull Barret arbeitete im Schatten des großen Granitfelsens in der Mitte seines Claims an seiner Waschrinne. Der Felsen ragte in den Creek und leitete das Wasser um seinen Fuß herum. Während Barret im Augenblick froh über den Schatten war, hatte er den großen Felsklotz vom ersten Tag an verflucht. Der Felsen befand sich ganz genau dort, wo Barret gern seine Waschrinne aufgebaut hätte. Es war ihm nichts anderes übriggeblieben, als anderswo mit der Arbeit zu beginnen. Es kostet Zeit und Geld, Felsen zu bewegen, selbst kleine. Und von beidem hatte Barret wenig. So blieb das Stück Berg, wo es war, und schien ihn ständig zu verspotten. Er verwünschte diesen Felsklotz.
Hull Barrets Gesicht nahm einen besorgten Ausdruck an, als er jetzt die Rüttelvorrichtung der Waschrinne losließ und etwas höher hinaufging, um einen besseren Blick in den Canyon hinab zu haben. Hull Barret war fünfunddreißig. Irgendwie schaffte er es, nicht älter auszusehen, obwohl er stets für andere geschuftet hatte. Das hatte ihn den ganzen Weg durch den Kontinent nach Kalifornien und schließlich zum Carbon Canyon geführt. Die Arbeit war jetzt härter als jemals zuvor, doch zum ersten Mal in seinem Leben brauchte er nicht zu dienen und den Speichellecker zu spielen, um ein mageres Gehalt zu bekommen. Er war sein eigener Herr - so wie die anderen Digger im Canyon. Das wenige, das er dem Carbon Creek abrang, gehörte ihm und niemandem sonst.
Mittlerweile schauten alle Bewohner des Canyons nervös bachabwärts. Man musste schon taub sein, um dieses Geräusch überhört zu haben: Es hallte von den Canyon-Wänden wider und ließ die wenigen Fensterscheiben in den besser gebauten Hütten erzittern.
Conway warf den Inhalt seiner Waschpfanne zu Boden und wollte den Hang hinaufrennen. Als er sich umwandte, fiel sein Blick auf ein Funkeln im ausgeschütteten Sand. Das Goldklümpchen war winzig, kaum größer als ein Sandkorn, doch es war ein Nugget. Er bückte sich, um es aufzuheben, und schätzte das Gewicht, als es auf seiner rauen Hand ruhte.
Das ist doch das Höchste, dachte er, und er wunderte sich, dass ihm der Fund nicht die Furcht vor dem anschwellenden Donnern nahm. Hastig steckte er das kleine Nugget in die Tasche und rannte auf seine Hütte zu.
Plötzlich erkannte er, was das Geräusch verursachte. Es war weder ein Gewitter noch eines der seltenen Erdbeben, die gelegentlich diesen Teil der Sierra erschütterten. Ein Dutzend Reiter jagte in vollem Galopp durch das Bachbett auf die kleine Ansiedlung zu. Wasser spritzte unter den Hufen der Pferde empor und bildete die Dunstwolke, die Hull Barret so irritiert hatte. Die Sonne ließ in der feinen Gischt unzählige winzige Regenbogen entstehen, während die Reiter den Frieden des frühen Mittags zerstörten. Der Anblick war eigentlich wunderschön, doch keiner der Digger oder ihrer Angehörigen dachte daran, diese vergängliche Schönheit zu bewundern.
»Gottverdammt!«, grollte Conway. Er ballte und öffnete hilflos eine Hand, während er das Näherkommen der Reiter beobachtete. Dann riss er seine Waschpfanne und die übrige Ausrüstung an sich und hastete zu seiner Hütte.
Jeder rannte jetzt, raffte Ausrüstung und persönliche Dinge zusammen, hetzte in Deckung und versuchte einfach, den Eindringlingen aus dem Weg zu gehen. Sie waren erfüllt von Verzweiflung, Panik und Resignation. Das Verderben brach über sie herein, und das Schlimmste daran war, dass sie sich schon daran gewöhnt hatten.
Nicht jeder flüchtete vor den Reitern. Ein kleiner gefleckter Hund behauptete seinen Platz und bellte wild den weit größeren Vierbeinern entgegen, die geradewegs auf ihn zu jagten. Der kleine Hund war tapfer, doch nichtsehr schlau.
»Linsey!« Megan Wheeler wandte sich um und schrie nach dem kleinen Hund. Er hörte nicht auf sie, sondern bellte den Reitern entgegen, die das Camp angriffen. Megan, die mit dem Hund einen Mangel an Reife und gesundem Menschenverstand gemeinsam hatte, ließ den Wassereimer fallen und rannte den Hang hinab, anstatt sich in Sicherheit zu bringen.
Die Reiter verteilten sich auf beiden Seiten des Creeks, feuerten ihre Revolver in die Luft ab, brüllten und johlten und taten ihr Möglichstes, um die allgemeine Verwirrung und Panik noch zu steigern. Es war nicht die Art der Männer, die man zu einer Familienparty einladen würde. Sie machten sich einen Spaß daraus, soviel zu zerstören wie nur irgend möglich. Sie waren in den Carbon Canyon gekommen, um selbst eine Party zu feiern. Nur die Bewohner des Camps konnten nicht darüber lachen.
Sarah Wheeler, Megans Mutter, stürzte aus einer der älteren, ärmlichen Hütten hoch oben auf dem Hügelhang und blickte volle Sorge in das Chaos hinunter. Der Blick ihrer scharfen blauen Augen glitt suchend über den Hang, das Bachbett und den Wald gegenüber.
»Megan? Megan!« Sie wurde bleich, als sie die vertraute Gestalt inmitten der Zerstörung zu entdecken glaubte. Niemand schaute zu ihr hin. Ihr Ruf ging im Schreien der Frauen und Männer, dem Wiehern aufgeregter Pferde und dem Echo der Schüsse unter.
Doch keine der vielen Kugeln traf jemanden; die Angreifer waren nicht interessiert an Mord. Sie waren gekommen, um den Diggern den Mut zu nehmen, nicht das Leben. Ein Jammer, dachten einige der Reiter. Da waren so viele leichte Opfer und von der allerbesten Art: von jener Sorte, die sich nicht zur Wehr setzt. Doch Befehl ist Befehl, und widerwillig hielten sich die Revolverhelden zurück. Es war ihnen klar, dass sich keiner der Dreckscharrer, die jetzt wie Schafe flüchteten, dafür bedanken würde, dass sie sich im Zaum gehalten und sie verschont hatten.
Sie jagten die flüchtenden Digger die Hänge hinauf, bis diese für die Pferde zu steil wurden. Als das Feld geräumt war, wandten sie sich der kostbaren Ausrüstung zu, die zurückgeblieben war. Nur ein Laut des Aufbegehrens war in dem Lärm und Durcheinander zu hören. Er stammte von dem einzigen Bewohner von Carbon Canyon, der noch immer den Mut fand, irgendwelchen Widerstand zu leisten; schade nur, dass diese Stimme zu einem kleinen Hund gehörte.
Nicht jeder rannte in Panik bis in den Wald hinauf. Spider Conway erreichte seine Hütte und blieb dort. Er war nicht bereit, sein Heim zu verlassen. Hull Barret verharrte zwischen seiner wertvollen Waschrinne und der heranjagenden Horde. Er nahm eine Schaufel in beide Hände und wartete.
Ein Reiter kam nahe heran. Barret holte mit der Schaufel aus, doch das Pferd war zu schnell, und der Hieb ging ins Leere. Barret geriet aus dem Gleichgewicht, konnte den Schwung nicht mehr abfangen und landete Hals über Kopf im kalten Bach. Der Mann, nach dem er geschlagen hatte, schaute zurück und lachte.
Die beiden Reiter, die ihm folgten, ritten einfach durch die Waschrinne. Sie hielten nur lange genug an, um sicherzugehen, dass die Hufe ihrer Pferde die Seitenbretter der Rinne zerschmetterten und die hölzernen Stützbeine zerbrachen. Dann jagten sie weiter, um ihr Zerstörungswerk fortzusetzen.
Barret saß im Creek und schaute hilflos zu, wobei er die nutzlose Schaufel in ohnmächtigem Zorn umklammerte.
Einer der Marodeure wollte seine Fähigkeiten mit dem Lasso demonstrieren: Der Stolz, den er dabei an den Tag legte, war fehl am Platz, denn sein Ziel bewegte sich nicht. Es war keine Kunst, die Schlinge um den Stützpfeiler einer Hütte zu werfen, während das andere Ende des Lassos am Sattelknopf befestigt war. Ein wenig Gebrüll, ein schneller Sporendruck, und das Pferd erledigte die eigentliche Arbeit. Der Stützpfosten wurde weggerissen, und die Hütte stürzte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Bei einem soliden Gebäude wäre das nicht so leicht gewesen, doch wie die Mehrzahl der Unterkünfte in Carbon Canyon war diese Hütte eher mit Hoffnung und Spucke zusammengebaut worden als mit teuren Nägeln und gutem Holz. Doch bis der Reiter sie ausgewählt hatte, um seine erbärmlichen Fähigkeiten und seine etwas merkwürdige Art von Humor zu demonstrieren, war sie für jemanden ein Heim gewesen. Jetzt war sie, wie viele Teile der unschätzbaren Goldgräber-Ausrüstung, die die Leute längs des Creeks zurückgelassen hatten, als die Reiter auftauchten, nur noch ein Haufen Müll.
Sarah Wheeler stieg von ihrer Veranda herunter und spähte angestrengt zu der Gestalt hinüber, die inmitten der Reiter hin und her lief. Furcht schwang in ihrer Stimme mit.
»Megan - nein! Komm hierher, Megan!« Sie versuchte ihrer Tochter nachzulaufen und geriet fast einem heranjagenden Pferd unter die Hufe. Im letzten Augenblick konnte sie sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Keuchend klammerte sie sich an den Stützpfeiler der Veranda, als der Mann, der sie fast niedergeritten hatte, zwischen ihren Wäscheleinen hindurch galoppierte. Frisch gewaschene Hemden und Schürzen flogen durch die Luft, und eine gerade erst geschrubbte Pumphose wurde in den Dreck getrampelt.
Plötzlich gab der Hund ein scharfes, schrilles Winseln von sich. Hunde und kleine Kinder sind überzeugt von ihrer Unverletzbarkeit, und so ist Schmerz für sie stets ein Schock. Es war erstaunlich, dass ein so kleines Tier einen so gellenden Laut hervorbringen konnte. Nur Kaninchen können noch lauter schreien.
Schließlich sammelten sich die Reiter auf der gegenüberliegenden Seite der verwüsteten kleinen Siedlung. Die Entfernung und das Keuchen ihrer Pferde dämpften ihre rüden Bemerkungen und ihr Gelächter, als sie die Pferde herumrissen und zusammen zum oberen Ende des Canyons davonritten. Bald waren nur noch das Rauschen des Baches und das Zwitschern von Vögeln zu hören, in das sich besorgte Rufe und gelegentliches Stöhnen mischten.
Mit der Schwerfälligkeit der Verdammten und der abgrundtiefen Verzweiflung von Menschen, die schon zu viele Tragödien ertragen hatten, kehrten die Digger und ihre Familien zum Creek und zu ihren Hütten zurück - zu denen, die noch standen. Um den Staub und Dreck, den die Eindringlinge aufgewirbelt hatten, kümmerten sie sich nicht. Sie lebten damit jeden Tag, und ein Dutzend Reiter wühlten nicht mehr Dreck auf als ein starker Wind. Es war die Häufigkeit dieser bösartigen Besuche, die immer schwerer zu ertragen war. Die Häufigkeit und die Gewissheit, dass der heutige Besuch nicht der letzte gewesen sein würde.
Die Digger hoben Werkzeuge und Hüte vom Boden auf oder zogen sie aus dem seichten Wasser. Männer, die meterhohem Schnee und dem drohenden Hungertod widerstanden hatten, weinten lautlos beim Anblick zerbrochener Waschrinnen und verbogener Waschpfannen. Die Glücklichen, die dieses Mal nur wenig verloren hatten, taten sich zusammen, um den weniger Glücklichen zu helfen, so gut sie konnten. Irgendwo weinte ein Baby; das Wimmern wurde leiser und verstummte schließlich, als die Mutter es in den Schlaf wiegte.
Am Ufer des Baches kniete Megan Wheeler neben etwas, das einem alten, zerfetzten Schuh glich. Sie weinte leise, als sie den winzigen Körper aufhob. Er war leicht, viel leichter als es der gefüllte Wassereimer gewesen war, und im Tod wirkte er kleiner als jemals zuvor. Sie schluckte mühsam, nicht wegen ihrer Tränen, sondern weil sie wütend war, und sie beachtete nicht das Blut, das ihre Hände besudelte.
Sie wandte sich um und flehte stumm ihre Nachbarn und Bekannten nach einer Art Bestätigung ihres Verlustes an, nach einem kleinen Ausdruck von Betroffenheit. Sie sah nichts dergleichen. Die Bürger von Carbon Canyon waren ganz benommen und hatten keine Trauer für einen toten Hund von undefinierbarer Rasse übrig. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Leben wieder aus dem Chaos zu retten, das die Eindringlinge angerichtet hatten.
Megan war alt genug, um zu erkennen, dass ihr niemand helfen würde, dass nichts zu machen war. Das hielt sie jedoch nicht davon ab zu wünschen, dass es anders wäre. Sie hatte Mitleid gesucht und keines gefunden. Es ist wenig Mitleid in einem geschlagenen Menschen, und die Bewohner von Carbon Canyon waren so gut wie geschlagen. Noch ein solcher Überfall, und sie würden erledigt sein.
Das war Megan ebenso gleichgültig wie die Zukunft der Stadt, die erst noch eine werden wollte, oder die unglücklichen Bewohner. Ihr ging es nur um das tote Tier, das sie geliebt hatte. Sie stieg den Hang hinauf und ging auf die Baumgrenze zu.
Sarah sah ihre Tochter kommen und machte einen Schritt in ihre Richtung, blieb dann aber stehen. Sie war selbst tief verletzt worden, hatte jemanden verloren, den sie geliebt hatte, und sie wusste aus Erfahrung, dass es keine einfachen, tröstenden Worte gab, die den Schmerz ihrer Tochter lindem könnten. Sie kannte Megan gut genug, um zu wissen, dass es im Augenblick besser war, nichts zu sagen. Das Mädchen war eigensinnig und entschlossen. Sie würde wissen wollen, warum. Sie würde Gründe für das Geschehen hören wollen, und Sarah konnte ihr keine nennen. Sie wusste selbst keine Antwort und konnte erst recht keine für ihre traurige Tochter finden.
So blieb sie einfach nahe bei der Hütte stehen und beobachtete, wie ihr Kind zu dem bewaldeten Hang hinaufstieg, der den Canyon einschloss. Die Kinder wurden in diesem Land sehr schnell erwachsen, und Sarah wusste, dass es mehr schaden als nutzen würde, wenn sie jetzt zu Megan ging. Also wandte sie ihre Aufmerksamkeit der verdreckten Wäsche und dem zertrampelten Gemüsegarten zu. Sie hatte selbst einiges zu erledigen, und je eher sie damit anfing, desto weniger Zeit würde sie haben, um über alles nachzugrübeln.
Es war still im Wald. Oben, jenseits des Bergrückens und zwischen den Kiefern und Eichen, war das Rauschen des Creeks nicht mehr zu hören - und noch weniger das resignierte Klagen derjenigen, die sich mühsam an seinen Ufern durchschlugen. Das passte Megan gut. Sie hatte jetzt keine Zeit für sie, weder für ihre Klagen noch für ihre Ausreden. Ihre persönliche Tragödie überstieg alles andere, was an diesem Tag geschehen war.
Nach kurzer Suche fand sie eine geeignete Stelle, eine Mulde zwischen Baumwurzeln, wo heruntergefallene Tannennadeln und Laub eine dicke Schicht über dem Granit gebildet hatten. Es war leicht, ein kleines Loch in dem weichen Boden auszuheben. Das Grab brauchte nicht groß zu sein, um den winzigen Kadaver aufzunehmen.
Sie legte den kleinen toten Hund sanft in die Vertiefung. Dann bedeckte sie ihn mit der Erde, die sie vorher weggescharrt hatte, und klopfte sie fest in der Hoffnung, dass sie wenigstens eine Zeitlang die Aasfresser fernhalten würde. Es wäre besser, wenn sie einige große Steine auf das Grab hätte schichten können, doch hier in der Nähe gab es keine, und plötzlich fühlte sie sich zu erschöpft, um etwas weiter weg nach welchen zu suchen. Die festgeklopfte Erde und das Laub mussten ausreichen.
Megan kauerte sich auf den Boden, allein dort im stillen Wald, und betrachtete das Grab. Dann sprach sie die Worte, die man sie für solche Anlässe gelehrt hatte. Doch der Trost, den sie normalerweise spendeten, war nur kalt, und sie konnte einen bitteren Klang in ihrer Stimme nicht unterdrücken.
»Der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts mangeln - aber mir mangelt es an etwas! Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.«
Sie hielt inne und schaute zum Himmel auf. Es war eine ferne Fläche von wolkengetupftem Blau jenseits der hohen Baumwipfel.
»Aber sie haben meinen Hund getötet! Warum hast Du zugelassen, dass sie meinen Hund töten?«
Als keine Antwort kam, schluckte Megan und fuhr fort: »Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück – und dennoch fürchte ich mich! Sie werden wiederkommen. Ich weiß, dass sie das tun werden. Sie sind vorher gekommen, und sie werden wieder kommen. Niemand spricht darüber. Es ist, als ob es verschwinden würde, wenn sie es ignorieren, doch es ist nicht verschwunden, und das wird es auch nicht, oder?« Diesmal eine längere Pause. Ich sollte Schluss machen, dachte sie müde.
»Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich - doch wir brauchen mehr als Trost. Was wir brauchen, ist ein Wunder.« Sie leckte sich über die Lippen. »Mutter sagt, dass Wunder manchmal geschehen. Die Bibel lehrt uns, dass Wunder geschehen. Deine Güte und Gnade mögen mich alle Tage meines Lebens begleiten - wenn es Dich gibt. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen.«
Sie erhob sich und starrte stumm auf das verborgene Grab. Ein Grabstein war nicht nötig. Jedem anderen wäre das völlig gleichgültig. Einige Leute würden sie auslachen, wenn sie ihnen erzählen würde, was sie hier getan hatte, und wenn sie jemanden bat, ein Kreuz für sie anzufertigen. Sie brauchte keines. Sie wusste, wo der Platz war und dass sie ihn wieder finden konnte, wann immer sie das wollte. Linsey... war nicht einmal zu einem richtigen Hund herangewachsen... hatte noch nicht genug Erfahrung gehabt, um wegzulaufen wie alle anderen... hatte noch nicht genug gewusst, um Angst zu haben.
Es würde jetzt einsamer denn je in der kleinen Hütte sein, besonders an den bevorstehenden Winterabenden.
Abermals wandte sie den Blick zum Himmel. »Versteh' mich, Herr, ich will für immer in Deinem Haus wohnen, doch ich möchte gern vorher ein bisschen mehr von diesem Leben haben, und wenn Du uns nicht hilfst, werden einige von uns schwer verletzt oder vielleicht sogar getötet werden. Denn diese Mörder werden wiederkommen. Bitte! Ich glaube nicht, dass ich zu viel erflehe. Nur ein Wunder. Ein kleines - in Linseys Größe?«
Sie sah ein letztes Mal zum Grab hin und wischte sich die Tränen aus ihren Augen. Dann wandte sie sich ab und ging zum Camp zurück. Ihre Mutter würde sich Sorgen machen. Bald würde sie nach ihr suchen, und Megan wusste, dass ihre Ma genug Sorgen hatte, ohne sich auch noch um den Verbleib einer eigenwilligen Tochter quälende Gedanken zu machen. Doch trotz ihres Entschlusses, erwachsen zu sein, fiel es ihr schwer, den Wald zu verlassen, und noch schwerer, nicht zurückzuschauen.
Hätte sie einen Blick zurückgeworfen, dann hätte sie vielleicht den Reiter gesehen. Es wäre allerdings schwierig gewesen, ihn zu entdecken. Er war weit entfernt, so weit, dass man kaum bestimmen konnte, ob er sich auf dem nächsten Hügelkamm oder dem übernächsten befand. Mann und Pferd wirkten müde, als hätten sie einen weiten Ritt hinter sich.
Der Mann trug eine abgetragene Mackinaw-Jacke zum Schutz vor dem Nachtfrost und einen breitkrempigen Hut, der sein Gesicht vor der Sonne schützte. Sowohl die Jacke als auch der Hut wiesen eine Spur vom letzten Morgenfrost auf. Der Mann war unrasiert, ob aus Nachlässigkeit oder weil er sich in einer so unzivilisierten Gegend aufhielt, konnte man nicht sagen, ohne ihn zu fragen, und sofern man die Möglichkeit zum Fragen gehabt hätte, hätte man vielleicht lieber darauf verzichtet. Da war etwas in diesem ernsten, kantigen Gesicht und in dem festen Blick, das eine oberflächliche Konversation nicht zuließ. Man redete nicht mit dem Reiter, wenn man nichts Vernünftiges zu sagen wusste, und selbst dann erhielt man möglicherweise keine Antwort.
Er saß aufrecht und mit einer gewissen Beiläufigkeit im Sattel, während er die Gegend unterhalb des Höhenrückens musterte; die schneebedeckten Gipfel, die der unglücklichen Thunder-Expedition im Jahre 1847 das Leben gekostet hatte. Die grünen Bergtäler mit Fichten und Kiefern, Tannen und Sequoien, die klaren Bäche, deren Wasser von den Bergen herabsickerte, um den fernen American River, den Fluss des Goldes, zu füllen. Goldablagerungen, leicht zu entdecken und inzwischen ziemlich ausgebeutet, die trotzdem immer noch Männer und Frauen aus aller Welt anlockten. Goldgräber, die der Farbe im Gestein die Bäche und Nebenflüsse hinauf folgten, die den American River speisten, in der Hoffnung, die Hauptadern zu finden, die Quelle des gelben Metalls, das durch Zufall bei Sutter's Mill entdeckt worden war.
Der arme alte John Sutter, dachte der Reiter. Jeder kannte die Geschichte. Das Gold war auf seinem Land von einem seiner Angestellten gefunden worden. 49er waren rücksichtslos über seine Felder getrampelt, hatten seine Farm dem Erdboden gleichgemacht und sein Vieh verjagt. Das Gold hatte seinen Wohlstand und sein Glück zerstört. Das kostbare Metall war nicht immer ein Segen für denjenigen, der es fand. Einige sehnten sich danach, andere wurden verrückt, weil sie keines hatten, und nur wenige waren fähig, es richtig zu nutzen.
Was den bleichen Reiter anbetraf, er brauchte es nicht. Es gab wichtigere Dinge für ihn. Sie beunruhigten ihn an diesem Tag, und er wünschte, er könnte sie vergessen. Es sollte eine Stadt dort unten sein, wie er gehört hatte, oder wenigstens eine kleine Ortschaft, wo ein müder Reisender eine warme Mahlzeit und Kaffee kaufen konnte. Das war einen Erkundungsritt wert. Er schnippte mit den Zügeln, kaum wahrnehmbar, doch das Pferd verstand und reagierte. Der Vierbeiner und der Zweibeiner kannten und respektierten einander. Sie kamen prächtig miteinander aus. Der Reiter brauchte das Tier nicht in den herbstlichen Wald hinab zu dirigieren.
In Carbon Canyon ging die Verzweiflung allmählich in Resignation über - und die Resignation in Arbeit. Die Männer klopften sich den Staub ab, den körperlichen und geistigen, und sagten sich, dass das Leben weitergehe. Hütten mussten repariert werden und in wenigstens einem Fall neu erbaut werden. Man inspizierte die Long Toms mit kritischen Blicken. Die Waschrinnen, welche am wenigsten beschädigt waren, wurden angehoben und aufgerichtet, während die Besitzer nach Hämmern und Nägeln suchten, um die gebrochenen Stützbeine zu reparieren. Waschpfannen und Spitzhacken wurden aus Schlamm und Kies gezogen. Sie waren wichtiger als die Waschrinnen mit den Rüttelvorrichtungen. Eine Waschrinne konnte geflickt und repariert werden, doch ein Digger musste zwei Monate lang arbeiten, um sich eine gute Hacke oder Schaufel anschaffen zu können.
Die Frauen bahnten sich einen Weg durch die Trümmer, sammelten verstreute Utensilien und persönliche Dinge auf und versuchten, Ordnung in ihre verschmutzten Wäschestücke zu bringen. Heute würde das Abendessen auf den grob zusammengezimmerten Tischen ein paar Stunden später als üblich serviert werden. Die Kinder hatten ebenfalls zu tun. Je nach Alter wurden sie eingesetzt, um das Brennholz wieder aufzustapeln, Töpfe und Pfannen zu waschen und Hühner und Schweine zurück in Käfige und Schweineställe zu treiben.
Nicht jeder war mit der Reparatur der Schäden beschäftigt, den die Reiter angerichtet hatten. Diejenigen, die noch einmal davongekommen waren, hatten genug anderes zu tun. Am Ende des Canyons, wo sich der Bach Carbon verbreiterte und etwas langsamer floss, löste Hull Barret die Bremse seines alten Planwagens und trieb die Stute an. Es war keine komfortable Kutsche, sondern das umgebaute Wrack eines alten Conestoga. Er sah nicht besonders schön aus, doch er war solide gebaut, so dass man darin Erz transportieren konnte, und stellte so etwas wie das einzige öffentliche Transportmittel dar, das es im ganzen Canyon gab. Jetzt war der Besitzer der einzige Passagier.
Ein vierschrötiger Zwanzigjähriger bemerkte das Nahen des Wagens. Der Junge - denn Eddy Conway war trotz seines Alters noch ein Junge mit dem Körper eines Mannes - sprang den Hang hinunter, wo er gearbeitet hatte, um den Freund seines Vaters anzuhalten.
»Verschwinden Sie von hier, Mr. Barret?« Er warf einen Blick zum Bach hinauf. »Die haben diesmal wirklich 'ne Schweinerei angerichtet, stimmt's?« Er stieß einen langen Pfiff aus, um seine Worte zu unterstreichen.
Hulls Miene war ernst. »Ich haue nicht ab, Eddy. Ich fahre nur zur Stadt. Jemand muss das tun. Einige der Waschrinnen brauchen neue Pfosten, und einige andere Dinge werden knapp. Nägel, Salz, Kaffee. Ich werde versuchen, auch etwas von dem neumodischen Leim zu besorgen, den sie in Dosen verkaufen.«
Der jüngere Conway bedachte Hull Barret mit einem arglosen Grinsen. »Ist das nicht schrecklich dumm, Mr. Barett? Erinnern Sie sich, was Ihnen das letzte Mal passiert ist? Sie wollen doch nicht, dass Ihnen das wieder geschieht, oder?«
»Ich werde schon auf mich Acht geben, Eddy. Geh jetzt wieder an die Arbeit.« Hull Barret schlug mit den Zügelenden und versuchte, die Stute anzutreiben. Er wollte aus dem Canyon fort, bevor andere Freunde und Nachbarn bemerkten, was er vorhatte - und bevor sie versuchen würden, es ihm auszureden. Er befürchtete, dass sie damit Erfolg haben könnten.
Conway trat zur Seite. »Klar gehe ich wieder an die Arbeit, Mr. Barret.«
Wo der Carbon Creek einen tiefen See bildete, saß Teddy Conway, Eddys Zwillingsbruder, und starrte auf die reglose Spitze seiner Angelrute. Er richtete sich auf, als der Wagen heranrollte.
»Hauen Sie ab, Mr. Barret?«
Der Digger seufzte. Die Conway-Jungen hatten Herzen so groß wie die Berge, doch unglücklicherweise nicht genug Verstand, um sich die Schuhe zuzuschnüren. Ihr Daddy musste die einfachsten häuslichen Angelegenheiten für sie erledigen. Zu jedermanns Erstaunen schaffte Spider Conway das und bearbeitete seinen Claim nicht minder gut. Jeder wusste, dass Eddys und Teddys Mutter bei ihrer Geburt gestorben war und dass Spider seither gezwungen war, ihnen sowohl Vater als auch Mutter zu sein. Deshalb tolerierten die Frauen von Carbon Canyon Spiders gelegentliche Ausbrüche und seine ordinären Sprüche, wenn er sich sogar in ihrem Beisein betrank.
Doch im Augenblick hatte Hull Barret wenig freundliche Gefühle oder Verständnis für seinen Kameraden.
»Ich fahre nur in die Stadt«, sagte er mürrisch. Sein Tonfall hatte ebenso wenig Wirkung auf den Jungen wie auf dessen Bruder Eddy. Beide Jungs waren ziemlich einfältig und wussten nichts von den Feinheiten menschlicher Kommunikation.
So fragte er munter: »Ist das nicht ziemlich dumm, Mr. Barret?«
Hull warf ihm einen Blick zu. Teddy erwähnte wenigstens nicht, was beim letzten Mal geschehen war. Die schmerzliche Erinnerung war auch überflüssig. Barret hatte schließlich nicht sein Gedächtnis verloren.
Im Grunde hatten die Jungen natürlich Recht. Es war in der Tat dumm von ihm, in die Stadt zu fahren, besonders jetzt, angesichts des heutigen Ereignisses. Aber, verdammt, irgendwer musste in der Stadt Lebensmittel und andere Dinge besorgen. Andernfalls konnten sie ebenso gut alle zusammenpacken und aufgeben. Doch wie er beiden Jungen gesagt hatte, er haute nicht ab.
Er spürte den Blick des Jungen auf seinem Rücken, als er den Wagen um einen großen Felsen lenkte.
Die Bluse war mehr als nur schmutzig. Wirbelnde Hufe hatten einen der Ärmel zerrissen. Sarah presste die Lippen aufeinander, als sie die Bluse aus dem Dreck aufhob und gegen das Licht hielt. Ja, sie konnte sie noch einmal flicken. Mit einem Schal würde sie die Naht verdecken, und außerdem war das größte Loch unter dem Arm, wo man es nicht sehen würde. Sie legte die Bluse in den Korb mit schmutzigen Kleidungsstücken, den sie sich unter den Arm geklemmt hatte. Von den weit verstreuten Wäschestücken war nur die Bluse beschädigt worden. Dreck und Schlamm konnten abgewaschen werden. Das erforderte nur ein wenig zusätzliche Arbeit. Es hätte weitaus schlimmer sein können.
Sie wandte sich wieder zur Hütte und entdeckte in diesem Augenblick den Wagen, der unterhalb vorbeifuhr.
»Hull? Hull, bist du das?«
Der Fahrer des Wagens hörte den Ruf, doch er reagierte nicht darauf. Er starrte grimmig geradeaus. Doch Sarah Wheeler war keine Frau, die sich so einfach ignorieren ließ. Sie setzte den Wäschekorb ab und überließ die mühsam zusammengesammelte Wäsche dem Wind und den Elementen. Sie raffte ihren Rock und lief den Hang hinunter.
»Hull Barret, halt an! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Hull! Halt sofort an!«
Einen Augenblick später war sie neben dem langsam fahrenden Wagen. Sie atmete schwer, als sie neben ihm herlief und zu dem unbewegten Gesicht des Fahrers emporschaute. »Hull, du fährst nicht in die Stadt! Ich lasse das nicht zu!«
Das Gesicht des Diggers verzog sich zu einem leichten Lächeln. Seine Antwort war freundlich. »Ich weiß deine Sorge zu schätzen, Sarah.«
»Es ist mehr als Sorge; es ist einfach gesunder Menschenverstand. Du weißt, wovon ich rede, Hull.«
Er nickte knapp. »Eddy und Teddy haben mich soeben daran erinnert. Nun fang nicht auch noch damit an, Sarah.«
»Hull, du kannst nicht in die Stadt fahren. Lahoods Männer werden dort sein!«
»Irgendwer... muss etwas tun.«
»Aber warum ausgerechnet du?« Sie stolperte neben dem Wagen her und versuchte, den Mann auf dem Fahrersitz im Auge zu behalten, während sie sich gleichzeitig bemühte, auf dem holprigen Boden das Gleichgewicht zu bewahren.
»Ich nehme an, ich bin der einzige Narr, der dazu bestimmt ist, es zu riskieren, ganz gleich, was passiert«, erwiderte er ruhig. »Sieht aus, als wären alle anderen zum Aufgeben bereit. Jedenfalls nahe daran. Wenn ich nicht hole, was wir brauchen, wird es mehr als nahe daran sein. Dann wird morgen jeder von hier verschwunden sein.«