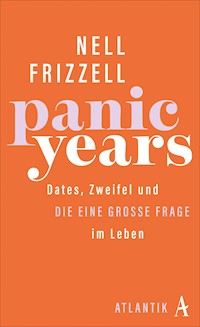
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
Ein tief ehrliches Buch über die einzigartige Zeit, in der sich eine Frau entscheiden muss, ob sie Kinder möchte oder nicht Ein Kind in diesen Zeiten? Und falls ja, mit wem? Und dann: wann genau? Ein Buch über die Fragen im Leben, vor denen jede Frau einmal steht – von denen aber noch nie so ermutigend, inspirierend und klug erzählt wurde wie hier. Nell Frizzell ist Ende zwanzig, als sie sich von ihrem langjährigen Freund trennt. Die gemeinsame Lebens- und Familienplanung ist damit auf Null gesetzt. Nur das Schlafzimmer ihrer Oma bietet Nell Raum, ihre Trennungstrauer zu verarbeiten, denn: Fragen rund um Fruchtbarkeit und Kinderwunsch, Familienplanung und Zukunftsvisionen sind für die Oma und ihre Freundinnen Vergangenheit. Sie sind frei, ihre Panic Years sind vorüber. Doch Nell steckt mittendrin …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Ähnliche
Nell Frizzell
Panic Years
Dates, Zweifel und die eine große Frage im Leben
Aus dem Englischen von Yasemin Dinҫer
Atlantik
Für Liz, die Mutter, die mich gemacht hat.
Und für Nick, der mich zu einer Mutter gemacht hat.
Einleitung
Am Morgen meines achtundzwanzigsten Geburtstags wachte ich allein in einem Einzelbett im Gästezimmer meiner Mutter auf und erinnerte mich daran, dass mein Freund der letzten sechs Jahre nicht mehr mein Freund war. Während ich vom Gewicht meines eigenen Herzens auf die Matratze gedrückt wurde, kam mir der Gedanke, dass ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit allein fühlte, fremd, unsicher und ungebunden.
Am Morgen meines dreißigsten Geburtstags wachte ich im Bett neben meiner besten Freundin auf. Sie war im fünften Monat schwanger, hatte einen Immobilienkredit aufgenommen und war verlobt. Ich war ein kinderloser Single und würde bald überflüssig sein. Ich blickte zu ihr hinüber, während die grelle Dezembersonne durchs Fenster kreischte wie ein Feueralarm, und fühlte mich, als stünde ich auf einem Bahnsteig und sähe zu, wie meine Freundin außer Sichtweite verschwand.
Am Morgen meines dreiunddreißigsten Geburtstags wachte ich neben einem Mann im Bett auf, den ich liebe, mit einem zwei Wochen alten Baby, das neben mir so sanft atmete, dass ich zum 578. Mal seit seiner Geburt eine Hand ausstrecken und sein Gesicht berühren musste, um sicherzugehen, dass es noch am Leben war. Mein Bauch fühlte sich an wie nasser Schlamm. Meine Augen waren vom andauernden Weinen zu Lychees angeschwollen. Seit den letzten paar Wochen meiner Schwangerschaft hatte ich nicht länger als drei Stunden am Stück geschlafen, ich trug eine Binde in Luftmatratzengröße und roch nach vergorener Milch. Als eine blassrosa Dämmerung die Baumkronen entlang des Flusses Lea küsste, zog ich mir einen XL-Herren-Jogginganzug und Socken von meinem Freund an, schlich mich aus meiner überhitzten kleinen Wohnung, überquerte die Fußgängerbrücke zu den Walthamstow Marshes, hielt mein Gesicht in die Sonne und brüllte.
In kürzerer Zeit, als meine Schwester brauchte, um ihren Führerschein zu machen, hatte sich mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich hatte die Sicherheit einer Beziehung aufgegeben, hatte mich mit der endlichen Natur meiner Fruchtbarkeit auseinandergesetzt, zeitweise eine sorglose Verderbtheit an den Tag gelegt und schließlich eine komplett neue Identität angenommen. Diese Veränderungen hatten dazu geführt, dass ich jetzt ein Baby hatte, aber ob es nun darum geht, eine langjährige Beziehung zu beenden, in ein anderes Land zu ziehen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen, zu heiraten oder einen Nervenzusammenbruch zu erleiden: Während dieser namenlosen Periode in unseren späten Zwanzigern, unseren Dreißigern und nicht selten auch noch Vierzigern geschehen meist enorme Dinge, nach denen es oftmals kein Zurück mehr gibt. Eltern zu werden ist dabei die einzige Entscheidung, die mit einer biologischen Deadline versehen ist, und auch die einzige, die sich tatsächlich nicht mehr umkehren lässt: Daher ist sie die eine Entscheidung, die alle anderen so scharf in den Fokus rückt. Man kann sich einen neuen Job suchen, umziehen, neue Freundschaften schließen, neue Partner oder Partnerinnen finden, aber sobald man zu Eltern wird, bleibt man es fürs Leben.
Trotzdem hat diese Periode keinen Namen. Im Gegensatz zu Kindheit, Jugend, Menopause oder Midlife-Crisis haben wir keinen allgemeingültigen Begriff für den Tumult aus Zeit, Hormonen, gesellschaftlichem Druck und Sehnen nach einem Kind, der über viele Frauen mit Ende zwanzig, Anfang dreißig hereinbricht. Es gibt keinen medizinischen Fachbegriff, kein zusammengesetztes deutsches Wort, nichts auf Lateinisch, Arabisch oder Französisch. Die Astrologie mag auf die Sieben-Jahres-Zyklen der Rückkehr des Saturn verweisen, aber diese vage Formulierung erzählt nur wenig von Mut und Größe, Blut und Tränen, Reisen und Transformationen, die ich sowohl an mir selbst, als auch an den Menschen in meinem Umfeld wahrgenommen habe. Während man mittendrin steckt, hat man das Gefühl, sich durch ein Netz aus unmöglichen Entscheidungen zu schlängeln – über Arbeit, Geld, Liebe, Wohnort, Karriere, Verhütung und Verpflichtungen –, von denen jede einzelne wie ein Faden an allen anderen zieht, sodass es unmöglich ist, das Ganze zu entwirren oder sich hindurchzubewegen, ohne es zu zerstören. Im Rückblick wurden viele, wenn nicht alle dieser Entscheidungen so drängend durch das pulsierende, pochende, unausweichliche Wissen um die Endlichkeit der eigenen Fruchtbarkeit, die sinkende Anzahl von Eizellen und die Tatsache, dass es der eigene Körper einem eines Tages nicht mehr ermöglichen wird, Kinder zu bekommen.
Diese Jahre sind geprägt durch die ewige Frage: Soll ich ein Baby bekommen, und wenn ja, wann, wie, warum und mit wem? Diese Frage sickert im Laufe der Zeit in jeden Bereich unseres Lebens. Sie ist das Rattern auf den Gleisen unter den eigenen Füßen. Die allem zugrunde liegende Basslinie. Ob man Eltern werden möchte oder nicht, als Person in ihren späten Zwanzigern und Dreißigern und vielleicht sogar noch in den Vierzigern bringt das langsame Verstreichen unbefruchteter Gelegenheiten eine Dringlichkeit in das eigene Leben, die sich so in keiner anderen Lebensphase wiederfindet. Man muss sich entscheiden, was man will, und zwar sofort, bevor der eigene Körper einem keine Wahl mehr lässt.
Dass es in jeder großen europäischen Sprache mehrere Wörter für die Jugendzeit gibt, aber kein einziges für diese zweite transformative Zeit im Leben einer Frau, weist auf zwei Dinge hin: Erstens lässt die Sprache uns häufig im Stich, und zweitens haben wir diese Phase nie richtig ernst genommen. Zu oft wird unsere Reise aus der Jugend hinaus, durch die fruchtbaren Jahre und hin zu einer neuen emotionalen Reife als Erwachen der Muttergefühle, als innere Unruhe oder ›lediglich‹ als das Ticken der biologischen Uhr abgetan. Dabei ist sie das komplexe Zentrum allen Drucks, aller Widersprüche und Ängste, mit denen westliche Frauen heute konfrontiert sind, von Fruchtbarkeit und Finanzen bis zu Liebe, Arbeit und Selbstwert.
Als ich mit achtundzwanzig meine Beziehung, mein Zuhause und meine Richtung verlor, sagte mir niemand, dies sei der Beginn von etwas Neuem. Niemand konnte mir kurz zusammengefasst erklären, dass aus so viel Verlust eine vollkommen neue Identität entstehen würde und dass die meisten Menschen in meinem Umfeld ebenfalls in einem Wandel begriffen waren, ob sie sich nun gerade in einer Beziehung befanden oder nicht. Wir alle kämpften mit denselben Fragen, und viele von uns fühlten sich ebenfalls gelähmt von dem Druck, große Entscheidungen zu treffen, im Hinblick auf die Elternschaft sogar unwiderrufliche. Vor der riesigen, ratternden Abfahrtszeitentafel meiner Zukunft war mir nicht bewusst, dass ich dort Schulter an Schulter mit Millionen anderen Frauen stand, die sich auf ihrer eigenen Reise durch das gleiche mütterliche Dilemma befanden.
Weil wir dieser Phase keinen Namen gegeben haben, sind wir nicht ausreichend auf sie vorbereitet, wenn sie vor der Tür steht, und haben nicht die nötigen Werkzeuge entwickelt, um unseren Weg durch sie zu finden. Das ist ein Problem, wenn Frauen dann das Gefühl vermittelt wird, alles, was in dieser Zeit geschieht, läge irgendwie allein in unserer Verantwortung und müsse von uns allein angegangen, ausgehalten und aufgelöst werden. Indem wir die Körperfunktionen der Frauen mit Hilfe von Verhütung regulieren und den Männern gestatten, als ewige Teenager zu leben – mit unsicheren Jobs, kurzen Liebschaften, pubertären Hobbys –, haben wir die Last der Entscheidung, ob man sich um ein Baby bemühen solle oder nicht, beinahe ausschließlich den Frauen aufgebürdet. Wir schirmen die Männer ab vor der Realität von Fruchtbarkeit, Familie und weiblichem Verlangen, weil uns beigebracht wurde, diese Dinge als uninteressant oder unattraktiv aufzufassen. Während meiner Zwanziger und bis in meine Dreißiger habe ich mir verzweifelt Mühe gegeben, locker und sorglos zu erscheinen, da ich glaubte, auch nur eine Andeutung meiner wahren, komplizierten Sehnsüchte – in meinem Fall nach Liebe, Bindung, Unabhängigkeit, einer erfolgreichen Karriere und schließlich auch einem Baby – würden dafür sorgen, dass ich für immer Single bliebe. Ich brachte mich selbst zum Schweigen, weil ich dadurch attraktiver zu wirken glaubte. Ich versteckte meine Schwächen, meine Wünsche und meine Gebärmutter.
Natürlich unterhielt ich mich mit meinen Freundinnen, aber ich war dabei nicht immer vollkommen ehrlich, was bedeutete, dass auch sie sich mir gegenüber nicht gänzlich öffneten. Wir setzten ein tapferes Gesicht auf und taten so, als hätten wir alles unter Kontrolle, wobei wir irgendwie die Tatsache übersahen, dass wir alle im selben Zug saßen. Ohne die üblichen Hilfsmittel aus Sprache und Etiketten, um unsere Erfahrung zum Ausdruck zu bringen, wurden wir bruchstückhaft, unsicher, ängstlich und beschämt. Nun ja, damit ist jetzt Schluss. Ich bin angetreten, um die Schultern zurückzurollen, meinen BH aufzumachen und diesem Ding einen Namen zu geben.
Im Laufe der Zeit sind mir dafür reichlich mehr oder weniger förmliche Vorschläge eingefallen. Zuerst die lustigen: fruchtbare Entscheidung, Eizellroulette, Hurkrux, Ova-Panik. Dann die Metaphern aus der Natur: die Spreu vom Weizen trennen, Lakune (eine Lücke oder ein Hohlraum im Knochen), Rubikon (ein Fluss, der unmöglich zu überqueren scheint), blaue Stunde (jene magische Zeit zwischen Tag und Dämmerung). Es gibt die lateinischen Ideen: reortempus – die Zeit der Entscheidung, procogravidum – schwer von Zweifeln sein, quasitinciens – mit Fragen schwanger gehen. Und zuletzt sind da noch die möglichen deutschen Komposita: Fastschwanger, Wechselperiode, Trockenlegen. Allesamt passend und besser als gar nichts, aber keins von ihnen beschwört die erstickende, heranschleichende, verwirrende Natur dieses Biests herauf. Als würde ich eine neu entdeckte Blume oder ein giftiges Kraut klassifizieren, gebe ich ihm am Ende den Namen »der Fluss«: eine körperliche und emotionale Transformation, die am Boden der Panikjahre heranwächst. In der Landschaft bedeutet »Fluss« das Fließen von Wasser, in unserem Körper ist es das Ausstoßen von Blut, in der Physik ist es ein Zustand beständigen Wandels. Der Fluss ist die Lücke zwischen Jugend und mittleren Jahren, in der Frauen jenen konstruierten Kunstgriff der Kontrolle über ihr Leben verlieren, sich mit ihrer Fruchtbarkeit auseinandersetzen und sich selbst neue Identitäten errichten. Der Fluss ist ein spezifischer Prozess, ausgelöst von Biologie, Gesellschaft und Politik, der so viele von uns durch die Panikjahre treibt wie, nun ja, Besessene.
Das hier ist eine Anatomie meiner eigenen Panikjahre. Dieses Buch ist kein Ratgeber, der erklärt, wie man den richtigen Mann findet, seinen Traumjob bekommt oder lernt, sich selbst zu lieben, schwanger zu werden oder am besten ein Kind großzuziehen. Es geht darum, was geschieht, wenn man sich dem teuren Besteck und der abgestimmten Bettwäsche des Erwachsenenlebens nähert und sich fragt, ob man ein Baby bekommen sollte, ob man nur deshalb eins will, weil man dazu erzogen wurde, oder ob man überhaupt in der Lage wäre, eins zu bekommen. Es geht um den Versuch, sich eine Karriere aufzubauen, ehe man sich in die Elternzeit verabschiedet, es geht darum, sich nach Stabilität zu sehnen, während sich der eigene Freundeskreis in Eltern und Nicht-Eltern aufteilt, es geht darum, nicht nur nach einem Freund oder einer Freundin Ausschau zu halten, sondern nach einem potenziellen Elternteil für das theoretische eigene Kind, es geht um Fruchtbarkeit, Genderungleichheit und gesellschaftliches Stigma. Es geht darum, weshalb man sich dabei erwischt, panische Berechnungen anzustellen: Wenn ich jemanden kennenlerne und erst mal ein Jahr mit ihm zusammenbleibe, und dann brauche ich zwei Jahre, um schwanger zu werden, aber wenn ich nun diesen Job anstrebe, und wenn ich mit dreizehn meine Periode bekommen habe und die Eizellen meiner Mutter mit vierzig verbraucht waren … bis man plötzlich nicht mehr rechnet, sondern sich eine unverblümte, schlichte und niemals abgeschlossene Frage stellt: Wer bin ich, und was will ich vom Leben?
Es geht um eine zweite Jugend, in der man nicht anfängt zu bluten und Brüste bekommt, sondern Selbsterkenntnis, Reife und Ernsthaftigkeit gewinnt. Ich will also das allgemeine Argument vorbringen, dass diese Zeit Anerkennung verdient, und zu diesem Zweck bringe ich ein persönliches Argument vor, indem ich meine eigenen Panikjahre wiedergebe, wie ich sie erlebt habe und noch immer erlebe. Ich beschreibe, wie ich mich von einer alleinstehenden, bindungsscheuen Mitbewohnerin durch Herzschmerz, Liegestütze, den Geruch von Schuhcreme, einen Besuch in einem Nonnenkloster, einen Sommer in Berlin, Schwangerschaft, Geburt, ein ausgesprochen unglückliches Busfenster und so vieles mehr in eine ausgewachsene Mutter mit flachen Stiefeln verwandelt habe. Ich werde darlegen, wie der Fluss meine Freundschaften, meine Beziehung, meine Umwelt, meine Gedanken, meine Arbeit und meine Fähigkeit, meinen Körper zu bewegen, beeinflusst hat. Zum ersten Mal gebe ich dem Fluss einen Namen und durchschreite ihn, Schritt für Schritt.
In meinem Fall begannen die Panikjahre auf einer Hausparty, als ich bei Freunden in Liverpool zu Besuch war, ein silbernes Kleid trug und in der auseinanderfallenden Küche einer toten Vermieterin stand, deren Mieter ihre Asche in einen Eckschrank gestellt und Teppiche über die verrotteten Dielen geworfen hatten. Meine Periode war einen Monat überfällig, und ich wachte an den meisten Tagen um halb fünf Uhr morgens auf, den Mund voller Angst und Übelkeit. Ich hatte meinen Freund zu Hause gelassen, um meine Freunde zu besuchen. Als ich mich in der grünen Küche umsah, ergriff ein Gedanke von mir Besitz, der seit Wochen allem zugrunde gelegen hatte: Ich könnte schwanger sein. Ich wollte nicht schwanger sein. Nicht so, nicht jetzt. Ich wollte nicht auf diese Weise gefangen sein. Das wurde mir damals mit einer Klarheit bewusst, die mir Angst einjagte. Mein Körper sagte mir, noch bevor mein Geist es realisiert hatte, dass ich unglücklich war. Meine Gebärmutter hatte ein Leuchtsignal abgesendet, und ich sah pflichtschuldig zu, wie es verglühte. Einen Monat später war ich Single, in Wirklichkeit doch nicht schwanger, saß in einem schäbigen Café in Walthamstow und feierte meinen achtundzwanzigsten Geburtstag allein über einer Tasse Instantkaffee.
Ohne den Anker eines Partners schleuderte ich mich in eine Welt aus Arbeit, Partys, Schweiß, Deadlines, Laufen, Reisen und Zigaretten. Ohne das Gegengewicht aus Liebe und mit dem explosiven Ehrgeiz einer jungen Journalistin stellte ich fest, dass ich zu allem ja sagen konnte. Tatsächlich war es so: Je öfter ich ja sagte, desto weniger musste ich denken. Ein ganzes Jahr lang lautete meine einzige berufliche Regel, absolut jeden Auftrag anzunehmen, den ich angeboten bekam. Außerdem ging ich zelten, hatte Sex mit Männern, die mich nicht lieben konnten und die ich nicht lieben konnte, bot Zeitungen, zu denen ich mein ganzes Leben aufgeschaut hatte, Artikel an, ging an windigen Stränden schwimmen, schrieb mir die Seele aus dem Leib, fragte mich, ob ich überhaupt wirklich ein Baby wollte, weinte tagelang vor meiner Periode, nähte Kleider, trat im Radio auf, schnitt mir das Haar und hörte meine Platten.
Eines Morgens, im gesprenkelten Grau des frühen Bewusstseins, wachte ich mit dem Geschmack von etwas Vertrautem auf der Zunge auf, wie den Fetzen eines Liedes, das man in der Schule gesungen hat. In meinem eigenen Schlafzimmer, unter meinen eigenen Bildern, unter meiner eigenen Bettdecke, die nach meinem eigenen Waschpulver roch, erinnerte ich mich endlich daran, wer ich war.
Schön und gut, nur war ich zu diesem Zeitpunkt dreißig, und meine Freundinnen, die bis dahin mit mir Toast gegessen und Tee getrunken hatten, während wir uns das Herz aus dem Leib rissen und der Zeit ins Gesicht lachten, packten plötzlich ihre Taschen und waren fort: Partner, Häuser, Verlobungsringe, Hochzeiten, Schwangerschaften, Babys. Der Wettlauf war eröffnet – gegen die Zeit, gegen unsere Körper, gegen die Halbwertzeit von Spermien und unweigerlich auch gegeneinander. Ich wusste, weil ich selbst dabei gewesen war, dass meine Mutter früh in die Wechseljahre gekommen war – mit vierzig –, daher hatte ich vermutlich noch weniger Zeit geerbt als meine Freundinnen. Meine Deadline war früher. Infolgedessen waren meine Panikjahre besonders intensiv, mein Sprint in Richtung Sicherheit akuter, mein Bedürfnis, alles geregelt zu bekommen, ziemlich extrem. Dennoch hatte ich aus irgendeinem Grund die Ansage noch nicht gehört, hatte noch nicht einmal mein Ticket gekauft. Die Menschen, die ich am meisten liebte, glitten davon, während ich wankend zurückblieb.
Weniger als zwei Jahre später war ich verliebt. Dieser Mann, mit Schultern wie ein Baugerüst und einem Kinn wie eine Gartenschaufel, trat unerwartet, unvorhergesehen und unangekündigt in mein Leben. Ganz mir nichts, dir nichts war ich in den Zug eingestiegen. Ich kannte sein Ziel nicht, aber ich wusste, dass ich irgendwohin unterwegs war. Was ich mir als Lösung für meine innere Unruhe ausgemalt hatte, führte allerdings lediglich zu noch mehr Fragen. Großen Fragen. Für jede Frau, die während der Panikjahre eine neue Beziehung beginnt, ist die Zukunft durchlöchert von jenen existenziellen Entscheidungen, die einen in die Knie zwingen können. Was bedeutet es für eine berufstätige Frau, in einem Land mit unerschwinglichen Preisen zu wohnen, das auf ein Klimadesaster zusteuert, wenn sie sich an einen Partner bindet oder gar an ein zukünftiges Kind? Wie reagiert man, wenn die beste Freundin verkündet, dass sie schwanger ist? Liegt vor einem selbst ein anderer Weg? Was, wenn der eigene Partner keine Kinder will? Oder wenn er Kinder will, bloß noch nicht jetzt, nicht sofort, nicht auf diese Weise? Ist dies der richtige Zeitpunkt, um das Land zu verlassen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen, sich einen wahnsinnig teuren Mantel zuzulegen, auf alles zu scheißen und mit jemandes Bruder zu schlafen, irgendwo ein Haus zu kaufen, wo es billig ist, und freiberuflich zu arbeiten? Sollte man einen Hund anschaffen?
Als würden einem die Zähne aus dem Kiefer gebrochen und der kalte Wind über jeden bloß liegenden Nerv fegen, erkennt man, dass man erneut die Kontrolle verloren hat. Der eigene Körper wird durch Verhütung in einem Zustand künstlicher Unfruchtbarkeit gehalten, während der Geist durch all die verlorenen Zukunftsmöglichkeiten rast. Man sitzt zwar im Zug, hat aber vergessen nachzusehen, wohin er unterwegs ist, und nun gleitet die Welt verschwommen an einem vorbei. Liebe kann nichts gegen den Fluss an Eizellen ausrichten, die den eigenen Körper verlassen, ein warmes Bett hilft einem nicht bei der Entscheidung, was man beruflich machen will, ein Partner beendet nicht den Bürgerkrieg zwischen Gehirn und Gebärmutter, ein Plus One gibt einem nicht unbedingt das Gefühl von Vollständigkeit. Drei Jahre nach dem Ende meiner letzten Beziehung wurde mir erneut etwas Schmerzhaftes und Wahres bewusst: Die Panikjahre enden nicht mit Sex oder gemeinsamen Handtüchern, sie werden nicht einfach zum Schweigen gebracht durch das Gewicht eines weiteren Körpers im eigenen Bett.
Während ich durch mein Leben schlitterte, Beziehungen beendete, versuchte, mehr Geld zu verdienen, meine Mietwohnung mit geliebten Freundinnen teilte, zur Therapie ging, meinen Körper kräftigte und mit zunehmend netteren Menschen Sex hatte, war für mich absolut nichts erkennbar, was diese Entscheidungen zusammenhalten würde. Nun, da ich in meine Mittdreißiger vordringe und mich von all dem Staub und den Dramen entferne, die meine Weitsicht trübten, erkenne ich, wie die Mutterschaft als Erwartung die ganze Zeit über mir schwebte. Sie war mein Motor gewesen und hatte mich zum Abschuss bereit gemacht. Natürlich. Während der gesamten Panikjahre beendeten mein Körper und Geist unbewusst mein altes Leben, um den Weg für ein neues zu ebnen, in dem ich mich, sofern ich es wollte, für den Versuch entscheiden konnte, ein Baby zu bekommen. Wie Luke Turner in seinem wunderschönen Memoir Out Of The Woods schreibt: »Die Entscheidung, die Grundlagen eines Lebens zu sprengen, wird stets Trümmer in alle Richtungen schleudern.« Denn, so zögerlich ich es auch erkannt und vor den wichtigen Menschen zugegeben haben mag, ich wollte wahrscheinlich schon immer ein Baby.
Während ich hier sitze und an einem Laptop tippe, der auf dem Wickeltisch meines Babys balanciert, ist mir bewusst, dass ich dieses Buch in vielerlei Hinsicht für die achtundzwanzigjährige Nell schreibe, die in ihrem silbernen Kleid neben der Urne einer fremden Frau in jener Küche in Liverpool stand und der ganz schlecht vor Panik darüber war, was als Nächstes geschehen mochte. Aber eigentlich schreibe ich dieses Buch für alle: für jene, die gerade in ihren Fluss steigen, für jene, die mittendrin stecken in der Verwirrung, für jene, die mehr über Mutterschaft erfahren wollen, ob sie sich selbst nun darin sehen oder nicht, für jene, die das alles bereits durchgemacht haben und sich darin wiedererkennen möchten, und für die Männer und Frauen, die einfach nur wissen wollen, wie die Panikjahre sind. Ich gebe nicht vor, eine ginbeduselte Partynudel zu sein, ich schreibe keine akademische Abhandlung, und ich nutze keine experimentellen literarischen Formen, um zu beweisen, dass auch Mütter kreativ sein können. Ich zeige einfach nur so ehrlich und bedeutungsvoll ich kann, wie diese Zeit aussehen mag: Warum eine Party zum dreißigsten Geburtstag sich wie eine Ein-Personen-Hochzeit anfühlen kann, wie es als einziger Single bei einer Abendgesellschaft ist, wie man es verkraftet, in einem sehr kleinen Zelt sexuell abgewiesen zu werden, weshalb man möglicherweise versehentlich losheult, wenn der Chef einen fragt, wo man sich in fünf Jahren sieht, wie es sich anfühlt, seine Periode zu bekommen, wenn man hofft, schwanger zu sein, das Fieber, das einen befällt, wenn man sich entscheidet, zu versuchen, ein Baby zu bekommen, wie es ist, wenn man sich vorstellt, jenes Baby an die Wand zu schmeißen.
Dieses Buch wird die donnernde Libido der Dreißigjährigen feiern, die sich gemeinsam mit einem Verschwörungstheoretiker und seinen Geheimratsecken einen Berg hinaufschleppt. Wie es sich anfühlt, durch die eigene Ambivalenz gegenüber der womöglich größten Entscheidung des eigenen Lebens zu waten. Die spitzengesäumte Hölle der Babypartys anderer Menschen. Das Gefühl, in einer tropfenden Toilette auf ein Stäbchen zu pinkeln und seine gesamte Zukunft auf vier Zentimetern säurehaltigem Papier in der Hand zu halten. Dieses Buch wird sich auf die Schultern all jener Augenblicke stellen und fragen: Wo sind wir, und wie sind wir hierhergekommen? Wie befreien wir uns von unserer gesellschaftlichen Konditionierung, warum enden Beziehungen, wieso heiraten Menschen noch immer, wann wird aus einem Fötus ein Baby, wie hoch ist das richtige Gehalt, was ist eine Familie, welche Bedeutung hat der fünfunddreißigste Geburtstag, und wie sollen wir die Verantwortung für die Verhütung aufteilen? Da das Gewicht all dieser und noch mehr Fragen Frauen in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern auf die Schultern kracht, ist es höchste Zeit, nach Antworten zu suchen.
1Plötzlich Single
Ich liege auf dem Bett meiner Großmutter und lausche den Kirchenglocken und dem Fernsehmoderator Noel Edmonds.
Selbstverständlich ist es nicht das eigentliche Bett meiner Großmutter. Es ist nicht jener Ort, an dem ich am Weihnachtsmorgen meinen Strumpf auspackte – der Strumpf, der tatsächlich eine alte Stützstrumpfhose meiner Großmutter war, in irgendeiner Schattierung von »Nerz« oder »Bambus«.
Nein, es ist ein anderes Bett – ein Einzelbett in der Farbe einer Prothese, das in einem kleinen Zimmer auf dem Dachboden ihres Pflegeheims versteckt ist. Nach Jahrzehnten der Landwirtschaft mit Viehbestand, Labradoren, Apfelbäumen und sprudelnden Bächen lebt meine Großmutter nun in einem Einzelzimmer mit Blick auf Schieferdächer, umgeben von Ziegelsteinen. Sie verbringt die letzten paar Jahre ihres Lebens in einer Stadt – ein Ort, den sie in den ganzen vierundneunzig Jahren ihrer Existenz zuvor nicht betreten hat. Für mich ist es großartig: Ich kann mit dem Zug hinfahren, in einem Café am Markt zu Mittag essen und bei Savers vorbeischauen, um ihr noch mehr Nivea-Körperpuder zu kaufen. Nicht, dass ich heute irgendetwas von diesen Dingen tun würde.
Heute liege ich auf ihrem Bett. Ich liege auf der Seite zusammengerollt und starre auf ihren weißen Schrank voller Faltenröcke aus Tweed, cremefarbener Satinblusen und flauschiger ausrangierter Pantoffeln. Aus dem kleinen Fernseher in der Ecke ertönt Deal or No Deal wie ein pfeifender Teekessel. Auf einem Tablett steht eine Schüssel voller Satsumas neben einem Stapel ungelesener Shropshire Stars, Wochenendbeilagen und einem Buch über die Royals. Im Zimmer unter mir bewegt sich ein Mann in der Form eines Liegestuhls ächzend auf die Tür zu, wobei seine Jogginghose an seinem hutzeligen Hintern hinunterrutscht und eine weiße Kinderunterhose entblößt. In der Küche schaufelt der Koch Kartoffelbrei neben ein Ei und Kressesalat und hört dabei Magic FM. Im Wohnzimmer dösen zwei Damen in Strickjacken und Karottenhosen vor dem Fernseher, während sich eine Kochshow auf magische Weise in ein altes Schwarz-Weiß-Musical verwandelt. Im Garten raucht eine der jüngeren Bewohnerinnen eine Zigarette von der Länge eines Strohhalms und beobachtet, wie ein Rotkehlchen an einer fetten Kugel pickt.
Ich weine nicht. Ich habe jenes leere Stadium reiner Taubheit erreicht, in dem man wie an einem stillen See sitzend einfach ins Nichts schauen kann. Ich denke, dass ich wohl für immer hier liegen bleiben werde. Meine Muskeln werden verkümmern, mir werden Barthaare wachsen, von Zeit zu Zeit wird jemand hereinkommen und mir ein frisches Nachthemd anziehen, ich werde Vanillepudding essen und Sherry trinken. Ich werde im Schlafzimmer meiner Großmutter liegen wie die Schicht aus Talk und Taschentüchern, die das Innere ihrer Handtasche auskleidet. Ich werde hierbleiben, bis alles besser ist, alles vorbei, alles beendet.
Zwei Wochen zuvor lag ich mit meinem Freund der letzten sechs Jahre im Bett, während er sanft und gründlich mein Leugnen des Zustands unserer Beziehung zerbrach wie eine Handvoll Stöckchen.
»Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir eigentlich noch gemeinsam verbringen würden, wenn wir nicht ausgingen«, sagt er.
Knack.
»Du bist immer beschäftigt.«
Knack.
»Ich glaube, du willst nicht mit mir zusammen sein.«
Knack.
Die Nacht hält den Atem an, während ich dort wach liege und mich so entblößt fühle, als hätte mir jemand die Haut vom Körper gezogen. Diesen Mann anzufassen, diesen Bären in Menschenkleidung, fühlt sich auf einmal unzulässig an, wie ein Verstoß, als würde man die Hand in jemandes Hosentasche stecken. Also liege ich still. Nach sechs Jahren, in denen er sich um mich gekümmert hat, hilft er mir nun schon wieder. Bloß hilft er mir diesmal dabei, mit ihm Schluss zu machen. Er sagt mir, ich solle mir ein paar Tage Zeit nehmen, ich solle mir keine Sorgen machen, es würde alles gut werden, aber ich solle darüber nachdenken, ob ich mich von ihm trennen wolle. Am Morgen klammere ich mich an ihn wie an ein Rettungsboot, weine verstört und verspreche ihm, ich wolle nicht, dass sich irgendetwas ändere. Aber zugleich breitet sich eine leise Stimme in meinem Kopf aus wie ein Tropfen Tinte in einem Glas Wasser und sagt mir, dass sich bereits etwas verändert hat. In den kommenden zwei Tagen sind wir uns näher als in den Monaten zuvor: Wir reden, sitzen zusammen, essen gemeinsame Mahlzeiten, legen füreinander die Wäsche zusammen. Ich betrachte seinen Rücken, groß wie eine Matratze, während er spült.
Ich sage ihm, dass ich ihn liebe, aber nicht aufgeregt bin. Ich glaube, dass ich etwas will, aber ich weiß nicht, was.
Er blickt nach unten. »Natürlich bin ich nicht aufregend«, erwidert er. »Ich bin der Mann, mit dem du dir eine Waschmaschine gekauft hast. Dieser Typ ist für niemanden aufregend.«
Mein Herz fällt auseinander wie eine Pusteblume im Regen.
Und so trennen wir uns. Natürlich tun wir das. Ich habe noch nie von einem »Werden wir uns trennen?«-Gespräch gehört, das nicht mit einem »ja« endete. Ohne es zu wissen fiel ich durch einen Riss in dem Stoff, der plötzlich mein altes Leben war, und landete kopfüber und rasend schnell in etwas anderem: dem Fluss. Wie so viele Tausende Kinder nach einer Trennung ziehe ich zu meiner Mutter, während er seine Sachen packt. In meinem Fall bedeutet das drei Haltestellen der Busroute 48 auf die andere Seite des Flusses Lea. Auf dem Weg zur Arbeit komme ich mit dem Fahrrad an unserer Wohnung vorbei und sehe, dass er all seine Bilder von der Wand genommen und auf dem Fußboden gestapelt hat. Die Wohnung wirkt nun entblößt, unpersönlich und unerträglich traurig.
Wenn man seine gesamten Zwanziger mit einer Person verbracht hat – zuerst befreundet, dann als Liebespaar, dann als Gefährten –, kann es ein kleiner Schock sein, zu erkennen, dass man absolut keine Ahnung hat, wer man ohne diesen Menschen ist. Was man isst, wann man schläft, wen man kennt, was man besitzt, wie man redet, was man sich anschaut, wo der Staubsauger steht, um wie viel Uhr man aufsteht, was man an seinem Geburtstag macht, was man lustig findet, ob einem das eigene Besteck gefällt, ob man sein Fahrrad reparieren kann, wie man seine Arbeit erledigt, wie man sich kleidet, wem man vertraut, was man hört, woran man sich erinnert, sogar schlicht, was man mag – von alldem weiß man nichts mehr. Man hat keine Ahnung, wer man ist, weil man den größten Teil seines Erwachsenenlebens mit einem anderen Menschen zusammen gewesen ist. Sein Geschmack wurde zum eigenen Geschmack, wurde zu seinem, wurde zum eigenen, wurde zu einem selbst, wurde zu ihm. Ich war für ungefähr sechs ganze Monate eine unabhängige berufstätige Frau gewesen, ehe ich mit meinem Freund zusammenkam. Ich war ungebrannter Ton. Als wir uns also genau an meinem achtundzwanzigsten Geburtstag trennten, hatte ich kaum ein Erwachsenenselbst, zu dem ich zurückkehren, auf das ich zurückgreifen oder bei dem ich Trost finden konnte. Mein Ich lag Jahre zurück, hatte jahrelang den Anschluss verloren. Kein Wunder fühlte ich mich wie gelähmt, überwältigt und losgelöst: Ich war verloren.
Dabei hatte ich nicht nur mich selbst verloren. O nein. Ich hatte auch seine Familie verloren – seine ältere Tante mit dem Kaminsims voller Vögel und seine Mutter mit ihrer Strickliesel und ihrer Vorliebe für Sechziger-Jahre-Motown –, ich hatte seine Freunde verloren, ich hatte seine Fähigkeiten, seine Hilfe, seine Werkzeuge und Handtücher und Fußmassagen verloren, ich hatte seine Version von mir verloren und all unsere gemeinsamen Zukunftsvorstellungen. Indem ich mich von einem Mann trennte, mit dem ich geglaubt hatte, eine Familie gründen zu wollen, verlor ich auch meine potenziellen Kinder. Als achtundzwanzigjährige Frau, deren Mutter mit vierzig in die Wechseljahre gekommen ist, weiß man vom Körper und Kopf her besser als die meisten Menschen, dass es nur ein begrenztes Zeitfenster gibt, in dem man Kinder bekommen kann. Das ist halbwegs erträglich, solange man einen Partner hat, denn auch wenn man noch nicht ganz bereit oder sich noch nicht ganz sicher ist, kann man sich doch zumindest damit beruhigen, dass man über das nötige Equipment verfügt, wenn es dann zu einer Entscheidung kommt. Man kann noch warten. Zumindest für eine Weile. Aber als achtundzwanzigjährige Frau, die sich mit gebrochenem Herzen in die weite Prärie des Singlelebens schleppt, ist diese endliche Zeit auf einmal eine ganz andere Aussicht. Sie kann beängstigend sein. Sie kann sich tödlich anfühlen. Und die Berechnungen, die am Horizont auftauchen, bekommen ein extremes Gewicht.
Sollte sich meine Menopause wie bei meiner Mutter bereits mit vierzig ankündigen, dann könnte meine Fruchtbarkeit in meinen Mittdreißigern beträchtlich abnehmen. Das hieß, dass ich wahrscheinlich vor meinem fünfunddreißigsten Geburtstag mit dem Versuch starten müsste, ein Baby zu bekommen – und dabei herausfinden, ob ich überhaupt fruchtbar war. Wenn ich dann Probleme hätte, würden mir noch ein paar Jahre bleiben, um die Alternativen auszuprobieren. Aber wartet mal, wenn ich vor meinem fünfunddreißigsten Geburtstag versuchen wollte, ein Baby zu bekommen, dann hieße das, ich müsste jemanden kennenlernen, und zwar speziell jemanden, der sich in mich verlieben und mit mir eine Familie gründen wollte, bis ich, was, zweiunddreißig war? Dann hätten wir noch zwei Jahre, die wir gemeinsam als Paar genießen könnten, ehe wir anfingen, mit Vorsatz zu vögeln. Das würde uns ein paar schöne Erinnerungen verschaffen, von denen wir später zehren könnten, wenn wir übernächtigt, überfordert und voller Verbitterung wären. Aber wartet mal, ich hatte siebzehn Jahre gebraucht, um meinen ersten Freund zu bekommen, und danach dreieinhalb Jahre, um meinen zweiten kennenzulernen. Wenn man sich daran orientieren konnte, lägen nun noch mindestens drei Jahre Singledasein vor mir. Damit wäre ich bei was, neunundzwanzig? Aber Moment, fast jeder lebte mindestens mal zwei Jahre lang unabhängig, hatte Sex mit unterschiedlichen Leuten und konzentrierte sich auf seine Arbeit, ehe er ernsthaft mit der Partnersuche begann. Dieser Rechnung zufolge hätte ich mit meinem Freund Schluss machen müssen, als ich siebenundzwanzig war. Ich würde also um eine sechsjährige Beziehung trauern müssen, während ich bereits ein Jahr im Rückstand war. Irgendwie musste ich es schaffen, mein Leben zu leben, unabhängig zu sein, Sex mit jemandem zu haben, ohne ihm in den Mund zu heulen, mich zu verlieben und darauf zu warten, dass er bereit für den Versuch der Familiengründung war, und das alles musste ich sofort tun, sonst würde mir die Zeit davonlaufen, und ich würde nie die Wahl haben: Mein Körper und die begrenzte Zahl meiner Eizellen würden mir die Entscheidung abnehmen, ehe ich auch nur die Gelegenheit hätte, es zu versuchen.
Seit jenem Wochenende glaube ich fest daran, dass alle Frauen mit einem gebrochenen Herzen, aber insbesondere jene, die gerade in ihren Fluss steigen, einen einwöchigen Aufenthalt in einer Institution spendiert bekommen sollten, wo alle anderen einfach zu alt und erschöpft sind, um noch über Babys, Liebe oder Herzschmerz zu reden. Wir sollten augenblicklich in ein großes halbkommunales Gebäude eingeliefert werden, in dem die Nähe des Todes ein gebrochenes Herz lächerlich erscheinen lässt und die sanfte Mischung aus Seife, Binden, Mahlzeiten, Nickerchen und Bettruhe vollkommen von uns Besitz ergreifen kann. Während einer Trennung gibt es eine Zeit der Analyse und eine Zeit der Paralyse: Jene ersten Wochen gehören fast ausschließlich zur Letzteren. Man ist noch nicht bereit, genauestens zu sezieren, was schiefgegangen ist. Im Grunde kann man nichts weiter tun, als dafür zu sorgen, dass man nicht auseinanderfällt, und auf den eigenen Herzschlag zu hören. Später bleibt noch genügend Zeit, um das Ende einer Beziehung mit Freundinnen, Familie, vielleicht sogar professionellen Zuhörern zu verarbeiten, diskutieren und auseinanderzunehmen. Man kann das Ganze nicht auf einmal schlucken, weshalb beginnt man also nicht damit, erst mal nur seine Wunden zu lecken? Wieso nimmt man sich nicht ein wenig Zeit, um seinem realen Leben zu entfliehen? Und wo könnte man sich selbst besser pflegen als in einem Pflegeheim?
Ihr mögt euch fragen, weshalb ich als frischgebackene Singlefrau in London so viel Trost bei den pastellfarbenen Vorhängen, Badezimmerdesinfektionsmitteln, Lockenwicklern, Lokalradiosendern, Taschenbüchern, Faltenröcken, Standuhren und Thrombosestrümpfen eines Pflegeheims in der Provinz fand. Wieso ich mich so bereitwillig dem gleichmäßigen, gemächlichen Stundenplan aus Mahlzeiten, Ruhezeiten, Singalongs und Tablettenvergabe unterwarf. Warum ich eine dermaßen tiefe Ruhe empfand, als ich in die bei neunzig Grad gewaschene Bettwäsche meiner unermüdlichen Großmutter sank oder über den unbetretenen Rasen hinausblickte. Die Antwort ist einfach: Für alle anderen in diesem großen roten Backsteinhaus auf dem Hügel war das schreckliche, drängende Pulsieren von Möglichkeit und Fruchtbarkeit längst zum Schweigen gebracht worden. Ihre biologischen Uhren waren stehen geblieben. Sie hatten diese Option nicht mehr. Ihre Arbeit war getan. Ihre Freundschaften verabschiedeten sich nach und nach. Ihr Fluss war lange versiegt. Jene Frauen hatten ihre Kinder entweder bekommen oder nicht. Sie hatten geliebt, geblutet, geschwitzt, waren ausgelaufen und hatten verloren, und nun begannen ihre letzten Lebensjahre. Ihre Körper vertrockneten, wurden blass und dünn bis zum Verschwinden. Ihre pergamentene Haut, ihr weißes Haar, ihre dicken Zehennägel und bröckelnden Zähne waren die greifbaren Manifestationen der Zeit, unbestreitbar und unaufhaltsam. Womöglich spürte ich eine anschwellende Flut der Hoffnungslosigkeit gegen meine Rippen drücken, wenn ich an die Zukunft, die Familie und das theoretische Leben dachte, die ich gerade verloren hatte, aber all das war nichts, was diese Leute hier nicht auch hatten bewältigen können. Mein gebrochenes Herz war weder einzigartig noch beispiellos oder weltverändernd. Ich folgte einfach dem zerbröckelten Pfad so vieler vor mir, die versucht hatten, von Liebe zu Liebe zu gelangen, ohne dazwischen zu oft in den Schlamm zu treten.
Was nicht heißen soll, dass jene Frauen unfreundlich oder nicht mitfühlend gewesen wären. Einige von ihnen waren wundervoll. Bei einem Besuch einige Monate später ging ich gerade zwischen Sherry und Mittagessen durch den Speisesaal, als eine zweiundneunzigjährige Lettin namens Elsa mich plötzlich an der Hüfte packte.
»Mein Liebes!«, rief sie und fixierte mich mit ihren dunkelblauen Augen. »Du erinnerst mich an die Gypsy-Frauen, von denen ich in der Kunsthochschule Aktbilder gemalt habe!«
Ich fühlte mich geschmeichelt. Wie ich später herausfand, hatte Elsa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Paris bildende Künste studiert – zu einer Zeit, als es für anständige Frauen als unschicklich galt, nackt zu posieren. In ihrem langen Leben hatte sie über Gastronomie geschrieben, zwei Söhne geboren, Kleider geschneidert, drei Sprachen gesprochen und großartige Dinnerpartys gegeben. Ihr Körper mochte zusammengefallen sein wie ein Soufflé, aber diese Frau war voller Leben, Humor und Freude über die Welt. In ihre bewegliche Zimtschnecke von Gesicht zu blicken und erklären zu wollen, dass ich mich durch den Verlust von Liebe, Sicherheit und meinen Zwanzigern ausgehöhlt fühlte, erschien mir wie der Versuch, sich bei einer Felswand über den Wind zu beschweren.
Es gibt eine bestimmte Art von Filmen, Popsongs oder Romanen – »I Will Survive«, Muriels Hochzeit –, in denen die Trennung von einem unpassenden Partner das Ende der Geschichte darstellt. Singleleben, Freiheit und Unabhängigkeit sind das Happy End für alle, von Hochschulabsolventinnen in ihren Zwanzigern bis zu achtundsechzigjährigen Geschiedenen. Wir sehnen uns nach einem ungebundenen Leben. Aber für Frauen im Fluss ist eine Trennung oft nur der Anfang der Geschichte, und »freedom’s just another word for nothing left to lose«. Wie meine Freundin, die Autorin Amy Liptrot, mir einmal in einer genialen, großbuchstabenlastigen Textnachricht schrieb: »Ich weiß noch, als ich mit meinem Berliner Freund Schluss machte und eine (jüngere) Freundin mich trösten wollte und meinte: ›Jetzt gibt es nichts mehr, was dich beschwert.‹ Und ich nur so: ›ICHWILLBESCHWERTWERDEN. GIBMIRDIEGEWICHTE. ICHBINBEREIT.‹«
Ich wusste genau, was sie meinte. Während ich auf meine frühen Dreißiger zurutschte wie Schlamm von einer Kelle, war ich nicht etwa Single, weil ich bindungsunwillig gewesen wäre. Ich hatte gerade deshalb eine unperfekte Beziehung beendet, weil ich die Person finden wollte, die sich vollkommen auf mich und meine Vorhaben einlassen würde. So tief ich es zum Zwecke des Selbstschutzes auch unterdrückt haben mochte, wollte ich beschwert werden durch Liebe, Zukunftspläne, gemeinsamen Besitz und die dysfunktionale Familie eines anderen. Ich wollte gemeinsam ein Sofa kaufen, zusammen in den Bergen wandern, meinen Pass in eine Ablagebox stecken, die speziell zu diesem Zweck angeschafft worden war. Ich wollte eine erwachsene Beziehung mit jemandem, der sich selbst bereit fühlte, erwachsen zu sein. Natürlich dachte ich damals bloß, ich würde mit jemandem zusammen sein wollen, der Tee trank, Kreuzworträtsel löste, einen ausgewachsenen Sexualtrieb und einen Vollzeitjob hatte. Im Rückblick sind diese Eigenschaften nach wie vor eine ziemlich gute Skizze meines idealen Lebenspartners und Vaters meines Kindes. Während mein Kopf noch die Spreu aus Herzschmerz, Einsamkeit und weiblicher Panik aussortierte, heckten mein Körper und mein Unterbewusstes eine Art Masterplan aus.
»Ich weiß noch, wie ich dachte: ›Ich will nicht mit vierunddreißig immer noch total dysfunktionale Beziehungen haben‹«, sagt Dolly Alderton eines warmen Julimorgens, an dem ich in ihrer perfekten Wohnung sitze, die direkt einem französischen Nouvelle-Vague-Film entsprungen zu sein scheint, und sie über das Jahr ausfrage, in dem sie aufhörte, Sex zu haben. Dollys Bestseller Alles, was ich weiß über die Liebe war ein ehrlicher, gefühlvoller und lustiger Blick auf das Leben, die Liebe, Freundschaft und die Zwanziger. Außerdem schrieb sie mit Witz und Weisheit über ihre im Alter von neunundzwanzig Jahren getroffene Entscheidung, nicht mehr zu daten, keinen Sex mehr zu haben, Männern keine Nachrichten mehr zu schreiben und sogar – wenn möglich – nicht mehr zu masturbieren. Wer wäre also besser geeignet, um Fragen zu Sex, einem gebrochenen Herzen und dem Beginn des Flusses zu beantworten?
»Solange ich meine Haltung gegenüber Sex und Männern nicht änderte, würde ich nicht in der Lage sein, eine liebevolle, funktionierende Partnerschaft zu führen und eine Familie zu gründen«, sagt sie und beißt in einen der Bagels, die ich als Friedensangebot und Bestechung zugleich mitgebracht habe. »Es war, als wäre jener Raum so unverhältnismäßig belebt und grell erleuchtet gewesen, dass ich einfach die Tür schließen und den Schlüssel einstecken musste, in dem Wissen, dass ich später wieder dorthin zurückkehren konnte.«
Als sie achtundzwanzig wurde – ein wichtiges Jahr in den Panikjahren so vieler Frauen –, war Dolly gerade frisch getrennt, machte eine Therapie, hörte infolgedessen auf zu daten und Sex zu haben, schrieb ihr Buch und zog aus ihrer Wohngemeinschaft aus, um fortan allein zu leben. Alles innerhalb von sechs Monaten.
»Ich dachte, ich hätte einen Zusammenbruch«, lacht sie. »Ich las viel über Sexsucht, bereinigte die Dinge mit Expartnern, verbrachte viel Zeit mit den Frauen, die ich liebe, und baute die Beziehung zu meiner Familie neu auf. Im Grunde war es mein Weg, wieder ein Gefühl für mich selbst zu entwickeln«, erklärt sie.
Wie viel von dieser Arbeit, frage ich sie, stand in einem direkten Zusammenhang mit ihrem Wunsch, Mutter zu werden?
»Ich dachte definitiv über Babys nach, in dem Sinne, dass ich wusste: Vor diesem nächsten Schritt musste ich das hier erst mal geregelt kriegen«, erklärt sie und artikuliert mit beängstigender Genauigkeit ein Gefühl, das ich erst seit kurzem verstehen gelernt habe. »Viele Frauen, die ich kenne, haben ihre späten Zwanziger im Grunde wie eine Art Erholungszeit zwischen ihren Zwanzigern und der nächsten Phase ihres Lebens behandelt.«
Es mag kontraintuitiv erscheinen, keinen Sex mehr zu haben, weil man Babys bekommen möchte, aber Dolly argumentiert, um die Art von stabiler Beziehung aufzubauen, die man braucht, um die ersten Jahre mit Kind zu überleben, muss man womöglich aufhören, die Art von Sex zu haben, die einen zuvor so sehr, nun ja, ins Schwitzen gebracht hat. Hat sie sich je Sorgen darüber gemacht, dass ihr die Zeit davonläuft?
»Nein. Damals nicht«, sagt sie und blickt mir direkt in die Augen. »Aber mittlerweile mache ich mir große Sorgen. Fruchtbarkeit ist so ein schwieriges feministisches Thema, weil unsere Biologie nicht mit unserer politischen Einstellung Schritt gehalten hat. Ich würde liebend gern sagen: ›Ich brauche keinen Mann, ich brauche keine Dates, ich kann mich einfach auf mich selbst konzentrieren, mit vierzig mit den Fingern schnipsen und dann ein Baby bekommen!‹ Aber so läuft es nun einmal nicht.«
Leider.
Natürlich entspringt nicht jeder Fluss einer Trennung. Für viele Frauen kündigt sich der Fluss mitten in einer Beziehung oder während ihrer Singlejahre durch irgendein anderes bedeutendes Ereignis an – ein Umzug in ein anderes Land, ein Jobwechsel oder -verlust, zusehen zu müssen, wie ein Kollege befördert wird, eine Verlobung, eine Endometriose-Diagnose, mitzuerleben, wie die besten Freundinnen Babys bekommen oder Häuser kaufen, um nur ein paar der größten Posten anzuführen. Allerdings trennen sich tatsächlich viele Leute am Ende ihrer Zwanziger nach langjährigen Partnerschaften. Eine Umfrage ausgerechnet der Bausparkasse Nationwide zeigte, dass eine durchschnittliche Beziehung in den Zwanzigern 4,2 Jahre hält – eine Statistik, die ich 2017 las und seitdem mit mir herumgetragen habe wie die Versichertennummer und den Termin beim Zentrum für sexuelle Gesundheit, zusammengefaltet in meinem Geldbeutel.
In jener Krisenzeit in den späten Zwanzigern, wenn aus Jobs Karrieren werden, aus Mieten Kaufen wird, aus Liebhabern Partner und aus Freundinnen Mütter werden, gibt es häufig ein Minierdbeben von Trennungen, wenn die Leute noch ein letztes Mal neu würfeln, ehe sie eine große Verpflichtung eingehen. Vielleicht leben wir uns auseinander, vielleicht streiten oder betrügen wir, vielleicht verzweifeln wir am Schnarchen, Trinken, den Socken in der Küche, dem Einkaufen von Toilettenpapier, dem Schmollen beim Abendessen, dem Pläneschmieden, den ausbleibenden Plänen, dem Hass auf Pläne. Aber manchmal stehen wir auch einfach nur vor einer anderen Person und stellen mit kalter, nackter und unvermeidlicher Traurigkeit fest, dass wir uns geirrt haben. Dass wir beide eine falsche Entscheidung getroffen haben. Unter jenen Umständen ist das Beenden einer Beziehung nicht nur gesund, rechtzeitig und mutig – es könnte uns tatsächlich das Leben retten. Aber was kommt als Nächstes? Wie flickt man ein gebrochenes Herz? Wie lange braucht man, um die richtige Person zu finden? Wann ist man darüber hinweg? Wird man je wieder lieben? Was will man eigentlich vom Leben? Diese Frage treibt Priester und Doktoren in ihren Talaren quer über die Felder.
2Lass uns rausgehen
Ich wollte niemals an einem Bahnhof sitzengelassen werden.
Manchmal ist Daten wie ein feuchtes Holzscheit: Es schwelt, raucht und spuckt, fängt aber nie richtig Feuer. Am Ende hat man nicht so sehr Liebeskummer aufgrund einer Person als aufgrund von etwas, das es eigentlich nie gegeben hat, eine entrissene Möglichkeit, ein Streich der Hoffnung, den man sich selbst gespielt hat. Das hier war ein solcher Fall von Liebeskummer. Und hier war ich, stand mit achtundzwanzig Jahren auf Bahnsteig vier am Bahnhof von Crewe in einem Pumpkin Café und versuchte, mich zwischen einem eiskalten Becher Birchermüsli vom Vortag für 2,99 Pfund und einer Tüte Salt-and-Vinegar-Chips für 1,29 Pfund zu entscheiden. Während die verspäteten Züge und Gleisänderungen sich über meinem Kopf abrollten wie bernsteinfarbener Regen, hielt ich den mit Folie bedeckten Becher in Joghurt getränkter Haferflocken in den Händen und spürte, wie mein Entschluss bröckelte.
Nur vierzig Minuten zuvor hatte mir ein Mann, mit dem ich zelten gewesen war, eröffnet, dass er zwar Vater werden, aber keine Freundin haben wollte. Auf dem Rückweg von einem Wochenende in den Bergen saßen wir in einem Virgin Train, der gerade in Stafford einfuhr, als er entschied, dies sei der richtige Zeitpunkt, um mir die frohe Botschaft zu überbringen. Er gab mir einen Kuss auf die Lippen, nahm seine Tasche und stieg aus dem Zug. Vor dem Fenster zwinkerte er mir zu, lächelte und beobachtete, wie ich davonfuhr. Von Stafford bis Crewe starrte ich in die gen Boden sinkende schmutzige Zwei-Pence-Sonne, während mein Herz gegen meinen Hals drückte wie ein Winkelschleifer, und bemühte mich, nicht zu weinen. Er hatte mich geküsst. Er hatte mir zugezwinkert. Er wollte mich nicht. Ich warf einen Blick auf die Menschen in meinem Abteil und brannte vor Scham, denn sie alle hatten es gesehen. Sie hatten dabei zugesehen, wie ich, einer feuchten Mülltüte gleich, höflich aber bestimmt fallengelassen wurde. Ich war zerzaust, ich trug Leggings, ich hatte meine Füße auf eine Tasche gestellt, die so viel wog wie eine Leiche, und ich war eine Idiotin. Eine absolute Idiotin.
Obwohl ich diesen Mann bereits seit zwei Jahren kannte, war es das erste Mal gewesen, dass wir wirklich Zeit zu zweit miteinander verbracht hatten. Ich weiß. Ehrlich, ich weiß. Von einer Bekannten zu einer verschwitzten Liebhaberin in der Natur zu werden, ist ein seltsamer Move, aber dieser wurde sozusagen zu meinem Markenzeichen. Ihr müsst wissen, ich habe es nie richtig hinbekommen, jemanden abzuschleppen, ohne eine große Sache daraus zu machen. Ich habe mir nie eine App heruntergeladen, habe nie nach rechts gewischt und auch nur selten jemanden gefragt, ob er mit mir etwas trinken oder essen gehen will. Stattdessen fragte ich einen Mann, den ich kaum kannte, praktisch aus dem Nichts, ob er mit mir ein Wochenende im Nirgendwo verbringen wollte, schwitzend, unter zwei auseinandergezogenen Polyesterlaken. Ihr würdet wirklich staunen, wie oft da ja gesagt wird.
Wie dem auch sei, da ich diesen Mann kaum kannte, hatte ich mit ihm auch noch nicht richtig über die Zukunft gesprochen, ich hatte mich nicht getraut. Ich war noch nie besonders an Hochzeiten interessiert gewesen und legte nicht viel Wert darauf, dass jemand mir einen Antrag machte, dennoch hatte ich mir ausgemalt, im Bett neben ihm aufzuwachen und sein Achselhaar in der Morgensonne zu betrachten. Ich hatte auf klammernde Küsse, Textnachrichten und Insiderwitze gehofft. Ich hatte davon zu träumen gewagt, ihm Brot zu backen, ein Marmeladenglas voller Zigarettenstummel auf einem Fensterbrett zu balancieren, ein gemeinsames Bücherregal zu haben und dazu, weil es stets etwas war, das ich mir in meiner Zukunft vorstellte, ein Baby. Es mag lächerlich klingen, wie die Kulmination der schlimmsten Ängste eines Bindungsphobikers, dass ich nach nur zwei Nächten in einem Zwei-Personen-Zelt mitten im Nirgendwo bereits ein Leben der totalen Interdependenz und Elternschaft mit einem Mann plante, den ich kaum kannte. Aber ganz so einfach ist es nicht.
Für mich und für viele andere, die sich im Fluss befinden, ist die Vorstellung, wie es sein könnte, ein Baby mit jemandem zu haben, ihm die eigene Gebärmutter anzuvertrauen und das eigene Leben untrennbar mit seinem zu verbinden, eine Möglichkeit auszutesten, welche Gefühle man wirklich für diesen Menschen hat. Es ist so, wie wenn man jemandem beim Tanzen zusieht und sich überlegt, ob man mit diesem Menschen Sex haben könnte, oder wenn man sich hinter den Schreibtisch im Büro einer anderen Person imaginiert, um zu schauen, ob man deren Job übernehmen könnte, oder wenn man ins Fenster einer Erdgeschosswohnung blickt und sich fragt, ob man mit dieser Tapete leben könnte. Ich malte mir aus, mit Leuten Babys zu bekommen, um mich selbst zu testen, das Ausmaß meiner Anziehung, meiner Bereitschaft und meiner Absichten. Wenn ich vor der Idee zurückschreckte, wusste ich, dass die Sache ein Reinfall war. Wenn ich das Gefühl hatte, das imaginäre Kind vor der Reizbarkeit, den Gewohnheiten, dem Drogenkonsum, dem Job oder der Familie jener Person beschützen zu müssen, war es ein ziemlich gutes Anzeichen dafür, dass ich mich von ihr fernhalten sollte (ob ich das dann tat oder nicht, ist eine andere Frage – zumindest waren die Anzeichen da, die ich aber bewusst ignorieren konnte). Wenn ich mir glücklich vorstellen konnte, wie er unser Neugeborenes durchs Haus trägt und dabei Stevie Wonder singt, dann wusste ich zumindest auf irgendeiner Ebene, dass ich mich bei dem Gedanken an eine gemeinsame Zukunft wohlfühlte. Und wenn man nach einer langen oder bedeutenden Beziehung wieder datet, wenn man in den Panikjahren datet, wenn man datet, während die Menschen um einen herum anfangen, sesshaft zu werden, dann wird die Zukunft zu einer ziemlich realen und unmittelbaren Angelegenheit. Die bevorstehenden Dinge nehmen noch beim Reden Form an. Daher ist ein Baby nicht einfach etwas, das eines Tages passieren könnte, sondern etwas, das tatsächlich relativ bald passieren kann. Mir jemanden, mit dem ich gerade geschlafen hatte, als einen Vater vorzustellen, war meine Art, mich mit einem inneren, kindlichen emotionalen Selbst zu verbinden und zugleich die Skizze einer möglichen Zukunft anzufertigen.
Als er sich mit jenen paar Worten also als ein williger Vater, aber nicht als ein Partner präsentierte, hatte er nicht nur meine Hoffnung beschämt und meine Zuneigung blamiert, sondern mir noch ein weiteres ungelebtes Leben entrissen. Er hatte eine mögliche Version von Nell ausgelöscht, und ebenso der Kinder, die sie hätte gebären können. Ohne sich dessen unbedingt bewusst zu sein oder es zu wollen, hatte er das Zahnfleisch meiner zur Schau getragenen Gleichgültigkeit zurückgeschoben und einen wunden Nerv der Sehnsucht enthüllt. Aber statt diese Sehnsucht wertzuschätzen, war er mit einem Zwinkern davongegangen.
Weil ich technisch so unfähig wie verschwenderisch bin, hatte ich nur etwa sieben Songs auf meinem Telefon heruntergeladen. Während ich mit schmerzendem Herzen durch Cheshire donnerte, hatte ich also die Wahl, mir entweder eine Coverversion von »It’s All Over Now, Baby Blue« von Them oder eine siebzehnminütige Version von »Love To Love You Baby« von Donna Summer anzuhören. Ich entschied mich für Ersteres. Heute wünschte ich, ich hätte Letzteres gewählt. Mit aufgesetzten Kopfhörern, das Gesicht ans Fenster gedrückt, fühlte ich mich leer. Ich war ein verzogener und aufgerissener Tischtennisball, der im Staub eines Scheunenbodens lag. Ich war eine niedergetretene Trockensteinmauer. Ich war eine leere, altersmüffelige Tupperdose. Ich weinte wie ein Feuer in der Sonne.
Natürlich gibt es keinen guten Ort, um mit jemandem Schluss zu machen. Der Akt des Schlussmachens hat schon viel zu viele Uferpromenaden, heiß geliebte Cafés, stille Wälder und dunstige Pubs ruiniert. Was mich auf eine Idee bringt: Der Staat sollte ausgewiesene Schlussmachbereiche zur Verfügung stellen. Sozusagen als Zwillingsprojekt zu meinen Pflegeheimen für gebrochene Herzen. Es sollte von der Regierung finanzierte öffentliche Orte geben, an die tränenmüde, lustlose Paare gehen können, um ihre Verbindung zu lösen. Statt ein Restaurant, einen nahe gelegenen Park oder, noch schlimmer, das eigene Zuhause mit einem Gespräch darüber zu verseuchen, auf wie viele Weisen der andere einen nicht mehr begehrt, wäre es doch so viel besser, eine anonyme, automatische, nicht beantwortbare E-Mail im Outlook-Postfach vorzufinden, die einen in ein von der M6 abgehendes Konferenzzentrum einlädt. Dort einen komplett neutralen, auf hässliche Weise unpersönlichen Raum über einem Wartebereich auf dem Bahnsteig zu betreten, in dem der eigene Partner einem auf einem Plastikschalenstuhl gegenübersitzt, die Ellbogen auf eine Holzfasertischplatte mit den Flecken von anderer Menschen Tränen gestützt, und einem langsam das Herz zerquetscht. Oder mit sinkendem Mut in ein Besprechungszimmer in einem Industriegebiet neben einer Kiesgrube zu treten, wo man seinen Freund auf Teppichfliesen unter einer Neonröhre stehen sieht und sicher weiß, dass man gleich verlassen wird. Dorthin wird man nie wieder zurückkehren müssen, man wird nicht während eines Essens im Pub oder eines langen Spaziergangs daran erinnert, es holt einen nicht zufällig drei Monate später ein, wenn man mit seiner Cousine Tee trinken geht. Es wird für immer ein entfernter bürokratischer Albtraum bleiben, den man ertragen hat und fortan ignorieren kann. So sollte Schlussmachen funktionieren.
Wahrscheinlich kam ich diesem glücklichen Traum so nahe wie irgend möglich, als ich am Bahnhof von Crewe stand, wo ein sibirischer Wind über die mit Scheiße bespritzten Bahnschienen unter meinen Füßen herauffegte, und versuchte, etwas für weniger als 5 Pfund zu kaufen, was das Nagen meiner Eingeweide stoppen könnte, ehe ich in eine Bummelbahn in Richtung London stieg. Der Rucksack hing an meinen Schultern wie ein schlechtes Gewissen, und die Kühlschranklichter der Auslage des Cafés schienen blind auf meine grauen Haare. Trotzdem frage ich mich, ob ich das verdient hatte. Trotzdem wünschte ich, er hätte es besser gemacht.
Zu diesem Zeitpunkt hätte ich das Zelten vermutlich sein lassen sollen. Ich hätte meinen eigenen Rat annehmen und erkennen sollen, dass das Verspeisen von Instant-Nudeln in einem Anorak höchstwahrscheinlich nicht zur Liebe des Lebens führt. Ich hätte in Betracht ziehen sollen, wie das mühsame Anziehen einer Unterhose, während man gekrümmt ist wie ein Shrimp, der Versuch, unter einer Kuppel aus vermodert riechendem Zelttuch Sex zu haben, oder das Schlafen in zwei Paar Herrensocken meine Chancen auf Hingabe schmälern könnten. Aber stattdessen zeltete ich noch härter. Liebe Leute, ich zeltete wie eine Besessene. Im Verlauf der nächsten zwei Jahre durchquerte ich das Land wie eine Pfadfinderin, ich wurde zur Pionierin des Draußen-Vögelns. Ich hatte endlich genügend Selbstvertrauen zusammengekratzt, um zu begreifen, was mir wichtig war: Landschaft, Draußensein, Menschen, die ja sagen, Sex und Abenteuer. Ich wollte einen Mann, der nach Holzfeuer roch, einen ordentlichen Pullover besaß und ein Zugticket im Voraus buchen konnte. Was ich noch nicht zugeben konnte, war, dass ich neben Romantik und Abenteuer auch Zuneigung und Verbindlichkeit wollte – und verdient hatte. Immerhin bekam ich ein paar gute Spaziergänge und viel frische Luft. Ihr wisst schon, genau wie ein Hund.
Es gibt einen Mythos, der unsere Kultur so beharrlich durchdringt, dass ich Jahre brauchte, um zu erkennen, dass er nicht immer zutreffend ist. Dieser Mythos besagt, alle Männer seien unersättliche sexuelle Wesen, die ihr gesamtes Leben in einem Zustand aufgeregten Verlangens verbringen, der von den Menschen in ihrem Umfeld entweder verurteilt oder gebilligt wird. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass das Schwachsinn ist. Manche Männer haben eine gesteigerte Libido. Manche Frauen auch. Die meisten Männer haben zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben und unter bestimmten Umständen eine gesteigerte Libido. Genau wie die meisten Frauen. Manche Männer haben eine schwache Libido. Manche Frauen haben eine schwache Libido. In seinem Buch Die versteckte Lust der Frauen argumentiert der Autor Daniel Bergner, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht so sehr biologisch als vielmehr anerzogen sind: Die weibliche Sexualität sei zwar genauso roh und animalisch wie die männliche, Frauen werde allerdings beigebracht, das Ausdrücken triebhaften Verlangens sei irgendwie unschicklich oder unweiblich. Wenn diese dringende animalische Lust dann endlich einmal zum Vorschein komme, könne sie bei Frauen daher beschämend oder unnatürlich wirken und schnell unterdrückt werden. Aber sie ist da, sie war schon immer da. Immerhin, wie Zoe Williams in einem ihrer besten Artikel schreibt, wurde Fifty Shades of Grey gerade deswegen zum bestverkauften Buch, seit die Verkaufszahlen im Vereinigten Königreich aufgezeichnet werden, weil es von Scharen lüsterner Frauen gekauft wurde, denselben Frauen, die von ihren verständnislosen oder hinter den Erwartungen zurückbleibenden Partnern zu oft als »frigide« oder »vertrocknet« abgetan werden. Es ist ein unangenehmer Scherz der Biologie, zumindest für heterosexuelle Paare, dass Männer oftmals mit achtzehn eine starke Libido genießen, während die Libido von Frauen eher mit dreißig ansteigt, was eine Quadratur des Kreises darstellt, die mir nie gelungen ist. Aber in unserem sexuellen Wesen und Appetit, wenn man von der sozialen Konditionierung einmal absieht, gleichen sich Männer, Frauen und nichtbinäre Menschen in vielerlei Hinsicht.





























