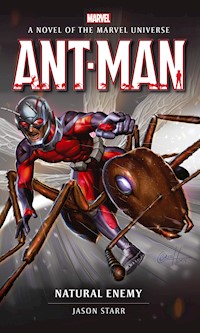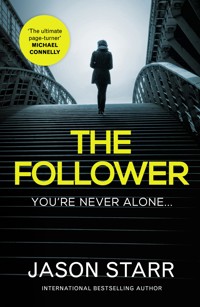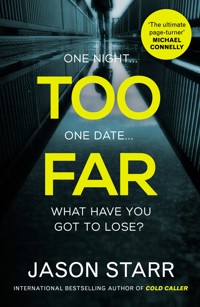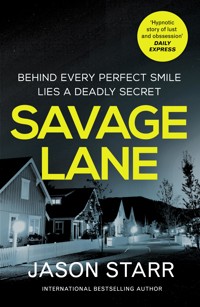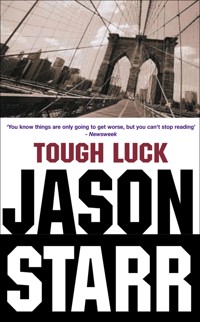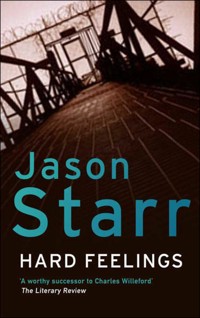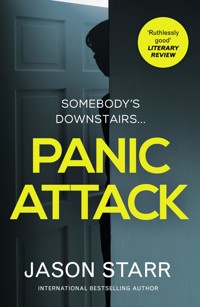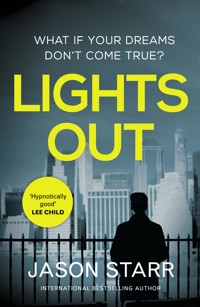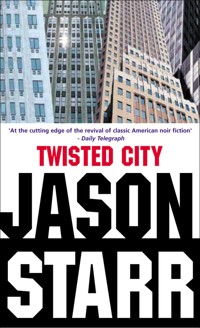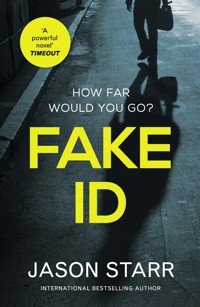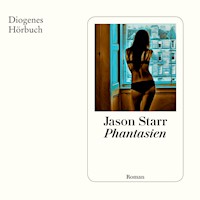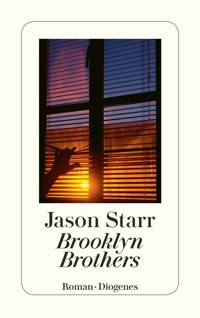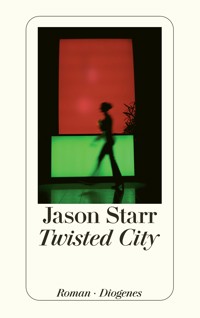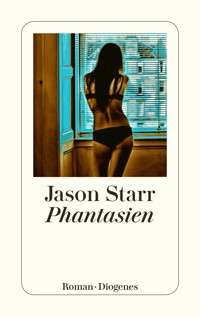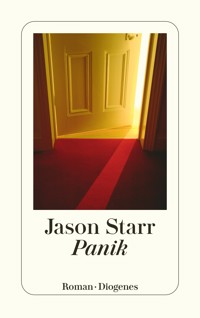
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Adam Bloom hat einen tödlichen Fehler gemacht, und seither hat es jemand auf seine Familie abgesehen. Es gibt allen Grund, in Panik zu geraten: Der Eindringling ist schon im Haus…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jason Starr
Panik
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ulla Kösters
Diogenes
Für Chynna und Sandy
Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus.
Sigmund Freud
1
Adam Bloom hatte einen Alptraum, einen, den er schon kannte. Er befand sich in seiner Praxis in Midtown und behandelte gerade eine Patientin, Kathy Stappini oder Jodi Roth, die beide bezeichnenderweise an Agoraphobie litten, als die Praxis urplötzlich auf einen weißen, quadratischen Raum zusammenschrumpfte, kaum größer als eine Gefängniszelle, und Kathy beziehungsweise Jodi sich in eine große, schwarze Ratte mit langen Fangzähnen verwandelte. Sie jagte ihn durch den Raum, sprang laut fauchend an ihm hoch. Dann kamen die Wände auf ihn zu. Er wollte schreien, brachte aber keinen Ton heraus. Eine lange, schmale Treppe tauchte aus dem Nichts vor ihm auf. Er nahm Stufe um Stufe, kam aber nicht von der Stelle, als versuchte er, eine nach unten fahrende Rolltreppe hinaufzulaufen. Als er zurückblickte, war die Ratte riesig geworden, fast so groß wie ein Rottweiler. Sie hatte es auf ihn abgesehen, bleckte die langen Fangzähne, wollte ihm an die Gurgel.
Jemand zerrte an seinem Oberarm. Verwirrt versuchte er, sich auf die andere Seite zu drehen. »Mum, Dad, wacht auf, schnell!«
Er öffnete die Augen, vollkommen desorientiert, noch immer in panischer Angst vor der Riesenratte, bis er begriff, dass er zu Hause in Forest Hills Gardens war, in seinem Bett, und dass seine Frau Dana direkt neben ihm lag. Wie immer, wenn er aus einem Alptraum erwachte, durchflutete ihn eine Woge der Erleichterung bei der plötzlichen Erkenntnis, dass alles in Ordnung war, dass die Welt Gott sei Dank doch kein so schrecklicher Ort war.
Doch da hörte er seine Tochter flüstern: »Da unten ist jemand!«
Marissa hatte letztes Jahr am Vassar-College ihr Kunstgeschichtsstudium abgeschlossen – Adam und Dana waren über die Wahl ihres Hauptfachs nicht gerade begeistert gewesen – und wohnte jetzt wieder zu Hause in ihrem alten Kinderzimmer. In letzter Zeit legte sie ein ziemlich auffälliges Verhalten an den Tag, wollte Aufmerksamkeit um jeden Preis. Sie hatte sich gleich mehrere Tattoos stechen lassen, eines davon, unten am Rücken, zeigte einen Engel, den sie gern zur Schau stellte, indem sie kurze Tops und Hüftjeans trug. Kürzlich hatte sie sich grelle pinkfarbene Strähnen ins hellbraune Haar gefärbt. Ihre Tage verbrachte sie damit, stundenlang grässliche Musik zu hören, haufenweise E-Mails, Blog-Einträge oder SMS-Nachrichten zu schreiben, fernzusehen oder mit ihren Freunden auf irgendwelchen Partys abzuhängen. Oft kam sie erst gegen drei oder vier Uhr morgens nach Hause, manchmal auch gar nicht, und ›vergaß‹ dann gern, Bescheid zu sagen. Sie war keine schlechte Tochter, aber Adam und Dana versuchten nun schon seit geraumer Zeit, sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, endlich die Kurve zu kriegen und sich auf eigene Füße zu stellen.
»Was ist?« Adam war noch ganz schlaftrunken, seine Gedanken kreisten um den Traum. Was für eine Bedeutung hatte die Ratte? Warum war sie schwarz? Warum begann es jedes Mal mit einer Patientin in seiner Praxis? Hatte es etwas zu bedeuten, dass es immer eine Frau war?
»Ich hab was gehört«, sagte Marissa. »Da unten ist jemand.«
Adam blinzelte ein paarmal und wurde allmählich wach. »Ach, das war bestimmt nur das Gebälk oder der Wind oder …«
»Nein, wenn ich’s dir doch sage. Ich habe Schritte gehört, da unten schleicht jemand herum.«
Dana war nun auch wach geworden. »Was ist los?«
Dana war siebenundvierzig, genauso alt wie Adam, aber sie hatte sich besser gehalten als er. Seine Haare wurden grau, fielen aus, und am Bauch hatte er einen unübersehbaren Rettungsring angesetzt. Dana verbrachte viel Zeit im Fitness-Studio, in den letzten zwölf Monaten ganz besonders, und das Resultat war eine Topfigur. Es hatte ein paar Turbulenzen in ihrer Ehe gegeben – als Marissa die Highschool besuchte, hätten sie sich fast auf Probe getrennt, aber in letzter Zeit lief es wieder besser.
»Unten ist jemand, Mum«, flüsterte Marissa.
Adam war müde und wollte einfach nur wieder einschlafen. »Das bildest du dir bestimmt bloß ein.«
»Aber ich bin mir sicher, dass ich was gehört habe.«
»Vielleicht solltest du besser nachsehen«, schlug Dana besorgt vor.
»Ich hab echt Angst, Daddy.«
Das Wort »Daddy« stimmte ihn schlagartig um. Er konnte sich gar nicht erinnern, wann sie ihn das letzte Mal so genannt hatte. Sie musste wirklich Angst haben. Da er nun schon einmal wach war und sowieso pinkeln musste, konnte er ebenso gut kurz nachsehen.
Adam atmete tief durch und setzte sich auf. »Okay, okay, ich geh ja schon.«
Als er aus dem Bett stieg, zuckte er zusammen. Seit ein paar Jahren litt er immer wieder unter Rückenschmerzen und fühlte sich steif und unbeweglich, die Quittung für Überbeanspruchung durch zu viel Sport, in seinem Fall Joggen und Golf. Der Physiotherapeut hatte ihm eine Liste mit Übungen für zu Hause mitgegeben, aber in seiner Praxis hatten ihn in letzter Zeit ein paar komplizierte Fälle auf Trab gehalten, und so hatte er die Übungen vernachlässigt. Außerdem sollte er den Rücken eigentlich vor dem Schlafengehen und nach jeglicher sportlicher Betätigung mit Eis kühlen, und auch an diesen Rat hatte er sich nicht gehalten.
Während er zur Tür ging, massierte Adam mit einer Hand seinen unteren Rücken, um die Steifheit herauszukneten. Er öffnete die Tür und blieb lauschend stehen. Nichts. Nur ein leiser Wind, der ums Haus strich.
»Ich kann nichts hören«, konstatierte er.
»Ich habe aber Schritte gehört«, flüsterte Marissa. »Warte noch.«
Dana war nun auch aufgestanden und hatte sich im Nachthemd zu Marissa gesellt.
Adam lauschte weitere fünf Sekunden. »Da ist niemand«, sagte er schließlich. »Am besten, ihr geht zurück ins Bett und versucht …«
Da hörte er es. Das Haus war groß, zweistöckig, fünf Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder, aber selbst von seinem Standort im ersten Stock am Ende des Flurs konnte er es klar und deutlich hören. Ein Geräusch, das aus der Küche oder dem Esszimmer kam, es klang wie klapperndes Geschirr, oder wie eine Vase, die verschoben wird.
Dana und Marissa hatten es ebenfalls gehört.
»Siehst du?«, sagte Marissa, und Dana rief aus: »Mein Gott, Adam, was sollen wir bloß tun?«
Die beiden Frauen klangen völlig verängstigt.
Adam versuchte, vernünftig zu überlegen, doch nun war er selbst besorgt und durcheinander. Gleich nach dem Aufwachen konnte er sowieso nie klar denken. Er brauchte mindestens drei Tassen Kaffee, bis er in die Gänge kam.
»Ich rufe die Polizei«, entschied Dana.
»Warte.«
»Warum?« Dana hatte den Hörer schon in der Hand.
Adam fiel kein stichhaltiges Argument ein. Da unten war jemand, daran bestand kein Zweifel, aber ein Teil von ihm wollte das nicht wahrhaben; er wollte weiter daran glauben, dass sein Haus ihm Sicherheit und Schutz bot.
»Keine Ahnung.« Er versuchte Ruhe zu bewahren und logisch zu argumentieren. »Da kann niemand sein, das ist unmöglich. Wir haben eine Alarmanlage.«
»Komm schon, Dad, du hast es doch selbst gehört!«
»Vielleicht ist nur etwas umgefallen«, sagte Adam.
»Da ist nichts umgefallen«, insistierte Marissa. »Das waren eindeutig Schritte. Du musst die Polizei rufen.«
Plötzlich drang von unten ein Husten oder Räuspern klar und deutlich an ihre Ohren. Von einem Mann. Das Geräusch klang näher, als dasjenige, das Adam zuvor gehört hatte. Der Eindringling musste sich in ihrem Wohnzimmer befinden.
»Okay, Dana«, flüsterte Adam. »Ruf die Polizei.«
Während Dana das Telefon wieder in die Hand nahm, ging Adam in den begehbaren Kleiderschrank, schaltete das Licht ein und tastete auf dem obersten Regal nach der Glock .45. Dann bückte er sich, räumte ein paar Schachteln aus dem Weg und öffnete schließlich den Schuhkarton, in dem er die Munition aufbewahrte.
»Was suchst du da?«, wollte Marissa wissen.
Adam blieb über die Schachtel gebückt, lud das Magazin und antwortete nicht. Er hatte die Pistole vor etwa vier Jahren gekauft, nachdem in der Nachbarschaft in mehreren Häusern eingebrochen worden war. Hin und wieder ging er zum Schießtraining in den Westside Pistol Range Club. Das Schießen machte ihm Spaß und war ein gutes Mittel, um Stress abzubauen und aufgestauter Wut gefahrlos Luft zu machen.
Mit der Pistole in der Hand trat er ins Zimmer. »Bist du jetzt total durchgeknallt?«, sagte Marissa.
Dana sprach noch immer mit der Notrufzentrale: »Ja, wir glauben, dass er im Haus ist«, flüsterte sie. »Das weiß ich nicht … Bitte kommen Sie schnell … Ja … Bitte beeilen Sie sich.« Dann legte sie auf. »Sie sind unterwegs«, erklärte sie und legte beschützend einen Arm um Marissa. Da fiel ihr Blick auf die Pistole in Adams Hand. »Um Himmels willen, was willst du denn damit?«
Sie hatte sich nie mit dem Gedanken anfreunden können, eine Pistole im Haus zu haben, und hatte Adam oft gebeten, das Ding wieder loszuwerden.
»Nichts«, sagte Adam.
»Und warum hast du sie dann geholt?«
Er antwortete nicht.
»Leg sie wieder zurück. Die Polizei wird jeden Augenblick hier sein.«
»Sei leise!«
»Adam, die Polizei ist unterwegs, es gibt keinen Grund, dass du …«
Sie hielt inne, weil sie wieder ein Geräusch hörten. Kein Zweifel, Schritte auf der Treppe.
»O mein Gott«, stöhnte Marissa, presste die Hand auf den Mund und begann zu weinen.
Adam versuchte sich zu konzentrieren, einen klaren Kopf zu bewahren, aber seine Gedanken liefen wirr durcheinander. »Versteckt euch im Schrank«, befahl er schließlich.
Dana sagte: »Was willst du …?«
»Nichts. Jetzt macht schon, geht, verdammt noch mal.«
»Komm mit uns.«
»Versteckt euch – sofort.«
Dana schien noch immer unentschlossen. Marissa weinte ein wenig lauter.
»Er wird sie noch hören«, drängte Adam seine Frau.
Dana und Marissa verschanzten sich im Schrank. Adam ging zur Tür. Die Pistole hielt er auf Ohrhöhe, den Lauf zur Decke gerichtet. Er lauschte ein paar Sekunden in die Dunkelheit, konnte aber nichts hören und hoffte schon, der Mann hätte es sich anders überlegt und ginge wieder runter. Vielleicht hatte er Marissa weinen hören und machte sich aus dem Staub.
Doch da knarrte wieder die Treppe – dieser Mistkerl kam tatsächlich nach oben. Erst jetzt wurde es Adam so richtig klar: Ein Fremder war in sein Haus eingedrungen.
In das Haus, in dem er aufgewachsen war, das seine Eltern ihm geschenkt hatten, als sie nach Florida gezogen waren. Marissa war damals noch ein Baby gewesen. Er hatte Forest Hills Gardens geliebt als Kind, all seine Freunde wohnten in der Nähe, und die meisten Häuser besaßen nach hinten raus herrlich große Gärten. Verglichen mit früher war die Gegend wesentlich sicherer geworden. Als er zehn Jahre alt war, hatte ihm ein älterer Junge das Fahrrad gestohlen – hatte ihn mit einem Messer bedroht und gesagt: »Her damit.« Als Teenager war er gleich zwei Mal auf dem Queens Boulevard überfallen und ausgeraubt worden, und später, als er mit Mitte zwanzig in Manhattan an der New School seinen Doktor machte, hatte man ihn im Village in der Lobby des Apartmenthauses eines Freundes mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt.
Adam blieb stehen, die Pistole schussbereit in der Hand. Er konnte hören, wie der Einbrecher eine weitere Stufe nach oben kam, und musste daran denken, wie hilflos er sich als Opfer von Überfällen jedes Mal gefühlt hatte. Nie wieder wollte er ein Opfer sein. Seine Gedanken rasten, aber er bemühte sich um einen klaren Kopf. ›Was ist, wenn der Kerl eine Waffe hat? Wenn er verrückt ist? Und wenn er einfach die Treppe hochgerannt kommt und wild um sich ballert? Was, wenn er mich erschießt?‹
Adam sah sich bereits mit einer Kugel in der Brust tot im Flur liegen, stellte sich vor, wie der Kerl Dana und Marissa im Schlafzimmer entdeckte. Der Typ konnte ein durchgeknallter Frauenschänder sein. So was kam immer wieder in den Nachrichten, dass ein Mann in ein Haus oder eine Wohnung einbrach und Frauen vergewaltigte. Doch Adam hätte nie gedacht, dass so etwas in seinem eigenen Haus geschehen könnte.
Aber vielleicht geschah es jetzt gleich.
Der Mann war bereits auf der Treppe, kam immer näher. In wenigen Sekunden konnte er oben sein, dann war es zu spät.
All das schoss ihm blitzartig durch den Kopf, ihm blieb keine Zeit zum Nachdenken. Wenn er mehr Zeit gehabt hätte, wenn er ruhiger und weniger durcheinander gewesen wäre, dann wäre ihm vielleicht klargeworden, dass die Polizei jeden Augenblick eintreffen musste. Für Forest Hills Gardens war eine private Sicherheitsfirma zuständig, die garantierte, bei einem Notruf in maximal fünf Minuten vor Ort zu sein. Wenn er sich mit Dana und Marissa im Schlafzimmer verschanzt hätte, wäre es dem Einbrecher wohl kaum gelungen, in dieser kurzen Zeit an sie heranzukommen. Vielleicht hätte er versucht, die verschlossene Tür aufzubrechen, aber mit der Polizei im Anmarsch hätte er bestimmt bald aufgeben müssen.
Aber so weit dachte Adam nicht. Seine Gedanken kreisten einzig und allein darum, dass er seine Familie beschützen musste, dass er nicht wieder Opfer sein wollte, dass so ein Mistkerl einfach in sein Haus eingebrochen war, in das Haus, in dem er aufgewachsen war, das Haus, das sein Vater 1956 gekauft hatte.
Er hörte den Mann eine Stufe höher kommen, dann noch eine … Bildete sich Adam das nur ein, oder wurde der Kerl jetzt schneller? Das Treppenhaus lag im Dunkeln, es gab nur ein Nachtlicht im Gang, eine kleine, orangefarbene Leuchte in Kerzenform, an einer Steckdose über der Fußleiste. Adams Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, aber er konnte noch immer wenig erkennen. Der Typ musste jeden Moment auftauchen. Wenn er noch eine oder zwei Stufen hochkam, würde Adam seinen Kopf sehen können. Vielleicht würde sich der Kerl auf ihn stürzen, ihn angreifen.
Im einen Augenblick stand Adam an der Tür zum Schlafzimmer, im nächsten rannte er mit gezückter Pistole in den Flur und schrie: »Hau ab! Mach, dass du hier wegkommst!«
Im Treppenhaus war es dunkler als vor dem Schlafzimmer. Adam sah, dass der Kerl doch noch nicht so weit oben stand, wie er angenommen hatte. Er befand sich erst auf halber Höhe der Treppe, und Adam konnte nur erkennen, dass es ein großer, kräftiger Mann sein musste.
Dann sah er, wie der Mann nach etwas griff. Es war eine plötzliche Bewegung, und Adam wusste sofort, dass er eine Knarre rausholen wollte. Er glaubte sogar, dunkel schimmerndes Metall in der Hand des Einbrechers aufblitzen zu sehen. Wenn er noch länger zögerte, würde der Mann ihn über den Haufen schießen. Er würde sich den Weg ins Schlafzimmer freischießen, Dana und Marissa finden und auch die beiden Frauen töten.
Der Mann sagte etwas. Später, als Adam darüber nachdachte, begriff er, dass er etwas wie »Bitte, nicht …« gehört hatte. Aber in jenem Augenblick ging alles rasend schnell, Adam hatte gar nicht mitbekommen, dass der Eindringling gesprochen hatte. Er konnte an nichts anderes denken als an die Gefahr, in der er und seine Familie schwebten, und schoss. Er wusste nicht, ob er den Kerl bereits mit der ersten Kugel erwischt hatte, aber die zweite traf in den Hals oder in den Kopf. Der Mann wurde nach hinten geworfen, taumelte. Adam fiel die Anweisung seines Trainers im Schießklub wieder ein: Immer auf die Brust zielen, nicht auf den Kopf – und so schoss er das Magazin leer, zielte auf Brustund Bauchraum. Der Kerl stürzte in die Dunkelheit, verschwand aus seinem Sichtfeld. Adam hörte seinen Körper mit einem dumpfen Schlag am Fuß der Treppe aufprallen.
Totenstille, dann ein Geräusch. Es kam von unten, aber nicht von dem Einbrecher, auf den Adam geschossen hatte.
Da war noch jemand im Haus.
Adam hörte Schritte, dann ein lautes Keuchen. Er hatte keine Munition mehr. Wenn der Typ nach oben kam oder zu schießen begann, war er verloren.
»Raus hier, sofort, oder ich schieße!«, schrie Adam.
Ganz schön clever, fast schon genial. Der Fremde würde glauben, dass er noch Munition hatte. Wieso auch nicht? Adam hatte so schnell geschossen, dass er unmöglich mitgezählt haben konnte. Und selbst wenn er mitgezählt hatte und wusste, dass es zehn Schuss gewesen waren, woher sollte er wissen, dass Adam keine Ersatzmunition hatte?
Sein Plan funktionierte, oder vielleicht war der Fremde auch einfach nur in Panik geraten. Auf jeden Fall hörte Adam, wie er losrannte, irgendwas dabei umwarf, wahrscheinlich den kleinen Beistelltisch, dann flog die Haustür auf und fiel wieder ins Schloss. Der Typ hatte sich verpisst.
»Adam?«
Mit einem Ruck fuhr Adam herum. Dana und Marissa waren aus dem Schlafzimmer gekommen.
»Ist dir was passiert?«, fragte Dana.
»Zurück ins Schlafzimmer!«, bellte Adam.
»Ist dir was passiert?«, wiederholte Dana.
»Rein mit euch!«
Die beiden Frauen kehrten ins Schlafzimmer zurück, Dana schloss die Tür hinter sich. Adam machte sich Sorgen wegen des Kerls unten an der Treppe. Und wenn er noch lebte?
Er streckte die Hand aus und legte den Daumen auf den Lichtschalter an der Flurwand gegenüber, zögerte dann aber. Vielleicht war das ja doch keine so gute Idee. Vielleicht zielte der Kerl mit seiner Waffe bereits auf ihn und wartete nur darauf, ihn richtig ins Visier zu bekommen.
Adam schaltete das Licht ein. Erleichtert stellte er fest, dass der Kerl, der eine schwarze Skimaske übers Gesicht gezogen hatte, noch immer zusammengerollt am Fuß der Treppe lag und sich nicht rührte. Adam ging langsam die Stufen hinunter, ließ den Mann nicht aus den Augen.
Aus der Nähe sah er, dass der Mann etwas dunklere Haut hatte, ein Latino, vielleicht ein Puerto-Ricaner. Brust und Gesicht waren ein blutiger Wust, und wo das linke Auge gewesen war, klaffte nun ein großes Loch, aus dem Blut und eine graue Masse quollen. Von seinem Unterkiefer fehlte ein ziemliches Stück.
Adam starrte die Leiche eine Weile an, versuchte zu begreifen, was er getan hatte.
Er hatte auf einen Menschen geschossen, geschossen und ihn getötet. Einen Menschen.
Dann wanderte sein Blick zur rechten Hand des Toten. Zwei Stufen oberhalb des Kopfes lag eine Taschenlampe. Adam konnte keine Waffe entdecken, weder auf der Treppe noch auf dem Boden. Vielleicht war der Kerl ja draufgefallen und verdeckte sie.
Wie betäubt blieb Adam vor dem Mann stehen, den er getötet hatte, bis schließlich die Polizei gegen die Tür hämmerte.
2
Obwohl es schon auf vier Uhr zuging und seit der Schießerei zwei Stunden vergangen waren, wimmelte es im Haus der Blooms von Polizisten. Dana und Marissa hatten sich mit Sharon und Jennifer ins Wohnzimmer zurückgezogen, zwei Freundinnen von Dana, die herbeigeeilt waren, um ihnen in dem Chaos beizustehen. Adam saß am Esszimmertisch Detective Clements gegenüber. Clements war ein wettergegerbter, grauhaariger Mann, der nach Zigaretten stank. »Sie haben Sanchez also auf der Treppe gesehen«, wiederholte er.
Die Polizei hatte in der Brieftasche des Toten einen Führerschein und weitere Ausweispapiere gefunden. Beim Opfer handelte es sich um den sechsunddreißigjährigen Carlos Sanchez aus Bayside, Queens. Sie hatten Sanchez bereits überprüft: ein Krimineller mit einem langen Strafregister, vor sechs Monaten erst aus Fishkill entlassen, wo er eine Strafe wegen mehrfachen Drogenhandels abgesessen hatte. Adam hatte schon genau berichtet, was sich vor den Schüssen abgespielt hatte, aber Clements wollte immer noch mehr Einzelheiten hören.
»Nun ja, ich habe ihn nicht richtig erkennen können«, sagte Adam, »was ich gesehen habe, war eine Gestalt, ein Schatten, Sie wissen schon.«
Adam war erschöpft und konnte sich nicht mehr konzentrieren. Die Nacht kam ihm so surreal vor – erst der Alptraum von der Riesenratte, dann sein Erwachen, die Schüsse und jetzt auch noch dieser Detective, der da vor ihm saß. Es würde eine Weile dauern, bis er verarbeiten könnte, was er getan hatte. Aber im Moment peinigten ihn grässliche Kopfschmerzen, und die drei Advils, die er genommen hatte, zeigten keinerlei Wirkung.
»Aber Sie wussten, dass es ein Mann ist«, stellte Clements fest.
»Ja, ich hatte Geräusche von unten gehört, und er hat gehustet oder sich geräuspert oder so. Es bestand kein Zweifel, dass es sich um einen Mann handelt. Meine Frau und meine Tochter haben es ebenfalls gehört.«
»Und dann haben Sie ihn erschossen.«
»Nein, nicht sofort. Das heißt …« Er musste nachdenken. Einen Moment lang konnte Adam sich tatsächlich nicht mehr an die genaue Abfolge der Ereignisse erinnern. Es war alles verschwommen, durcheinander. »Ich habe ihn nicht einfach so erschossen«, sagte er dann mit fester Stimme. »Ich habe eine Bewegung gesehen, so als greife er nach einer Waffe.«
»Haben Sie die Waffe gesehen?«
»Ich habe geglaubt, eine zu sehen, ja.« Adam fühlte sich unbehaglich, es kam ihm vor, als wolle Clements ihn einer Lüge überführen. »Ich konnte seinen Arm erkennen. Er kam die Treppe hoch, und ich hatte Angst, dass er auf mich schießen würde. Was sollte ich tun? Da war ein Einbrecher in meinem Haus, der die Treppe hochkam. Meine Frau und meine Tochter hatten sich im Schlafzimmer versteckt. Ich hatte keine Wahl.«
»Haben Sie ihn gewarnt?«
»Wie bitte?«
Adam hatte die Frage sehr wohl verstanden, wusste aber nicht, wie er darauf antworten sollte. Und langsam aber sicher ging ihm dieses Gespräch auf die Nerven.
»Haben Sie ihm gesagt, dass Sie eine Waffe haben und dass er seine fallen lassen soll?«, fragte Clements.
»Nein, aber ich habe ihm gesagt, dass er abhauen soll, dass er aus meinem Haus verschwinden soll oder so was Ähnliches.«
»Und was hat er gesagt?«
Adam erinnerte sich, dass der Typ etwas hatte sagen wollen, vielleicht so etwas wie: »Bitte, nicht …«, aber Clements hatte er nichts davon erzählt. Was für einen Sinn hätte das gehabt? Es machte keinen Unterschied.
»Ich glaube nicht, dass er irgendwas gesagt hat. Aber das ist alles wahnsinnig schnell gegangen. Ich dachte, er würde gleich auf mich schießen, in meinem Haus! Was wollen Sie eigentlich? Ich habe doch wohl das Recht, mich zu verteidigen, oder etwa nicht?«
»Ja, natürlich«, bestätigte Clements.
»Und warum habe ich dann den Eindruck, dass Sie mich verhören?«
»Das ist kein Verhör, ich befrage Sie nur.«
»Was ist da der Unterschied?«
Clements’ Mundwinkel hoben sich, es sah beinahe aus wie ein Lächeln. »Hören Sie, ich glaube nicht, dass Sie sich rechtlich gesehen Sorgen machen müssen, Dr. Bloom. Sie waren in einer Extremsituation und haben gehandelt, wie Sie handeln mussten. Jemand ist in Ihr Haus eingedrungen. Ja, das gibt Ihnen das Recht, sich zu verteidigen. Sofern mit Ihrem Waffenschein alles in Ordnung ist, werden Sie deswegen wohl keine Probleme bekommen. Aber eines muss ich sagen: ein Glück, dass Sie kein Polizist sind.« Er blätterte eine Seite in seinem Block um. »Was ist mit dem anderen Einbrecher?«
»Was soll mit dem sein?«
»Ja, das ist mir vorhin schon aufgefallen: Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass es ein Mann war?«
Adam dachte darüber nach, es fiel ihm noch immer schwer, sich zu konzentrieren. »Ich glaube, dafür gibt es keinen besonderen Grund. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es zwei Männer waren.«
»Aber als Sie geschossen haben, hatten Sie keine Ahnung, dass da noch ein zweiter Einbrecher war, richtig?«
»Richtig.«
»Deshalb haben Sie auch das ganze Magazin verballert. Sie haben nicht daran gedacht, Munition für einen möglichen zweiten Einbrecher aufzusparen.«
Clements hatte ihn schon mehrmals gefragt, warum er gleich zehn Mal geschossen hatte, und Adam hatte ihm erklärt, dass er nicht gewusst hatte, ob er tatsächlich getroffen hatte, dass er sich nur schützen wollte. Es gefiel ihm gar nicht, dass Clements jetzt schon wieder darauf zurückkam, als wolle er ihm etwas unterstellen.
»Ich wollte doch nur sichergehen, dass ich ihn …«, ›umgebracht habe‹, wollte Adam sagen, konnte das aber noch umformulieren in »ihn traf, bevor er mich erwischte.«
Kopfschüttelnd betrachtete Clements seine Notizen. »Ein Glück, dass Sie kein Polizist sind, Doktor. Wirklich ein Glück.«
Adam hatte die Nase voll. »Können wir das nicht auf später verschieben? Oder auf morgen früh? Ich bin total fertig, habe fürchterliche Kopfschmerzen, und Sie werden verstehen, dass das alles ein bisschen viel war heute Nacht.«
»Das ist mir bewusst, aber da gibt es ein paar Punkte, die ich gerne noch klären würde.«
Adam holte tief Luft. »Und welche Punkte wären das bitte?«
»Nun, zum Beispiel wie die Einbrecher ins Haus gekommen sind.«
Auch das hatten sie bereits diskutiert, und zwar mehr als ein Mal. Die Polizei hatte keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens feststellen können. Aber beide Türen, die Hintertür in der Küche und die Haustür, waren nicht abgeschlossen und die Alarmanlage war deaktiviert gewesen. Adam hatte Clements versichert, dass er die Anlage scharf gestellt hatte, bevor er zu Bett gegangen war, so wie er das jeden Abend tat.
»Haben wir das nicht schon alles durchgekaut?«
Clements tat, als hätte er Adam nicht gehört. »Sind Sie wirklich sicher, dass Sie die Haustür verschlossen und die Kette vorgehängt haben, bevor Sie ins Bett gegangen sind?«
»Ja«, sagte Adam.
»Sind Sie oder Ihre Frau oder Ihre Tochter später vielleicht noch einmal nach draußen, um den Müll rauszubringen oder so, und haben dann vergessen …?«
»Nein, ich bin gestern als Letzter ins Bett, und ich habe die Kette vorgehängt. Ich schließe immer ab und hänge die Kette vor, wenn ich als Letzter ins Bett gehe, das ist Routine. Ich kontrolliere, ob das Gas in der Küche abgedreht ist, schließe alle Türen ab, stelle die Alarmanlage scharf und gehe dann zu Bett.«
»Wenn das stimmt, dann muss der andere Einbrecher die Kette an der Haustür geöffnet haben, als er vorne raus flüchtete.«
»Das muss wohl so gewesen sein«, stimmte Adam zu. »Ich habe definitiv die Haustür zuschlagen hören.«
»Dann sind die Einbrecher also zur Hintertür hereingekommen.«
»Ja.« Adam massierte sich den verspannten Nacken.
»Sind Sie hundertprozentig sicher, dass Sie die Alarmanlage scharf gestellt haben und dass sie danach niemand mehr abgeschaltet hat?«
»Ich bin mir sicher.«
»Aber die Alarmanlage war nicht scharf, als wir eingetroffen sind, richtig?«
»Wenn die Alarmanlage scharf gewesen wäre, dann hätte der Kerl«… Adam korrigierte sich …»ich meine die Person sie auf ihrer Flucht hinaus auch ausgelöst.«
»Das hört sich vernünftig an«, sagte Clements. »Wer also –«
»Ich habe keine Ahnung«, fiel Adam dem Detective ins Wort.
Clements funkelte Adam irritiert an. »Wer also kennt den Sicherheitscode – außer Ihnen und Ihrer Familie natürlich?«, fuhr er dann mit erhobener Stimme fort.
»Niemand.«
»Haben Sie den Code jemals weitergegeben?«
»Nein.«
»Haben Sie Ihre Frau und Ihre Tochter auch schon danach gefragt?«
»Sie haben den beiden diese Frage doch bereits gestellt, und sie haben nein gesagt, oder täusche ich mich?«
»Schon, aber jetzt frage ich Sie.«
»Was fragen Sie mich? Ob meine Frau oder meine Tochter gelogen haben?«
»Oder vielleicht nicht ganz ehrlich waren.«
»Wo ist da der Unterschied?«
Clements grinste süffisant, als genieße er den Schlagabtausch, aber Adam zuckte nicht mit der Wimper.
»Sie haben den Code nicht weitergegeben«, bekräftigte er. »Niemand von uns hat den Code weitergegeben.«
»Tut mir leid, dass ich den Advocatus Diaboli spiele, Dr. Bloom, aber wenn es sich bei dem flüchtigen Einbrecher nicht um Houdini höchstpersönlich handelt, dann muss er irgendwie an den Sicherheitscode gekommen sein.«
»Vielleicht hat ihn jemand gestohlen«, mutmaßte Adam. »Von der Sicherheitsfirma. Vielleicht hat sich jemand in deren Computer gehackt oder so.«
»Wir werden dieser Möglichkeit nachgehen«, sagte Clements. »Aber wir wissen bereits, dass der Sicherheitsfirma keine Schlüssel abhanden gekommen sind. Haben Sie oder ein anderes Mitglied der Familie vielleicht jemandem die Hausschlüssel gegeben?«
»Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass jeder von uns nur einen Satz Schlüssel besitzt, dazu gibt es noch einen Satz Ersatzschlüssel, und der ist nach wie vor an seinem angestammten Platz.«
»Vielleicht hatte ja jemand anders Zugang zu den Schlüsseln. Hatten Sie in letzter Zeit Handwerker im Haus?«
Adam dachte nach. »Wir hatten vor ein paar Wochen die Maler hier, aber die Leute haben ganz bestimmt nichts damit zu tun.«
»Ihre Frau hat uns bereits die Namen der Maler, des Elektrikers, Ihrer Haushaltshilfe und Ihres Gärtners gegeben. Gibt es sonst noch jemanden, den wir Ihrer Meinung nach überprüfen sollten?«
»Nein.«
»Ich habe gesehen, dass die Schlüssel für die Hintertür leicht nachzumachen sind«, fuhr Clements fort. »Will sagen, dort haben Sie keine Sicherheitsschlösser, richtig?«
»Ja. Und?« Adams Lider wurden schwer, er konnte die Augen kaum noch offen halten.
»Also ist es nicht unmöglich, dass sich jemand Nachschlüssel besorgt hat, oder?«
»Schon«, räumte Adam ein. »Aber niemand weiß, wo wir die Ersatzschlüssel aufbewahren.«
Clements blätterte eine Seite seines Blocks um. »Ihre Frau hat mir erzählt, dass Sie vorhatten, für ein paar Tage nach Florida zu fliegen, ist das richtig?«
»Ja, wir wollten meine Mutter besuchen.«
»Aber wegen einer Sturmwarnung haben Sie die Reise kurzfristig abgesagt?«
»Ja, das stimmt. Wir haben gehört, dass ein heftiger Sturm vor der Küste tobt. Es hieß, dass er sich möglicherweise zu einem Hurrikan auswächst und auf Florida zusteuert. Deshalb haben wir unseren Besuch lieber auf ein andermal verschoben.«
»Wann genau haben Sie sich entschieden, nicht zu fliegen?«
Nachdenklich massierte Adam wieder seinen Nacken. »Das war vor zwei Tagen.«
»Wer hat von der Änderung Ihrer Pläne gewusst?«
»Niemand. Das heißt, ich musste natürlich ein paar Patienten informieren, neue Termine vereinbaren und so. Und ich schätze mal, dass Dana und Marissa es auch ein paar Leuten erzählt haben, aber wir haben die Neuigkeit nicht in die Zeitung gesetzt.«
Clements grinste nicht einmal. »Haben Sie Patienten, die zu Gewalttätigkeit neigen?«
Adam musste sofort an Vincent denken, einen Patienten, der ihn seit einem Monat regelmäßig aufsuchte und der ihm erzählt hatte, dass er vor ein paar Wochen bei einer Kneipenschlägerei jemanden zusammengeschlagen hatte. Dann war da noch Delano, um die vierzig, der als Kind seinen Bruder mit einem Messer schwer verletzt hatte.
»Ja, da gibt es schon ein paar.«
»Haben Sie in letzter Zeit Drohungen erhalten?«
»Nein. So etwas kommt höchst selten vor. Ich bin Psychologe, kein Psychiater. Wenn ich bei einem Patienten Anzeichen für diese Art von Labilität feststelle, schicke ich ihn zu einem Spezialisten.«
»Dann können Sie also auf Anhieb diagnostizieren, ob jemand labil ist?«
Adam hatte keine Ahnung, was diese Frage sollte, ob Clements damit etwas Bestimmtes bezweckte oder einfach nur den Klugscheißer herauskehren wollte.
»Ja, ich denke schon«, sagte Adam.
»Dann sollten Sie vielleicht den Job wechseln«, schlug Clements vor. »Vielleicht sollten Sie es mal mit meinem probieren.« Der Detective grinste selbstgefällig. »Übernachten manchmal Freunde Ihrer Tochter hier?«
»Natürlich. Sie wohnt hier.«
»Werden hier im Haus Drogen konsumiert?«
»Wie bitte?«
Adam ahnte, worauf Clements hinauswollte, und es gefiel ihm ganz und gar nicht.
»Sanchez hatte mehrere Vorstrafen wegen Drogendelikten. Vielleicht war er ja ein Bekannter Ihrer Tochter oder sogar ihr Dealer?«
»Sie kannte den Kerl nicht, nie im Leben.«
»Dann hat sie vielleicht einen Freund oder den Freund eines Freundes oder sonst irgendjemanden einmal mit nach Hause genommen, jemanden, der sich deshalb hier auskannte, der vielleicht –«
»Meine Tochter hat mit dieser Sache nichts zu tun.«
»Dr. Bloom, ich versuche doch nur –«
»Und ihre Freunde stehlen keine Schlüssel und brechen nicht in Häuser ein. Es sind ganz normale, nette junge Leute, genau wie sie.«
»Dr. Bloom, in ihrem Zimmer steht eine Bong.«
Wieder beschlich Adam das Gefühl, dass dieses Gespräch mehr als nur eine Routinebefragung war.
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich versuche nur herauszufinden, wie die beiden Einbrecher ins Haus gelangt sind.«
»Ach, tatsächlich? Für mich hört sich das eher so an, als wollten Sie uns was ganz anderes unterstellen. Meine Tochter hat mit dieser Sache nicht das Geringste zu tun, also lassen Sie sie bitte aus dem Spiel.«
Clements schien nicht überzeugt, lenkte aber ein: »Und was ist mit Ihren Verwandten?«
»Was soll mit denen sein?«
»Irgendwelche Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Feindschaften?«
Adam musste an Dana und ihren Bruder Mark denken, der manisch-depressiv war. Sie verstanden sich nicht besonders und hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr. Aber Mark lebte in Milwaukee und hatte mit dem Einbruch bestimmt nichts zu tun, also beschloss Adam, ihn nicht zu erwähnen.
»Nein«, sagte er. »Das hier hat ganz sicher nichts mit meiner Familie zu tun, absolut nichts, null, nada, niente.«
Clements klappte – endlich – seinen Block zu. »Das sollte fürs Erste reichen. Aber ich möchte, dass Sie weiter darüber nachdenken, wer sich die Schlüssel und den Code für die Alarmanlage besorgt haben könnte. Im Moment sieht das hier verdammt nach einem Insider-Job aus. Die Person, die Personen hatten nicht nur Zugang zum Haus, sie schienen sich auch recht gut auszukennen. Sie wussten, dass sie durch die Hintertür konnten, weil es dort keine Kette gibt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass zumindest einer von denen schon einmal im Haus war. Vielleicht ein Handwerker oder ein Lieferant, der einen Teppich gebracht hat oder so. Falls Ihnen also jemand einfällt, der möglicherweise Zugang zu beidem hatte, zu den Schlüsseln und dem Code, lassen Sie es mich bitte sofort wissen.«
»Alles klar, kein Problem«, sagte Adam und stand auf.
»Jetzt muss ich noch mal mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter sprechen.«
»Das ist doch nicht Ihr Ernst?«
»Es wird nicht lange dauern, aber ich muss mit den beiden sprechen.«
»Warum hat das nicht Zeit bis –?«
»Weil es nicht warten kann, darum.« Clements’ Ton verbot jede weitere Diskussion.
Adam begleitete den Detective ins Wohnzimmer, wo Dana und Marissa auf der Couch saßen. Sharon und Jennifer hatten es sich ihnen gegenüber bequem gemacht.
Adam fühlte sich ausgesprochen unbehaglich in Sharons Gesellschaft, ganz besonders aber, wenn Dana sich im selben Raum befand.
Vor etwa fünf Jahren, als Adam und Dana eine schwere Ehekrise durchmachten, kriselte es bei Sharon und Mike ebenfalls. Sharon hatte Adam in der Praxis angerufen und gefragt, ob sie sich bei ihm Rat holen könne. Adam hatte eingewilligt und mit ihr einen Termin um sieben Uhr vereinbart, sein letzter Termin an diesem Tag. Alle anderen Kollegen hatten die Praxis bereits verlassen. Bei dieser informellen Eheberatung deutete Adam an, dass es auch in seiner Ehe nicht allzu gut lief. Er wusste genau, was er da tat – ihr seine Verletzlichkeit zeigen, um ihr auf diese Weise sein Interesse zu signalisieren. Er wusste, dass sie ihn attraktiv fand, denn sie flirtete schon seit Jahren mit ihm. Eine Weile lang bemitleideten sie sich gegenseitig, dann gestand Sharon, dass sie sich in ihrer Phantasie oft ausgemalt hatte, wie ›es‹ zwischen ihnen passierte. Adam, der praktisch jeden Tag Patienten mit Liebesaffären beriet, war sich des Risikos nur allzu bewusst. Es wäre ein Riesenfehler, mit Sharon etwas anzufangen. Das konnte zu einem tiefen Riss in der Beziehung zu seiner Frau führen, einem Riss, der möglicherweise nie mehr gekittet werden konnte. Aber zu wissen, was richtig und falsch war, und das Richtige zu tun, waren zwei völlig verschiedene Dinge. Er war auch nur ein Mensch, so wie alle anderen. Dass eine andere Frau so großes Interesse an ihm zeigte, schmeichelte ihm, und er konnte ihr einfach nicht widerstehen.
Sie hatten nur einmal Sex, auf der Therapiecouch. In ethischer Hinsicht hatte er keine Bedenken, schließlich war Sharon keine richtige Patientin. Dennoch wollte er sich nicht auf eine ausgewachsene Affäre mit ihr einlassen, schon gar nicht, wenn er an all die Tränen und den ganzen Ärger dachte, die unweigerlich folgen würden. Deshalb erklärte er ihr – und Sharon pflichtete ihm bei –, dass dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen sei und sie beide mit ihrem Leben weitermachen müssten wie bisher. Sharon vertrug sich schließlich wieder mit ihrem Mann. Dana und Adam gingen zur Paartherapie, und es gelang ihnen, ihre Beziehung in vielerlei Hinsicht zu verbessern. Dennoch fand Adam, dass es noch immer ernstzunehmende Probleme zwischen ihnen gab, eines davon war fehlende Nähe. Er spielte mit dem Gedanken, Dana diesen Fehltritt zu gestehen. Normalerweise riet er seinen Patienten, Seitensprünge zu beichten, denn er glaubte fest daran, dass dies der einzige Weg war, Wunden zu heilen und Nähe und Vertrauen in der Beziehung wiederherzustellen. Da er in seinem Fall aber keinerlei emotionale Bindung zu Sharon aufgebaut hatte, würde ein Geständnis Dana nur verletzen und somit mehr schaden als nützen. Also konzentrierte er sich darauf, die Gründe für diesen Seitensprung zu verstehen, und entwickelte Strategien, um ein besserer Ehemann zu werden. Er bereute, was er getan hatte, aber er wollte dafür weder Dana noch sich selbst die Schuld geben. In jeder Ehe gab es Höhen und Tiefen, und sein kleiner Fehltritt war nun wirklich nichts Atypisches. Er hatte unter den gegebenen Umständen sein Bestes getan, und wenn er noch einmal in eine solche Situation geriete, würde er sich bemühen, eine bessere Entscheidung zu treffen.
Am liebsten hätte er jeglichen Kontakt zu Sharon abgebrochen, aber das war natürlich unmöglich. Abgesehen davon, dass man sich immer mal wieder in der Nachbarschaft oder auf Partys traf, waren Dana und Sharon Freundinnen, ebenso wie Marissa und Hillary, Sharons Tochter. Adam und Mike kamen ebenfalls recht gut miteinander aus und spielten gelegentlich zusammen Golf in Adams Club. Sharon und Adam hatten inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis, doch obwohl sie es vermieden, den Seitensprung zu thematisieren, gab es da immer noch diese schwelende Anziehung zwischen ihnen, die wohl nie nachlassen würde.
Detective Clements bat Marissa, mit ihm ins Esszimmer zu gehen.
»Schon wieder?«, fragte Marissa. Sie sah todmüde aus.
»Ist schon okay«, beschwichtigte Adam sie und starrte Clements böse an. »Es dauert nicht lange.«
»Ihr beide solltet jetzt nach Hause gehen, es ist spät geworden«, sagte Dana zu Sharon und Jennifer, kaum dass Marissa und Clements den Raum verlassen hatten.
»Bist du sicher?«, fragte Sharon. »Wenn du willst, dass wir noch bleiben, dann …«
»Nein, nein, danke, wirklich nicht. Wir sehen uns morgen.«
»Ich habe eine Idee«, meinte Jennifer. »Wir kommen gleich morgen früh rüber und bringen Bagels und Kaffee mit.«
»Das ist wirklich nicht nötig«, sagte Dana.
»Aber das machen wir doch gerne«, insistierte Sharon.
Sharon und Jennifer umarmten Dana und Adam zum Abschied. Adam versuchte den vertrauten Duft von Sharons Parfum zu ignorieren, und die Erektion, die er prompt bei ihm auslöste. »Es ist wirklich nett, dass du rübergekommen bist«, sagte er zu ihr.
Das fand er tatsächlich. Dass sie mitten in der Nacht zu ihnen gekommen war, um ihnen beizustehen, zeugte wirklich von Feingefühl. Das hätte sie nicht tun müssen.
»Aber das ist doch selbstverständlich«, antwortete Sharon. »Dafür sind Freunde doch da.«
Sharon und Jennifer waren gegangen, und Dana und Adam blieben allein im Wohnzimmer zurück. »Warum will er denn noch einmal mit Marissa sprechen?«, erkundigte sich Dana.
Adam wollte ihr nicht sagen, dass Clements die Bong in Marissas Zimmer gesehen hatte, weil sie sich nur wieder aufregen würde. Er würde es ihr morgen sagen.
»Ich schätze, er muss noch ein paar Routinefragen klären. Er weiß, wie müde wir sind, und wird sich kurz fassen.«
Adam wusste, dass Dana wusste, dass er ihr etwas verschwieg; Frauen hatten eine Antenne für so etwas, meistens jedenfalls. Aber diesmal ließ Dana es ihm durchgehen.
»Wie geht es dir?«, erkundigte sie sich stattdessen.
»Ganz okay, wenn man die Umstände bedenkt.«
»Vielleicht solltest du mit jemandem reden.«
Detective Clements hatte Adam bereits gefragt, ob er mit einem Psychologen sprechen wolle. Adam fand es ziemlich seltsam, einen Psychologen zu fragen, ob er einen Psychologen brauche.
»Ich werde Carol um einen Termin bitten«, erklärte Adam.
Carol Levinson war eine Kollegin in Adams Praxisgemeinschaft. Sie war zwar nicht wirklich seine Therapeutin, aber immer wenn er sich danach fühlte, buchte er eine Sitzung bei ihr.
»Mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Aber was ist mit dir?«
»Ich fühle mich ganz okay, glaube ich.«
Bestimmt war die Pistole der Grund für diesen kalten, distanzierten Unterton in Danas Stimme. Sie war schon immer dagegen gewesen, sie im Haus zu haben, und hatte ihn mehrmals gebeten, sie wegzuschaffen. Er hatte versucht, ihr klarzumachen, dass er diese Pistole brauchte, dass er sich ohne sie verwundbar und verletzlich fühlte, und schließlich hatte sie eingewilligt, dass er die Pistole behielt, sofern er sie versteckte. Jetzt aber erkannte er, dass sie die Pistole nie wirklich gebilligt hatte, dass sie ihm insgeheim vorwarf, einen Menschen erschossen zu haben. Natürlich würde sie keinen Ton sagen, nicht jetzt gleich jedenfalls, das war nicht ihr Stil. In Situationen wie dieser vermied sie die Konfrontation, entwickelte Ausweichstrategien, legte passiv-aggressives Verhalten an den Tag. Sie würde die Suppe am Köcheln halten, um die Dramatik zu steigern, und das Thema erst ein paar Tage später aufs Tapet bringen.
»Ich würde dich ja gerne ins Bett schicken«, sagte Adam, »aber ich fürchte, Clements will auch mit dir noch einmal sprechen.«
»Ich wünschte, die Polizei würde endlich verschwinden.«
»Das wär mir auch am liebsten, aber es kann jetzt wirklich nicht mehr lange dauern.«
»Ist die Leiche noch im Haus?«
»Keine Ahnung, ich hab nicht nachgesehen.«
»Stehen die Reporter noch vor der Tür?«
»Wahrscheinlich ja.«
»Ich will nicht in die Zeitung kommen«, sagte sie. »Ich will nicht meinen Namen, deinen Namen und auch ganz bestimmt nicht Marissas Namen in der Zeitung lesen.«
»Das wird sich nicht vermeiden lassen.«
»Mein Gott, glaubst du, sie bringen es auf der Titelseite?«
Adam glaubte sehr wohl, dass die Nachricht es auf die Titelseiten sämtlicher größerer Zeitungen schaffen würde; eine Schießerei in einer der wohlhabenden Gegenden New Yorks wäre bestimmt eine Schlagzeile wert, aber er wollte sie beruhigen. »Das bezweifle ich.«
»Bestimmt bringen sie es auch im Fernsehen«, sorgte sich Dana weiter. »Ich habe die vielen Kameras da draußen gesehen. Ganz bestimmt bringen sie es auf New York I und auch in allen Lokalnachrichten.«
»Da bin ich mir nicht so sicher, wer weiß, bis morgen gibt es vielleicht eine neue, sensationellere Nachricht, und die Sache gerät in Vergessenheit.«
Er wusste, dass Dana ihm kein Wort glaubte. Aber wenigstens hatte er es versucht.
»Was ist mit dem anderen Kerl? Hat der Detective was gesagt? Werden sie ihn kriegen?«
»Den werden sie bald schnappen, ganz bestimmt, wahrscheinlich noch heute Nacht«, behauptete Adam. Da er sah, wie durcheinander sie noch immer war, nahm er sie fest in die Arme und küsste sie. »Das Ganze tut mir schrecklich leid, wirklich.« Er hielt sie noch ein Weilchen, wohl wissend, dass ihr eine Bemerkung zu der Pistole auf den Lippen lag und sie sich schwer zusammennahm, um nicht auf der Stelle einen Streit vom Zaun zu brechen.
Er entließ sie sanft aus seinen Armen, und Dana sagte: »Ich wünschte, die ganze Sache würde sich in Luft auflösen. Ich wünschte, ich könnte jetzt schlafen gehen und morgen, wenn ich aufwache, wäre all das hier nicht passiert.«
Kurz darauf kehrte Marissa von dem Gespräch mit dem Detective zurück, und Dana musste nun mit ihm ins Esszimmer, um weitere Fragen zu beantworten. Marissa wirkte verstört, und Adam fühlte sich vollkommen hilflos. Erst vor ein paar Stunden hatte sie Daddy zu ihm gesagt, und das hatte ihn daran erinnert, dass sie trotz ihres großspurigen Auftretens noch immer sein kleines Mädchen war. Er nahm sie fest in die Arme und küsste sie auf die Stirn. »Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Alles kommt wieder in Ordnung, schon ganz bald.«
Noch immer schwirrten Polizisten im Haus herum, in der Küche, im Wohnzimmer und natürlich auch bei der Treppe. Sie suchten nach Fingerabdrücken und anderen Spuren und Beweisen. Er warf einen Blick aus dem Fenster. Die Übertragungswagen der Fernsehsender standen noch immer in der Straße, und die Journalisten liefen auf dem Rasen hin und her; ein paar der Nachbarn waren auch da. Die Reporter warteten darauf, jemanden von der Familie interviewen zu können, ein paar Sekunden O-Ton zu kriegen. Am besten, er brachte es gleich hinter sich.
Er ging nach draußen; alles wirkte so surreal – vor dem eigenen Haus zu stehen, um vier in der Früh, das grelle Scheinwerferlicht, das ihm ins Gesicht schien, und all die Reporter, die ihm Fragen zuriefen. Er erkannte ein paar von ihnen, diese Olsen von Fox News und den jungen Schwarzen von Channel II. Jemand balancierte ein Mikro an einer langen Stange über seinem Kopf, und plötzlich tauchten zahllose Mikros von ABC, WINS, NY I und anderen Sendern vor seiner Nase auf. Er war es nicht gewohnt, derart im Mittelpunkt zu stehen, ganz im Gegenteil: Normalerweise gab er sich alle Mühe, nicht ins Rampenlicht zu geraten. Jahrelang hatte er unter Glossophobie gelitten, der Angst, öffentlich zu sprechen, und so hielt er sich normalerweise lieber als Beobachter im Hintergrund. Wenn irgend möglich, drückte er sich bei Fachkonferenzen vor Vorträgen, und wenn er doch in den sauren Apfel beißen musste, setzte er diverse kognitive Verhaltensstrategien ein, um seine Ängste in den Griff zu kriegen.
»Warum haben Sie ihn erschossen?«, wollte der Reporter von Channel II wissen.
»Ich hatte keine andere Wahl«, erklärte Adam, dem bereits der Schweiß ausbrach. »Er kam die Treppe hoch, mitten in der Nacht, und als ich ihm zurief, er solle abhauen, reagierte er nicht. Ich glaube, jeder hätte an meiner Stelle das Gleiche getan.«
»Wussten Sie, dass er unbewaffnet war?« Die Frage kam von dieser Olsen-Tante, deren Vornamen er vergessen hatte.
»Nein, das habe ich nicht gewusst.«
»Würden Sie es wieder tun?«, rief ein Typ aus den hinteren Reihen.
»Ja«, antwortete Adam. »Wenn ich noch einmal in solch eine Situation geriete, wenn jemand in mein Haus einbrechen würde und meine Familie in Gefahr wäre, würde ich es wieder tun. Ganz bestimmt.«
Die Reporter stellten noch jede Menge Fragen, und alle hatten sie diesen vage vorwurfsvollen Unterton. Das überraschte Adam. Er hatte mit mehr Wohlwollen vonseiten der Reporter gerechnet. Doch nun fühlte er sich plötzlich ähnlich bedrängt wie bei der Befragung durch Clements, hatte das Gefühl, die Reporter wollten ihn bloßstellen, ihm eine verborgene Wahrheit entlocken, die es nicht gab.
Dennoch hielt er über eine halbe Stunde lang die Stellung, beantwortete alle Fragen ruhig und höflich. Er griff auf die Techniken zurück, die er auch seinen Patienten empfahl, konzentrierte sich auf seine Atmung, sprach aus dem Bauch, nicht aus der Brust heraus – und spürte, wie er sich langsam entspannte, sich fast wieder normal fühlte. Als die Reporter schließlich keine Fragen mehr hatten, dankte er ihnen für ihre Aufmerksamkeit und kehrte ins Haus zurück.
3
Als Marissa die Schüsse hörte, war sie fest davon überzeugt, dass ihr Vater tot war. Mein Gott, wie hirnrissig war das denn, sich da draußen mit einer Pistole hinzustellen und wild draufloszuballern. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Aber das war typisch für ihren Vater – wenn der sich erst mal was in den Kopf gesetzt hatte, dann zog er das durch, ohne Rücksicht auf Verluste.
Marissa, die sich noch immer mit ihrer Mutter im begehbaren Kleiderschrank versteckt hielt, hatte laut losgeschrien, aber ihre Mum hielt ihr rasch den Mund zu. »Schschscht!«
Ihre Mutter war auch sauer wegen der Pistole, aber alles war so schnell gegangen, dass keine von ihnen hatte eingreifen können.
Die Schießerei hatte nur wenige Sekunden gedauert, danach war es totenstill im Haus.
»Warte hier«, befahl ihre Mutter und ging nachsehen, was passiert war. Marissa hatte Angst, dass ihre Mutter auch noch erschossen würde, und wollte sie aufhalten, aber dann sah sie ihren Vater mit der Pistole in der Hand oben an der Treppe stehen. Er wirkte verängstigt und erschrocken, und gleich darauf verlor er die Nerven und schrie, sie sollten beide ins Schlafzimmer zurückgehen.
Kurze Zeit später kam er zu ihnen.
»Hast du ihn erwischt?«, fragte ihre Mutter.
»Ja.«
»Ist er tot?«
Ihr Vater schluckte schwer und räusperte sich: »Ja, er ist tot.«
Als die Polizei eintraf, ging ihr Dad nach unten, um zu erklären, was passiert war. Dann hörten sie wieder Polizeisirenen, und noch mehr Polizisten kreuzten auf. Marissa blieb mit ihrer Mutter im ersten Stock, sie sprachen mit einem der Beamten. Es widerte Marissa ziemlich an, wie er sie angrinste und auf ihre Brüste glotzte. Als sie schließlich nach unten gingen, über die Hintertreppe, wandte sich Marissa im Flur kurz um und warf einen raschen Blick die Haupttreppe hinunter. Sie konnte die Blutlache am Fuß der Stufen sehen und ein Bein des Einbrechers, Jeans und hohe schwarze Turnschuhe. So eine Scheiße!
Ein anderer Cop nahm die beiden unten in Empfang und führte sie ins Esszimmer, wo er ihnen jede Menge Fragen stellte. Ihre Mum war viel gefasster als sie, zumindest vermittelte sie diesen Eindruck. Sie schaffte es, ziemlich genau zu beschreiben, was passiert war, während Marissa kaum in der Lage war, einen Gedanken zu Ende zu verfolgen, so dass sich ihr Bericht ziemlich konfus anhörte.
Eine halbe Ewigkeit schien vergangen, als ihr Dad endlich ins Esszimmer kam. »Wie geht es euch beiden? Alles in Ordnung mit euch?«, erkundigte er sich sogleich.
Sie wusste, dass das Show war, der Versuch, Stärke zu demonstrieren, so zu tun, als habe er alles im Griff. Nun ja, sein Gefühlsleben hatte er längst nicht so gut im Griff, wie er dachte. Nur weil er Seelenklempner war, hieß das noch lange nicht, dass er nicht ebenso verkorkst war wie alle anderen. Marissa konnte er nichts vormachen, sie wusste, dass er völlig durch den Wind war. Sie empfand Mitleid mit ihm, aber das hier hatte er sich selbst eingebrockt. Niemand hatte ihn gezwungen, die Pistole zu holen. Niemand hatte ihm gesagt, er solle abdrücken.
»Der Detective ist da. Er wird vermutlich mit uns reden wollen«, erklärte ihr Vater mit steinerner Miene und abwesendem Blick.
»Alles in Ordnung mit dir?«, erkundigte sich ihre Mum. Sie hatte offenkundig eine Stinkwut im Bauch, gab sich aber Mühe, sich nichts anmerken zu lassen.
»Mir geht’s gut, mach dir wegen mir keine Sorgen«, sagte ihr Dad und fügte sachlich hinzu: »Sie haben keine Waffe gefunden.«
Jetzt kochte ihre Mutter vor Wut. An ihrem Dad schien das völlig vorbeizugehen, dabei war es nicht zu übersehen.
»Haben sie auch wirklich alles abgesucht?«, vergewisserte sich ihre Mum.
»Ja«, bestätigte ihr Vater. »Aber ich hab nichts falsch gemacht, er hat nach etwas gegriffen. Was hätte ich denn sonst tun sollen?«
Ganz offensichtlich wollte er von ihrer Mutter die Absolution, aber darauf konnte er lange warten.
»Ich muss mich setzen«, sagte ihre Mum.
Als ihr Vater schließlich hinüber ins Esszimmer gegangen war, um mit dem Detective zu reden, brach es aus ihrer Mutter heraus: »Verdammte Scheiße, was zum Teufel hat er sich dabei gedacht?«
Normalerweise fluchte ihre Mutter nicht. Es jagte Marissa einen ziemlichen Schrecken ein.
»Keine Ahnung, ich hab geglaubt, ich seh nicht recht, als er plötzlich die Pistole ausgepackt hat. Ich hab ihm auch gesagt, was zum Teufel willst du damit?«
»Ich bin so wütend, so wütend, ich könnte ihn mit bloßen Händen erwürgen.«
Das Gesicht ihrer Mutter war ganz rot angelaufen. Marissa hatte sie noch nie so außer sich gesehen.
Marissa war zwar auch stinksauer auf ihren Vater, aber im Moment schien es ihr wichtiger, ihre Mutter zu beschwichtigen. »Er hat doch nur getan, was er glaubte, tun zu müssen.«
»Er hat also geglaubt, er müsse jemanden erschießen? Wem willst du hier was vormachen? Ich hatte die Polizei schon an der Strippe! Wie lang hat es gedauert, bis sie hier waren? Fünf Minuten? Wir hätten uns im Schlafzimmer einschließen, uns im Schrank verstecken können. Er musste die Pistole nicht holen, und ganz bestimmt musste er niemanden erschießen!«
»Vielleicht war es ja so, wie er gesagt hat. Vielleicht hat er geglaubt, es sei Notwehr.«
»Es ist mir schnurzegal, was er gedacht hat. Wie oft habe ich ihm gesagt, dass er diese verdammte Pistole wegschaffen soll? Erst vor ein paar Wochen habe ich ihm noch mal gesagt, dass ich das Ding nicht im Haus haben will, und er ist nur wieder mit den üblichen Ausreden gekommen.« Sie senkte die Stimme, ahmte Adam nach: »Das ist doch nur zu unserem Schutz. Ich werde sie ja nie benutzen.« Dann sprach sie in normaler Tonlage weiter: »Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Es war nur eine Frage der Zeit.«
Detective Clements trat ins Wohnzimmer, um mit Dana und Marissa zu sprechen. Sie erzählten ihm so ziemlich das Gleiche wie dem ersten Polizisten, wobei Dana die meisten Fragen beantwortete. Dann zogen sich Clements und Adam zu einer weiteren Befragung ins Esszimmer zurück. Sharon Wasserman und Jennifer Berg waren herübergekommen. Hillary, Sharons Tochter, war Marissas beste Freundin. Sie hatte letztes Jahr ihr Studium an der Northwestern University abgeschlossen und war dann nach Hause zurückgekehrt. Jennifers Sohn Josh, der an der George Washington University Jura studierte und kurz vor dem Abschluss stand, war Marissas erster Freund gewesen, in der siebten Klasse.
Es dauerte ewig, bis Clements und Adam ins Esszimmer zurückkehrten. Clements verlangte, mit Marissa unter vier Augen zu sprechen. Marissa war todmüde und sehnte sich nach ihrem Bett. Sie sah überhaupt keinen Sinn darin, die gleichen Fragen wieder und wieder durchzukauen.
Sie ging mit Clements ins Esszimmer und setzte sich ihm gegenüber an den Tisch.
»Ich weiß, es ist spät, aber es gibt noch ein paar Punkte, die ich mit Ihnen klären muss.«
»In Ordnung«, sagte Marissa und verschränkte die Arme über der Brust.
»Ihre Freunde … hat einer von denen irgendwelche Vorstrafen?«
»Nein.«
»Sie müssen nicht unbedingt im Knast gewesen sein. Wissen Sie vielleicht, ob einer schon mal etwas gestohlen hat oder gesagt hat, dass er irgendwo einbrechen will oder –«
»Wenn Sie glauben, einer meiner Freunde wäre hier mit diesem Typen eingebrochen, dann sind Sie nicht mehr ganz dicht.«
»Was ist mit Drogen? Nimmt irgendeiner Ihrer Freunde Drogen?«
Natürlich warfen ein paar ihrer Freunde hin und wieder was ein, sie war schließlich zweiundzwanzig – erwartete der Bulle etwa, dass sie ihre Freunde verpfiff?
»Nein«, sagte sie.
Er wirkte nicht überzeugt. »Es tut mir leid, aber ich muss darauf bestehen, dass Sie die Frage wahrheitsgemäß beantworten.«
›Klar muss ich das, ich stehe ja vor Gericht und unter Eid‹, dachte sie. »Was haben meine Freunde mit dem Einbruch zu tun?«
»Wo kaufen Sie Ihr Gras, Marissa?«
Die Frage traf sie völlig unvorbereitet und versetzte sie in Panik. In ihrem Zimmer stand eine Bong, und sie hatte eine Tüte Gras hinten in der Schublade mit ihrer Unterwäsche versteckt. Sie hatte keine Ahnung, ob Clements in ihrem Zimmer gewesen war, aber es sah ganz danach aus. Trotzdem war sie nicht so dämlich, vor einem Polizeibeamten zuzugeben, dass sie kiffte.
»Wovon reden Sie überhaupt«, antwortete sie deshalb.
»Ich war in Ihrem Zimmer.«
Ihr Herz schlug so laut und schnell, dass sie glaubte, ihr ganzer Körper schwinge mit.
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass keiner meiner Freunde was mit dem Einbruch zu tun hat. Das ist vollkommen hirnrissig.«
»Ich frage Sie jetzt ein letztes Mal, Marissa: Wo kaufen Sie Ihre Drogen?«
Am liebsten hätte sie angefangen zu heulen, aber sie riss sich am Riemen. »Ich nehme keine Drogen.«
»Ich habe die Bong in Ihrem …«
»Die gehört einer Freundin. Ich passe nur darauf auf.«
»Aha, Sie passen auf eine Bong auf, soso.« Er grinste.
Sie war eine schlechte Lügnerin, und diese dämliche Ausrede würde sie nicht lange aufrechterhalten können. »Na gut, sie gehört mir. Was wollen Sie jetzt machen? Mich festnehmen, weil ich eine Bong habe?«
»Der Besitz von Marihuana ist strafbar.«
»Es gehört mir nicht«, sagte sie verzweifelt.
»Ich frage Sie zum letzten Mal: Von wem beziehen Sie Ihr Gras?«
»Darren, ein Freund.«
»Wie kann ich ihn kontaktieren?«
So ein Arschloch!
»Warum wollen Sie –«
»Geben Sie mir seine Telefonnummer.«
Darren kannte sie vom College. Sie war immer mal wieder mit ihm zusammen gewesen, ein ziemliches Hin und Her. Jetzt wohnte er wieder bei seinen Eltern auf der Upper West Side. Wenn sie ihn auffliegen ließ, würde er sie fertigmachen.
Sie gab Clements Darrens Telefonnummer. »Aber bitte rufen Sie ihn nicht an. Ich bin mir sicher, dass er nichts mit dem Einbruch zu tun hat.«
Clements ignorierte sie. »Hat einer Ihrer Freunde irgendwelche Straftaten begangen oder welche geplant oder mal im Knast gesessen?«
Sofort musste sie wieder an Darren denken, der in Poughkeepsie eine Nacht hinter Gittern verbracht hatte, weil die Bullen bei einer Verkehrskontrolle einen Joint in seinem Wagen gefunden hatten. Aber sie konnte ihn nicht noch tiefer reinreiten.
»Nein«, sagte Marissa, »nicht dass ich wüsste.«
»Ich weiß, ich habe Sie schon mal gefragt, aber kennen Sie einen Carlos Sanchez?«
»Nein.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Weil ich das eben weiß, darum.«
Er legte eine kleine Plastiktüte auf den Tisch, in der sich ein Führerschein befand. »Und? Kommt er Ihnen bekannt vor?«
Sie betrachtete das Foto – ein ziemlich ungepflegter, hässlicher Kerl mit einem kalten, starren Blick. Den hatte sie noch nie zuvor gesehen.
»Den Typen kenne ich nicht.«
Clements schien noch immer nicht zufrieden. »Haben Sie jemals irgendwem Ihren Hausschlüssel geliehen oder …«
»Nein, nie.«
»Stimmt das auch?«
»Glauben Sie etwa, ich gebe irgendjemandem meinen Schlüssel, damit er bei uns einbrechen kann?«
»War es so?«
»Natürlich nicht!«
War das noch zu fassen?
Clements erhob sich. »Okay. Sie müssen jetzt mit mir kommen.«
»Wohin?«
»Zur Treppe. Ich möchte, dass Sie sich Sanchez ansehen.«
Bei der Vorstellung wurde ihr schlagartig übel. »Ich soll mir die Leiche ansehen?«
»Das Foto auf dem Führerschein ist mehrere Jahre alt. Er hat ziemlich zugenommen. Ich muss sichergehen, dass Sie ihn nicht vielleicht doch kennen.«
»Hab ich eine Wahl?«
»Nein.«
Sie hatte noch nie eine Leiche gesehen – das heißt, abgesehen von ein oder zwei Beerdigungen, wo die Toten aufgebahrt waren –, dennoch war ihr das alles im Moment ziemlich egal, sie wollte einfach nur auf dem schnellsten Wege in ihr Bett.
Marissa ging mit Clements in die Eingangsdiele. Der Tote lag immer noch am Fuß der Treppe, genau wie zuvor, nur konnte sie jetzt den ganzen Körper sehen. Die Spezialisten von der Spurensicherung schwirrten nach wie vor um die Leiche herum, suchten wohl nach DNA-Spuren, Fingerabdrücken und so was. Da war Blut, jede Menge Blut, dunkelrot, auf den unteren Stufen und auf dem Boden darunter. Darauf war Marissa nicht gefasst. Ihr wurde ganz flau im Magen, trotzdem trat sie näher, sah dem Toten ins Gesicht. Die Augen standen halb offen, und Blut lief aus seiner Nase. Der Mund sah komisch aus, und als sie genauer hinsah, erkannte sie, dass der Unterkiefer fast vollständig fehlte.
»O mein Gott«, stöhnte sie, was Clements offenbar falsch verstand.
»Erkennen Sie ihn?«, fragte er.
»Nein, nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist.« Sie wich zurück, weg von der Leiche. »Kann ich jetzt gehen? Kann ich jetzt endlich gehen?«
Clements brachte sie wieder ins Wohnzimmer und holte ihre Mutter zu einem Gespräch unter vier Augen, so dass sie allein mit ihrem Vater zurückblieb.
Zuerst schloss er sie in seine Arme und versicherte ihr immer wieder, dass alles wieder in Ordnung kommen würde – ja, klar, bestimmt –, und dann wollte er wissen, wie das Gespräch mit Clements gelaufen war.
Sie antwortete nicht sofort, sagte dann schließlich: »Er hat mich gezwungen, die Leiche anzuschauen.«
»Wie bitte?« Offensichtlich regte ihn das gewaltig auf. »Warum zum Teufel hat er das getan?«
Sie hatte keine Lust, weiter mit ihm darüber zu reden. Seit Jahren schon war ihre Beziehung angespannt und verkrampft, und seit sie vom College nach Hause zurückgekommen war, hatte sich die Lage nicht gerade verbessert. Wie auch, wenn er ständig herumnörgelte, dass sie sich einen Job suchen und ausziehen sollte. Dabei hatte sie nur vorübergehend wieder bei ihren Eltern wohnen wollen, eben so lange, bis sie ein eigenes Auskommen hatte.Über die Empfehlung eines ihrer Kunstgeschichtsprofessoren hatte sie einen Teilzeitjob im Metropolitan Museum of Art ergattert, aber ihr Boss dort war ein Ekelpaket, und außerdem hatte ihr Job mit Kunst nichts am Hut. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Audioguide-Kopfhörer an die Besucher zu verleihen. Nach einem Monat hatte sie die Schnauze voll gehabt und den Job hingeschmissen. Seitdem hatte sie zahllose Bewerbungen verschickt und auch einige Vorstellungsgespräche gehabt, aber ihr Vater warf ihr immer wieder vor, so eine Chance leichtfertig aufgegeben zu haben. Manchmal hielt sie es kaum noch im selben Zimmer mit ihm aus.
»Er wollte sicherstellen, dass ich ihn wirklich nicht kenne. Egal.« Sie war erschöpft und hatte keinen Bock, zu reden.
Aber ihr Vater konnte sich nicht beruhigen. »Das ist ja nicht zu fassen, einfach nicht zu fassen. Er hätte dich nicht dazu zwingen dürfen, niemals! Warum auch? Was will er damit erreichen?« Nachdenklich schüttelte er den Kopf. »Hat er auch nach deiner Bong gefragt?«
Marissa hatte keine Lust, sich auf ein solches Gespräch einzulassen, erst recht nicht um diese Uhrzeit und in diesem Zustand.
»Ja«, antwortete sie. »Aber er hat keine große Sache daraus gemacht.«
»Wie oft habe ich dir gesagt, dass du das Ding aus dem Haus schaffen sollst?«
»Nie, das hast du mir nie gesagt.«
»Ich hab dir verboten, unter meinem Dach zu kiffen.«
»Seit ich vom College zurück bin, habe ich vielleicht zwei Mal hier zu Hause was geraucht, aber wenn es dich so sehr stört, lass ich es eben, kein Problem.«
»Und ich will auch nicht, dass du in meinem Haus trinkst.«
»Wann habe ich denn hier was getrunken?«
»Neulich, als Hillary mit diesem Kerl da war.«
»Der Kerl ist Medizinstudent und heißt Jared, er ist ein Freund von Hillary. Wir haben Wein getrunken, jeder ein Glas, mehr nicht.«
»Egal, ich will trotzdem nicht, dass du hier im Haus trinkst, hast du mich verstanden?«
»Das ist lächerlich. Ich habe nichts getan, du reagierst nur wieder deinen Frust an mir ab.«
»Wie bitte?«, sagte er mit leicht erhobener Stimme.
»Als ob die ganze Sache hier mit meiner Bong oder meinem Alkoholkonsum zu tun hätte. Das hier hat einzig und allein was mit dir zu tun, mit dir und deiner Pistole.«
Ihr Vater warf ihr einen Blick zu, den sie in letzter Zeit ziemlich oft zu sehen bekommen hatte, ein Blick, als würde er sie hassen.
»Geh ins Bett«, befahl er.
»Na toll! Ich habe nichts getan, und du behandelst mich wie eine Zehnjährige.«