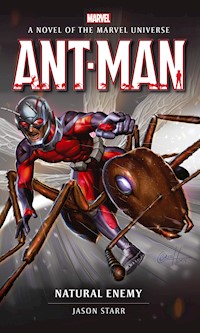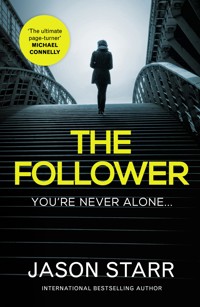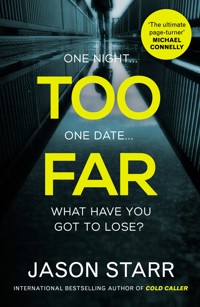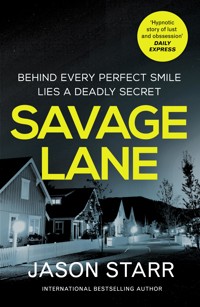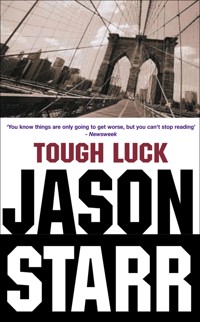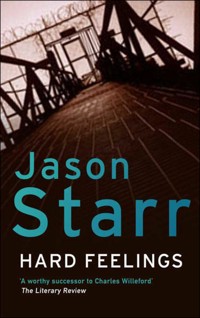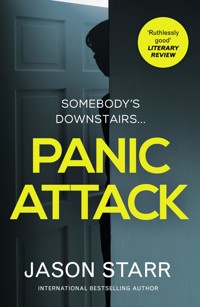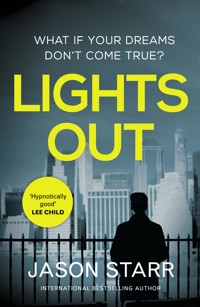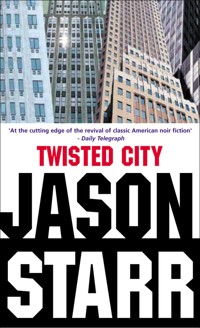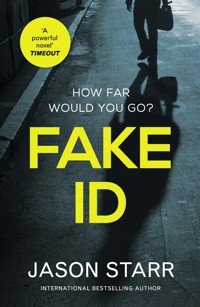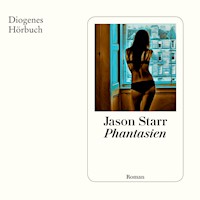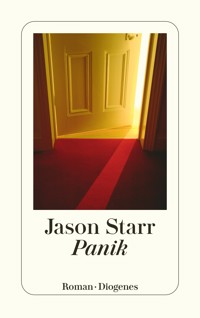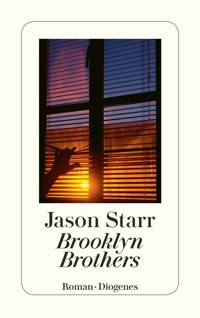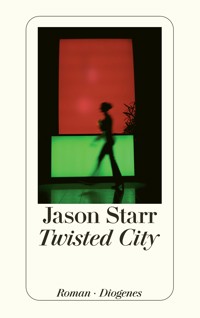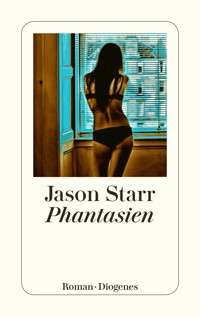10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jack Harper steckt tief in einer Midlife-Crisis. Seine Ehe mit Maria ist am Tiefpunkt angelangt, ihr Liebesleben am Ende. Der einzige Lichtblick ist sein Sohn Jonah. Doch dann scheint es für seine Eheprobleme eine Lösung zu geben: eine diskrete Seitensprung-Website. Entgegen seinen anfänglichen Bedenken lässt er sich auf eine Online-Affäre ein und begeht damit den größten Fehler seines Lebens. Immer schneller wird er in eine tödliche Spirale hineingezogen, aus der es kein Entrinnen gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jason Starr
Seitensprung
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Thomas Stegers
Diogenes
Für Mom
Sex ist nicht safe und wird es niemals sein.
Norman Mailer
Die Realität ist nur eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige.
Albert Einstein
1
»Gefällt mir. Echt, gefällt mir«, sagte Rob McEvoy, als er das Zwei-Zimmer-Penthouse in der 73rd Street, Nähe Third Avenue besichtigte, und fügte, nachdem er durch den kurzen Flur bis zur Küche vorgegangen war, hinzu: »Frühstückstheke, auch gut. Was für ein Holz?«
»Teak«, sagte ich.
»Super.«
»Hat der Besitzer erst vor ein paar Monaten eingebaut«, ergänzte ich. »Die Arbeitsplatte ist aus Blue Louise, Spitzengranit, und die Geräte sind alle neu, Sub-Zero-Wolf, mit integrierter Spülmaschine.«
Rob entfernte sich Richtung Wohnzimmer, fragte: »Kamin funktioniert?«
»Yep. Dabei sieht man kaum noch Apartments mit funktionierenden Kaminen in Manhattan.«
»Das Wohnzimmer ist ein bisschen klein.«
»Ja«, sagte ich, »aber es gibt einen separaten Essbereich, offene Raumaufteilung mit viel Licht, die Wohnung geht nach zwei Seiten.«
»Süden?«
»Norden und Osten.«
»Schon okay. Sonne kriege ich in L.A. genug ab.«
Er lächelte, und seine wie neu wirkenden Zahnkronen schimmerten im Kontrast zu seiner übermäßig solariumbraunen Haut noch weißer. Er sah ganz anders aus als vor – vierundzwanzig Jahren, mein Gott –, als wir noch zwei sich abrackernde Musiker waren und in der Lower East Side wohnten. Hätten wir nicht über Facebook wieder Kontakt aufgenommen, wäre ich wohl einfach an ihm vorbeigegangen, wenn wir uns auf der Straße begegnet wären. »An sich ist die Wohnung sehr hell, besonders morgens«, sagte ich.
»Ja, und so klein ist das Wohnzimmer auch wieder nicht. Genug Platz für ein großes, breites Sofa, das ist doch alles, worauf es ankommt, oder?«
Er zwinkerte mir zu und ging zur Tür, die auf die Terrasse führte. »Wow. Lass sehen.«
Wir betraten die Terrasse, die mit Clubsesseln von Crate&Barrel ausgestattet war.
»Eine Terrasse in dieser Größe und zu diesem Preis findest du sonst nirgends«, sagte ich. »Knapp dreißig Quadratmeter. Manche Wohnungen in Manhattan sind nicht mal so groß. Man kann hier grillen, Partys feiern …«
»Das ist der Wahnsinn«, sagte Rob. »Genau das, wonach ich suche. Wie viel kostet sie?«
»Der Besitzer verlangt zwei Millionen, und das ist kaum verhandelbar. Er hat erst kürzlich den Preis gesenkt, und es ist eine Anlageimmobilie, er ist nicht darauf angewiesen zu verkaufen. Du kannst natürlich versuchen, auf eins neun und ein paar Zerquetschte runterzuhandeln, aber ich glaube nicht, dass er einknickt. Die Nebenkosten liegen bei tausendneunhundertsechzig, was noch äußerst günstig ist, und so kämen wir bei einer Anzahlung von zwanzig Prozent auf –«
»Ich zahle bar«, sagte Rob.
»Oh. Okay.« Ich wusste, dass Rob sich ganz gutstand – er hatte in Hollywood seine eigene Musikagentur gegründet, Music Mania –, aber dass er einfach zwei Millionen in bar auf den Tisch blättern konnte, hätte ich nicht gedacht.
»Cool«, sagte ich.
»Ich möchte auch alles so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen«, sagte er. »In den nächsten ein bis zwei Monaten.«
»Wenn wir bis dahin den ganzen Papierkram erledigt haben und die Verwaltung keine Einwände hat, dürfte das kein Problem sein.«
»Super.« Rob fläzte sich auf einen der Clubsessel. »Ich sag dir ganz offen, ich war mit einigen Maklern unterwegs, habe etliche Wohnungen gesehen, die mir gefallen, aber die hier ist mein Favorit. Und sowieso wäre es mir lieber, du bekommst die Provision als irgendein Fremder.«
Sollte das ein Angebot sein? Klang sehr danach, aber sicher war ich mir nicht.
Seit einiger Zeit zweifelte ich an allem. Mein einziger Abschluss in den zurückliegenden drei Monaten betraf eine Ein-Zimmer-Mietwohnung, ohne Doorman, und die Provision musste ich mir mit einem anderen Makler teilen. Das Leben in Manhattan, auf der Upper East Side, war nicht gerade billig, und Maria und ich mussten uns gehörig anstrengen, um die Miete, die Rechnungen und die Auslagen für unseren achtjährigen Sohn zu bezahlen. Urlaub hatten wir seit Jahren nicht mehr gemacht.
Der Verkauf einer Zwei-Millionen-Wohnung könnte das Blatt wenden.
»Hört sich doch gut an«, sagte ich und dachte: Mach schon. Schließ den Deal ab! »Wenn du noch Fragen hast, beantworte ich die gerne, und wenn du willst, kann ich beim Verkäufer mal für dich vortasten, was den Preis angeht, ich meine, falls du vorhast, ein Angebot zu machen.« Rob ließ den Blick über die Dächer schweifen und sagte: »Mann, ich liebe diese Aussicht.«
»Die ist toll, nicht? Wohnungen mit unverbautem Blick sind in Manhattan heutzutage rar gesät. Und wenn man denkt, man hätte eine tolle Aussicht, dann wird gegenüber ein neuer Bau hochgezogen und blockiert einem die Sicht. Diese Sorge brauchst du hier nicht zu haben. Die Townhouses da drüben sind ihre Millionen wert, da wird nichts aufgestockt.«
»Das Intime gefällt mir«, sagte er. »Hier kannst du mitten am Tag ficken, und keiner sieht dich.«
Ich wusste nicht, ob das als Witz gemeint war, lachte aber trotzdem. »Ha, ja, das ist wahr. Stimmt absolut … Und? Denkst du, dass sie deiner Frau gefallen wird?«
Er sah mich an, als hätte ich etwas Anstößiges von mir gegeben.
»Meiner Frau?«
»Ja«, sagte ich. »Ich nehme an, ihr wollt sie als Zweitwohnung benutzen, wenn ihr in der Stadt seid, oder?«
Er hatte seine Frau in einigen E-Mails an mich erwähnt, und sein Facebook-Status lautete ›Verheiratet‹. Ich schielte auf seinen Ringfinger, den dicken goldenen Ehering.
»Nein. Ich will sie als Zweitwohnung nutzen, wenn ich in der Stadt bin«, betonte er und führte sein falsches Lächeln vor. »Meine Frau wird nie auch nur davon erfahren. Wie heißt es doch so schön? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.«
Er ging an mir vorbei zurück ins Zimmer. Ich folgte ihm.
»Wenn ich die Wohnung nehme«, sagte er, »dann suche ich mir als Erstes einen Innenarchitekten und richte mir hier ein Smarthome ein. Hippe Möbel, eine Bar, das richtige Licht, ein geiles Soundsystem. Und ein riesiges Bett. Das ist doch das Wichtigste, oder?«
Ich lächelte mit ihm, wollte seine Bemerkung nicht werten. Ich brauchte den Deal.
»Du wirst dich hier bestimmt gut amüsieren«, sagte ich.
»Oh, das kann ich dir garantieren.«
Ich rang mir erneut ein Lächeln ab, erst als er wegschaute, verdrehte ich die Augen.
Während wir mit dem Aufzug nach unten fuhren, gab ich ihm noch etwas mehr Informationen über das Haus und das Viertel.
»Melde dich, falls du Fragen hast«, sagte ich. »Ich will nicht drängen, aber ich weiß, dass noch andere Makler diese Wohnung ihren Kunden zeigen. Es gibt ernsthaftes Interesse, und ich glaube nicht, dass sich das Angebot lange hält.«
Ich hatte keine Ahnung, ob noch andere Makler Besichtigungstermine für diese Wohnung vereinbart hatten und ob es überhaupt Interesse gab. Meine Erfahrung sagte mir nur, dass ich alles daransetzen musste, um ihn aus der Reserve zu locken. Wenn es zutraf, was er mir gesagt hatte, und er noch andere Wohnungen in Betracht zog, brauchte ich so bald wie möglich eine Entscheidung von ihm.
»Keine Angst, ich lasse dich nicht hängen«, sagte er. »Ich beeile mich.«
Natürlich wollte ich ihn nicht gehen lassen, ohne dass er wenigstens ein Angebot gemacht hatte, andererseits durfte ich auch nicht zu starken Druck ausüben.
»Alles klar«, sagte ich.
Ich freute mich schon darauf, in mein Büro zurückzukehren und Rob damit endlich loszuwerden, als er sagte: »Sollen wir irgendwo zu Mittag essen?«
»Liebend gerne«, log ich, »aber leider habe ich im Büro noch was zu erledigen.«
»Komm schon, Mann«, sagte er. »Du bist eingeladen. Wo wir uns doch nur alle zwanzig Jahre oder so sehen. Wir haben einiges aufzuholen.«
Mir war klar, dass das keine gute Idee war. Es ist immer ein Fehler, mit einem potentiellen Kunden noch irgendwo hinzugehen, wenn man einen Deal abschließen will; aus Nähe entsteht nichts Gutes.
Andererseits sollte er nicht denken, dass ich ihn abwimmeln wollte.
»Okay, cool«, sagte ich. »Was soll’s. Für einen schnellen Happen reicht die Zeit.«
2
Rob ließ das Uber-Taxi vor dem Le Veau D’Or halten, einem gehobenen französischen Restaurant in der East 60th Street, an dem ich schon oft vorbeigekommen war, das ich aber noch nie betreten hatte. Rob trug ein schwarzes Sportsakko, darunter ein schwarzes Designer-T-Shirt. War das der typische Musikmogul-Look? Ich jedenfalls kam mir mit meinen Jeans, Sneakers und dem grauen Button-Down-Hemd ziemlich underdressed vor.
»Hm, vielleicht sollten wir uns lieber was suchen, wo es etwas zwangloser zugeht«, bemerkte ich.
»Chill, Bro«, sagte Rob. »Du siehst gut aus. Ein bisschen Low Budget, ja, aber du bist Jack Harper, ein Rock-’n ’-Roller, du bist hip. Glaubst du, Bono schert sich darum, wie er aussieht, wenn er mittags essen geht?«
Ja, ich glaube schon, wollte ich gerade antworten, doch da standen wir bereits im Restaurant, und ich dachte, na gut, dann können wir auch gleich hierbleiben.
Während die Hostess, eine attraktive, langbeinige Blondine, uns zu einem Tisch führte, beobachtete ich, wie sich Robs Blick auf ihren Hintern einschoss; dann sah er mich an und formte übertrieben deutlich mit den Lippen die Worte Geiler Arsch.
Ich bedauerte bereits meine Entscheidung, mit ihm essen zu gehen. Würde mein Geplauder mit ihm die Chance, den Verkauf abzuwickeln, wirklich erhöhen? Wenn er spürte, dass ich ihn eigentlich blöd fand, könnte es sie sogar verringern. Manchmal ist weniger mehr.
An unserem Tisch angekommen, wandte sich Rob an die Hostess: »Schauspielerin oder Model?«
Seine Stimme dröhnte – ein paar Gäste sahen zu uns herüber –, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er versehentlich laut sprach. Er wollte, dass andere Leute mithörten. Die Hostess, wahrscheinlich gewöhnt an die schmierige Anmache von Geschäftsleuten, schien gefasst.
»Schauspielerin.«
»Die Chancen stehen immer fünfzig zu fünfzig, stimmt’s?« Rob lächelte gekünstelt. Dann wechselte er zu einem angestrengt konzentrierten Gesichtsausdruck, der ebenso gekünstelt war. »Sie haben schöne Augen. Ich glaube, diesen Blauton habe ich noch nie gesehen, außer wenn ich in der Ägäis segle.«
Ich fand das zum Kotzen.
»Danke«, sagte sie. »Genießen Sie Ihr Essen.«
Als sie zum Restauranteingang zurückeilte, drehte sich Rob um und blickte ihr hinterher.
»Ich könnte ihr zu den schönsten zwei Minuten ihres Lebens verhelfen«, sagte er. »Ach, ich will dir nichts vormachen. Zwanzig Sekunden!«
Wieder dröhnte seine Stimme, und die ältere Frau am Nebentisch warf mir einen kurzen Blick zu. Ich reagierte mit einem hilflos verlegenen Achselzucken, als wollte ich mich entschuldigen: Ich kann nichts dafür.
»Und ich sage dir, die steht auf so was«, fuhr er fort. »Neun von zehn Mädchen, die einen älteren Mann kennenlernen, vergucken sich in ihn. Weißt du auch, warum? Weil ihr Freund wahrscheinlich irgend so ein zweiundzwanzigjähriger Idiot ist, der ihr nie Komplimente macht, der sie immer nur runterputzt, der sie nicht respektiert. Das ist der Schlüssel – Respekt. Wir Älteren wissen, dass man Frauen respektieren muss, wir wissen, wie man – wie heißt doch gleich das altmodische Wort für Ritter und König Artus und solche Leute?«
Ich wusste nicht, wovon er sprach.
»Galant«, sagte er. »Das habe ich gesucht. Danke. Erinnerst du dich, als wir zweiundzwanzig waren? Damals hatten wir keinen blassen Schimmer, wie man Frauen behandelt, aber heute, wo wir älter sind, könnten wir das bieten, was jüngere Frauen suchen – Respekt, Intelligenz, Weltläufigkeit, mit einem Wort, Klasse.«
Eine Kellnerin kam an unseren Tisch, eine Asiatin, jung, attraktiv. Rob grüßte sie mit einem anbiedernden »Hallöchen«, ersparte ihr aber weitere Anmachsprüche.
»Darf ich Ihnen vorher etwas zu trinken bringen?«
»Einen Wodka Gimlet«, sagte Rob.
»Mir reicht ein Wasser«, sagte ich.
Rob sah mich an, als spuckte ich Feuer. »Wirklich?«
»Ja, ganz sicher.«
Die Kellnerin lächelte und ging.
»Na komm, ein Glas wirst du doch wohl trinken«, sagte Rob. »Es gibt schließlich einen Grund zum Feiern. Ein Wiedersehen nach zweiundzwanzig Jahren, das ist wunderbar.«
»Ich bin bei den Anonymen Alkoholikern«, sagte ich.
Er sah mich an, als hätte ich einen Witz gemacht. Als er merkte, dass ich es ernst meinte, fragte er: »Seit wann?«
»Ich bin seit sechs Jahren und fünf Monaten trocken.«
»Das ist ja toll«, antwortete er. »Ich meine, toll, dass du diese Disziplin hast. Ich hätte die nicht, weiß Gott. Was war der Auslöser?«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine, einen kalten Entzug zu machen. Wenn ich mich an früher erinnere, hast du jeden Abend getrunken.«
»Das war der Auslöser.«
Er lächelte, dann sagte er: »Kapiert, Bro. Halb Los Angeles gehört dem Orden von Bill Wilson an. Ich bin nur erstaunt, dass du auch so ein Apostel bist.«
»Es ist einfach eine Menge Mist passiert in zweiundzwanzig Jahren«, sagte ich absichtlich vage, weil ich mich in kein Gespräch über meinen Alkoholismus und die vielen anderen Fehler, die ich gemacht hatte, verwickeln lassen wollte, und ergänzte: »Es wurde Zeit, sich dem Mist zu stellen, und das habe ich getan.«
»Cool«, sagte er. »Und was macht die Musik?«
Wo wir schon bei Themen waren, über die ich nicht sprechen wollte.
Ich griff nach dem Glas Wasser, merkte dann aber, dass die Kellnerin es noch gar nicht serviert hatte.
»Ich habe seit einer Ewigkeit keine Gitarre mehr in der Hand gehabt.«
»Nein!«, sagte Rob. »Das ist nicht dein Ernst. Musik war dein Leben. Du wolltest nichts anderes machen. Wenn du nicht gespielt hast, hast du Songs geschrieben oder über Musik gesprochen oder dir andere Bands angehört. Ich weiß, Musik kann ein hartes Business sein, man muss seine Miete bezahlen und so … Aber wie konntest du das nur alles aufgeben?«
»Das Leben kam mir in die Quere. Ich habe ein Kind, neue Verantwortungen. Und du? Spielst du noch?«
Ich wollte das Gespräch in eine andere Richtung lenken, weg von dem unangenehmen Thema, weg von mir.
»Sieben Tage die Woche«, sagte er. »Ich plane gerade, eine Band in L.A. zusammenzustellen. Nichts Ernstes, nur so, aus Spaß, ein bisschen schrammeln. Ich habe aber schon ein paar Gigs in einer Bar in West Hollywood festgemacht. Hey, da kommt mir die Idee: Wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, müssen wir unbedingt zusammen jammen.«
»Vielleicht«, sagte ich, hatte aber nicht die Absicht, mit Rob zu spielen, geschweige denn überhaupt je wieder eine Gitarre anzufassen.
Die Kellnerin brachte mein Wasser und Robs Gimlet und nahm unsere Bestellung auf: Fischtopf für mich, gedünsteter Lachs – »die Soße extra« – für Mister L.A.
Als die Kellnerin ging, drehte sich Rob um und sah sich ihren Hintern an.
»Und? Machen deine Kinder irgendwelchen Sport? Fußball oder so?«
Wir unterhielten uns eine Weile über unsere Kinder. Ich sagte ihm, mein Sohn Jonah nehme dieses Schuljahr Karate- und Schachunterricht und spiele gerne Pokémon.
»Mein Sohn ist auch verrückt nach Pokémon«, sagte Rob. »Ein großer Golisopod-Fan. Siehst du, ich bin ein guter Vater, ich halte mich auf dem Laufenden bei diesem Kram.« Und dann, nach einem langen Schluck von seinem Gimlet, fragte er: »Und? Wie sind so die Mütter auf der Schule? Heiße Bräute darunter?«
Rob mochte vierundvierzig Jahre alt sein, befand sich aber auf dem geistigen Stand eines Sechzehnjährigen.
»Nur so, aus Neugier«, sagte ich. »Hast du keine Angst, dass deine Frau dahinterkommt?«
»Wohinter?«
»Deinen Lebensstil. Hast du keine Angst, dass du dein Leben an die Wand fährst?«
Er machte ein Gesicht, als hätte ich etwas Lächerliches vorgebracht, etwas ganz und gar Unmögliches.
Dann sagte er: »Jetzt komm aber. Ich bin doch nicht blöd. Nur Dumme lassen sich erwischen. Ich werde schon dafür sorgen, dass nicht irgendeine verrückt gewordene Verflossene bei mir aufkreuzt. Und ich selbst werde es meiner Frau ja nicht unter die Nase reiben. Ich habe mein Leben zu Hause, und ich habe mein anderes Leben, und die beiden Leben werden sich nicht überschneiden.«
So wie er mit mir darüber sprach, so offen – und laut –, hatte ich meine Zweifel, dass er besonders vorsichtig war.
»Hast du kein schlechtes Gewissen?«, fragte ich.
»Machst du Witze?«, sagte er. »Meine Affären haben meine Ehe gerettet. Würde ich nicht fremdgehen, wären Julianne und ich längst geschieden. Als mein Jüngster ein Jahr alt war und sie eine Krise durchmachte, weil ihr Vater gerade starb, da hätten wir uns ganz sicher getrennt. Viele Männer in meiner Situation hätten sich verpisst. Aber ich bin ein guter Vater und auch ein guter Ehemann. Gott sei Dank, dass ich mit anderen Frauen meinen Spaß haben konnte, dass ich dieses Ventil hatte.«
Ich hörte Oprahs Fernsehpublikum förmlich aufstöhnen.
»Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst«, sagte ich. »Ich würde verrückt, wenn ich so leben müsste. Alles Lug und Trug.«
»Man gewöhnt sich daran«, sagte er lässig.
Er winkte nach unserer Kellnerin und bestellte noch einen Gimlet. Ich fand es nicht besonders rücksichtsvoll, sich zu betrinken, während man mit einem alten Freund, der ein trockener Alkoholiker war, zu Mittag aß. Andererseits war Rücksicht noch nie Robs Stärke gewesen.
»Na gut«, sagte Rob. »Dann will ich dir eine Frage stellen. Bist du glücklich verheiratet?«
Maria und ich hatten seit viereinhalb Jahren keinen Sex mehr.
»Ja«, sagte ich.
»Du hast gezögert.«
»Nein.«
»Ich habe dich beobachtet«, sagte er. »Ich konnte bis drei zählen, bevor du geantwortet hast. Na gut, vielleicht nur bis zwei, aber egal. Die Einsicht, dass man ein Problem hat, ist ein Prozess. Aber wem sage ich das. Du weißt, wie das ist. Du befindest dich noch in der Selbstverleugnungsphase. Dafür musst du dich nicht schämen.«
»Danke«, sagte ich. »Mir geht es gleich viel besser.«
Der Sarkasmus entging ihm.
Mit einem schiefen Lächeln, die Parodie eines Gebrauchtwagenverkäufers, sagte er: »Okay, Mister Glücklich-verheiratet-und-noch-nie-betrogen. Und in der Phantasie? Hast du es in deiner Phantasie jemals mit einer anderen Frau gemacht?«
»Natürlich«, sagte ich. »Jeder hat Phantasien. Aber das bedeutet nicht –«
»Ich hatte ständig Phantasien«, unterbrach er mich. »Und damit meine ich nicht nur, an heißen Sommertagen hübschen Mädchen hinterherzuschauen. Meine Phantasien gingen viel weiter. Sie waren lebhaft. Immer. Dann geht man einen Schritt weiter. Man fängt an, die Phantasien zu verwirklichen. Man flirtet mehr, man wirkt auf Frauen, man sucht ihre Aufmerksamkeit. Weißt du, was ich nie kapiert habe? Ich habe nie kapiert, warum manche Männer ab vierzig in eine Krise geraten. Vierzig, fünfzig, mit Viagra oder Levitra, das ist für den Mann so etwas wie das goldene Zeitalter des Flachlegens.«
Ich musste lachen. Robs schräge Logik war grotesk, aber amüsant.
»Okay«, sagte ich. »Und wo lernst du sie kennen, deine … wie soll ich sie nennen? Freundinnen?«
»Hauptsächlich online«, sagte er. »Auf Dating-Seiten.«
»Echt jetzt? So was machst du?«
»Diese Einstellung hatte ich früher auch«, sagte er. »Bis ich es versucht habe. Was hast du denn gedacht? Dass ich Frauen auf der Arbeit kennenlerne, um anschließend bei #MeToo zu landen? Ich riskiere gerne mal was auf der Seilrutsche, aber nicht beim Sex-Dating. Online ist die sicherste Methode, um fremdzugehen, und diese Dating-Apps sind das Beste, was verheirateten Männern seit der Einführung der Montags-Footballspiele passieren konnte. Meine Lieblingsseite heißt D-Ho, Abkürzung für Discreet Hookups. Beim ersten Mal auf D-Ho kommt einem alles irgendwie lahm vor. Viele Typen geben sich ein Fake-Profil, aber die Frauen sind clever genug, um nicht anzubeißen. Nach und nach lernt man die Frauen kennen, man tauscht E-Mails aus, chattet oder schickt einen virtuellen Blumenstrauß. Abgeschmackt, ich weiß, aber eins sage ich dir, es funktioniert. Bis jetzt habe ich elf Frauen kennengelernt und hatte Sex mit acht von ihnen. Kein schlechter Schnitt, was?«
»Hast du keine Angst davor, dass Hacker deine Kreditkarteninfo klauen?«, fragte ich. »Oder die Kundenliste öffentlich machen?«
»Wenn einem Golfspieler von einem Krokodil die Hand abgebissen wird, hört er dann mit dem Golfspielen auf?«
Ich hatte keine Ahnung, was das Gerede sollte.
»Ich versteh nicht, was du meinst«, sagte ich.
»Syphilis, Aids, Herpes, Schwangerschaft – Sex war schon immer risky«, sagte Rob. »Aber trotzdem haben die Leute Sex. Guck dir nur die Frau an, die ich heute Abend treffe. Verheiratet, zwei Kinder, irre sexy. Ich hoffe, die Bilder halten, was sie versprechen.«
Er zeigte mir das Foto einer sehr attraktiven Frau, etwa Mitte dreißig, auf seinem Handy. Sie lächelte, hielt einen Drink in der Hand und sah aus, als wäre sie auf einer Büroparty.
»Was soll ich sagen? Du hast den Dreh anscheinend raus.«
Er kniff die Augen zusammen, als versuchte er, ein kompliziertes gedankliches Problem zu durchdringen, und sagte dann: »Spüre ich da einen gewissen Neid bei dir, Jack? Ist das dein Problem? Deine Karriere als Musiker ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Du hast mit dem Trinken aufgehört. Du hast nicht mehr genug Abwechslung in deinem Leben. Und jetzt würdest du dich gerne mit deinem alten Kumpel Rob auf seiner Spielwiese so richtig austoben. Stimmt’s oder hab ich recht?«
Er lag nicht komplett daneben, trotzdem sagte ich: »Nein. Ich bin nur neugierig. Wie gehst du vor? Triffst du dich mit den Frauen, um Sex zu haben?«
»Nein«, sagte er. »Wir treffen uns zum Ficken. Zum Beispiel heute Abend. Wir haben uns an meiner Hotelbar verabredet, aber ich glaube nicht, dass wir das erste Glas ganz austrinken. Oh Mann, ich zeige dir mal die SMS, die sie mir geschickt hat. Sie ist vulgär und fies, ich liebe so was.«
»Stört es dich nicht, dass sie ihren Mann betrügt? Dass sie Kinder hat?«
»Nicht mein Problem.«
»Und wenn ihr Mann es spitzkriegt und sie sich am Ende scheiden lassen?«
»Sie ist ein erwachsener Mensch, es ist ihre eigene Entscheidung.«
Ich lachte.
»Jetzt mal ehrlich«, sagte er ohne das leiseste Lächeln. »Wenn du deine Frau betrügen könntest und ich dir garantieren würde, dass es nicht die geringste Chance gibt, dass sie je davon erfährt – würdest du es tun?«
»Ich bitte dich, das ist doch lächerlich –«
»Mit anderen Worten, ja.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Jeder Mann würde es tun. Und stell dir vor, auch die meisten Frauen. Wenn du mir jetzt sagst, du würdest niemals betrügen, es sei falsch, unmoralisch, dann sage ich dir: Du redest Scheiße. Was ist denn die Alternative? Nicht zu betrügen? Immer den gleichen langweiligen Sex mit derselben Frau bis ans Lebensende? Versteh mich nicht falsch, ich liebe meine Frau, wie gesagt, ich möchte mit ihr zusammen alt werden und sie im Pflegeheim mit Kartoffelbrei füttern, wenn wir neunzig sind. Aber wenn man sich das klarmacht, muss man doch verrückt sein, nicht fremdzugehen. Wie heißt es so schön: Wie man es macht, macht man es falsch. Warum es dann nicht gleich falsch machen und richtig ficken?«
Unser Essen kam. Mir gelang es, das Gespräch auf andere Themen als außerehelichen Sex zu lenken. Hauptsächlich unterhielten wir uns über gemeinsame Bekannte aus der Zeit, als wir noch zusammenwohnten. Ich hatte mit einigen, die Rob aus den Augen verloren hatte, Kontakt gehalten und brachte ihn auf den neuesten Stand, was sie jetzt machten.
Gegen Ende suchten wir beide händeringend nach Gesprächsstoff, und wir waren erleichtert, als die Rechnung kam. Ich schlug vor, sie zu teilen, aber er bestand darauf zu bezahlen.
»Geht auf Music Mania«, sagte er.
Kaum waren wir draußen, setzte er seine verspiegelten Aviators auf, obwohl es bedeckt war und nieselte.
»Überleg es dir mit der Wohnung und sag Bescheid, wohin die Reise geht«, sagte ich. »Ich glaube, es wird dir da gefallen, ganz bestimmt, und wenn du ein Angebot abgeben und den Vertrag schnell abschließen willst, setze ich mich gleich dran.«
Ich merkte, dass er nicht zuhörte.
»Klingt gut«, sagte er mit Blick auf sein Handy. »Scheiße, es ist schon spät. Ich muss zu einer Besprechung, dann geht es zurück ins Hotel, ein bisschen ausruhen vor meinem großen Date heute Abend. Viel Schlaf werde ich wohl nicht kriegen.« Er sah mich an. »Du bist rasend neidisch. Du kannst es abstreiten, so viel du willst, aber verbergen kannst du es nicht.«
Wir umarmten uns, klopften uns auf die Schulter und gingen dann auseinander.
3
Als ich Larry Stein bei unserem Termin um halb zwei zu Gesicht bekam, war mir sofort klar, dass dies eine Nullnummer werden würde. Am Telefon hatte er sich älter angehört, schätzungsweise vierzig, tatsächlich war er Ende zwanzig, höchstens dreißig. Schlimmer noch, am Telefon wirkte er wie ein ernsthaft interessierter Käufer; er wohne zurzeit zur Miete, arbeite an der Wall Street und suche nach einer großen Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sich das Schlafzimmer teilen ließe, oder die man zu einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung umbauen könne, im Millionen-Preissegment. Jetzt, leibhaftig vor mir, trug er einen billigen Anzug und eine gefälschte Rolex, die er wahrscheinlich für zehn Dollar bei einem Straßenverkäufer erstanden hatte.
Im Büro versuchte ich nun, mir ein genaueres Bild von ihm zu machen, erkundigte mich nach seiner Herkunft, seinem Beruf, und dabei hatte er erwähnt, eher beiläufig, er arbeite als stellvertretender Filialleiter in einem Geschäft für Koffer und Taschen an der Wall Street. »Ich arbeite an der Wall Street« war offenbar wörtlich gemeint gewesen. Ich fragte ihn, ob er noch ein zusätzliches Einkommen habe, und er antwortete, er verfüge über Vermögen.
Ich war skeptisch. Er kam mir wie einer dieser Blindgänger vor, die sich am Wochenende einen Spaß daraus machten, an offenen Wohnungsbesichtigungen teilzunehmen, dennoch zeigte ich ihm die Wohnung in der 90th Street. Er löcherte mich mit Fragen: ›Wie steht es um die Hausfinanzen?‹ ›Wer sitzt im Co-op-Verwaltungsrat?‹ ›Woher kommen die Doormen?‹ ›Sind die Heizkosten inklusive?‹ Nachdem wir ungefähr zwanzig Minuten in der Wohnung verbracht hatten, und er zwischendurch sicher fünf-, sechsmal ins Badezimmer gegangen war, fragte er: »Wie hoch wäre meine monatliche Belastung?«
»Angenommen, Sie zahlen zwanzig Prozent an, liegt sie bei ungefähr dreitausendsechshundert.«
»Warum so viel?«
›Vielleicht weil es ein Millionendollar-Apartment ist‹, dachte ich im Stillen, gab mich nachsichtig und sagte: »Bei tausendsechshundert Dollar Instandhaltungskosten kommt das dabei heraus.«
»Das übersteigt meine Mittel«, sagte er.
Einmal durchgeatmet, dann sagte ich: »Möchten Sie sich preiswertere Wohnungen ansehen?«
»Heute habe ich keine Zeit. Aber ich werde wieder auf Sie zukommen.«
Da wusste ich, dass ich nie wieder von ihm hören würde.
Auf dem Weg nach Downtown, die Third Avenue entlang, simste ich Rob McEvoy. Cool, Mann, unser Wiedersehen! Wieder auf dem neuesten Stand, toll, und wenn du noch Fragen zu der Wohnung hast, melde dich einfach!
Rob war im Moment mein heißester Anwärter – ehrlich gesagt, mein einziger Anwärter. Schlimmer noch, ich brauchte diesen Abschluss unbedingt. Die Provision für ein Zwei-Millionen-Apartment betrug 120000 Dollar. In diesem Fall müsste ich sie mir mit einem anderen Makler teilen, und auch meine Firma holte sich ihren Schnitt, aber nach Steuern würde mein Anteil praktisch mein gesamtes Jahreseinkommen ausmachen.
Wenn ich den Abschluss versemmelte … aber darüber wollte ich lieber gar nicht nachdenken.
Rob schickte mir eine Antwort: Mach ich … ja, mach ich!!!
Okay, ich gebe zu, ich war neidisch auf Rob. Nicht auf seine Sexgeschichten, sondern auf seine Karriere. Klar, er war ein Arschloch, aber er verdiente Geld, arbeitete im Musikgeschäft. Vor meiner Ehe war ich Studiogitarrist gewesen, manchmal tourte ich mit Bands durch Amerika, einmal auch Europa. Meine Gage war unregelmäßig, ich war oft pleite und schlief bei Freunden auf dem Sofa, aber ich war ein sauguter Gitarrist, es war die glücklichste Zeit meines Lebens.
Mir fehlte ein Beruf, der mich erfüllte.
Ich wartete auf dem Pausenhof der Grundschule P.S. 158, einem massiven Vorkriegsbau in der York Avenue, zusammen mit anderen Eltern, bis Jonahs Klasse nach draußen kam.
Dieser Moment bildete immer das Highlight meines Tages. Weil Maria in der PR-Abteilung eines Finanzdienstleisters vollzeitbeschäftigt war, meine Arbeitszeit dagegen flexibel, konnte ich das Hinbringen und Abholen erledigen, statt einen Babysitter zu engagieren wie viele andere Elternpaare in Manhattan. Manche Männer hätten es vielleicht nervig gefunden, für mich dagegen war das Zusammensein mit Jonah immer so, als würde ich Zeit mit meinem besten Freund verbringen. Ich machte alle seine Klassenfahrten mit, war jeden zweiten Freitag sein Lese- und Mathe-Buddy, und begleitete ihn zu den wichtigsten Schulveranstaltungen, zum Beispiel zum Batiktag, Walkathon, Tanzabend und zur Halloween-Party.
Es war so weit, ein scheinbar endloser Strom kreischender lebhafter Kinder verließ die Schule, doch Jonahs Klasse verspätete sich. Upper East Siders konnten genauso cliquenhaft sein wie ihre Kinder, und die Eltern standen in ihren angestammten Gruppen zusammen. Es gab die Clique der berufstätigen Mütter, der Yoga-Mütter, der Soul-Cycle-Mütter, der Mütter von der Eltern-Lehrer-Vereinigung, der Großmütter, der nichtberufstätigen Väter und der Babysitter. Morgens gab es die Clique der »Anzug-Väter«, hochnäsige Schnösel, die sich alle von irgendwoher kannten und immerzu Anspielungen auf ihre »Firmen« und »Fusionen« und »Buyouts« machten. Wenn ich in meinem Business etwas gewiefter gewesen wäre, hätte ich diese Fahrdienste als Gelegenheit zum Einschleimen genutzt, so wie manche die AA-Meetings, die ich besuchte. Ich hätte mich in jedes Gespräch einmischen und meine Visitenkarte unter die Leute bringen können. »Hey, falls Sie zufällig jemanden kennen, der eine Wohnung sucht, melden Sie sich.« Aber Arschkriecherei war nicht mein Stil.
Während ich wartete, geriet ich in Hörweite einer Unterhaltung zwischen Stacy Katz und Geri Sherman von der Eltern-Lehrer-Vereinigung. Ich sagte nichts, lächelte nur und nickte ab und zu. Sie sprachen über den Lehrplan und einen bevorstehenden Ausflug zum South Street Seaport.
Ich hatte Stacy und Geri nie in einem irgendwie sexuellen Sinn wahrgenommen. Mir war aufgefallen, dass sie attraktiv waren, aber konkret daran gedacht hatte ich nicht. Doch jetzt hörte ich Bobs Stimme im Ohr: Du solltest mal die Mütter auf der Schule meiner Tochter sehen. Wenn er jetzt hier wäre, würde er Geri anmachen, definitiv. Sie war eine kleine Brünette, Anfang vierzig und mitten in einer Scheidung. Von einem anderen Vater hatte ich erfahren, dass sie ihren zukünftigen Ex betrogen hatte – sie war also genau Robs Typ.
Ich schaute mich um und fragte mich, welche Mütter Rob sonst wohl noch anbaggern würde. Karen Schaeffer, eine der SoulCycle-Mütter, war glücklich verheiratet, doch das würde Rob nicht abhalten; eher wäre es für ihn eine Herausforderung. Vielleicht würde er auch eine der Yoga-Mütter anmachen, Kirsten Lasher, Jenny Liang oder Danielle Freidman, ja, Danielle auf jeden Fall. Sie war mit einem arbeitssüchtigen Neurochirurgen verheiratet, dem man diverse Affären nachsagte. Sie war Ende dreißig, aber sah immer noch klasse aus. Enge Jeans, hochhackige Stiefel und einen Ausschnitt, der einen tiefen Blick ins Dekolleté erlaubte, das war das typische Danielle-Outfit. Seit einiger Zeit verabredete sie sich häufiger für Spielnachmittage mit Greg Langley, einem nicht berufstätigen Vater, der, wie ich gehört hatte, mit seiner Frau in einer Eheberatung war; gut vorstellbar, dass sie sich nicht nur zum gemeinsamen Spielen mit ihren Kindern trafen.
Robs Idee, dass irgendwann jeder seinen Ehepartner betrog, kam mir absurd vor, obwohl ich irgendwo gelesen hatte, siebzig Prozent aller Verheirateten würden zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Ehe betrügen. Falls das zutraf, musste es unter den Eltern an der Schule ganz schön viele außereheliche Beziehungen geben, und ich hatte noch nie davon gehört.
»Hi, Daddy.«
Jonah stand vor mir. So tief in Gedanken versunken, hatte ich gar nicht gemerkt, dass seine Klasse aus der Schule gekommen war.
»Hey, Kiddo«, sagte ich und küsste ihn auf die Stirn. Jonah hatte hellbraunes Haar, aber früher oder später würde es dunkler werden, weil Maria und ich beide dunklere Haare hatten. »Wie war es in der Schule?«
»Okay. Kaufst du mir ein Eis?«
»Nein, kein Eis. Du hast an zwei Tagen hintereinander Eis gehabt.«
»Ach komm, Dad. Bitte.«
»Zu Hause gibt es einen gesunden Snack«, sagte ich. »Und danach gehen wir in den Park und spielen ein bisschen Basketball, ja? Ist das cool oder nicht?«
»Cool«, sagte er, und wir klatschten uns ab.
Später, nach Basketball und Eis – ja, ich bin eingeknickt –, gingen wir zu unserem Wohnblock, einem bescheidenen, aber gut erhaltenen Nachkriegsbau mit Doorman in der 83rd Street zwischen First und York Avenue. Leider wohnten wir zur Miete, wir konnten uns keine Eigentumswohnung leisten, eine Eigentumswohnung in der Upper East Side wäre eine riesige Investition. Nachdem die Second Avenue Subway endlich eröffnet hatte, war die Nachfrage in unserem Viertel sprunghaft angestiegen, hauptsächlich dank des Zuzugs der Hipster aus dem überteuerten Williamsburg. Trendy Restaurants und Bars mit Live-Musik und sogar Varietés hatten in der Gegend eröffnet, und erst kürzlich war ich an einer Reihe neuer veganer Cafés vorbeigekommen, immer ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Stadtviertel abhebt.
Unsere Wohnung hätte man auf dem Markt als junior four anbieten können, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber eigentlich war es nur eine Ein-Zimmer-Wohnung. Jonah bewohnte das Schlafzimmer, und wir hatten in der Ess- oder Arbeitsnische im Wohnzimmer noch eine Wand eingezogen, um ein zweites Schlafzimmer zu haben. Die Wohnung war zu klein für drei Personen, aber bei Marias Gehalt und meinen Provisionen konnten wir uns nicht mehr leisten. Eine Zeitlang klappte das, aber schon für zwei Personen war eigentlich nicht genug Platz – kommt noch ein Kind hinzu, wird es beinahe unmöglich.
Ich saß mit Jonah im Wohnzimmer und half ihm bei den Hausaufgaben, als Maria hereinkam. Sie hatte für ein paar Tage dienstlich in Houston zu tun gehabt und zog ihren Koffer hinter sich her in die Wohnung. Sie trug ein dunkelblaues Kleid, die Haare zu einem straffen Pferdeschwanz zusammengebunden.
»Mommy!« Jonah lief seiner Mutter in der Tür entgegen.
Sie beugte sich zu ihm hinunter und umarmte ihn. »Hallo, mein Süßer, wie geht es dir? Du hast mir so gefehlt.«
»Du mir auch.«
»Ich möchte ganz genau wissen, was du gemacht hast. Ich ziehe mich nur eben schnell um, okay?«
»Okay.«
»Hey«, begrüßte mich Maria.
Sie küsste mich flüchtig auf den Mund und ging ins Schlafzimmer.
Unsere Beziehung hatte sich sehr verändert. Als ich sie vor dreizehn Jahren bei einem meiner Gigs Downtown kennenlernte, trug sie einen engen Minirock aus Leder, Netzstrümpfe, einen Igelschnitt und Nasenring und saß allein am Tresen.
Normalerweise war ich zu schüchtern, um Frauen anzusprechen, aber in dem Fall war ich ohne zu zögern auf sie zugegangen und hatte gesagt: »Hey, ich bin –«
»Jack Harper«, fiel sie mir ins Wort.
»Verzeihung«, sagte ich, »aber woher kennst du –«
»Ich war bei eurem Auftritt letzte Woche und in der Woche davor bei dem in Brooklyn.« Sie strahlte. »Ich liebe deine Musik. Du spielst wahnsinnig gut.«
Wir gingen zusammen aus, und nach einer Woche sprachen wir von uns als Seelenverwandte. Sie kam zu meinen Auftritten und jubelte mir vorne an der Bühne zu. Ihre Begeisterung schien mir übertrieben, aber natürlich schmeichelte mir der Beifall meiner sexy Freundin. Nach zwei Monaten zog ich bei ihr ein, ein halbes Jahr später heirateten wir.
Meine Freunde warnten mich, nichts zu überstürzen, aber Logik interessierte mich damals nicht. Maria und ich verlebten ein tolles Jahr miteinander, dann ließ sie ihr Haar wachsen, nahm den Nasenring ab und bekam einen Job in einem Unternehmen. Ich freute mich für sie und auch darüber, dass wenigstens einer von uns eine feste Stelle gefunden hatte, aber wir entfremdeten uns voneinander. Sie interessierte sich nicht mehr so für Musik, besonders meine, und kam nicht mehr zu meinen Auftritten; sie müsse »früh aufstehen«, sagte sie oder nannte andere Ausreden.
Gleichzeitig machte ich eine schwierige Phase in meiner Karriere als Musiker durch. Meine Band bekam nicht mehr so viele Gigs, und die Arbeit im Studio ließ ebenfalls nach. Maria und ich hatten vor, eine Familie zu gründen, und mir war klar, dass ich einen Weg finden musste, mehr zum Einkommen beizusteuern.
Alkohol war schon immer ein Problem gewesen – eigentlich seit meinem ersten Glas auf der Highschool. Als Maria schwanger wurde, versprach ich ihr, mich zurückzuhalten, aber es klappte nicht. Nachdem Jonah auf der Welt war, blieb ich tagsüber mit ihm zu Hause, während Maria arbeitete, abends trat ich auf und betrank mich. In Jonahs Anwesenheit trank ich nie, war aber meist verkatert.
Schließlich tat ich das einzig Richtige für mich und meine Familie und wurde trocken. Maria, das muss ich ihr zugestehen, hielt während dieser dunklen Zeit zu mir. Mit meiner Musikerlaufbahn ging es weiter bergab, deswegen erwarb ich eine Lizenz als Immobilienmakler, um mehr für den gemeinsamen Unterhalt tun zu können.
Der Sieg über den Alk hat mir dabei geholfen, ein besserer Vater zu werden, ein besserer Mensch; meiner Ehe hat er nicht geholfen. Maria und ich lebten wie in einer Wohngemeinschaft, die sich untereinander meistens nicht vertrug. Wechselelternschaft wurde für uns zur schlechten Routine; ich war tagsüber für Jonah da, und wenn Maria abends von der Arbeit kam, übernahm sie.
Wir hatten keinen Abend für uns allein, gingen auch kaum unter Leute. Ich traf mich zwei-, dreimal die Woche mit Bekannten von den Anonymen Alkoholikern, während Maria Kunden betreute. »Befreundete Paare« gab es kaum in unserem Leben, eigentlich nur Marias Studienfreund Steve und dessen Frau Kathy. Aber seit sie aus der Stadt raus nach Westchester gezogen waren, sahen wir uns nicht mehr so häufig.
Unser Sexualleben verkümmerte. Maria konzentrierte sich auf ihre Karriere und war öfter beruflich unterwegs. Wenn ich mal die Initiative ergriff, schob sie Müdigkeit vor – sie selbst ergriff nie die Initiative –, und schließlich gab ich es ganz auf. Mehrmals schlug ich eine Eheberatung vor, sie war dagegen. Sie hatte noch nie eine Therapie gemacht, trotz ihrer schwierigen Kindheit, schon die Vorstellung fand sie bedrohlich. Ich fing allein eine Therapie an, doch um eine Ehe zu kitten, braucht es zwei.
Eine Scheidung wäre die logische Konsequenz gewesen und sicher das Beste für Jonah. Maria und ich bildeten nicht gerade ein vorbildliches, sich liebendes Paar. Aber mir schwante, dass eine Trennung von ihr ein Alptraum werden würde. Maria konnte liebenswürdig sein, aber auch nachtragend. Ihr Cousin Michael war ein skrupelloser Scheidungsanwalt, und mit dem zweitklassigen Anwalt, der mich vertreten hätte, hätte ich alt ausgesehen, besonders, wenn Maria die »Alkoholikerkarte« gezogen hätte. Sie hätte mich in den Ruin getrieben und versucht, das alleinige Sorgerecht für Jonah zu bekommen. Ich konnte dagegenhalten, dass ich trocken war und in Jonahs Leben seit seiner Geburt eine wichtige Rolle spielte, aber würden diese Argumente etwas gelten vor Gericht?
Ohne eine tragfähige Alternative, um der Ehe zu entkommen, bis Jonah auf dem College wäre, wurschtelten wir weiter.
Rob hatte mich nach meinen Phantasien gefragt. Natürlich hatte ich Phantasien, aber sie drehten sich nicht um Sex mit anderen Frauen.
Meine Phantasien drehten sich darum, wie ich endlich aus meiner schlechten Ehe ausbrechen konnte.
Nachdem Jonah seine letzten Rechenaufgaben gelöst hatte, ging ich in die Küche, wo Maria unsere Bestellung von Seamless auspackte. Es war unser Standardgericht, Hühnchen mit Kaiserschoten und gemischtem Gemüse, General Tso’s Chicken und eine große Wan-Tan-Suppe.
»Und?«, fragte ich. »Wie war Houston?«
Nach langem Schweigen sagte sie: »Produktiv.«
»Produktiv hört sich gut an. Besser als unproduktiv.«
Sie schien abgelenkt, sah auf ihr Handy.
»Kommt jetzt nicht bald die Börsenzulassung?«
»Was für eine Börsenzulassung?«, fragte sie irritiert.
»Für das Biotech-Unternehmen«, antwortete ich. »Deswegen warst du doch in Houston, oder nicht?«
»Die Zulassung war vor zwei Monaten«, sagte sie. »Ich habe dir davon erzählt, weißt du nicht mehr?«
Ich konnte mich nicht daran erinnern, meinte aber trotzdem: »Ach ja, stimmt.«
Sie tippte eine SMS oder eine E-Mail in ihr Handy. Etwa eine Minute ging vorbei.
Ich wusste, dass sie mich nicht fragen würde, wie mein Tag verlaufen war, wenn ich es nicht selbst ansprach, deswegen sagte ich: »Ich hatte heute einen interessanten Tag. Ich habe Rob McEvoy eine teure Wohnung gezeigt.«
»Wem?« Sie tippte noch immer etwas in ihr Handy.
»Rob McEvoy«, sagte ich. »Schon vergessen? Mein alter Mitbewohner. Wir haben in einigen Bands zusammengespielt.«
Maria hatte Rob nie kennengelernt, aber ich hatte ihr von ihm erzählt.
»Ach, der Rob?« Jetzt sah sie mich an. »Hast du nicht immer gesagt, der ist ein Arschloch?«
»Genau der.«
Ich erklärte ihr, dass er in Manhattan eine Wohnung suchte, ließ aber unerwähnt, dass er sie als Absteige zum Ficken nutzen wollte.
»Wollen wir hoffen, dass es wenigstens einmal zu einem Abschluss kommt«, sagte sie und verteilte General Tso’s Chicken auf drei Teller.
Für einen zufälligen Beobachter klang es wie eine harmlose Bemerkung, ich dagegen hörte heraus: ›Wollen wir hoffen, dass du endlich auch etwas Geld verdienst, es stinkt mir nämlich gewaltig, dass ich seit einiger Zeit der Hauptverdiener bin.‹
»Was soll das denn heißen?«, fragte ich.
»Es heißt, dass ich dir die Daumen drücke«, sagte sie.
»Wirklich?«
Jonah beobachtete uns.
»Jetzt komm, Jack, lass uns nicht wieder damit anfangen.«
Maria hatte recht, sie wollte nicht vor Jonah streiten, aber mir gefiel nicht, dass sie den Spieß umdrehte. Sie hatte eine passiv-aggressive Bemerkung gemacht, und weil ich sie herausgefordert hatte, reagierte sie, als hätte ich etwas Falsches gesagt. Es war nicht das erste Mal. Es war eine subtile Art der Erniedrigung, eines unserer vielen scheinbar unlösbaren Probleme.
Beim Abendessen stand Jonah im Mittelpunkt. Maria erkundigte sich nach der Schule und den Hausaufgaben, ich sprach mit ihm über Fußball. Ich machte mir nichts aus Fußball, aber da Jonah gerne Fußball spielte, tauschten wir uns über Messi und Ronaldo aus, und in einer Unterhaltung mit einem Achtjährigen konnte ich mithalten.
Das Schöne an geliefertem Essen: Man braucht nicht abzuwaschen. Während Maria und Jonah Zeit für sich hatten, in der sie ihm bei seinen Hausaufgaben half, besuchte ich ein AA.-Meeting in der St. Monica’s Church in der 79th Street, unweit First Avenue.
Wenn eben möglich, meist zweimal die Woche, besuchte ich ein Meeting in Manhattan. Meistens ging ich zu dem in der St. Monica’s Church, weil es in der Nähe war und ich einige Freunde in der Gruppe hatte. Viele alte Bekannte waren im Laufe der Jahre aus der Stadt weggezogen, mit anderen hatte ich mich verkracht; mein Sozialleben spielte sich hauptsächlich bei den AA ab. Dort oder auf anschließenden Treffen und alkoholfreien Partys in Wohnungen von Freunden.
Ich ergriff häufig das Wort bei diesen Meetings, heute Abend jedoch war ich eher in der Stimmung, nur zuzuhören. Eine Zeitlang sprach Ricardo, dann erzählten einige neue Mitglieder ihre Geschichte. Nach dem Meeting stand ich noch mit einigen Freunden zusammen, darunter Dave, einem jungen rothaarigen Mann, den ich gerade sponserte. Dave war sechsundzwanzig, Angestellter in der Werbebranche und seit fast einem Jahr trocken. Nach einer schwierigen Phase, in der wir praktisch zehnmal täglich telefonierten, hatte er sich jetzt wieder gefangen. Er hatte einen neuen Job, eine neue Freundin und sah gesund und glücklich aus.
Als ich schon am Aufbrechen war, nahm er mich beiseite. »Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Hilfe bedeutet. Im Ernst, Jack, ich weiß nicht, wie ich das ohne dich durchgestanden hätte.«
»Dafür sind wir da«, sagte ich.
Er umarmte mich herzlich.
Wieder zu Hause, gegen zehn, lag Jonah schon im Bett und schlief.
Maria war im Badezimmer und machte sich bettfertig. Ich ließ mich mit meinem Laptop auf dem Sofa nieder und checkte meine geschäftlichen E-Mails und den Terminplan für den nächsten Tag. Dann ließ ich mich ablenken und überprüfte den Facebook-Status von einigen Bekannten. Rob hatte ein Foto seiner Tochter gepostet, als Katze kostümiert in einer Schulaufführung von Peter und der Wolf und dazu geschrieben: Bin stolz auf mein Mädchen.
Ich klickte den Like-Button, seine Tochter war wirklich hinreißend.
Während ich noch online war, verzog sich Maria in unser Schlafzimmer und schloss die sehr dünne Tür hinter sich. Sie legte sich gewöhnlich gegen zehn hin, eine Stunde vor mir, um zu lesen, und war normalerweise gegen elf eingeschlafen. Sie stand früh auf, um halb sieben, und ging noch vor der Arbeit ins Fitnessstudio.
Wie üblich sah ich noch etwas fern, mit Kopfhörer, um Maria und Jonah nicht zu stören. Ich zappte mich durch die Programme, Lokalnachrichten, dann einen Ausschnitt aus einer Folge von Arrested Development, den ich schon mehrmals gesehen hatte, und schweifte zwischendurch gedanklich ab, machte mir Sorgen wegen der Arbeit, hoffte, dass der Kaufvertrag mit Rob zustande kam. Bis jetzt hatte er mir noch kein Angebot unterbreitet, aber heute Abend war er ja auch durch sein Date abgelenkt. Ich stellte mir die beiden in Robs Hotelzimmer vor, laut kreischend bei ungezügeltem Sex.
Um elf schaltete ich den Fernseher aus, löschte die Lichter im Wohnzimmer und in der Küche und legte mich zu Maria ins Bett. Vertieft in die Lektüre auf ihrem E-Reader, schien sie mich gar nicht zu bemerken. Ein paar Minuten später legte sie den E-Reader auf dem Nachttisch ab und drehte sich auf ihre Seite, mit dem Rücken zu mir.
Als ich leises Schnarchen vernahm, drehte ich mich in die andere Richtung und schlief ebenfalls ein.
4
Nachdem ich Jonah an der Schule abgesetzt hatte, eilte ich Uptown zur 95th Street, zwischen Park- und Lexington Avenue zu einer Wohnungsbesichtigung. Es war eine Co-op-Drei-Zimmer-Wohnung im dritten Geschoss eines hübschen Brownstone in einer von Bäumen gesäumten Straße, einen Block entfernt von The Lower Lab, einer begehrten Upper-East-Side-Grundschule. Die Wohnungseigentümer ließen sich scheiden und wollten unbedingt verkaufen. Zwischen den Parteien herrschte eine solche Spannung, dass ihre Anwälte die Aufgabe übernahmen, die Wohnung den Maklern zu zeigen, und die Wohnung folglich um 50000 Dollar unter Wert angeboten wurde. Die Eigentümer würden das erstbeste Angebot vom erstbesten kreditwürdigen Käufer akzeptieren, und ich hatte den perfekten Kandidaten an der Hand, Alex Korin, dessen Frau gerade ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte. Alex und seine Frau hatten sich schon mehrere Wohnungen mit mir angesehen, auch eine Vorabbewilligung einer Hypothek lag vor. Das Problem war, dass bereits vier Makler die Wohnung besichtigten, als ich kam, und sie vermutlich ebenfalls interessierte Kunden hatten.
Ich erreichte Alex auf seinem Handy. »Du musst sofort deinen Arsch in Bewegung setzen. Ich habe die perfekte Wohnung für euch, Mann.«
Alex war in den Dreißigern, besaß einige Bars in der City, ich konnte in diesem zwanglosen Ton mit ihm reden.
»Ich habe gerade erst angefangen zu arbeiten, und ich habe den ganzen Vormittag über Termine«, sagte er.
»Eins kann ich dir sagen«, versuchte ich es noch mal, »die Wohnung ist genau das, was du suchst, und sie wird sich nicht lange auf dem Markt halten.«
Alle Makler behaupteten, dass die Wohnungen, die sie unbedingt verkaufen wollten, sich »nicht halten« würden, selbst wenn sie seit Monaten auf dem Markt dümpelten. Auch wenn ich es in diesem besonderen Fall ehrlich meinte, für ihn redete ich nur Blech.
»Eventuell könnte ich nach drei Uhr vorbeikommen, aber ich würde mich vorher noch melden und dir Bescheid sagen.«
»Bis dahin ist die Wohnung weg, das kann ich dir versprechen. Könnte deine Frau sich die Wohnung ansehen?«
»Nein. Sie ist mit unserer Tochter heute Morgen zum Arzt. Wahrscheinlich Streptokokken.«
Ich versuchte, ihn zu überreden, sich vielleicht doch eine Stunde freizuschaufeln, aber er meinte, heute Morgen sei es unmöglich. Deprimiert legte ich auf. Ich hörte, wie Sally Engle, eine erfahrene und bekannte Maklerin, die für einen der großen Immobilienhändler arbeitete, den Anwälten der Eigentümer versicherte, dass mehrere interessierte Käufer noch unterwegs zur Wohnung seien. Auch die anderen Makler hatten potentielle Käufer, die sich auf den Weg gemacht hatten, und es war klar, dass die Wohnung innerhalb einer Stunde verkauft sein würde.
Es regnete. Ich hatte keinen Schirm dabei, trotzdem ging ich zu Fuß zum Büro, es war mir egal, ich bemerkte nicht einmal, dass ich klatschnass wurde.
Wolf Realty befand sich in einem unscheinbaren Geschäftshaus in einer Nebenstraße, 74th Street, unweit Third Avenue. Die meisten Kunden stießen über Mundpropaganda oder Online-Listings auf uns. Wir waren zu dritt im Büro, mich eingeschlossen, und unsere Schreibtische standen hintereinander an der linken Wand, meiner in der Mitte. Unser Chef Andrew Wolf hatte einen eigenen Raum im hinteren Teil.
Kein Kind sagt zu seinen Eltern: »Wenn ich groß bin, möchte ich Makler werden.« Immobilienhandel kann sehr lukrativ sein, wenn man Glück hat, doch in den meisten Fällen schlittert man in den Beruf hinein, wenn es woanders nicht geklappt hat. Man musste sich nur meine beiden Kollegen ansehen. Claire hockte allein zu Hause, nachdem die Kinder ausgezogen waren; ihre Lizenz hatte sie erst vor drei Jahren erworben, da sie über keinerlei Berufserfahrung verfügte und nirgendwo sonst einen Job fand. Brian hatte als Cutter, Schuhverkäufer, Bühnenarbeiter, Kellner, Lektoratsassistent und Hundeausführer gearbeitet; ich hatte meine Zweifel, dass Immobilien sein letzter Karriereschritt waren. Und Andrew Wolf war erst in den Immobilienhandel eingestiegen, nachdem ein paar seiner Restaurants Konkurs gemacht hatten.
Als ich ins Büro kam, telefonierten Claire und Brian gerade, aber es waren wohl eher private Gespräche. In unserem Job gab es viel Leerlauf. Der New Yorker Immobilienmarkt war heiß, aber wir konkurrierten mit einer Unmenge Online-Listings und sogar mit Airbnb. Uns allen saß die Angst im Nacken, dass Immobilienhändler, genauso wie Reiseagenturen, irgendwann überflüssig würden. An Tagen wie diesen erschienen mir mein Beruf, meine Zukunft und die Zukunft ganz allgemein unglaublich trostlos.
Während mein PC hochfuhr, wanderte mein Blick zum Schild, das ich über meinen Schreibtisch aufgehängt hatte: GOTT IST MEIN CO-PILOT. Mein erster Sponsor bei AA hatte mir vorgeschlagen, mich mit solchen Erbauungssprüchen zu umgeben. Manchmal kam mir dieser Spruch dämlich vor, sogar ein bisschen kitschig, trotzdem sah ich jeden Morgen zu dem Schild.
Ich spulte mein übliches Programm ab und checkte die neu hereingekommenen Listings – nichts Interessantes darunter –, dann kam eine SMS von Maria: Steve und Kathy haben uns Samstag eingeladen.
Steve war ein Exfreund von Maria vom College, einer der Freunde, mit denen sie gelegentlich wandern ging. Steve und Kathy hatten zwei Söhne, einer in Jonahs Alter.
Ich schrieb zurück: Kann sein, dass ich an dem Tag zu einer offenen Besichtigung muss, aber ich will versuchen, sie zu verschieben.
Sie antwortete: Okay, ich sage zu.
Ich hatte nicht geschrieben, dass ich auf jeden Fall mitkäme, nur, dass ich es versuchen würde, aber ich hatte keine Lust, ihr zu widersprechen.
Dann kam eine SMS von Rob McEvoy: Brothaman!! Unterwegs zum Flughafen. Sagenhaft gestern Abend, Bro. Irre, die Frau. Kann mich kaum auf den Beinen halten!!
Ich war ziemlich angepisst, dass er schon wieder abflog. Ich war davon ausgegangen, dass er sich mindestens noch ein, zwei Tage in der Stadt aufhielt. Und wo blieb sein Angebot?
Ich schrieb zurück: Wow, jetzt schon? Dachte, du würdest länger bleiben.
Dann kam die Nachricht: Ja. Im Büro in L.A. ist die Kacke am Dampfen. Wenn ich wieder inNYCbin, jammen wir!!!
Und noch eine: Bin noch immer scharf auf die Wohnung. Bleiben in Kontakt!BB.
»Leck mich«, sagte ich.
Ich kam mir wie der letzte Idiot vor, wie konnte ich nur glauben, dass Rob, der notorisch unzuverlässige Rob, sich irgendwie für mich einsetzen würde.
Ich las die SMS noch mal. Wenn er wirklich »scharf« auf die Wohnung war, warum machte er dann nicht auf der Stelle ein Angebot? Er musste ja nicht zurück nach L.A., um es mit seiner Frau zu besprechen: Hey, Honey, okay, wenn ich in Manhattan eine kleine Absteige zum Ficken kaufe?