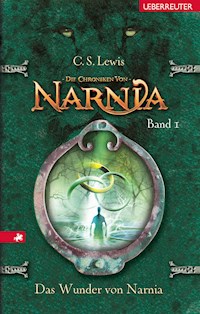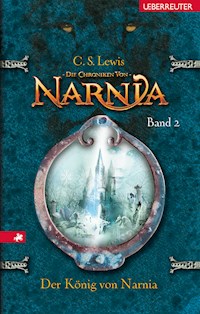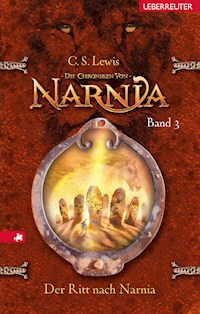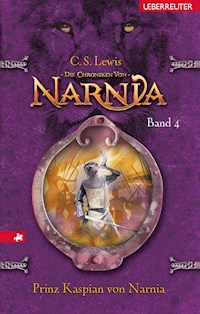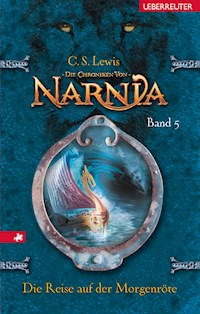Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieser Longseller ist seit der deutschen Herausgabe vor 40 Jahren zu einem Klassiker zum Thema „Argumente für den Glauben“ geworden. Höchst logisch und mit kraftvoller Bildhaftigkeit begegnet der „Narnia“-Erfinder Lewis dem Vorurteil, man müsse den Verstand über Bord werfen, um heute noch Christ zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C.S. Lewis Pardon, ich bin Christ
C.S. Lewis
Pardon, ich bin Christ
Meine Argumente für den Glauben
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Titel der englischen Originalausgabe: «Mere Christianity» by C.S. Lewis © C.S. Lewis Pte Ltd. 1942, 1943, 1944, 1952 Published by Brunnen Verlag Basel under license from the CS Lewis Company Ltd.
Neuübersetzung (2014): Christian Rendel, Witzenhausen
Der Text basiert auf der 23. Taschenbuch-Auflage / 4. Hardcover-Auflage © 1977, 2016 by Brunnen Verlag Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Umschlagfoto: Photobank gallery, Shutterstock.com Umschlagfoto: Tom Gowanlock, Shutterstock.com E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung:
Inhalt
Zum Geleit
Vorwort von C. S. Lewis
Erstes BuchRecht und Unrecht als Schlüssel zum Sinn des Universums
1. Das Gesetz der menschlichen Natur
2. Einige Einwände
3. Die Wirklichkeit des Gesetzes
4. Was steckt hinter dem Gesetz?
5. Wir haben Grund zur Beunruhigung
Zweites BuchWas Christen glauben
1. Rivalisierende Vorstellungen von Gott
2. Die Invasion
3. Die erschreckende Alternative
4. Der vollkommene Büßer
5. Die praktische Schlussfolgerung
Drittes BuchChristliches Verhalten
1. Die drei Aspekte der Ethik
2. Die Kardinaltugenden
3. Sozialethik
4. Ethik und Psychoanalyse
5. Sexualethik
6. Die christliche Ehe
7. Vergebung
8. Die große Sünde
9. Nächstenliebe
10. Hoffnung
11. Glaube
12. Noch einmal Glaube
Viertes BuchJenseits der Persönlichkeit – Erste Schritte zum Verständnis der Dreieinigkeit
1. Erschaffen und Zeugen
2. Gott in drei Personen
3. In der Zeit und jenseits der Zeit
4. Infiziert mit dem Guten
5. Die widerspenstigen Zinnsoldaten
6. Zwei Anmerkungen
7. Tun wir so, als ob
8. Ist Christsein leicht oder schwer?
9. Die Kosten überschlagen
10. Nette Leute oder neue Menschen?
11. Die neuen Menschen
Zum Geleit
Im Jahr 2000 führte die amerikanische Zeitschrift Christianity Today eine Umfrage über die einflussreichsten Bücher des zwanzigsten Jahrhunderts durch. Der bei Weitem am häufigsten genannte Autor war C.S. Lewis, und das mit Abstand am häufigsten genannte seiner Bücher war Pardon, ich bin Christ – im Original Mere Christianity.
Pardon, ich bin Christ ist der Klassiker der christlichen Apologetik im zwanzigsten Jahrhundert schlechthin. Als ehemaliger Atheist, der sich in einem mehrjährigen Prozess vor allem durch philosophisches Nachdenken dem Glauben an Gott annäherte und schließlich zum christlichen Glauben fand, war Lewis in einer einzigartig günstigen Position, um sich in seine skeptischen Zeitgenossen hineinzuversetzen und ihre Schwierigkeiten vorherzusehen. Mit seiner Methode, seine Leser voraussetzungslos und allein aufgrund von Vernunftargumenten und anschaulichen Illustrationen ans Christentum heranzuführen, hat er das Genre nachhaltig geprägt. Viele haben versucht, ihm darin nachzueifern, doch nur wenige konnten mit seinem Scharfsinn, seinem Bilderreichtum und seiner lebendigen Sprache mithalten.
Seit seinem Erscheinen 1952 hat das Buch unzählige Auflagen erlebt. Es wurde in etliche Sprachen übersetzt und von Millionen von Menschen in aller Welt gelesen. Niemand weiß, wie viele Menschen ihre Hinwendung zum christlichen Glauben auf Pardon, ich bin Christ zurückführen. Bekannt ist aber, dass darunter auch etliche illustre Persönlichkeiten sind, wie etwa der ehemalige amerikanische Präsidentenberater Charles Colson (1931–2012), der Genetiker und ehemalige Leiter des Humangenomprojekts, Francis Collins (geb. 1950), und der Philosoph C.E.M. Joad (1891–1953). Bis heute ist die Popularität des Buches ungebrochen.
Dabei ist Pardon, ich bin Christ keineswegs über jede Kritik erhaben. Auf theologischem Gebiet war Lewis ein Laie, was er auch selbst immer wieder betont. Der renommierte britische Neutestamentler N.T. Wright – selbst ein Bewunderer des Buches – hat Pardon, ich bin Christ mit einer Hummel verglichen, die erstaunlicherweise fliegen kann, obwohl sie nach aller naturwissenschaftlichen Erkenntnis dazu eigentlich gar nicht in der Lage sein dürfte. Was die philosophischen Argumente angeht, so ist es in den letzten Jahren geradezu in Mode gekommen, auf ihre Lücken und Unvollständigkeiten hinzuweisen.
Freilich erklären sich diese Lücken vor allem daraus, dass Pardon, ich bin Christ keine hochgestochene philosophische Abhandlung für Fachleute ist, sondern ein Buch für eine allgemeine Leserschaft, noch dazu eines, das ursprünglich als eine Reihe von Radiovorträgen entstand. Aus Lewis' Korrespondenz mit den Redakteuren der BBC während der Abfassung lässt sich gut ablesen, welche eiserne Disziplin ihm die dadurch gebotene Kürze der einzelnen Kapitel abverlangte. Lewis musste sich auf das unbedingt Notwendige beschränken und konnte somit nicht in aller Ausführlichkeit auf alle möglichen Einwände und Nuancen zu jedem Argument eingehen. Er war sich vollkommen bewusst, dass ihn das angreifbar machte, aber dieses Risiko ging er im Interesse der Verständlichkeit und Zugänglichkeit seiner Gedankengänge ein.
Eines der eindrücklichsten und am häufigsten zitierten Argumente aus Pardon, ich bin Christ und zugleich eine der beliebtesten Zielscheiben der Kritiker ist das sogenannte «Trilemma» am Ende des Kapitels «Die erschreckende Alternative». Dort legt Lewis dar, Christus habe uns durch die Behauptungen, die er über sich selbst aufstellte, keine andere Möglichkeit gelassen, als ihn entweder für den Sohn Gottes oder aber für einen Geisteskranken oder einen Verbrecher zu halten.
Glaubt man den Kritikern, so hat dieses Argument mehr Löcher als ein Fischernetz. Zweifellos haben sie insofern recht, als es in der knappen Form, in der Lewis es hier präsentiert, allen möglichen Einwänden Tür und Tor öffnet. Dennoch ist es gerade dieses Argument, das immer wieder Leser aller Bildungsschichten – darunter auch Leute wie Charles Colson und Francis Collins – davon überzeugt hat, dass der Zimmermannssohn aus Nazareth tatsächlich der ist, der er zu sein behauptete.
Interessanterweise hat Lewis dieses Argument für Pardon, ich bin Christ gegenüber der ursprünglichen Fassung, die er im Radio vortrug, sogar noch gekürzt. Dort nämlich packte er einen der häufigsten Einwände gleich selbst bei den Hörnern:
Natürlich könnte man sich auf den Standpunkt stellen, [Jesus] habe diese Dinge überhaupt nicht gesagt, sondern seine Anhänger hätten sie nur erfunden. Aber damit würde man die Schwierigkeit nur verlagern. Schließlich waren sie ja auch Juden und damit die Letzten, denen so etwas eingefallen wäre. Über Mose oder Elia hatte dieses Volk nie etwas Derartiges behauptet. Mit dieser Theorie handelt man sich also statt eines unerklärlichen Verrückten nur deren zwölf ein. So kommen wir nicht aus der Sache heraus.
Warum Lewis diese Sätze, die doch vielen seiner Kritiker den Wind aus den Segeln genommen hätten, aus der Buchfassung strich, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Man sieht an diesem Beispiel jedoch, dass seine Argumente in diesem Buch oftmals knappe Zusammenfassungen von Gedankengängen sind, die sich bei näherer Betrachtung als vielschichtiger und komplexer erweisen, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Es wäre aber voreilig, sie deswegen für oberflächlich zu halten. Eher dürfte es ratsam sein, sie als Einladungen zum Weiterdenken aufzufassen.
Es ist zuzugeben, dass man in einigen Passagen dem Buch sein Alter von nun rund siebzig Jahren anmerkt (und zwar nicht nur an Kleinigkeiten wie der Anzahl der Monde im Sonnensystem). Vor allem betrifft dies einige Kapitel im Abschnitt über die Ethik. Über Lewis' Frauenbild ist schon viel – auch kontrovers – geschrieben und diskutiert worden. Einige Sätze, die Anlass dazu gaben, finden sich auch in Pardon, ich bin Christ. Über seine Idee, einen Unterschied zwischen der staatlichen und der christlichen Ehe zu machen, hat sich schon sein Zeitgenosse und enger Freund J.R.R. Tolkien ereifert. Was Lewis über Pazifismus, Soldatentum und Todesstrafe zu sagen hatte, erschien den Herausgebern der Ende der 1950er-Jahre entstandenen ersten deutschen Ausgabe gar so heikel, dass sie kurzerhand ein halbes Kapitel aus dem Text strichen. Die vorliegende Neuübersetzung enthält erstmals auch diese Passagen in deutscher Sprache.
Freilich macht Lewis es seinen Lesern nicht leicht, ihn zu ignorieren, selbst da, wo sie ihm aufgebracht widersprechen möchten. Auch hier merkt man bei genauerem Nachdenken, dass hinter manchen Aussagen, die veraltet anmuten, vielschichtigere Zusammenhänge und Gedankengänge stecken, als es zunächst den Anschein hat. Nicht alles, was uns befremdet, weil es nicht zu unserem eigenen Zeitgeist zu passen scheint, muss deshalb falsch sein. Lewis selbst warnte vielfach vor dem, was er «chronologischen Snobismus» nannte: der Grundannahme, alles Neue müsse immer besser und richtiger sein als alles Alte.
Man kann sich wunderbar an Lewis reiben, und das lohnt sich sehr, denn oft wird man feststellen, dass sich das eigene Denken dabei schärft. Im Ergebnis wird gewiss nicht jeder ihm am Ende zustimmen und wohl kaum einer in jedem Punkt, aber jeder wird aus der gedanklichen Auseinandersetzung großen Gewinn davontragen.
Lewis' große Stärke ist nicht nur seine Denkschärfe, sondern auch seine Spekulierfreudigkeit und Bilderkraft, mit denen er an knifflige theologische und philosophische Fragen herangeht. Besonders im letzten Teil des Buches, der sich mit der christlichen Vorstellung von Gott befasst, spielt er diese Stärken voll aus. Seine Überlegungen zum Verhältnis von Zeit und Ewigkeit etwa sind fester Bestandteil der gedanklichen Werkzeugkiste von Generationen von Christen geworden.
Fünfzig Jahre nach Lewis' Tod und über sechzig Jahre nach dem Erscheinen von Pardon, ich bin Christ sind viele Gedanken dieses Buches ebenso aktuell wie eh und je. Möge diese neue, erstmals vollständige deutsche Übersetzung des Klassikers vielen künftigen Lesern den Zugang zu diesem großen christlichen Denker erschließen.
Christian Rendel, Witzenhausen, im Februar 2014
Vorwort von C.S. Lewis
Der Inhalt dieses Buches wurde ursprünglich über den Rundfunk ausgestrahlt und dann in drei Teilen als Broadcast Talks (1942), Christian Behaviour (1943) und Beyond Personality (1944) veröffentlicht. In den Druckversionen habe ich dem, was ich am Mikrofon gesagt hatte, ein paar Dinge hinzugefügt, aber ansonsten den Text ziemlich so gelassen, wie er war. Eine «Ansprache» im Radio sollte sich meiner Meinung nach möglichst wie ein echtes Gespräch anhören, nicht wie ein laut vorgelesener Essay.
Darum habe ich in meinen Ansprachen all die Verkürzungen und Geläufigkeiten verwendet, die ich im gewöhnlichen Gespräch auch benutze. Dabei habe ich es in der Druckversion belassen und don't und we've für do not und we have eingesetzt. Und überall, wo ich in den Vorträgen ein Wort durch den Nachdruck in meiner Stimme besonders hervorgehoben hatte, habe ich es kursiv gesetzt. Inzwischen neige ich zu der Auffassung, dass das ein Fehler war – ein nicht erstrebenswertes Zwischending zwischen der Kunst des Sprechens und der Kunst des Schreibens. Ein Redner darf gern zur Betonung Variationen der Stimme einsetzen, denn diese Methode bietet sich für sein Medium ganz natürlich an. Ein Schriftsteller hingegen sollte sich für diesen Zweck nicht der Kursivschrift bedienen. Er verfügt über seine eigenen, ganz anderen Mittel, die entscheidenden Wörter hervorzuheben, und die sollte er auch benutzen. In dieser Ausgabe habe ich die Verkürzungen beseitigt und die meisten Kursivsetzungen durch eine Umstellung der Sätze, in denen sie vorkamen, ersetzt. Ich hoffe jedoch, dass der «volkstümliche» oder «ungezwungene» Tonfall, den ich von vornherein beabsichtigt habe, davon unbeschadet geblieben ist. Außerdem habe ich Dinge hinzugefügt und andere gekürzt, wo ich der Meinung war, irgendeinen Aspekt meines Themas inzwischen besser zu verstehen als vor zehn Jahren, oder wo ich wusste, dass die ursprüngliche Version von anderen missverstanden worden war.
Der Leser sei gewarnt, dass ich jemandem, der zwischen zwei christlichen «Konfessionen» schwankt, keine Hilfe sein werde. Von mir erfahren Sie nicht, ob Sie Anglikaner, Katholik, Methodist oder Presbyterianer werden sollten. Diese Frage spare ich absichtlich aus (selbst die gerade aufgelisteten Konfessionen sind lediglich alphabetisch geordnet). Wo ich selbst stehe, ist kein Geheimnis. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Laie in der Church of England, weder besonders «high» noch besonders «low» noch besonders sonst etwas.
Doch in diesem Buch habe ich nicht vor, irgendjemanden von meinem eigenen Standpunkt zu überzeugen. Seit ich Christ geworden bin, war ich stets der Meinung, dass der beste und vielleicht einzige Dienst, den ich meinen nichtgläubigen Mitmenschen erweisen kann, darin besteht, den Glauben, der fast allen Christen zu allen Zeiten gemeinsam war, zu erklären und zu verteidigen. Für diese Auffassung hatte ich mehr als einen Grund. Erstens geht es in den Fragen, in denen sich Christen voneinander unterscheiden, häufig um Feinheiten der Theologie oder gar der Kirchengeschichte, die den echten Fachleuten vorbehalten bleiben sollten. Ich hätte in solchen Gewässern den Boden unter den Füßen verloren und eher selbst der Hilfe bedurft, als dass ich anderen hätte weiterhelfen können.
Und zweitens müssen wir uns, glaube ich, eingestehen, dass die Diskussion dieser strittigen Punkte überhaupt nicht geeignet ist, einen Außenstehenden in den Schoß der christlichen Gemeinde zu bringen. Solange wir über diese Dinge schreiben und reden, werden wir andere eher davon abschrecken, sich überhaupt auf irgendeine christliche Gemeinschaft einzulassen, als dass wir sie in die unsere hineinziehen. Von dem, was uns trennt, sollte nur in Gegenwart derer die Rede sein, die bereits zu der Überzeugung gekommen sind, dass es einen Gott gibt und dass Jesus Christus sein einziger Sohn ist.
Schließlich hatte ich den Eindruck, dass viel mehr und auch begabtere Autoren sich bereits mit solchen kontroversen Fragen befassten als damit, das «bloße» Christentum zu verteidigen, wie Baxter es nannte. Der Frontabschnitt, wo ich mich am nützlichsten machen zu können glaubte, war zugleich der, der auch am dünnsten besetzt zu sein schien. Und dort sah ich natürlich meinen Platz.
Soviel ich weiß, waren das meine einzigen Motive, und es wäre mir sehr lieb, wenn die Leute aus meinem Schweigen zu gewissen umstrittenen Fragen keine fantastischen Schlüsse ziehen würden.
Zum Beispiel muss ein solches Schweigen meinerseits nicht bedeuten, dass ich selbst zwischen den Stühlen stehe. Manchmal ist das der Fall. Auf manche Fragen, über die unter Christen gestritten wird, ist uns meiner Meinung nach keine Antwort mitgeteilt worden. Auf manche werde ich vielleicht die Antwort nie erfahren. Würde ich sie stellen, selbst in einer besseren Welt, so würde ich (nach allem, was ich weiß) möglicherweise dieselbe Antwort darauf erhalten, die einst ein viel größerer Fragesteller zu hören bekam: «Was geht es dich an? Folge du mir nach!» Doch es gibt andere Fragen, bei denen ich genau weiß, auf welchem Stuhl ich sitze, und über die ich dennoch nichts sage. Denn ich schreibe nicht, um etwas zu erklären, was ich «meine Religion» nennen könnte, sondern um das «bloße» Christentum zu erklären, das so ist, wie es ist, und so war, wie es war, lange bevor ich geboren wurde und ob es mir passt oder nicht.
Manche Leute ziehen voreilige Schlüsse aus dem Umstand, dass ich über die Jungfrau Maria nicht mehr sage, als ich sagen muss, um die jungfräuliche Geburt Christi zu bekräftigen. Aber meine Gründe dafür sind doch wohl offensichtlich, oder? Sobald ich mehr darüber sagte, hätte ich mich schon auf heiß umkämpftes Terrain begeben. Und mit keiner anderen Kontroverse unter Christen muss man so behutsam umgehen wie mit dieser. Katholiken vertreten ihre Überzeugungen zu diesem Thema nicht nur mit dem gewöhnlichen Eifer, der jeden aufrichtigen religiösen Glauben kennzeichnet, sondern auch (völlig natürlicherweise) mit der besonderen und, wenn man so will, ritterlichen Empfindsamkeit, die ein Mann verspürt, wenn die Ehre seiner Mutter oder seiner Geliebten auf dem Spiel steht. Wer darin anderer Meinung ist als sie, steht vor ihnen allzu leicht nicht nur als Ketzer da, sondern auch noch als Schuft.
Umgekehrt beschwören die gegensätzlichen protestantischen Überzeugungen zu diesem Thema Gefühle herauf, die an die Wurzeln jeden monotheistischen Glaubens rühren. Strenggläubige Protestanten sehen hier die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf (so heilig es auch sein mag) in Gefahr: Der Polytheismus erhebe sich wieder. Widerspricht man ihnen, so macht man sich verdächtig, noch Schlimmeres zu sein als ein Ketzer – ein Heide. Wenn irgendein Thema geeignet ist, einem Buch über «bloßes» Christentum den Garaus zu machen – wenn irgendein Thema gänzlich unergiebig ist für Leute, die noch nicht daran glauben, dass der Sohn dieser Jungfrau Gott sei –, dann doch wohl dieses.
Kurioserweise kann man aus meinem Schweigen über umstrittene Punkte noch nicht einmal schließen, ob ich sie für wichtig oder unwichtig halte. Denn diese Frage selbst ist ja auch umstritten. Eines der Dinge, über die Christen verschiedener Meinung sind, ist die Wichtigkeit ihrer Meinungsverschiedenheiten. Wenn zwei Christen unterschiedlicher Konfession anfangen, miteinander zu streiten, dauert es meist nicht lange, bis der eine fragt, ob dieser oder jener Punkt denn «wirklich so wichtig» sei, und der andere erwidert: «Wichtig? Na hör mal, diese Frage ist absolut entscheidend!»
Ich sage das alles einfach nur, um deutlich zu machen, was für ein Buch ich hier zu schreiben versuche. Ich will keineswegs meine eigenen Überzeugungen verheimlichen oder mich aus meiner Verantwortung dafür stehlen. Wie gesagt, was ich glaube, ist kein Geheimnis. Um Tristram Shandys Onkel Toby zu zitieren: «Es steht im Gebetbuch geschrieben.»
Die Gefahr war natürlich, dass ich irgendetwas als allgemeingültiges Christentum darstellen könnte, was in Wirklichkeit nur der Church of England oder (schlimmer noch) nur mir selbst eigen ist. Davor versuchte ich mich zu schützen, indem ich das ursprüngliche Manuskript des jetzigen Zweiten Buches an vier Geistliche schickte (einen Anglikaner, einen Katholiken, einen Methodisten und einen Presbyterianer) und sie um ihre Beurteilung bat. Der Methodist fand, ich hätte nicht genug über den Glauben gesagt, und der Katholik meinte, ich hätte die Bedeutung der Theorien, mit denen der Sühnetod Christi erklärt wird, etwas zu sehr heruntergespielt. Ansonsten waren wir uns alle fünf einig. Die übrigen Bücher habe ich keiner solchen «Nagelprobe» unterzogen, weil darin zwar auch Dinge zur Sprache kommen, über die Christen unterschiedlicher Meinung sein können, aber wenn, dann sind es Meinungsverschiedenheiten zwischen Einzelnen oder zwischen Denkschulen, nicht zwischen Konfessionen.
Soweit ich es den Besprechungen und den zahlreichen Briefen, die mir geschrieben werden, entnehmen kann, ist diesem Buch, welche Mängel es sonst auch haben mag, zumindest eines gelungen: Es präsentiert ein einvernehmliches, allgemeines, zentrales oder «bloßes» Christentum. Insofern kann es vielleicht nützlich sein, um der Ansicht entgegenzutreten, wenn wir die umstrittenen Punkte beiseiteließen, bliebe uns nur ein verschwommener, blutleerer gemeinsamer Nenner. Aber dieser gemeinsame Nenner ist in Wirklichkeit nicht nur handfest, sondern auch scharfkantig. Von allen nichtchristlichen Überzeugungen trennt ihn ein Abgrund, mit dem auch die schlimmsten Spaltungen innerhalb des Christentums überhaupt nicht zu vergleichen sind. Wenn ich auch nicht direkt zur Sache der Wiedervereinigung beigetragen habe, so habe ich doch vielleicht deutlich gemacht, warum wir uns wiedervereinigen sollten. Jedenfalls ist mir von überzeugten Mitgliedern anderer Konfessionen als meiner eigenen kaum etwas von dem berüchtigten odium theologicum entgegengeschlagen. Die Feindseligkeit kam mehr von den Grenzgängern, ob innerhalb oder außerhalb der Church of England: von Menschen, die sich zu keiner Gemeinschaft so richtig bekennen wollen. Auf eine eigentümliche Art finde ich das tröstlich. In ihrem Zentrum, wo ihre treuesten Kinder weilen, stehen sich die verschiedenen Konfessionen am nächsten – wenn nicht in der Lehre, so doch im Geist. Und das deutet darauf hin, dass es im Zentrum einer jeden von ihnen etwas – oder jemanden – gibt, der trotz aller unterschiedlichen Überzeugung, aller Verschiedenartigkeit im Temperament, trotz aller Erinnerungen an gegenseitige Verfolgungen in ihnen allen mit derselben Stimme spricht.
So viel zu meiner Zurückhaltung in dogmatischer Hinsicht. Im Dritten Buch, das sich mit der Moral befasst, bin ich ebenfalls über einige Dinge stillschweigend hinweggegangen, allerdings aus einem anderen Grund. Seit meinem Dienst als Infanterist im Ersten Weltkrieg habe ich eine Abneigung gegen Leute, die sich selbst in behaglicher Sicherheit befinden, aber den Männern an der Front allerlei Ermahnungen erteilen. Infolgedessen widerstrebt es mir auch, viel über Versuchungen zu sagen, denen ich selbst nicht ausgesetzt bin.
Kein Mensch, vermute ich, ist für jede Sünde anfällig. Der Impuls zum Beispiel, der Menschen zum Glücksspiel treibt, ist meiner Natur völlig fremd. Zweifellos fehlt mir dafür irgendein guter Impuls, dessen Übertreibung oder Perversion der Hang zum Glücksspiel ist. Deshalb hielt ich mich nicht für qualifiziert, Ratschläge über erlaubtes oder unerlaubtes Glücksspiel zu erteilen – falls es überhaupt jemals erlaubt ist, denn nicht einmal das behaupte ich zu wissen. Auch über Empfängnisverhütung habe ich nichts gesagt, da ich weder eine Frau noch auch nur ein verheirateter Mann bin und ein Priester ebenso wenig. Ich hielt es nicht für angebracht, strenge Richtlinien über Schmerzen, Gefahren und Kosten zu vertreten, vor denen ich selbst bewahrt bin, zumal ich auch kein seelsorgerliches Amt habe, das mich dazu verpflichten würde.
Weit gewichtigere Einwände könnte man dagegen erheben – und sie wurden auch schon geäußert –, dass ich das Wort Christ als Bezeichnung für einen Menschen verwende, der die allgemeinen Lehren des Christentums bejaht. «Wer sind Sie überhaupt», fragen die Leute, «dass Sie festlegen wollen, wer ein Christ ist und wer nicht?» Oder: «Könnte es nicht sein, dass so mancher, der an diese Lehren nicht glauben kann, in Wahrheit viel eher ein Christ ist und dem Geist Christi viel näher steht als manche Gläubigen?»
Nun, in gewissem Sinne ist dieser Einwand völlig richtig, überaus menschenfreundlich, zutiefst geistlich und äußerst feinfühlig. Er vereint alle Vorzüge in sich; nur ist er leider zu nichts nütze. Wir können einfach die Sprache nicht so gebrauchen, wie diese Bedenkenträger es gern hätten, ohne Schiffbruch zu erleiden. Ich will versuchen, dies anhand der Geschichte eines anderen, weitaus weniger wichtigen Wortes deutlich zu machen.
Das Wort Gentleman bezeichnete ursprünglich einmal etwas ganz Bestimmtes, nämlich jemanden, der ein Wappen führte und Land besaß. Wenn man jemanden einen «Gentleman» nannte, so machte man ihm damit kein Kompliment, sondern sprach lediglich einen Sachverhalt aus. Sagte man, jemand sei «kein Gentleman», so beleidigte man ihn damit nicht, sondern man gab eine Information über ihn weiter. Es war kein Widerspruch, wenn man sagte, John sei ein Lügner und ein Gentleman, genauso wenig, wie es heute ein Widerspruch ist, wenn man sagt, James sei ein Dummkopf und ein Dr. phil.
Aber dann kamen Leute und sagten – so richtig, menschenfreundlich, geistlich und feinfühlig, nur leider nicht nützlich: «Ja, sicher, aber was einen Gentleman eigentlich ausmacht, ist doch nicht das Wappen oder das Land, sondern sein Verhalten, oder? Ein wahrer Gentleman ist doch der, der sich so benimmt, wie es sich für einen Gentleman gehört, nicht wahr? In diesem Sinne ist doch Edward viel eher ein Gentleman als John, finden Sie nicht?»
Sie meinten es gut. Wenn man ehrbar und höflich und tapfer ist, ist das natürlich viel mehr wert, als wenn man ein Wappen hat. Nur ist es nicht dasselbe. Und schlimmer noch, es ist nichts, worüber sich alle einig sein werden. Nennt man in diesem neuen, verfeinerten Sinn jemanden einen «Gentleman», so informiert man damit nicht mehr über den Betreffenden, sondern man lobt ihn. Bestreitet man, er sei ein «Gentleman», so beleidigt man ihn nur noch.
Ein Wort aber, das nichts mehr beschreibt, sondern nur noch ein Lob ausdrückt, sagt nichts mehr über einen Gegenstand aus: Es verrät uns lediglich, wie der Sprecher zu dem Gegenstand steht. (Ein «schönes» Essen ist schlicht und einfach ein Essen, das dem Sprecher schmeckt.) Hat man das Wort Gentleman erst einmal durch Vergeistlichung und Verfeinerung von seinem alten ungehobelten, objektiven Sinn befreit, so bedeutet es kaum mehr, als dass der Sprecher den Betreffenden gut leiden kann. Infolgedessen ist Gentleman als Wort nutzlos geworden. Ausdrücke der Wertschätzung hatten wir schon zur Genüge; dafür hätten wir dieses nicht auch noch gebraucht. Will dagegen jemand es (zum Beispiel in einer historischen Abhandlung) in seinem alten Sinn verwenden, so kann er das nicht tun, ohne es erst zu erklären. Es ist für diesen Zweck verdorben.
Wenn wir nun zulassen, dass die Leute anfangen, die Bedeutung des Wortes Christ zu vergeistlichen und zu verfeinern oder, wie sie vielleicht sagen würden, zu «vertiefen», dann wird sehr rasch daraus auch so ein unnützes Wort werden. Das fängt damit an, dass die Christen selbst es für niemanden mehr verwenden könnten. Es kommt uns nicht zu, zu sagen, wer im tiefsten Sinne dem Geist Christi nah oder fern ist. Wir können den Menschen ja nicht ins Herz schauen. Wir können nicht richten; es ist uns sogar verboten. Es wäre bodenlose Überheblichkeit, wenn wir von irgendeinem Menschen behaupten würden, er sei in diesem verfeinerten Sinn ein Christ oder eben nicht. Und es ist klar, dass ein Wort, das wir nie verwenden können, kein sehr nützliches Wort ist.
Die Nichtgläubigen wiederum werden das Wort zweifellos frohgemut in seinem verfeinerten Sinn benutzen. In ihrem Mund wird es sich in ein bloßes Lobeswort verwandeln. Wenn sie jemanden einen Christen nennen, werden sie damit meinen, dass sie ihn für einen guten Menschen halten. Aber diese Verwendung des Wortes wird keine Bereicherung unserer Sprache sein, denn das Wort gut haben wir ja bereits. Dagegen wird das Wort Christ keinerlei sinnvollem Zweck mehr dienen können.
Deshalb müssen wir bei der ursprünglichen, klaren Bedeutung bleiben. Die Bezeichnung Christen wurde erstmals in Antiochien für die «Jünger» verwendet (Apostelgeschichte 11,26), also für diejenigen, die die Lehre der Apostel annahmen. Es ist nirgends die Rede davon, dass sie nur auf die beschränkt worden wäre, die aus dieser Lehre den größtmöglichen Nutzen zogen. Ebenso wenig ist davon die Rede, dass sie auf diejenigen ausgeweitet worden wäre, die auf irgendeine verfeinerte, geistliche, inwendige Weise «dem Geist Christi viel näher» standen als die Unzulänglicheren unter den Jüngern. Es geht hier weder um einen theologischen noch um einen moralischen Punkt. Es geht lediglich darum, Wörter so zu gebrauchen, dass wir alle verstehen, was gesagt wird. Wenn ein Mensch, der die christliche Lehre annimmt, ihr in seiner Lebensführung nicht gerecht wird, ist es viel klarer, ihn einen schlechten Christen zu nennen, als zu sagen, er sei gar kein Christ.
Ich hoffe, es kommt kein Leser auf den Gedanken, das «bloße» Christentum würde hier als Alternative zu den Bekenntnissen der bestehenden Glaubensgemeinschaften vorgeschlagen – so, als könnte man es sich zu eigen machen, statt kongregationalistisch oder griechisch-orthodox oder sonst etwas zu sein. Es ist eher so etwas wie ein Foyer mit mehreren Türen, die in verschiedene Zimmer führen. Wenn ich jemanden in dieses Foyer bringen kann, habe ich erreicht, was ich wollte. Aber die Kaminfeuer, die Stühle und die gedeckten Tische sind in den Zimmern, nicht im Foyer. Im Foyer kann man auf jemanden warten oder verschiedene Türen probieren, aber wohnen kann man dort nicht. Für diesen Zweck, glaube ich, wäre auch das schlechteste Zimmer (welches auch immer das ist) noch vorzuziehen. Freilich kann es sein, dass manche Leute sich einige Zeit im Foyer aufhalten müssen, während andere im Nu genau wissen, an welche Tür sie klopfen müssen. Warum es diese Unterschiede gibt, weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass Gott niemanden warten lässt, es sei denn, er sieht, dass das Warten für den Betreffenden gut ist. Wenn Sie dann schließlich in Ihr Zimmer kommen, werden Sie feststellen, dass das lange Warten Ihnen irgendeinen Nutzen gebracht hat, den Sie sonst nicht gehabt hätten. Aber Sie sollten es als eine Wartezeit betrachten, nicht als dauerhaften Lagerplatz. Sie müssen beharrlich um Wegweisung beten; und natürlich müssen Sie sich auch im Foyer schon bemühen, die Regeln zu beachten, die im ganzen Haus gelten. Vor allem müssen Sie sich von der Frage leiten lassen, welche Tür zur Wahrheit führt, nicht davon, bei welcher Ihnen die Farbe und die Vertäfelung am besten gefallen. Einfach ausgedrückt, sollte die Frage nie lauten: «Gefällt mir diese Art von Gottesdienst?», sondern: «Ist das wahr, was hier gelehrt wird? Gibt es hier Heiligung? Führt mich mein Gewissen in diese Richtung? Wenn ich zögere, an diese Tür zu klopfen, liegt es vielleicht nur an meinem Stolz, an bloßen Geschmacksfragen oder daran, dass mir der Türsteher persönlich unsympathisch ist?»
Wenn Sie dann Ihr Zimmer gefunden haben, seien Sie freundlich zu denen, die sich für andere Türen entschieden haben oder noch im Foyer ausharren. Sollten sie im Irrtum sein, brauchen sie Ihr Gebet umso mehr; und sollten sie gar Ihre Feinde sein, ist es sogar Ihre Pflicht, für sie zu beten. Das ist eine jener Regeln, die im ganzen Haus gelten.
Erstes Buch
Recht und Unrecht als Schlüssel zum Sinn des Universums
1. Das Gesetz der menschlichen Natur
Jeder hat schon einmal Leute miteinander streiten hören. Manchmal hört sich das ulkig an, manchmal auch nur unangenehm. Aber egal, wie es sich anhört: Ich glaube, wir können etwas sehr Wichtiges lernen, wenn wir genau hinhören, was da so alles gesagt wird. Da hört man Sätze wie diese: «Wie würde dir das gefallen, wenn jemand so mit dir umgehen würde?» – «Das ist mein Platz, ich war zuerst hier.» – «Lass ihn doch in Ruhe, er hat dir doch überhaupt nichts getan.» – «Wie kommen Sie dazu, sich so einfach vorzudrängeln?» – «Gib mir was von deiner Apfelsine ab, ich habe dir ja auch von meiner abgegeben.» – «Komm schon, du hast es versprochen.» Solche Sachen sagen die Leute jeden Tag, egal, ob es gebildete oder ungebildete Leute und ob es Kinder oder Erwachsene sind.
Was ich an all diesen Bemerkungen interessant finde, ist, dass derjenige, der so etwas sagt, damit nicht bloß ausdrückt, dass das Verhalten der anderen Person ihm nicht gefällt. Sondern er beruft sich auf irgendeinen Verhaltensmaßstab und geht davon aus, dass dieser auch der anderen Person bekannt ist. Und die Antwort des anderen darauf lautet nur in den seltensten Fällen: «Steck dir deinen Maßstab sonst wohin.» Stattdessen versucht er fast immer, plausibel zu machen, dass sein Verhalten in Wirklichkeit gar nicht gegen den Maßstab verstoße, oder wenn doch, dass es irgendeine besondere Entschuldigung dafür gebe. Er zieht irgendeinen besonderen Grund herbei, warum in diesem speziellen Fall die Person, die zuerst auf dem Platz saß, ihn nicht behalten sollte. Oder er sagt, die Situation sei ja eine ganz andere gewesen, als er ein Stück von der Apfelsine abbekam. Oder es sei irgendetwas dazwischengekommen, weshalb er nun sein Versprechen nicht mehr halten müsse.
Es sieht also ganz danach aus, dass beide Seiten eine Art Gesetz oder irgendwelche Regeln über Fairness und Anstand oder eine Moralvorstellung im Kopf haben, wie auch immer man es nennen will, über die sie sich im Grunde einig sind. Und das sind sie auch. Wäre das nicht der Fall, so könnten sie natürlich miteinander kämpfen wie Tiere, aber sie könnten nicht im menschlichen Sinne des Wortes miteinander streiten. Streiten heißt, dass man dem anderen zu beweisen versucht, dass er im Unrecht ist. Und das wäre ja ein ziemlich sinnloses Unterfangen, wenn nicht eine gewisse Einigkeit darüber bestünde, was eigentlich Recht und was Unrecht ist. Es hätte ja auch keinen Sinn, einem Fußballer zu sagen, dass er ein Foul begangen hat, wenn man sich nicht über die Spielregeln beim Fußball grundsätzlich einig wäre.
Dieses Gesetz oder diese Regeln über Recht und Unrecht nannte man früher das Naturrecht. Das ist nicht zu verwechseln mit den «Naturgesetzen» wie der Schwerkraft oder der Vererbung oder den Gesetzen der Chemie. Die alten Denker hingegen meinten, wenn sie das Gesetz von Recht und Unrecht «Naturrecht» nannten, im Grunde das Gesetz der menschlichen Natur. Ebenso wie alle physikalischen Körper dem Gesetz der Schwerkraft und alle Organismen den biologischen Gesetzen unterliegen, so der Gedanke, unterlag auch das Geschöpf namens Mensch seinem Gesetz – nur mit einem großen Unterschied: Ein Körper konnte sich nicht aussuchen, ob er dem Gesetz der Schwerkraft gehorchte oder nicht. Ein Mensch hingegen konnte wählen, ob er dem Gesetz der menschlichen Natur gehorsam oder ungehorsam war.
Wir können das noch anders ausdrücken. Jeder Mensch unterliegt in jedem Augenblick mehreren verschiedenen Arten von Gesetzen, aber nur bei einem einzigen davon hat er die Freiheit, ihm ungehorsam zu sein. Als physikalischer Körper unterliegt er der Schwerkraft, gegen die er sich nicht wehren kann. Lässt man ihn mitten in der Luft los, so kann er sich genauso wenig wie ein Stein aussuchen, ob er fallen will oder nicht. Als Organismus unterliegt er verschiedenen biologischen Gesetzen, gegen die er ebenso wenig ausrichten kann wie ein Tier. Das heißt, den Gesetzen, die er mit anderen Dingen gemeinsam hat, kann er nicht ungehorsam sein. Das Gesetz jedoch, das allein seine menschliche Natur betrifft und das er nicht mit Tieren oder Pflanzen oder unbelebten Dingen gemein hat, ist das einzige, dem er ungehorsam sein kann, wenn er will.
Dieses Gesetz wurde Naturrecht genannt, weil die Leute meinten, jeder Mensch kenne es von Natur aus und müsse es nicht erst beigebracht bekommen. Damit meinten sie natürlich nicht, dass man nicht hier und da einen seltsamen Kauz finden könne, der es nicht kennt. Schließlich stößt man ja auch gelegentlich auf Leute, die farbenblind sind oder kein Ohr für Melodien haben. Aber auf die Menschheit als Ganzes gesehen, war man der Meinung, eine gewisse Vorstellung von anständigem Verhalten müsse für alle offensichtlich sein. Und ich glaube, damit hatte man recht. Wäre das nicht so, dann wären all die Dinge, die wir über den Krieg gesagt haben, nichts als Unsinn. Was hätte es für einen Sinn, zu sagen, dass der Feind im Unrecht war, wenn das Recht nicht etwas wirklich Vorhandenes wäre, was die Nazis im Grunde genauso gut kannten wie wir und woran sie sich hätten halten müssen? Hätten sie keine Ahnung gehabt, was wir mit Recht meinen, dann hätten wir wohl immer noch gegen sie kämpfen müssen, aber wir hätten ihnen dafür genauso wenig einen Vorwurf machen können wie für ihre Haarfarbe.
Ich weiß, manche Leute sagen, die Vorstellung eines Naturrechts oder eines von allen Menschen anerkannten anständigen Verhaltens sei nicht schlüssig, weil es in verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche ethische Vorstellungen gegeben habe.
Aber das stimmt nicht. Es gab zwar durchaus ethische Unterschiede, aber von einer völligen Verschiedenartigkeit kann keine Rede sein. Wenn jemand sich die Mühe machen will, die Sittenlehren, sagen wir, der alten Ägypter, Babylonier, Hindus, Chinesen, Griechen und Römer miteinander zu vergleichen, dann wird er staunen, wie ähnlich sie einander und unserer eigenen Sittenlehre sind. Einige Belege dafür habe ich im Anhang eines anderen Buches namens Die Abschaffung des Menschen zusammengetragen. Für unsere augenblickliche Fragestellung brauche ich meine Leser jedoch nur zu bitten, einmal zu überlegen, was eine völlig andersartige Sittenlehre bedeuten würde.
Stellen Sie sich ein Land vor, in dem man Bewunderung dafür erntet, dass man im Kampf die Flucht ergreift, oder in dem man stolz darauf ist, gerade die Leute, die einen besonders freundlich behandeln, aufs Kreuz zu legen. Genauso gut könnte man versuchen, sich ein Land vorzustellen, in dem zwei und zwei fünf ergibt. Es hat zwar immer unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, welchen Menschen gegenüber man sich selbstlos verhalten sollte – ob nur gegenüber den eigenen Angehörigen, gegenüber den eigenen Landsleuten oder gegenüber allen. Aber man war sich immer einig, dass man nicht immer nur auf den eigenen Vorteil aus sein sollte. Selbstsucht wurde noch nie bewundert. Es gab unterschiedliche Meinungen darüber, ob ein Mann eine Frau haben darf oder vier. Aber es herrschte immer Einigkeit darüber, dass er nicht einfach jede Frau haben kann, die ihm gefällt.
Das Bemerkenswerteste aber ist Folgendes. Immer wenn Sie jemanden treffen, der behauptet, er glaube nicht daran, dass es Recht und Unrecht wirklich gibt, werden Sie feststellen, dass derselbe Mensch das im nächsten Atemzug zurücknimmt. Vielleicht bricht er ein Versprechen, das er Ihnen gegeben hat, aber wenn Sie versuchen, ein Versprechen ihm gegenüber zu brechen, wird er sich im Nu beklagen: «Das ist nicht fair!» Eine Nation kann sagen, Verträge seien ohne Belang; doch im nächsten Moment wird sie sich verplappern und sagen, der Vertrag, den sie zu brechen gedenkt, sei ohnehin ungerecht. Aber wenn Verträge ohne Belang sind und es so etwas wie Recht und Unrecht in Wirklichkeit gar nicht gibt – mit anderen Worten, wenn ein Naturrecht nicht existiert –, wo liegt dann der Unterschied zwischen einem gerechten und einem ungerechten Vertrag? Haben sie damit nicht die Katze aus dem Sack gelassen und bewiesen, dass sie das Naturrecht im Grunde genauso gut kennen wie alle anderen?
Wie es scheint, müssen wir uns also der Tatsache stellen, dass es Recht und Unrecht wirklich gibt. Es kann zwar vorkommen, dass Leute sich in ihrem Urteil darüber irren, wie es ja auch vorkommt, dass Leute Rechenfehler machen. Aber Recht und Unrecht sind genauso wenig eine Frage des Geschmacks oder der Meinung wie das Einmaleins.
Wenn wir uns darüber nun einig sind, komme ich zu meinem nächsten Punkt, nämlich dem folgenden: Niemand von uns hält das Naturrecht wirklich ein. Sollte es unter Ihnen Ausnahmen geben, so bitte ich um Entschuldigung. Wen das betrifft, der sollte lieber ein anderes Buch lesen, denn nichts von dem, was ich hier sagen werde, ist für ihn von Belang.
Und nun zu den gewöhnlichen Sterblichen, die verblieben sind: Ich hoffe, Sie verstehen das, was ich jetzt sagen werde, nicht falsch. Ich will Ihnen keine Predigt halten und mich schon gar nicht als etwas Besseres hinstellen als andere Leute. Ich möchte nur auf eine Tatsache aufmerksam machen, nämlich die Tatsache, dass wir selbst es in diesem Jahr, in diesem Monat oder höchstwahrscheinlich an diesem Tag schon versäumt haben, das Verhalten zu praktizieren, das wir von anderen Leuten erwarten.
Natürlich haben wir vermutlich alle möglichen Entschuldigungen. Als Sie neulich so ungerecht zu den Kindern waren, da waren Sie einfach übermüdet. Und diese etwas zwielichtige Geldangelegenheit – die, die Sie schon fast vergessen haben – spielte sich ab, als Sie gerade ziemlich in der Klemme saßen. Und Ihr Versprechen gegenüber dem alten Soundso, das Sie nie eingelöst haben – nun, Sie hätten ihm das gar nicht erst zugesagt, wenn Sie geahnt hätten, dass Sie so entsetzlich viel zu tun haben würden. Was Ihr Benehmen gegenüber Ihrer Frau (oder Ihrem Mann) oder Ihrer Schwester (oder Ihrem Bruder) angeht – ja, wenn ich wüsste, wie die einem auf die Nerven gehen können! Dann würde ich mich nicht darüber wundern – und wer zum Kuckuck bin ich überhaupt?
Ich bin ja ganz genauso. Das soll heißen, mir gelingt es auch nicht sehr gut, mich an das Naturrecht zu halten. Und sobald mich jemand darauf aufmerksam macht, dass ich mich nicht daran halte, fallen mir endlose Ausreden ein. Dabei ist die Frage im Moment nicht, ob das gute Ausreden sind. Der Punkt ist, dass sie ein weiterer Beweis dafür sind, wie fest wir, ob wir wollen oder nicht, an das Naturrecht glauben. Denn wenn wir nicht daran glaubten, dass es anständiges Verhalten gibt, warum sollten wir dann so eifrig Entschuldigungen dafür vorbringen, dass wir uns nicht anständig verhalten haben?
Die Wahrheit ist, dass wir so fest an den Anstand glauben und uns so sehr unter dem Druck dieser Regeln oder dieses Gesetzes fühlen, dass wir es einfach nicht ertragen können, zu wissen, dass wir es übertreten. Also versuchen wir die Verantwortung von uns abzuwälzen. Denn Sie merken ja, dass wir nur für unser schlechtes Verhalten immerzu nach Erklärungen suchen. Nur unsere schlechte Laune schreiben wir der Müdigkeit, den Sorgen oder dem Hunger zu. Unsere gute Laune buchen wir auf unser eigenes Konto.
Dies sind also die beiden Punkte, die ich darlegen wollte. Erstens, dass die Menschen auf der ganzen Welt dieser seltsamen Vorstellung anhängen, sie sollten sich auf eine bestimmte Weise verhalten, und dass sie diese Vorstellung einfach nicht loswerden. Zweitens, dass sie sich de facto aber nicht so verhalten. Sie kennen das Naturrecht, und sie übertreten es. Diese beiden Tatsachen sind die Grundlage für jedes klare Denken über uns selbst und das Universum, in dem wir leben.
2. Einige Einwände
Wenn sie die Grundlage sind, sollte ich mir lieber die Zeit nehmen, diese Grundlage zu befestigen, bevor ich weitermache. Manche Briefe, die ich bekommen habe, zeigen, dass eine ganze Menge Leute Mühe damit haben, zu verstehen, was genau dieses Gesetz der menschlichen Natur oder dieses Sittengesetz oder diese Regel des anständigen Verhaltens denn eigentlich ist.
Zum Beispiel haben einige Leute mir geschrieben: «Ist das, was Sie das Sittengesetz nennen, nicht einfach nur unser Herdeninstinkt, der sich genauso entwickelt hat wie alle unsere anderen Instinkte?» Nun, ich bestreite nicht, dass wir vielleicht einen Herdeninstinkt haben; aber das ist nicht das, was ich mit dem Sittengesetz meine.
Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, von einem Instinkt zu etwas getrieben zu werden – von der Mutterliebe, dem Sexualinstinkt oder dem Instinkt, sich Nahrung zu verschaffen. Instinkt bedeutet, dass man ein starkes Bedürfnis oder Verlangen danach empfindet, etwas ganz Bestimmtes zu tun. Und natürlich treibt uns manchmal genau so ein Verlangen dazu, einem anderen Menschen zu helfen. Zweifellos ist dieses Verlangen auf den Herdeninstinkt zurückzuführen. Aber wenn man ein Verlangen verspürt, jemandem zu helfen, ist das etwas ganz anderes, als wenn man das Gefühl hat, man sollte jemandem helfen, ob man will oder nicht.
Angenommen, Sie hören den Hilfeschrei eines Mannes in Gefahr. Dies löst in Ihnen vermutlich zwei verschiedene Arten von Verlangen aus – zum einen das Verlangen, zu helfen (das auf Ihren Herdeninstinkt zurückzuführen ist), zum anderen das Verlangen, sich von der Gefahr fernzuhalten (das auf Ihrem Selbsterhaltungsinstinkt beruht). Doch neben diesen beiden Impulsen werden Sie in Ihrem Innern noch etwas Drittes finden, das Ihnen sagt, Sie sollten dem Impuls zum Helfen folgen und den Impuls zum Davonlaufen unterdrücken.
Nun kann dieses dritte Phänomen, das über die beiden Instinkte urteilt und entscheidet, welcher davon bejaht werden sollte, nicht selbst einer dieser beiden sein. Genauso gut könnten Sie sonst sagen, das Notenblatt, das Ihnen sagt, welche Taste des Klaviers Sie in einem gegebenen Moment anschlagen sollen, sei selbst eine der Tasten der Klaviatur. Das Sittengesetz sagt uns, welche Melodie wir spielen sollen. Unsere Instinkte sind lediglich die Tasten.
Eine andere Möglichkeit, sich klarzumachen, dass das Sittengesetz nicht bloß einer unserer Instinkte ist, ist folgende: Wenn zwei Instinkte im Widerstreit miteinander liegen und sich im Kopf des Geschöpfs nichts anderes befindet als diese beiden Instinkte, dann muss offensichtlich der stärkere der beiden gewinnen. Doch gerade in den Momenten, in denen uns das Sittengesetz besonders bewusst ist, scheint es uns meistens zu sagen, dass wir uns auf die Seite des schwächeren der beiden Triebe stellen sollen. Wenn es nach Ihrem Verlangen geht, wollen Sie sich wahrscheinlich viel lieber in Sicherheit bringen als dem Ertrinkenden helfen. Doch das Sittengesetz fordert Sie auf, ihm trotzdem zu helfen.