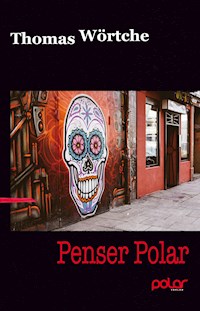
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Seit September 2013 erscheint monatlich im Netz das Onlinemagazin Polar Gazette, das sich mit jeder neuen Ausgabe einem Thema des Genres Krimi widmet. Sei es „Muss ein Krimi immer gut enden . . . muss er nicht!" oder „Hat der Krimi einen Sound?" Thomas Wörtche schreibt die Kolumnen, die das Genre mal literaturwissenschaftlich, mal mit einem Augenzwinkern unter die Lupe nimmt. Alle Kolumnen erscheinen nun im Polar Verlag. Mit „Polar Penser", deren Texte von Thomas Wörtche neu überarbeitet wurden, unterstreichen wir einmal mehr, dass der Krimi mehr ist, als er scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Wörtche
Penser Polar
Polar Verlag
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2015© 2015 Polar Verlag GmbH HamburgAlle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeinerForm (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unterVerwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigungdes Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden..Lektorat: Robert SchekulinUmschlaggestaltung: Detlef Kellermann, Robert NethAutorenfoto: Christine FenzlSatz: Andre MannchenGesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesignISBN: 978-3-945133-29-3eISBN: 978-3-945133-30-9
www.polar-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Anfänge
Theorie
Pulp
Schubladen
Deutschkrimi
Gerechtigkeit
Komik
Suspense
Gewalt
Töten
Motiv
Perspektive
Epigonen
Liebe
Familie
Fatal
Politik
Rettung
Unterwegs
New York
Knast
Jazz
Rebell
Die unheilvolle Neigung, über die Dinge nicht mehr nachzudenken, sobald sie nicht mehr zweifelhaft sind, hat die Hälfte aller menschlichen Irrtümer zu verantworten.Blaise Pascal
Einleitung
Penser Polar ist aus den monatlichen Kolumnen entstanden, die in der Polar Gazette seit 2013 monatlich erschienen sind. Die Idee war, zum jeweiligen Thema der Ausgabe eine Art „Feuilleton“ zu schreiben. Also keinen lexikografischen Artikel, keinen gelehrten Aufsatz, sondern heiteren freestyle. Herausgekommen sind, wie ich beim Überarbeiten und beim neu Sortieren gemerkt habe, dreiundzwanzig unsystematische Stückchen zur allgemeinen Verunsicherung.
Seit „Krimis“ ihren Siegeszug in der Publikumsgunst angetreten haben, scheint immer mehr Menschen klar zu sein, was ein Krimi ist oder zu sein hat. Ich weiß es immer noch nicht. Und je mehr Gewissheiten und feste Ansichten darüber da draußen herumgeistern, umso mehr reizt es mich, ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Unsystematisch, pointillistisch, abschweifend, paradox. Notfalls widersprüchlich, wenn es die Texte, um die sich alles dreht, erfordern.
Denn eines ist klar: Kriminalliteratur ist weit mehr und anderes als das, was im heutigen Verständnis damit assoziiert wird. Kriminalromane sind keine Texte, die einfach so für sich in der Gegend herumlungern. Sie haben ihre Geschichte als Genre, und diese Geschichte ist wiederum alles andere als isoliert zu verstehen. Sie sind Teil der Literaturgeschichte. Sie stehen in Kontexten. Sie sind konstitutiv mit allen anderen Parametern der menschlichen Geschichte verbunden – mit Politik, Kulturgeschichte, mit Soziologie, Ästhetik, Medienhistorie, Psychologie und Philosophie. Das macht die Dinge komplizierter, aber auch bedeutend erfreulicher. Versucht man, sie in diesen unendlich vielen und unendlich verschiedenartigen Spannungs- und Beziehungsgeflechten anzuschauen, versucht man also, möglichst viele neugierige Scheinwerferaugen auf sie zu richten, desto vielfältiger, bunter und strahlender beginnen sie zu leuchten.
Manchmal schwant mir auch, dass wir eigentlich einen neuen Begriff bräuchten – angesichts dessen, was massenweise als „Krimi“ produziert und konsumiert wird, und das, was Kriminalliteratur alles auch ist und kann, kommen mir manchmal Begriffe wie „Vielfältigkeit“ verdächtig und unrichtig vor. Seitdem die gnadenlose Klonierung einiger weniger Erfolgsformeln um sich gegriffen hat, scheint eher eine gewisse Monokultur zu entstehen. Das zieht sich von den großen Romanfabriken bis zu den Selfpublishern durch. Krimi wird auf einen vermuteten kleinsten gemeinsamen Nenner für ein möglichst breites Publikum hin produziert. Was nicht passt, wird misstrauisch beäugt und lieber abgelehnt als freudig willkommen geheißen. Wir sagen „Krimi“ und meinen etwas jeweils ganz anderes.
„Krimi“ ist inflationär geworden. Krimi nervt. Krimi verspielt jegliche Reputation, wenn er sich in vorauseilendem Gehorsam jeder noch so albernen Zumutung des Marketings unterwirft. Das ist manchmal sogar kreuzkomisch. Und darauf kann man eigentlich nur mit dem gebotenen Unernst reagieren. Was wiederum die ganze Angelegenheit vergnüglicher macht. Mentale Schubumkehr, sozusagen.
Ich hoffe natürlich, dass auch Sie ein bisschen Vergnügen an den kleinen Textchen haben, die Sie unterhalten und manchmal stutzen lassen sollen. Ich kann nichts dafür, dass manche Dinge dann doch ein bisschen anders sind als man glaubt. Und wenn Sie am Ende auch nicht mehr so ganz genau wissen, was ein Krimi ist, würde mich das sehr freuen.
Berlin, im Juni 2015Thomas Wörtche
Anfänge
Man wird kaum gefragt, wann man angefangen hat, Bücher zu lesen. Man wird jedoch relativ oft gefragt, wie man zum Lesen von Kriminalromanen gekommen ist. Da steckt schon ein klein wenig Voyeurismus drin, so etwa: Wann hast Du Deine erste Zigarette, Deinen ersten Suff, Dein erstes . . . Und so weiter. Und dann werden sie meistens auch brav abgeliefert, die kriminalliterarischen Initiationserlebnisse: Unter der Bettdecke, heimlich, meine Eltern wollten das nicht . . . Und natürlich Geständnisse, die menschlich sind, allzu menschlich. Je nach Generation „Drei Fragezeichen“, Edgar Wallace, Enid Blyton, Jerry Cotton, Agatha Christie, so Sachen. Man kennt die Rituale und die pawlowschen Antworten.
Damit kann ich nicht dienen. Ich habe früh angefangen zu lesen, kreuz und quer, Akzent Stevenson, Cooper, C.S. Forester, um dann zum Snob mit viel Distinktionsgewinn in meinem Umfeld zu werden: Musil, Proust, Joyce, Thomas Bernhard, Kafka und alle Surrealisten, und Alfred Jarry und . . . Und wenn mir ein Krimi begegnete, wurde er sofort verachtet – Agatha Christie, was für arg schlichte Gemüter, Dorothy Sayers, konservativer Unfug, Jerry Cotton, was für´n Wannabe-Quatsch. Und als juicy books hatte man die Mutzenbacher, Oscar Wilde, Apollinaire und Georges Bataille, Crepax und natürlich Henry Miller, da brauchte man keinen James Hadley Chase, Carter Brown und Konsorten.
Die Attitüde von damals war peinlich, der jugendliche Sturm und Drang hochfahrend und -trabend.
Aber – so falsch lag ich gar nicht. Ich kann immer noch nichts mit Krimis anfangen, die den Mörder suchen, den sie selbst versteckt haben, oder welche, die ein paar Jahre oder Jahrzehnte später auf irgendwelchen Zeitgeistwellen daher gesurft kommen, die im Nicht-Krimiland schon längst durch sind, oder die Simplifizierung zu ihrem Geschäft machen und so was dann als wahrhaft populär ausgeben, weil doch der Leser ein recht schlichtes Kerlchen oder Mädel sei, für den man alles Mündchens Maß vorkauen muss. So ein Leser wollte ich nicht sein und war es auch nicht. Deshalb war ich von Krimis wenig beeindruckt. Lange, lange Lesejahre. Dann kam die Science Fiction, so Ende der 1960s, Anfang der 1970s. Und Mitte der 1970s Eric Ambler, Ross Thomas, Chester Himes . . .
Und es gab einen herben Rückschlag, als ich an der Uni in einer Art „Literarischem Kolloquium“ einen frühen Roman von -ky verteidigen musste. Man hat dort debattieren gelernt, indem man einen Roman oder Gedichtband oder was auch immer gegen die massive Kritik aller anderen auf Biegen und Brechen defendieren musste – oder man ging unter. Mit wehender Fahne oder gurgelnd. Ich hatte -ky gewählt, um zu zeigen: Hier, Leute, es gibt auch deutsche Krimis, die sogar von Hochschullehrern geschrieben werden. Leider hatte ich das Teil vorher nicht gelesen. Ich ging unter. Gurgelnd. Und vor allem zu Recht. Das Buch, ich habe verdrängt welches, war so grottig, dass meine Mitdiskutanten drüber herfielen wie ein Schwarm Wanderameisen über eine tote Maus, und das mit allen guten Gründen der Welt, und retten konnte ich es beim besten Willen nicht. Es war keine „Literatur“, und es war keine keine „Literatur“, also kein Pulp oder Trash oder so, was leicht zu verteidigen gewesen wäre. Es wollte Krimi und gleichzeitig literarisch sein, spannend, aber gleichzeitig ein moralischer Diskurs, es wollte links und radikal sein, und man spürte den Beamtenstatus des Autors in jeder Zeile. Und es machte es den Snobs unter den Krimiverächtern sehr, sehr leicht, es zu zernichten. Und auch das völlig zurecht.
Nun wird man aus gekränkter Eitelkeit heraus nicht unbedingt zum Fan von irgendwas. Ich wurde auch kein „Freund“ der Kriminalliteratur, so wie man zum Freund dunklen Bieres wird, ihr Fan schon gar nicht. Ich „liebe“ Kriminalliteratur nicht, ich liebe den einen und anderen Menschen, mehr schaff ich nicht. Und Artefakte wollen auch nicht geliebt werden, das ist der neue Gefühligkeitskitsch, der aus vielen Ecken der sozialen Netzwerke quillt und vor allem der schlimmsten aller Lektürehaltungen, dem identifikatorischen Lesen, als emotionaler Kleister dient.
Und gerade mit Gefühligkeit hat Kriminalliteratur wenig zu tun. Kleine einsame Eisinseln, nannte Jerome Charyn einmal sinngemäß die Prosatexte von Dashiell Hammett. Die kühle Eleganz eines Eric Ambler und der Witz und die Intelligenz on the rocks, die die Romane von Ross Thomas auszeichneten – all das hatte die „seriöse“ Literatur nur in den wenigsten Fällen zu bieten und schon gar nicht im Zusammenhang mit Themen wie Steuervermeidung, der Korruption von Staatsmännern oder der Austauschbarkeit von Kriminalität und kapitalistischem Wirtschaftsgebaren. Sie konnte, und so begann meine Geschichte mit der Kriminalliteratur, was andere Literatur nicht konnte. Oder sie konnte es zumindest besser. Besser heißt: Intelligenter, leichtfüßiger, witziger, analytischer, akrobatischer, spannender, unterhaltsamer, klüger und vor allem radikaler. Das Allerschönste: Es stand nicht in Leuchtschrift drauf, es wurde kein Bohei darum gemacht.
Das Gemachtsein, das Artifizielle von Texten musste nicht ihr Thema sein, denn obwohl sie hochartifiziell waren und sind, haben sie Sachen zu erzählen: Stoffe, Thema, Plot. Dinge, die, würden sie anders erzählt, auch anders wahrgenommen würden. Oder gar nicht. Oder nur am Rande. Da, wo man „Kriminalität“ am liebsten hätte, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Realität. Deswegen hat man ja gern schlechte Kriminalliteratur, die sich auch noch als Literatur fühlt, in manchen Kreisen am liebsten. Dort rückt sie in die Mitte der literarischen Gesellschaft, weil man ihre hanebüchenen Plots und Stoffe nicht so ernst nehmen muss und sie auf Kosten ihrer Literarizität ignorieren kann. Und diese „Literarizität“ ist dann auch meistens noch ziemlich inferior. Die Pfauenräder, die heute mediokre Autoren wie Henning Mankell oder Jo Nesbø schlagen, wenn sie als die Shakespeares von heute das Publikum beeindrucken wollen, hätten Eric Ambler oder Ross Thomas ein mildes Lächeln entlockt. Wenn überhaupt, während sie die eigentlichen Beiträge zu Comédie Humaine verfassten.
Es geht um Anfänge und um Beginn. Nicht darum, dass früher alles besser war. Tatsächlich konnte man vielleicht durch die offene Lektüre von Kriminalromanen symbolischen Distinktionsgewinn in sozialen verwandeln, während man heute, wo alle Welt „Krimis“ liest, sich als deren Verächter vorteilhafter positionieren kann (wobei man aber schon wieder verloren hätte, weil man zeigt, dass man die wirklich coole Kriminalliteratur nicht kennt und bloß Donna Leon verachtet – Sie sehen, es wird kompliziert!), aber das ist sooo interessant auch wieder nicht.
Interessanter ist, ob man die Welt anders sieht, wenn man in den intellektuellen Prägejahren eine bestimmte Literatur gelesen oder nicht gelesen hat. Ist, wer Naturlyrik liest, lyrisch gestimmt? Liest, wer meint, die Welt sei zu enträtseln, Agatha Christie? Oder lesen Finanzmanipulatoren Eric Ambler, weil sie sich von ihm verstanden wissen? Und welches Bild haben junge Leser von heute vom Umgang der Geschlechter, wenn sie hauptsächlich Thriller lesen, in denen Frauen zerteilt, gemartert und geschändet werden, gewohnheitsmäßig, sozusagen? Oder lesen sie Thriller, in denen Frauen gewohnheitsmäßig zerteilt, gemartert und geschändet werden, weil sie so was aus der Realität nicht kennen, es aber gerne würden (kennen und gar selber tun)? Oder weil sie es sich selbst nicht trauen, sich aber von den Cleaves, Etzolds & Co. verstanden fühlen? Und warum sind viele dieser Leser weiblich? Wo liegen da die Anfänge? Sind Lektüreprägungen auch ästhetisch-moralische Prägungen? Habe ich als Patricia-Highsmith-Leser notwendigerweise den bösen Blick auf meine Mitmenschen? Oder lese ich Patrícia-Melo- oder Zoë-Beck-Romane, weil ich das Gefühl habe, sie können mir mit ihrer Kunst noch neue scheußlichkomische Facetten von homo sapiens zeigen, auf die selbst ich noch nicht gekommen bin?
Auf der Ebene verschwinden dann übrigens wieder die Unterschiede. Ich kann mir auch von William Shakespeare ein paar wirklich üble Nummern über unsere Spezies verpassen lassen, auf die ein Schlachteplatteanrichter wie Wulf Dorn in seiner Einfalt ein paar hundert Jahre später immer noch nicht gekommen ist. Während umgekehrt eine gut/ böse-Gemengelage à la Jerome Charyn auch einen Renaissancepapst zum Grübeln gebracht hätte.
Kriminalliteratur wäre dann nur noch formal zu unterscheiden. Und genau wegen ihrer formalen Unterscheidbarkeit mochte ich sie in meinen und in ihren genrehistorischen Anfängen überhaupt nicht.
Ein Grundparadox? Eigentlich nicht, aber schon wichtig, weil da der missglückte Anfang zu dem eher fröhlichen (na ja vorläufigen) Ende führt, dass Kriminalroman, Thriller oder welche Schublade auch immer wir bemühen wollen, eben keine „Form“ sind, sondern nur verschiedene Arten, die Welt zu erzählen. Eine „Formel“ braucht es nicht, ein paar Standardsituationen schon (aber die braucht jede narration zur schnellen Verständigung über das, was der Fall ist), den Rest erledigt der Plot – und der ist sprachlich, also ästhetisch organisiert.
Deswegen sind Romane von Ross Thomas, Elmore Leonard oder Robert Littell Kunstwerke der Entgrenzung. Sie sabotieren die U/E-Grenzen, die Grenzen von Fiktion und Realität, von Wahrheit und Lüge, von Gewissheit und Skepsis. Sie mischen die Verhältnisse von kreativer Distanz und emotionaler Identifikation neu. Sie beschäftigen sich mit Atavismen wie Gewalt und Macht und spüren sie in der Mitte der Gesellschaft auf, wo sie ansonsten sehr aufwändig verdrängt werden oder als umhegt und eingefriedet gelten.
Am Anfang stand der Verdacht, dass Crime Fiction alles das könne. Hier und heute könnte man allmählich anfangen, es zu akzeptieren.
Everybody knows the dice are loadedLeonard Cohen
Theorie
Brauchen Kriminalromane Theorie? Auf dem Cover von Jochen Vogts unverzichtbarer Sekundärliteratur-Sammlung „Der Kriminalroman“ steht als Untertitel „Poetik. Theorie. Geschichte“. Das liest sich eher wie ein Wunschkatalog denn wie ein Inhaltsverzeichnis und wäre vermutlich mit einem Fragezeichen versehen korrekter.
Mit der „Geschichte“ fängt es schon an. Es gibt, soweit ich sehe, keine einzige brauchbare „Geschichte der Kriminalliteratur“ – weder eine nationale noch eine internationale. Wie auch? Alleine die bibliografische Erfassung der weltweit meistproduzierten Literatur treibt hartgesottene Maniaken wie den geschätzten Claude Mesplède oder sein deutsches Pendant, den Buchhändler und Sammler Thomas Przybilka, weit über die Grenzen ihrer Kapazitäten, so wie auch schon Klaus-Dieter Walkhoff-Jordan mit seiner deutschen Krimi-Bibliografie einfach nicht mehr nachkam, nachdem der Markt in den 1990ern explodiert war, und wenn man genau schaut, auch schon lange vorher. Denn was man vor zwei oder drei Jahrzehnten über den südamerikanischen, afrikanischen oder asiatischen Kriminalroman noch nicht wusste, sollte einem heute noch die Schamesröte ins Gesicht treiben. Natürlich gibt es inzwischen großartige Einzelstudien wie die von Doris Wieser über den lateinamerikanischen Kriminalroman, aber auch die müssen sich beschränken, weil z.B. Lateinamerika nun alles andere ist als ein einheitlicher Kulturraum. Ähnliches gilt für Afrika und Asien. Zwischen dem Maghreb und der Republik Südafrika liegen nicht umsonst ein paar tausend Kilometer. Und manche „Räume“ machen mehr Sinn als Staatengrenzen oder Sprachräume. Der „Kulturraum“ Mittelmeer zum Beispiel, von der Türkei bis nach Spanien und Marokko, den man dann allerdings wiederum mit den verschiedenen kriminalliterarischen und literarischen und überhaupt mit den jeweils sehr unterschiedlichen verschiedenen narrativen Kontexten und Einflüssen synchronisieren müsste. Da reichen alberne Grafiken über „Krimis und ihre Schauplätze“ nicht wirklich aus.
Wenn wir diese Diskussion jetzt auch noch diachron wenden, wird´s ganz finster. Selbst beim guten „deutschen“ Krimi, für den man gern irgendwelche obskuren und musealen „Vorläufer“, Krimis avant la lettre und andere Fossilien ausgräbt (lesen mag das zopfige Zeug sowieso niemand, warum auch), ohne die einfache Frage zu stellen, was eine ex post rekonstruierte „Tradition“, die nicht die geringste Relevanz für die „aktuelle“ Produktion der, sagen wir, letzten 50, 60 Jahre hatte, überhaupt für einen Erkenntnisgewinn haben soll.
Ähnlich steht es mit der „Poetik“. Natürlich gibt es immer wieder die Frage, was denn ein „guter Krimi“ sei. Dabei handelt es sich vermutlich um die zeitgenössische Sehnsucht nach einer Art „Regelpoetik“, an der man beckmesserisch abarbeiten kann, was sie so als einzelne Merkmale für einen gelungenen Kriminalroman anbietet und was vor allem die eigene Urteilsfähigkeit nicht allzu sehr herausfordert. Außer den berühmten „Regeln“ von S.S. van Dine und den seltsam rituellen Selbstverpflichtungen von Autoren des Golden Age, nach denen niemals der Gärtner der Mörder sein dürfe (oder ähnliche Albernheiten), gibt es keine Regeln, und diese hoffentlich nicht ernst gemeinten Regularien hatten eh nicht den geringsten Einfluss auf die literarische Praxis ihrer Zeit und auf deren whodunnits, bei denen Wirklichkeits- und Wahrscheinlichkeits-Beugung schlicht und einfach dazugehörte. Und sei´s als Ausweis für den bewussten Anti-Realismus, mit dem man Mord-Spiele nach der bis dato größten Mordorgie, dem Ersten Weltkrieg, wieder in die literarische und vermutlich auch gesellschaftspolitische Vor-Moderne zurückscheuchen wollte.
Aber diese eher drolligen Versuche einer Reglementierung, die – anders als zu Zeiten „echter Regelpoetiken“ à la Opitz oder Gottsched, die schon damals viel Unsinn angerichtet haben – nicht mehr im geistes-, kultur-, religions-, erkenntnistheoretischen oder sonstigen Kontext der Zeit abgesichert waren, stehen doch am Anfang der allgemeinen Rede über die berühmten „Regeln des Genres“, die erfüllt oder überschritten oder verletzt oder außer Kraft gesetzt werden oder mit denen „gespielt“ wird. Besonders gerne wird auch, nebenbei bemerkt, „mit den Versatzstücken des Genres gespielt“, vor allem dann, wenn diese Formel auf Klappentexten oder in verteidigenden Rezensionen misslungener Bücher auftaucht. Übersetzt heißt das meistens: „Der Autor weiß nicht so recht, was er da macht, das Ganze ist in die Hose gegangen, aber wir verkaufen´s dem Leser mal als Absicht“.
Daraus folgt, dass es diese Regeln wohl geben müsse und dass sie allgemeinverbindliche Normen vorgeben, selbst da, wo sie negiert werden: „In der Negation bleibt das Negierte bestehen“, according to Wolfgang Iser. Ja, sicher dat. Und so entsteht ein Galimathias wirrer Redeversatzstücke über Krimis, die umso selbstverständlicher genutzt werden, je weniger man sie auf ihre Validität geprüft hat oder dazu in der Lage ist. Nein, es gibt keine Regeln des Genres, keine Gesetze. Die gibt es nur in den Bauanleitungen von formula fiction, der es nicht um Literatur geht, schon gar nicht um Kriminalliteratur, sondern um die größtmögliche Anzahl vermutlich verkaufbarer Exemplare.
Aus dieser unübersichtlichen Lage resultiert auch der Irrtum, Kriminalliteratur sei eine „Form“ – oder zumindest zwei „Formen“, der Detektivroman und der Thriller, was gattungstheoretischer Unfug ist, und nicht tiefer reicht als eine ganz schnelle Einschätzung und die Verständigung darüber zu liefern: Krimi ist mit Mord und Aufklärung und Aufklärer, Thriller nicht unbedingt.
Mehr sagt diese Unterscheidung nicht. Weder „Krimi“ noch „Thriller“ haben eine meaning of structure. Ihre literarische Struktur kann unendlich variieren. Beide können alles sein. Ideologische Machwerke, brillante Literatur, erkenntnistheoretische Wüsten und blühende ästhetische Landschaften. Wenn man sofort ahnt, wie ein Buch läuft, hat man vermutlich ein Exemplar formula fiction erwischt. Wenn nicht, könnte man es mit Literatur zu tun haben. Oder auch nicht. „Als Thriller gut, dennoch Punkteabzug bei Amazon, weil kein Krimi, ich aber keine Thriller mag“, so grenzdebil sehen in letzter Konsequenz die „Urteile“ aus, die dergleichen Schein-Kategorien ausgelöst haben. Könnte eine Poetik der Kriminalliteratur da helfen?
Oder eine Theorie? Ach, je, Sie ahnen es – was ist eine Theorie der Kriminalliteratur? Was beschreibt sie, was will sie, wo könnten ihre Intentionen liegen? Es gibt zig verschiedene „Kriminalliteraturen“, es gibt Subgenres, es gibt enorme Ausfächerungen und noch nicht einmal einen tragfähigen Begriff, was denn „Kriminalliteratur“ sei. Und all das mit einer jeweils eigenen Theorie, Philosophie oder Poetik ausgestattet, ergäbe eine unüberschaubare Menge an kleinteiliger, oft kurzlebiger Theoreme, Theoriechen, eigentlich Theorikel, mit denen man weder produktions- noch rezeptionsästhetisch etwas anfangen kann.
Warum auch? Wenn Denker wie Carlo Ginzburg oder Luc Boltanski über „Kulturtechniken“ der Moderne philosophieren oder soziologisieren, dass etwa deduktive Verfahren von verschiedenen Berufsgruppen angewendet werden, darunter auch fiktionale Helden wie Auguste Dupin oder Sherlock Holmes, so ist das keine Theorie über oder von Kriminalliteratur, sondern lediglich deren, obendrein reichlich evidente, Kontextualisierung. Und ansonsten metaphorisches Reden, das zum Gegenstand „Kriminalliteratur“ wenig zu sagen hat.
„Die Moderne“ und „der Kriminalroman“ (man bedenke nur die schier unendlichen Ausdifferenzierungen dieser Begriffe und deren sachliche Extension, um meinen wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Schauder nachzuvollziehen) haben natürlich insoweit miteinander zu tun, als dass das eine im anderen, also der Kriminalroman in der Moderne stattfindet. That´s it. Und dass beide mit ähnlichen Strukturen arbeiten, ist ebenfalls ein rein metaphorischer Satz und beliebig konjugierbar. Gesellschaften und ihr semantisches Material stehen in einem irgendwie gearteten Verhältnis zueinander, das hat Niklas Luhmann schon richtig gesehen. In welchem genau, das wissen wir immer noch nicht. Eine Theorie oder Philosophie des Kriminalromans wird es uns nicht sagen. Höchstens einzelne Texte, aber dann reden wir von Interpretationen von Kriminalromanen. Die wiederum sehr sinnvoll sind. Aber zur Interpretation gehört zunächst eine Textbeschreibung und dann eher eine Theorie der Interpretation als gleich eine Metatheorie des Kriminalromans, die sich meist die Beschreibung schenkt. Denn die ist mühsam, kostet Arbeit und Sorgfalt und verlangt vor allem Sachkenntnis. Und da machen wir doch lieber schnell mal irgendeine „Theorie“ und hoffen, wir kommen damit durch. Und so entsteht dann meistens wieder kategorialer Unfug oder irgendwelche Meinungen („Ich find das Buch blöd“ – „Ich nicht“ – schön, dass wir mal drüber gesprochen haben . . .) und letztlich der elende „Literatur-Tipp“, wie ihn die Marketing-Abteilungen am liebsten hätten.
Überhaupt Philosophie, Theologie oder andere Großsysteme. Die funktionieren in Kriminalromanen wie jeder andere circumstantial realism auch, mehr ist da nicht. Wenn Ludwig Wittgenstein gerne Kriminalromane gelesen hat, hat das kaum Auswirkungen auf die Substanz seiner philosophischen Theorie. Wenn Autoren in Kriminalromanen gerne Wittgenstein zitieren, heißt das, dass entweder der Held des Romans Wittgenstein mag oder nicht mag oder der Autor ihn mag oder nicht mag oder dass er mit schicken Verweisen seinen Text ein bisschen bildungsprestigemäßig hochpimpen will oder weiß der Geier. Eine strukturelle Analogie des „Tractatus“ mit einem Thriller möchte ich gerne demonstriert bekommen. Dass der Marxismus als Weltanschauung in Kriminalromanen stecken kann, no problem with me, und manche Krimis haben sogar katholische Implikationen, die selbst hartgesottene Säkularisten aus ästhetischen Gründen bei Gilbert Keith Chesterton schätzen können. Das ganze Schuld- und Sühne-Ding kann man in eine „Theologie des Kriminalromans“ pressen, wobei die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal von crime fiction genau an diesem Punkt im Unterschied zu „Macbeth“ durchaus für Verlegenheit sorgen würde (und kommen Sie jetzt bitte nicht damit, dass auch Shakespeare Krimis geschrieben hat – der nächste kategoriale Unfug, der unentwegt daher gebetet wird, bis man Kopfschmerzen bekommt).





























