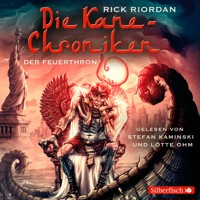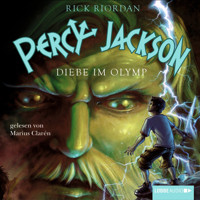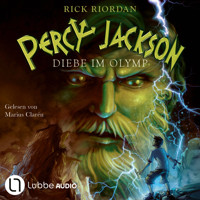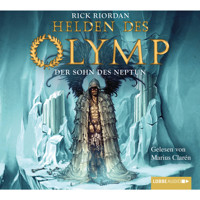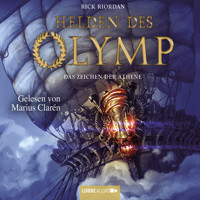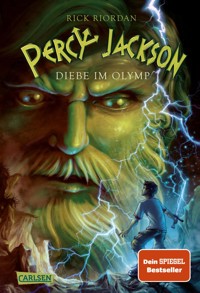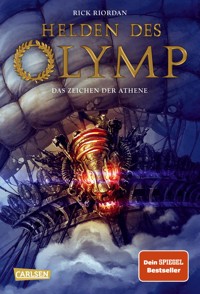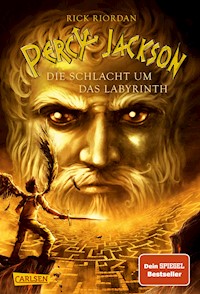
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Action, Witz und unterirdische Gefahren Unterhalb des Camp Half-Blood liegt ein geheimes Labyrinth! Und seit Tagen träumt Percy von einer unheimlichen Bedrohung, die damit in Verbindung steht. Klar, dass Percy, Annabeth und Grover erkunden, was es damit auf sich hat. Doch das Labyrinth besteht nicht nur aus verwirrenden Gängen und Rätseln, sondern auch aus versteckten Fallen, dunklen Geheimnissen und blutrünstigen Kreaturen. Aber damit nicht genug: Der Titan Kronos und seine Verbündeten schmieden eine Verschwörung gegen die Götter des Olymp. Jetzt ist Multitasking angesagt. Percy muss die Intrigen stoppen und sich gleichzeitig den tödlichen Herausforderungen des Labyrinths stellen. Die Jugendbuch-Bestsellerserie mit nachtragenden Ungeheuern und schrulligen Göttern Als Percy Jackson erfährt, dass er ein Halbgott ist und es die Kreaturen aus der griechischen Mythologie wirklich gibt, verändert das alles. Von nun an stehen ihm und seinen Freunden allerlei Monster, göttliche Streitigkeiten und epische Quests bevor. Gespickt mit Heldentum, Chaos und Freundschaft ist die Fantasy-Reihe rund um den Halbgott Percy Jackson inzwischen millionenfach verkauft. Der Mix aus Spannung, Witz und Mythologie begeistert Jung und Alt aus mehr als 40 Ländern und es ist die bekannteste Serie von Rick Riordan. ***Griechische Götter in der Gegenwart: chaotisch-wilde Fantasy für junge Leser*innen ab 12 Jahren und für alle Fans der griechischen Mythologie***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Rick Riordan:
Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Die Armee des Kronos wird immer stärker! Nun ist auch Camp Half-Blood nicht mehr vor ihr sicher, denn das magische Labyrinth des Dädalus hat einen geheimen Ausgang mitten im Camp. Nicht auszudenken, was passiert, wenn der Titan und seine Verbündeten den Weg dorthin finden! Percy und seine Freunde müssen das unbedingt verhindern. Unerschrocken treten sie eine Reise ins Unbekannte an, hinunter in das unterirdische Labyrinth, das ständig seine Form verändert. Und hinter jeder Biegung lauern neue Gefahren …
Alle Bände der »Percy Jackson«-Serie: Percy Jackson – Diebe im Olymp (Band 1) Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen (Band 2) Percy Jackson – Der Fluch des Titanen (Band 3) Percy Jackson – Die Schlacht um das Labyrinth (Band 4) Percy Jackson – Die letzte Göttin (Band 5) Percy Jackson – Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane (Sonderband)
Percy Jackson erzählt: Griechische Göttersagen Percy Jackson erzählt: Griechische Heldensagen
Und dann geht es weiter mit den »Helden des Olymp«!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Glossar
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Für Becky,
die mir immer den Weg durch
Ich kämpfe gegen einen Haufen Cheerleader
Das Letzte, was ich in meinen Sommerferien wollte, war, noch eine Schule in die Luft fliegen zu lassen. Aber da saß ich nun am ersten Montag im Juni im Wagen meiner Mom vor der Goode High School in der East 81st Street.
Die Goode School war ein riesiges Haus aus braunem Klinker mit Blick auf den East River. Vor dem Gebäude standen massenweise BMWs. Als ich an dem eleganten Torbogen hochschaute, fragte ich mich, wie schnell ich wohl von dieser Schule geworfen werden würde.
»Ganz ruhig.« Meine Mom klang überhaupt nicht ruhig. »Das ist schließlich nur ein Schnuppertreffen. Und denk daran, Lieber, das hier ist Pauls Schule. Also versuch bitte, sie nicht zu … du weißt schon.«
»Zerstören?«
»Ja.«
Paul Blofis, der Freund meiner Mutter, stand vor der Schule auf der Treppe und begrüßte angehende Neuntklässler. Mit seinen grau gesprenkelten Haaren, seinen Jeans und seiner Lederjacke sah er aus wie ein Fernsehschauspieler, dabei war er nur Englischlehrer. Er hatte die Goode School überreden können, mich in die neunte Klasse aufzunehmen, obwohl ich von allen Schulen geflogen war, die ich jemals besucht hatte. Ich hatte versucht, ihm klarzumachen, dass das keine gute Idee war, aber er wollte nicht auf mich hören.
Ich sah meine Mom an. »Du hast ihm nicht die Wahrheit über mich gesagt, oder?«
Mom trommelte nervös mit den Fingern auf das Lenkrad. Sie war angezogen wie für ein Bewerbungsgespräch – sie trug ihr bestes blaues Kleid und hochhackige Schuhe.
»Ich dachte, das hätte noch Zeit«, gab sie zu.
»Damit wir ihn nicht vergraulen.«
»Heute wird schon nichts passieren, Percy. Es ist doch nur ein Vormittag.«
»Klasse«, murmelte ich. »Dann kann ich ja gefeuert werden, noch ehe das Schuljahr überhaupt angefangen hat.«
»Positiv denken. Morgen geht’s ins Camp. Und nach dem Schnuppertreffen hast du dein Date …«
»Das ist kein Date!«, widersprach ich. »Das ist nur Annabeth, Mom. Himmel!«
»Immerhin kommt sie den ganzen Weg vom Camp hierher, nur um sich mit dir zu treffen.«
»Von mir aus.«
»Und dann geht ihr ins Kino.«
»Jaja.«
»Nur ihr zwei!«
»Mom!«
Sie hob ihre Hände, wie um sich zu ergeben, aber ich wusste, dass sie sich alle Mühe gab, nicht zu lächeln. »Geh jetzt lieber rein, Schatz. Wir sehen uns heute Abend.«
Ich wollte gerade aus dem Auto steigen, als ich noch mal zur Schultreppe hinüberschaute. Paul Blofis begrüßte ein Mädchen mit roten Kraushaaren. Sie trug ein kastanienbraunes T-Shirt und zerfetzte und mit Filzstiftzeichnungen verzierte Jeans. Als sie sich umdrehte, konnte ich für einen Moment ihr Gesicht sehen, und die Haare auf meinen Armen sträubten sich.
»Percy?«, fragte meine Mom. »Was ist los?«
»N-nichts«, stotterte ich. »Hat die Schule einen Seiteneingang?«
»Rechts um den Block rum. Warum?«
»Bis nachher!«
Meine Mom wollte etwas sagen, aber ich sprang aus dem Auto und rannte los, in der Hoffnung, dass die Rothaarige mich nicht sehen würde.
Was wollte die denn bloß hier? Nicht einmal ich konnte so ein Pech haben!
Doch, konnte ich. Und ich sollte bald feststellen, dass mein Pech noch viel größer war.
Es gelang mir nicht sonderlich gut, mich zum Schnuppertreffen hineinzuschleichen. Zwei Cheerleaderinnen in lila-weißen Uniformen standen am Seiteneingang und warteten nur darauf, Neulinge überfallen zu können.
»Hi!« Sie lächelten und ich ging davon aus, dass damit zum ersten und letzten Mal irgendwelche Cheerleader freundlich zu mir gewesen waren. Die eine war blond und hatte eisige blaue Augen; die andere war eine Afroamerikanerin und hatte dunkle Locken wie die Medusa (und ihr könnt mir glauben, ich weiß, wovon ich rede). Beide hatten ihre Namen in Schreibschrift auf die Uniformen gestickt, aber für mich als Legastheniker sahen die Wörter aus wie sinnlose Spaghetti.
»Willkommen an der Goode School«, sagte die Blonde. »Du wirst begeistert sein.«
Aber als sie mich von Kopf bis Fuß musterte, sagte ihre Miene eher: Uääh, was ist denn das für ein Versager?
Die andere trat unangenehm dicht an mich heran. Ich vertiefte mich in die Stickerei auf ihrer Uniform und las »Kelli« daraus. Sie roch nach Rosen und nach etwas, das ich vom Reitunterricht im Camp her kannte – nach frisch gewaschenen Pferden. Für eine Cheerleaderin war das ein seltsamer Geruch. Vielleicht hatte sie ja ein Pferd. Jedenfalls kam sie so dicht an mich heran, dass ich das Gefühl hatte, sie wollte mich die Treppe hinunterschubsen.
»Wie heißt du, Fisch?«
»Fisch?«
»Frischling?«
»Äh, Percy.«
Die Mädchen wechselten einen Blick.
»Ach, Percy Jackson«, sagte die Blonde. »Wir warten schon auf dich.«
Das jagte mir einen heftigen Oha-Schauer über den Rücken. Sie verstellten den Eingang und lächelten auf eine nicht gerade freundliche Weise. Meine Hand stahl sich instinktiv zu meiner Hosentasche, in der ich Springflut aufbewahrte, meinen tödlichen Kugelschreiber.
Dann hörte ich aus dem Gebäude eine Stimme. »Percy?« Das war Paul Blofis, irgendwo weiter hinten auf dem Gang. Ich hatte mich noch nie so sehr darüber gefreut, seine Stimme zu hören.
Die Cheerleaderinnen wichen zurück. Ich drängelte mich so ungeduldig an ihnen vorbei, dass ich Kelli aus Versehen mit dem Knie am Oberschenkel traf.
Kling.
Ihr Bein gab einen hohlen metallischen Klang von sich, als ob ich eine Fahnenstange getroffen hätte.
»Au«, murmelte sie. »Pass doch auf, Fisch.«
Ich schaute nach unten, aber ihr Bein sah aus wie jedes andere stinknormale Bein. Ich war zu verdutzt, um Fragen zu stellen. Ich rannte den Gang entlang und die Cheerleaderinnen lachten hinter mir her.
»Da bist du ja!«, sagte Paul zu mir. »Willkommen an der Goode!«
»Hallo, Paul – äh, Mr Blofis!« Ich schaute mich um, aber die Cheerleaderinnen waren verschwunden.
»Percy, du siehst aus, als wäre dir gerade ein Gespenst begegnet.«
»Ja, äh …«
Paul klopfte mir auf den Rücken. »Hör mal, ich weiß, dass du nervös bist, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben hier eine Menge Schüler mit ADHD und Legasthenie. Die Lehrer wissen, wie sie da helfen könnten.«
Ich hätte fast lachen mögen. Wenn ADHD und Legasthenie doch nur meine größten Probleme gewesen wären! Ich wusste natürlich, dass Paul mir nur helfen wollte, aber wenn ich ihm die Wahrheit über mich erzählte, würde er mich entweder für verrückt halten oder schreiend davonlaufen. Diese Cheerleaderinnen, zum Beispiel – ich hatte ein echt mieses Gefühl, was die anging …
Dann schaute ich durch den Gang und mir fiel ein, dass ich noch ein Problem hatte. Die Rothaarige, die ich draußen auf der Treppe gesehen hatte, kam gerade durch den Haupteingang.
Bitte, sieh mich nicht, betete ich.
Sie sah mich. Ihre Augen weiteten sich.
»Wo wird denn nun geschnuppert?«, fragte ich Paul.
»In der Turnhalle. Da lang. Aber …«
»Bis dann.«
»Percy?«, rief er, aber ich war schon losgerannt.
Ich dachte, ich hätte sie abgeschüttelt.
Eine Menge Kids steuerte auf die Turnhalle zu, und bald war ich nur noch einer von dreihundert Vierzehnjährigen, die sich auf der Zuschauertribüne zusammendrängten. Eine Blaskapelle spielte ein verstimmtes Kampflied, das sich anhörte, als würde jemand mit einem metallenen Baseballschläger auf einen Sack voller Katzen einschlagen. Ältere Kids, vermutlich Mitglieder der Schülervertretung, führten die Schuluniform von Goode vor und sahen alle nach Mann, sind wir cool aus. Lehrer liefen hin und her, lächelten und schüttelten Schülerhände. Die Wände der Turnhalle waren bedeckt mit riesigen lila-weißen Bannern mit Aufschriften wie WILLKOMMEN, FRISCHLINGE, GOODE IST GUT, WIR SIND ALLE EINE GROSSE FAMILIE und anderen glücklichen Sprüchen, die in mir gleich Brechreiz aufkommen ließen.
Die anderen Frischlinge sahen auch nicht begeistert aus. Ich meine, im Juni zum Schnuppertreffen gehen zu müssen, wo das Schuljahr doch erst im September anfängt, ist echt ziemlich uncool. Aber auf Goode »bereiten wir uns darauf vor, ganz früh ganz weit vorne zu sein«. Das hatte jedenfalls im Schulprospekt gestanden. Die Blaskapelle hörte auf zu spielen. Ein Typ im Nadelstreifenanzug trat ans Mikrofon und redete los, aber in der Turnhalle gab es ein solches Echo, dass ich keine Ahnung hatte, was er da sagte. Er hätte auch gurgeln können.
Jemand packte mich an der Schulter.
»Was machst du denn hier?«
Sie war es, mein rothaariger Albtraum.
»Rachel Elizabeth Dare«, sagte ich.
Ihr fiel das Kinn herunter, als ob sie es nicht fassen könnte, dass ich die Frechheit besaß, mich an ihren Namen zu erinnern. »Und du bist Percy Soundso; im Dezember, als du versucht hast, mich umzubringen, hab ich deinen vollständigen Namen nicht mitbekommen.«
»Hör mal, ich wollte nicht … ich habe nicht … was machst du überhaupt hier?«
»Dasselbe wie du, vermute ich mal. Schnuppertreffen.«
»Du wohnst in New York?«
»Hast du vielleicht gedacht, am Hoover-Damm?«
Ich hatte mich das nie gefragt. Wann immer ich an sie gedacht hatte (und ich sage nicht, dass ich an sie gedacht hatte, sie tauchte nur ab und zu in meinen Gedanken auf, okay?), stellte ich mir immer vor, dass sie in der Nähe des Hoover-Damms wohnte, einfach weil sie mir dort begegnet war. Wir hatten zehn Minuten miteinander verbracht, in denen ich sie aus Versehen mit dem Schwert bedroht hatte; sie hatte mir das Leben gerettet und ich war von einer Bande übernatürlicher Mordmaschinen davongejagt worden. Ihr wisst schon, so eine typische Zufallsbegegnung.
Irgendwer hinter uns flüsterte: »He, Mund halten. Die Cheerleaderinnen wollen etwas sagen!«
»Hallo, Leute!«, blubberte ein Mädchen ins Mikrofon. Und zwar die Blonde, die mir am Eingang begegnet war. »Ich bin die Tammi, und das hier, ist, äh, die Kelli.« Kelli schlug ein Rad.
Neben mir wimmerte Rachel, als ob sie jemand mit einer Stecknadel gestochen hätte. Ein paar Kids schauten herüber und kicherten, aber Rachel und ich starrten nur voller Entsetzen die Cheerleader an. Tammi schien das alles nicht bemerkt zu haben. Sie redete nur darüber, wie toll wir uns in unserem Frischlingsjahr ins Schulleben einbringen könnten.
»Weg hier«, sagte Rachel zu mir. »Sofort.«
»Warum?«
Rachel gab keine Antwort. Sie drängte sich zum Rand der Tribüne durch und ignorierte die stirnrunzelnden Lehrer und protestierenden Kids, die sie anrempelte.
Ich zögerte. Tammi erklärte gerade, dass wir uns jetzt in kleine Gruppen aufteilen und uns die Schule ansehen würden. Kelli fing meinen Blick auf und lächelte belustigt, als ob sie gespannt sei, was ich wohl tun würde. Wenn ich jetzt abhaute, würde das einen schlechten Eindruck machen. Paul Blofis saß bei den übrigen Lehrern. Er würde sich fragen, was in mich gefahren war.
Dann dachte ich an Rachel Elizabeth Dare und ihre besondere Fähigkeit. Sie hatte im vergangenen Winter am Hoover-Damm eine Gruppe von Sicherheitswächtern sehen können, die gar keine Sicherheitswächter waren, sie waren nicht einmal Menschen. Mit hämmerndem Herzen stand ich auf und lief hinter ihr her aus der Turnhalle.
Ich fand Rachel im Musiksaal. Sie versteckte sich bei den Schlagzeugen hinter einer Basstrommel.
»Rüber da!«, sagte sie. »Kopf einziehen!«
Ich kam mir reichlich blöd vor, als ich mich hinter einem Haufen Bongos verkroch, aber ich ging neben ihr in die Hocke.
»Sind sie dir gefolgt?«, fragte Rachel.
»Du meinst die Cheerleaderinnen?«
Sie nickte nervös.
»Ich glaube nicht«, sagte ich. »Was sind das für Wesen? Was hast du gesehen?«
Ihre grünen Augen leuchteten vor Angst. Die Sommersprossen in ihrem Gesicht erinnerten mich an Sternbilder. Ihr kastanienbraunes T-Shirt hatte die Aufschrift HARVARD KUNSTGESCHICHTLICHE FAKULTÄT. »Du … du würdest mir doch nicht glauben.«
»O doch, das würde ich«, versprach ich. »Ich weiß, dass du durch den Nebel sehen kannst.«
»Den was?«
»Den Nebel. Das ist … na ja, das ist wie ein Schleier, der verbirgt, wie die Dinge wirklich sind. Einige Sterbliche werden mit der Fähigkeit geboren, hindurchzusehen. So wie du.«
Sie musterte mich forschend. »Das hast du schon am Hoover-Damm gesagt. Du hast mich als sterblich bezeichnet. Als ob du das nicht wärst.«
Ich hätte auf die Bongos einschlagen mögen. Was hatte ich mir bloß dabei gedacht? Ich würde das niemals erklären können. Es hatte keinen Zweck, es überhaupt zu versuchen.
»Sag schon«, bat sie. »Du weißt, was das alles bedeutet. Die ganzen schrecklichen Dinge, die ich sehe.«
»Ich weiß, das hört sich jetzt komisch an. Aber weißt du irgendwas über griechische Mythen?«
»So wie … Minotaurus und Hydra?«
»Ja, aber sag ihre Namen nicht, wenn ich in der Nähe bin, ja?«
»Und die Furien«, sie kam in Fahrt, »und die Sirenen, und …«
»Okay!« Ich schaute mich im Musikzimmer um, überzeugt, dass Rachel jeden Moment eine Bande von blutrünstigen Ungeheuern aus den Wänden platzen lassen würde, aber noch waren wir allein. Ich hörte, wie eine Meute von Kids aus der Turnhalle kam und über den Gang lief. Sie fingen jetzt mit den Gruppenführungen an. Uns blieb nicht viel Zeit zum Reden.
»Diese Monster«, sagte ich, »die ganzen griechischen Gottheiten – die sind echt.«
»Ich wusste es!«
Mir wäre wohler gewesen, wenn sie mich als Lügner bezeichnet hätte, aber Rachel sah aus, als ob soeben ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt worden wären.
»Du hast ja keine Ahnung, wie schwer das war«, sagte sie. »Jahrelang habe ich gedacht, ich würde verrückt. Ich konnte es niemandem sagen. Ich konnte …« Sie kniff die Augen zusammen. »Moment. Wer bist du? Ich meine, in Wirklichkeit?«
»Ich bin kein Monster.«
»Das weiß ich. Sonst würde ich das sehen. Du siehst aus wie … du. Aber du bist kein Mensch, oder?«
Ich schluckte. Obwohl ich drei Jahre Zeit gehabt hatte, mich daran zu gewöhnen, wer ich war, hatte ich noch nie mit einer normalen Sterblichen darüber gesprochen – abgesehen von meiner Mom, aber die hatte ja schon Bescheid gewusst. Ich weiß nicht, warum, aber ich ließ es darauf ankommen.
»Ich bin ein Halbblut«, sagte ich. »Ich bin halb menschlich.«
»Und halb was?«
In diesem Moment betraten Tammi und Kelli den Musiksaal. Die Türen knallten hinter ihnen ins Schloss.
»Da bist du ja, Percy Jackson«, sagte Tammi. »Zeit für dein Schnuppertreffen.«
»Die sind grauenhaft«, keuchte Rachel.
Tammi und Kelli trugen noch immer ihre lila-weißen Cheerleader-Uniformen und hielten noch ihre Pompons von der Parade in der Hand.
»Wie sehen sie wirklich aus?«, fragte ich, aber Rachel war zu entsetzt, um zu antworten.
»Ach, hör nicht auf die.« Tammi lächelte mich strahlend an und kam auf uns zu. Kelli blieb an der Tür stehen und versperrte uns den Ausgang.
Sie hatten uns in die Falle gelockt. Ich wusste, wir würden uns den Weg freikämpfen müssen, aber Tammis umwerfendes Lächeln lenkte mich ab. Ihre blauen Augen waren wunderschön und die Art, wie ihre Haare über ihre Schultern fielen …
»Percy«, sagte Rachel warnend.
Ich sagte etwas ungeheuer Intelligentes, wie »Ähä?«.
Tammi kam näher. Sie hielt mir ihre Pompons entgegen.
»Percy!« Rachels Stimme schien von weit her zu kommen. »Reiß dich zusammen!«
Ich brauchte alle meine Willenskraft, aber ich schaffte es, meinen Kugelschreiber aus der Tasche zu ziehen und die Kappe abzudrehen. Springflut wuchs zu einem neunzig Zentimeter langen Bronzeschwert heran, seine Klinge verströmte ein schwaches goldenes Licht. Tammis Lächeln verwandelte sich in ein hämisches Grinsen.
»Ach, hör doch auf«, sagte sie. »Das brauchst du doch nicht. Wie wäre es stattdessen mit einem Kuss?«
Sie roch nach Rosen und sauberem Tierfell – ein seltsamer, aber irgendwie berauschender Duft.
Rachel kniff mir energisch in den Arm. »Percy, sie wird dich beißen! Sieh sie dir doch bloß an!«
»Die ist nur eifersüchtig.« Tammi sah sich zu Kelli um. »Darf ich, Herrin?«
Kelli verstellte noch immer die Tür und leckte sich hungrig die Lippen. »Na los, Tammi. Das machst du gut.«
Tammi trat noch einen Schritt vor, aber nun richtete ich meine Schwertspitze auf ihre Brust. »Zurück!«
Sie bleckte die Zähne. »Frischlinge«, sagte sie angewidert. »Das hier ist unsere Schule, Halbblut. Wir fressen, wen wir wollen!«
Dann fing sie an, sich zu verwandeln. Aus ihrem Gesicht und ihren Armen wich die Farbe. Ihre Haut wurde kalkweiß, ihre Augen leuchtend rot und in ihrem Mund wuchsen Reißzähne.
»Ein Vampir«, stammelte ich. Dann sah ich ihre Beine unter dem Cheerleader-Rock. Ihr linkes Bein war braun und zottig und hatte einen Eselshuf; ihr rechtes Bein dagegen schien geformt wie ein Menschenbein, es war jedoch aus Bronze. »Oh, ein Vampir mit …«
»Erwähne ja nicht die Beine!«, fauchte Tammi. »Es ist unhöflich, Witze über sie zu machen.«
Sie schob sich auf ihren seltsamen, nicht zueinanderpassenden Beinen voran. Sie sah einfach bizarr aus, vor allem wegen der Pompons, aber ich konnte nicht lachen – nicht, solange ich diese roten Augen und die scharfen Reißzähne sah.
»Ein Vampir, hast du gesagt?« Kelli lachte. »Diese alberne Sage geht auf uns zurück, Dummkopf. Wir sind Empusen, Dienerinnen der Hekate.«
»Mmm.« Tammi schob sich dichter an mich heran. »Dunkle Magie hat uns aus Tier, Bronze und Geist erschaffen. Wir existieren, um uns vom Blut junger Männer zu ernähren. Also los, gib mir einen Kuss!«
Sie bleckte die Reißzähne. Ich konnte mich vor Schreck nicht bewegen, Rachel dagegen warf der Empusa eine Snare-Drum an den Kopf.
Die Dämonin zischte und wehrte die Trommel ab. Sie kullerte zwischen den Notenständern hindurch und die Schnarrsaiten rasselten. Rachel warf ein Xylofon hinterher, aber die Dämonin wischte auch das einfach beiseite.
»Normalerweise töte ich keine Mädchen«, knurrte Tammi. »Aber bei dir, Sterbliche, mache ich eine Ausnahme. Du siehst mir ein wenig zu scharf.«
Sie holte aus.
»Nein!« Ich schlug mit Springflut zu. Tammi versuchte, der Klinge auszuweichen, aber ich durchschnitt ihre Uniform und mit einem grauenhaften Schrei zerfiel sie zu Staub, der auf Rachel herabrieselte.
Rachel hustete. Sie sah aus, als ob gerade ein Sack Mehl über ihr entleert worden wäre. »Heftig!«
»Bei Monstern ist das eben so«, sagte ich. »Tut mir leid.«
»Du hast meinen Lehrling umgebracht!«, schrie Kelli. »Du brauchst eine Lektion über Schulgeist, Halbblut!«
Dann fing auch sie an sich zu verändern. Ihre drahtigen Haare verwandelten sich in züngelnde Flammen. Ihre Augen wurden rot. Ihr wuchsen Reißzähne. Sie sprang auf uns zu, und ihr Messingfuß und der Huf machten auf dem Boden des Musiksaals verschiedene Geräusche. »Ich bin die Ober-Empusa«, knurrte sie. »Seit tausend Jahren schon hat mich kein Heros mehr besiegt.«
»Ach ja?«, fragte ich. »Dann wird es aber höchste Zeit!«
Kelli war sehr viel schneller als Tammi. Sie wich meiner Faust aus und rollte zwischen die Blasinstrumente, wobei sie mit viel Getöse eine Reihe Posaunen zu Boden gehen ließ. Rachel konnte sich gerade noch retten. Ich schob mich zwischen sie und die Empusa. Kelli umkreiste uns, ihre Augen wanderten zwischen mir und dem Schwert hin und her.
»Was für eine hübsche kleine Klinge«, sagte sie. »Wie schade, dass sie zwischen uns steht!«
Ihr Erscheinungsbild änderte sich dauernd – mal war sie Dämonin, mal hübsche Cheerleaderin. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, aber das war sehr verwirrend.
»Armes Herzchen.« Kelli kicherte. »Du hast keine Ahnung, was hier läuft, oder? Bald wird dein hübsches kleines Camp in Flammen aufgehen, deine Freunde werden Sklaven des Herrn der Zeit werden und du kannst nichts tun, um das zu verhindern. Es wäre barmherzig, dein Leben jetzt zu beenden, damit du das nicht mit ansehen musst.«
Vom Gang her hörte ich Stimmen. Eine Schnuppergruppe näherte sich. Ein Mann sagte etwas über abschließbare Schränke und deren Ziffernkombinationen.
Die Augen der Empusa leuchteten auf. »Hervorragend. Wir bekommen Gesellschaft!«
Sie griff zu einer Tuba und warf damit nach mir. Rachel und ich zogen die Köpfe ein. Die Tuba segelte über uns hinweg und zerschlug die Fensterscheibe.
Die Stimmen auf dem Gang verstummten.
»Percy!«, rief Kelli mit gespielt ängstlicher Stimme. »Warum hast du das geworfen?«
Ich war zu verdutzt, um zu antworten. Kelli packte einen Notenständer und erwischte damit eine Reihe von Klarinetten und Flöten. Stühle und Musikinstrumente krachten auf den Boden.
»Aufhören!«, sagte ich.
Jetzt hörten wir jede Menge Stimmen auf dem Gang, und alle kamen in unsere Richtung.
»Zeit, unseren Besuch zu begrüßen!« Kelli bleckte ihre Fangzähne und stürzte auf die Tür zu. Ich setzte mit Springflut hinter ihr her. Ich musste verhindern, dass sie den Sterblichen etwas antat.
»Percy, nicht!«, schrie Rachel. Aber ich begriff erst, was Kelli vorhatte, als es zu spät war.
Kelli riss die Tür auf. Paul Blofis und eine Gruppe von Frischlingen wichen erschrocken zurück. Ich hob mein Schwert.
In letzter Sekunde drehte die Empusa sich wie ein verängstigtes Opfer zu mir um. »Nicht, bitte!«, rief sie. Ich konnte meine Klinge nicht mehr anhalten, sie war schon in Bewegung.
Unmittelbar bevor die himmlische Bronze sie traf, ging Kelli wie ein Molotowcocktail in Flammen auf. Eine Feuerwelle übergoss sie von Kopf bis Fuß. Ich hatte das noch nie bei einem Monster erlebt, aber ich hatte auch keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, und wich in den Musiksaal zurück, als die Flammen die Türöffnung füllten.
»Percy?« Paul Blofis sah aus wie vom Blitz getroffen und starrte mich über das Feuer hinweg an. »Was hast du denn getan?«
Schüler schrien und jagten den Flur entlang. Der Feueralarm heulte los. Sprinkleranlagen in der Decke erwachten zischend zum Leben.
Mitten in dem ganzen Chaos zog Rachel mich am Ärmel. »Du musst raus hier!«
Sie hatte Recht. Die Schule stand in Flammen und mir würden sie die Schuld dafür zuschieben. Sterbliche ließen sich vom Nebel täuschen. Für sie würde es aussehen, als ob ich gerade vor einer Gruppe von Zeugen eine hilflose Cheerleaderin überfallen hätte. Und ich würde das alles nicht erklären können. Ich wandte mich von Paul ab und stürzte auf das zerbrochene Fenster des Musiksaals zu.
Ich rannte aus der Seitenstraße auf die East 81st und lief Annabeth genau in die Arme.
»He, du bist aber früh fertig!« Sie lachte und packte mich an den Schultern, damit ich nicht auf die Straße taumelte. »Pass doch auf, wo du hinläufst, Algenhirn!«
Für den Bruchteil einer Sekunde war sie guter Laune und alles war in Ordnung. Sie trug Jeans und ein orangefarbenes Camp-T-Shirt und ihre Halskette aus Tonkugeln. Die blonden Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre grauen Augen funkelten. Sie sah aus wie auf dem Weg ins Kino oder um einen Nachmittag mit mir abzuhängen.
Dann kam Rachel Elizabeth Dare, noch immer mit Monsterstaub bedeckt, aus der Seitenstraße gerannt und schrie: »Percy, warte auf mich!«
Annabeths Lächeln verschwand. Sie starrte zuerst Rachel und dann die Schule an. Und erst jetzt schien sie den schwarzen Rauch und den heulenden Feueralarm zu bemerken.
Sie sah mich stirnrunzelnd an. »Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Und wer ist das da?«
»Äh, Rachel – Annabeth. Annabeth – Rachel. Äh, sie ist eine Freundin, würde ich sagen.«
Ich wusste nicht so recht, wie ich Rachel sonst nennen sollte. Ich kannte sie schließlich kaum, aber nachdem wir zweimal gemeinsam in Lebensgefahr geschwebt hatten, konnte ich sie wohl nicht mehr als flüchtige Bekannte bezeichnen.
»Hallo«, sagte Rachel. Dann drehte sie sich zu mir um. »Du hast ganz schön viel Ärger am Hals. Und du schuldest mir noch immer eine Erklärung.«
Auf dem FDR Drive heulten Polizeisirenen.
»Percy«, sagte Annabeth kalt. »Wir sollten gehen.«
»Ich will mehr über Halbblute wissen«, beharrte Rachel. »Und über Monster. Und diesen Götterkram.« Sie packte meinen Arm, zog einen Filzstift hervor und schrieb mir eine Telefonnummer auf die Hand. »Du rufst mich an und erklärst mir alles, okay? Das bist du mir schuldig. Und jetzt mach, dass du wegkommst.«
»Aber …«
»Ich denk mir irgendwas aus«, sagte Rachel. »Ich sage ihnen, dass es nicht deine Schuld war. Geh einfach!«
Sie rannte zurück zur Schule und ließ Annabeth und mich auf der Straße stehen.
Annabeth starrte mich für eine Sekunde an. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und rannte davon.
»He!« Ich trabte hinter ihr her. »Da waren zwei Empusen«, versuchte ich zu erklären. »Sie hatten sich als Cheerleaderinnen verkleidet und sie haben gesagt, das Camp wird abgefackelt werden und …«
»Du hast einer Sterblichen etwas über Halbblute erzählt?«
»Sie kann durch den Nebel sehen. Sie hat die Monster vor mir erkannt.«
»Also hast du ihr die Wahrheit gesagt.«
»Sie hat sich vom Hoover-Damm her an mich erinnert, deshalb …«
»Du bist ihr schon mal begegnet?«
»Äh, letzten Winter. Aber echt, ich kenne sie kaum.«
»Sie sieht gar nicht schlecht aus.«
»Das – das ist mir noch gar nicht aufgefallen.«
Annabeth ging weiter in Richtung York Avenue.
»Ich bring das mit der Schule in Ordnung«, versprach ich. Ich wollte unbedingt das Thema wechseln. »Ehrlich, das wird schon gut gehen.«
Annabeth würdigte mich keines Blickes. »Ich geh mal davon aus, dass unser Nachmittag abgeblasen ist. Wir müssen dich von hier wegbringen, jetzt, wo die Polizei dich sucht.«
Von der Goode High School hinter uns quoll Rauch auf. In der dunklen Rauchsäule glaubte ich fast, ein Gesicht sehen zu können, eine Dämonin mit roten Augen, die mich auslachte.
Bald wird dein hübsches kleines Camp in Flammen aufgehen, hatte Kelli gesagt. Deine Freunde werden Sklaven des Herrn der Zeit werden.
»Du hast Recht«, sagte ich zu Annabeth und das Herz rutschte mir in die Hose. »Wir müssen ins Camp Half-Blood. Und zwar sofort.«
Anruf aus der Unterwelt
Nichts kann einen perfekten Morgen so abrunden wie eine lange Taxifahrt mit einem wütenden Mädchen.
Ich versuchte, mit Annabeth zu reden, aber sie verhielt sich, als ob ich soeben ihrer Oma ein Bein gestellt hätte. Ich konnte nur aus ihr herausbringen, dass sie in San Francisco einen von Monstern nur so wimmelnden Frühling verbracht hatte; dass sie seit Weihnachten zweimal im Camp gewesen war, wobei sie mir aber nicht sagen wollte, warum (was mich ganz schön fertigmachte, denn sie hatte mir nicht einmal erzählt, dass sie in New York war), und dass sie rein gar nichts darüber wusste, wo Nico di Angelo steckte (lange Geschichte).
»Irgendwas von Luke gehört?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. Ich wusste, dass das ein schwieriges Thema für sie war. Annabeth hatte Luke immer bewundert, den ehemaligen Chef der Hermes-Hütte, der uns verraten und sich dem bösen Titanen Kronos angeschlossen hatte. Sie wollte es nicht zugeben, aber ich wusste, dass sie ihn noch immer gernhatte. Als wir im vergangenen Winter auf dem Tamalpais gegen Luke gekämpft hatten, hatte er irgendwie einen Sturz von einem über fünfzehn Meter hohen Felsen überlebt. Soviel ich wusste, segelte er noch immer mit seinem von Dämonen bevölkerten Kreuzfahrtschiff durch die Gegend, während sein zerhackter Gebieter Kronos sich in einem goldenen Sarkophag Stück für Stück neu bildete und darauf wartete, dass er genug Macht haben würde, um die olympischen Götter herauszufordern. Unter Halbgöttern nannten wir das ein »Problem«.
»Mount Tam wimmelt noch immer von Monstern«, sagte Annabeth. »Ich habe mich nicht in die Nähe getraut, aber ich glaube nicht, dass Luke da oben ist. Ich glaube, dann würde ich es wissen.«
Das beruhigte mich nicht sonderlich. »Was ist mit Grover?«
»Der ist im Camp«, sagte sie. »Wir sehen ihn nachher.«
»Hat er denn was herausgefunden? Bei seiner Suche nach Pan, meine ich?«
Annabeth spielte an ihrer Halskette herum, wie sie das immer tut, wenn sie sich Sorgen macht.
»Du wirst schon sehen«, sagte sie. Aber eine Erklärung gab sie nicht.
Als wir durch Brooklyn fuhren, rief ich mit Annabeths Telefon meine Mom an. Halbblute benutzen keine Handys, wenn es sich vermeiden lässt, denn wenn wir unsere Stimmen durch die Gegend funken, ist das so, als ob wir den Monstern ein Leuchtsignal schickten: Hier bin ich! Bitte, fresst mich! Aber ich hielt diesen Anruf für wichtig. Ich hinterließ eine Mitteilung auf unserem Anrufbeantworter und versuchte zu erklären, was an der Goode School geschehen war. Vermutlich gelang mir das nicht gerade blendend. Ich sagte meiner Mom, dass es mir gut ging und dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchte, ich aber im Camp bleiben würde, bis die Lage sich wieder beruhigt hätte. Ich bat sie, Paul Blofis auszurichten, dass mir das alles leidtat.
Danach fuhren wir schweigend weiter. Die Stadt blieb hinter uns zurück, und schließlich hatten wir die Autobahn erreicht und brausten durch die Landschaft des nördlichen Long Island, vorbei an Obstgärten und Weinbergen und Verkaufsbuden mit regionalen Produkten.
Ich starrte die Telefonnummer an, die Rachel Elizabeth Dare auf meine Hand gekritzelt hatte. Ich wusste, dass es verrückt war, aber ich hätte sie sehr gern angerufen. Vielleicht könnte sie mir helfen, zu begreifen, was die Empusa gemeint hatte – mit dem abgefackelten Camp und meinen versklavten Freunden. Und warum war Kelli in Flammen aufgegangen?
Ich wusste, dass Monster niemals wirklich starben. Irgendwann – in Wochen, Monaten oder auch Jahren – würde Kelli im widerlichen Urschlamm der Unterwelt wieder Gestalt annehmen. Aber dennoch ließen sie sich normalerweise nicht so leicht zerstören. Falls sie überhaupt wirklich zerstört war.
Das Taxi bog auf die 25 A ab. Wir fuhren durch die Wälder an der Nordküste, bis auf unserer Linken ein niedriger Hügelkamm auftauchte. Annabeth bat den Fahrer, an der Farm Road 3141 zu halten, gleich unterhalb des Half-Blood Hill.
Der Fahrer runzelte die Stirn. »Hier gibt’s aber weit und breit nichts, junge Frau. Sicher, dass ihr rauswollt?«
»Ja, bitte.« Annabeth reichte ihm ein Bündel Sterblichen-Geld und der Fahrer beschloss, keine weiteren Fragen zu stellen.
Annabeth und ich kletterten auf den Hügel. Der junge Wachdrache war eingenickt; er hatte sich um die Fichte gewickelt, aber er hob seinen kupferroten Kopf, als wir näher kamen, und ließ sich von Annabeth unter dem Kinn kraulen. Rauch quoll aus seinen Nüstern wie aus einem Teekessel, und er verdrehte vor Wohlbehagen die Augen.
»Hallo, Peleus«, sagte Annabeth. »Passt du gut auf alles auf?«
Als ich den Drachen zuletzt gesehen hatte, war er einen Meter achtzig lang gewesen. Jetzt war er mindestens doppelt so groß und so dick wie der Baum selbst. Über seinem Kopf schimmerte am untersten Ast der Fichte das Goldene Vlies, dessen Magie die Grenzen des Camps vor Eindringlingen beschützte. Der Drache wirkte entspannt, so, als sei alles in Ordnung. Das Camp unter uns sah friedlich aus – grüne Wiesen, Wald, leuchtend weiße griechische Gebäude. Das vierstöckige Bauernhaus, das wir als das Hauptgebäude bezeichneten, thronte zwischen den Erdbeerfeldern. Im Norden hinter dem Strand glitzerte der Long Island Sound im Sonnenlicht.
Aber irgendetwas stimmte nicht. In der Luft lag eine Spannung, als halte der ganze Hügel den Atem an und warte auf eine Katastrophe.
Wir gingen ins Tal hinab und stellten fest, dass die Sommersaison schon voll im Gang war. Die meisten Campbewohner waren am vergangenen Freitag eingetroffen, und ich fühlte mich sofort ausgeschlossen. Die Satyrn spielten in den Erdbeerfeldern auf ihren Flöten und ließen durch Waldmagie die Pflanzen wachsen. Campbewohner bekamen Unterricht im Pferdeflug und sausten auf ihren Pegasi über die Bäume hinweg. Aus den Schmieden stieg Rauch auf und Hämmer klirrten, weil in der Abteilung für Kunsthandwerk Waffen hergestellt wurden. Die Teams von Athene und Demeter veranstalteten ein Wagenrennen und auf dem Kanusee kämpften einige Leute in einem griechischen Dreiruderer gegen eine riesige orangefarbene Seeschlange. Es war ein typischer Tag im Camp.
»Ich muss mit Clarisse sprechen«, sagte Annabeth.
Ich starrte sie an, als ob sie soeben verkündet hätte, sie müsse einen riesigen stinkenden Stiefel aufessen.
»Wieso das denn?«
Clarisse aus der Ares-Hütte gehörte zu den Leuten, die ich am allerwenigsten mochte. Sie war eine gemeine, undankbare Tyrannin. Ihr Dad, der Kriegsgott, wollte mich umbringen. Sie versuchte in regelmäßigen Abständen, mich zu Brei zu schlagen. Abgesehen davon war sie super.
»Wir haben da so ein Projekt«, sagte Annabeth. »Bis nachher.«
»Was denn für ein Projekt?«
Annabeth schaute kurz zum Waldrand hinüber.
»Ich sage Chiron, dass du hier bist«, sagte sie. »Er wird vor der Versammlung noch mit dir reden wollen.«
»Was für eine Versammlung?«
Aber sie lief schon den Pfad zum Bogenschießgelände hinunter, ohne sich umzusehen.
»Ja«, murmelte ich. »War toll, mit dir zu reden.«
Auf dem Weg durch das Camp begrüßte ich einige von meinen Freunden. Auf der Auffahrt vor dem Hauptgebäude knackten Connor und Travis aus der Hermes-Hütte gerade den Geländewagen des Camps. Silena Beauregard, die Leiterin der Aphrodite-Hütte, winkte mir im Vorüberfliegen von ihrem Pegasus zu. Ich hielt Ausschau nach Grover, konnte ihn aber nicht entdecken. Schließlich ging ich in die Schwertkampfarena, denn das mache ich meistens, wenn ich schlechter Laune bin. Training beruhigt mich immer. Vielleicht, weil Schwertkampf das Einzige ist, womit ich mich wirklich auskenne.
Als ich ins Amphitheater kam, hätte fast mein Herz ausgesetzt. Denn in der Mitte der Arena stand, mit dem Rücken zu mir, der größte Höllenhund, den ich jemals gesehen hatte.
Dabei habe ich schon einige ganz schön große Höllenhunde gesehen. Einer von Nashorngröße hatte versucht, mich umzubringen, als ich zwölf war. Aber dieser hier war größer als ein Panzer. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er die magischen Campgrenzen überwunden hatte. Er schien sich wie zu Hause zu fühlen, lag auf dem Bauch und grunzte zufrieden, während er einer Strohpuppe den Kopf abbiss. Er hatte mich noch nicht bemerkt, aber sobald ich ein Geräusch machte, war ich geliefert, das wusste ich. Mir blieb keine Zeit, um Hilfe zu holen. Ich zog Springflut aus der Tasche und drehte die Kappe ab.
»Jaaaa!« Ich griff an. Meine Klinge hätte um ein Haar das riesige Hinterteil des Monsters getroffen, als aus dem Nirgendwo ein anderes Schwert dazwischenfuhr.
KLONG!
Der Höllenhund spitzte die Ohren. »WUFF!«
Ich sprang zurück und schlug instinktiv nach dem Schwertkämpfer – einem grauhaarigen Mann in griechischer Rüstung. Er parierte meinen Angriff ohne Mühe.
»Heda!«, sagte er. »Waffenstillstand!«
»WUFF!« Das Gebell des Höllenhundes ließ die Arena zittern.
»Das ist ein Höllenhund!«, schrie ich.
»Die will nur spielen«, sagte der Mann. »Das ist Mrs O’Leary.«
Ich kniff die Augen zusammen. »Mrs O’Leary?«
Als sie ihren Namen hörte, bellte die Höllenhündin ein weiteres Mal. Mir ging auf, dass sie gar nicht wütend war – sie war aufgeregt. Sie stupste die halb aufgelöste, übel zerkaute Strohpuppe zu dem Schwertkämpfer hinüber.
»Braves Mädchen«, sagte der Mann. Mit seiner freien Hand packte er die Puppe in ihrer Rüstung am Hals und schleuderte sie in Richtung Tribünen. »Hol den Griechen! Hol den Griechen!«
Mrs O’Leary setzte ihrer Beute hinterher, sprang darauf und drückte die Rüstung platt. Sie fing an, auf dem Helm herumzukauen.
Der Schwertkämpfer grinste. Er war vielleicht Mitte fünfzig, hatte kurze graue Haare und einen kurzen grauen Bart. Für sein Alter war er gut in Form. Er trug schwarze Bergsteigerhosen und einen bronzenen Brustpanzer, den er über ein orangefarbenes Camp-T-Shirt geschnallt hatte. Unten an seinem Hals war ein seltsames Zeichen zu sehen, ein lila Fleck wie ein Muttermal oder ein Tattoo, aber ehe ich es mir genauer ansehen konnte, zog er die Träger des Brustpanzers hoch und der Fleck verschwand unter seinem Kragen.
»Mrs O’Leary ist mein Haustier«, erklärte er. »Da konnte ich doch nicht zulassen, dass du ihr ein Schwert in den Bauch bohrst, oder? Das hätte sie vielleicht erschreckt.«
»Wer sind Sie?«
»Versprichst du, mich nicht umzubringen, wenn ich mein Schwert weglege?«
»Von mir aus.«
Er ließ das Schwert in die Scheide gleiten und streckte die Hand aus. »Quintus.«
Ich schüttelte seine Hand. Sie war rau wie Sandpapier.
»Percy Jackson«, sagte ich. »Tut mir leid wegen … Wie haben Sie überhaupt …«
»Mir einen Höllenhund als Haustier zugelegt? Lange Geschichte, voller tödlicher Gefahren und etlicher riesiger Kauspielzeuge. Ich bin übrigens der neue Lehrer im Schwertkampf. Greife Chiron unter die Arme, während Mr D nicht da ist.«
»Ach.« Ich versuchte, nicht zu glotzen, als Mrs O’Leary der Strohpuppe den Schild samt Arm abriss und ihn schüttelte wie ein Frisbee. »Moment, Mr D ist nicht da?«
»Ja, na ja … viel zu tun. Da muss sogar Dionysos einspringen. Er besucht alte Freunde. Sorgt dafür, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Und mehr sollte ich wohl besser nicht verraten.«
Wenn Dionysos wirklich weg war, dann war das die beste Nachricht des Tages. Er war nur deshalb unser Campleiter, weil Zeus ihn zur Strafe hergeschickt hatte, nachdem er verbotenerweise eine Waldnymphe belästigt hatte. Er hasste die Campbewohner und gab sich alle Mühe, uns das Leben schwer zu machen. Wenn er nicht da war, konnte dieser Sommer vielleicht doch noch nett werden. Andererseits, wenn sogar Dionysos den Hintern hochgekriegt hatte und jetzt den Göttern half, Truppen gegen die titanische Bedrohung zu sammeln, dann musste die Lage doch ganz schön mies sein.
Auf meiner linken Seite hörte ich einen lauten Knall. Sechs Holzkästen so groß wie Picknicktische waren in der Nähe aufgestapelt worden und wackelten gefährlich. Mrs O’Leary legte den Kopf schief und sprang auf sie zu.
»Ruhig, mein Mädchen«, sagte Quintus. »Die sind nicht für dich.« Er lenkte sie mit dem Frisbeeschild ab.
Die Kästen wackelten und bebten. Sie waren auf den Seiten beschriftet, aber ich als Legastheniker brauchte einige Minuten, um das zu entziffern.
DREIMAL-G-RANCH
ZERBRECHLICH
DIESE SEITE NACH OBEN
Am unteren Rand stand in kleineren Buchstaben: VORSICHTIG ÖFFNEN. DIE DREIMAL-G-RANCH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SACHBESCHÄDIGUNG, VERSTÜMMELUNG ODER ENTSETZLICH SCHMERZHAFTEN TOD.
»Was ist in den Kisten?«, fragte ich.
»Eine kleine Überraschung«, sagte Quintus. »Trainingshilfen für morgen Abend. Du wirst begeistert sein.«
»Okay«, sagte ich, obwohl ich nicht so sicher war, was den »entsetzlich schmerzhaften Tod« anging.
Quintus warf den Schild und Mrs O’Leary jagte hinterher. »Ihr jungen Leute braucht mehr Herausforderungen. Als ich ein Junge war, gab es solche Camps nicht.«
»Sie – Sie sind ein Halbblut?« Ich wollte nicht so überrascht klingen, aber ich hatte noch niemals einen alten Halbgott gesehen.
Quintus schmunzelte. »Einige von uns schaffen es eben doch, bis zum Erwachsenenalter zu überleben. Wir sind ja nicht alle von schrecklichen Weissagungen betroffen.«
»Sie wissen von der Weissagung?«
»Ich hab so einiges gehört.«
Ich wollte schon fragen, was »so einiges« bedeuten sollte, aber in diesem Moment kam Chiron in die Arena geklappert. »Percy, da bist du ja!«
Er kam offenbar gerade vom Bogenschießunterricht. Über sein Zentaur Nummer 1-T-Shirt hatte er Köcher und Bogen gestreift. Er hatte für den Sommer seine braunen Locken und seinen Bart gestutzt, und seine untere Hälfte, ein weißer Hengstrumpf, war mit Erde und Gras befleckt.
»Ich sehe, du hast unseren neuen Lehrer schon kennengelernt.« Chirons Tonfall war lässig, aber er hatte einen nervösen Blick. »Quintus, dürfte ich Percy mal kurz ausleihen?«
»Aber gern doch, Meister Chiron.«
»Du brauchst mich wirklich nicht Meister zu nennen«, sagte Chiron, obwohl er durchaus erfreut klang. »Komm, Percy. Wir haben viel zu bereden.«
Ich warf noch einen Blick auf Mrs O’Leary, die jetzt die Beine der Strohpuppe abknabberte.
»Bis dann«, sagte ich zu Quintus.
Im Weggehen flüsterte ich Chiron zu: »Quintus kommt mir ein bisschen …«
»Geheimnisvoll vor?«, schlug Chiron vor. »Schwer zu durchschauen?«
»Ja.«
Chiron nickte. »Ein überaus qualifiziertes Halbblut. Exzellenter Schwertkämpfer. Ich wünschte nur, ich könnte verstehen …«
Was immer er hatte sagen wollen, offenbar überlegte er es sich anders. »Aber fangen wir vorne an, Percy. Annabeth hat mir erzählt, dass dir einige Empusen begegnet sind.«
»Ja.« Ich erzählte ihm von dem Kampf an der Goode School und wie Kelli sich in Flammen aufgelöst hatte.
»Mm«, sagte Chiron. »Die mächtigeren Monster können das. Sie ist nicht gestorben, Percy. Sie ist einfach entwichen. Es ist kein gutes Zeichen, dass die Dämoninnen aktiv werden.«
»Was wollten sie denn da?«, fragte ich. »Haben sie auf mich gewartet?«
»Kann schon sein.« Chiron runzelte die Stirn. »Erstaunlich, dass du überlebt hast. Ihre Fähigkeiten zur Täuschung … fast jeder Heros wäre ihrem Zauber erlegen und verschlungen worden.«
»Ich auch«, gab ich zu. »Wenn Rachel nicht gewesen wäre.«
Chiron nickte. »Ironie des Schicksals, von einer Sterblichen gerettet zu werden, aber jetzt sind wir ihr einen Gefallen schuldig. Und was die Empusa über einen Angriff auf das Camp gesagt hat – darüber müssen wir noch genauer sprechen. Aber jetzt komm erst einmal mit, wir müssen in den Wald. Grover hätte dich gern dabei.«
»Wobei?«
»Bei der Ratsversammlung«, sagte Chiron grimmig. »Der Rat der Behuften Älteren tritt gerade zusammen, um über Grovers Schicksal zu entscheiden.«
Chiron sagte, wir müssten uns beeilen, deshalb ließ ich mich von ihm auf dem Rücken mitnehmen. Als wir an den Hütten vorbeigaloppierten, schaute ich zum Speisesaal hinüber – einem offenen griechischen Pavillon auf einem Hügel mit Blick auf das Meer. Ich sah den Pavillon seit dem vergangenen Sommer zum ersten Mal, und das brachte böse Erinnerungen zurück.
Chiron jagte in den Wald. Nymphen lugten aus den Bäumen, als wir vorübereilten. Riesige Gestalten raschelten in den Schatten – Monster, die als Herausforderung für die Campinsassen hier untergebracht waren.
Ich hatte geglaubt, den Wald ziemlich gut zu kennen, da ich hier zwei Sommer lang Eroberung der Flagge gespielt hatte, aber Chiron wählte einen Weg, den ich nicht wiedererkannte, durch einen Tunnel aus alten Weiden, vorbei an einem kleinen Wasserfall und über eine von Wiesenblumen überwucherte Lichtung.
Eine Gruppe von Satyrn saß im Kreis auf der Wiese. Grover stand in der Mitte, gegenüber von drei richtig alten, richtig fetten Satyrn, die jeder auf einem Thron aus zurechtgestutzten Rosensträuchern saßen. Ich hatte diese drei alten Satyrn noch nie gesehen, aber ich ging davon aus, dass es sich um den Rat der Behuften Älteren handelte.
Grover schien ihnen gerade eine Geschichte zu erzählen, zupfte am Saum seines T-Shirts und trat nervös von einem Ziegenhuf auf den anderen. Er hatte sich seit dem vergangenen Winter nicht sehr verändert, vielleicht, weil Satyrn nur halb so schnell altern wie Menschen. Seine Akne war schlimmer geworden. Seine Hörner waren ein wenig gewachsen und lugten gerade so eben aus seinen Locken hervor. Überrascht stellte ich fest, dass ich jetzt größer war als er.
Auf einer Seite des Kreises standen Annabeth, ein mir unbekanntes Mädchen und Clarisse. Chiron setzte mich neben den dreien ab.
Clarisse hatte sich ihre strähnigen braunen Haare mit einem Halstuch in Tarnfarben zusammengebunden. Sie sah jetzt noch muskulöser aus als sonst, falls das überhaupt möglich war, als ob sie viel unter freiem Himmel gearbeitet hätte. Sie schaute mich wütend an und murmelte »Missgeburt«, was bedeuten musste, dass sie guter Laune war. Normalerweise begrüßt sie mich damit, dass sie versucht, mich umzubringen.
Annabeth hatte den Arm um das andere Mädchen gelegt, das aussah, als ob es geweint hätte. Sie war klein – zierlich nennt man das wohl – und hatte flaumige bernsteinfarbene Haare und ein hübsches elfenhaftes Gesicht. Sie trug einen grünen Chiton und Schnürsandalen und betupfte sich die Augen mit einem Taschentuch. »Das wird schrecklich enden«, schluchzte sie.
»Nein, nein.« Annabeth streichelte ihre Schulter. »Ihm passiert schon nichts, Wacholder.«
Annabeth sah mich an und ihre Lippen bildeten die Wörter Grovers Freundin.
Jedenfalls glaubte ich das, aber Sinn ergab es nicht. Grover hatte eine Freundin? Dann betrachtete ich Wacholder genauer und sah, dass ihre Ohren ein wenig spitz zuliefen. Ihre Augen waren nicht vom Weinen gerötet, sondern grün gefärbt, in der Farbe von Chlorophyll. Sie war eine Baumnymphe – eine Dryade.
»Mein lieber Herr Underwood!«, brüllte der Ratsherr auf der rechten Seite und unterbrach damit, was immer Grover hatte sagen wollen. »Erwarten Sie im Ernst, dass wir das glauben?«
»A-aber Silenus«, stammelte Grover. »Das ist die Wahrheit.«
Der Ratstyp, Silenus, wandte sich seinen Kollegen zu und murmelte etwas. Chiron trabte nach vorn und stellte sich neben sie. Mir fiel ein, dass er Ehrenmitglied des Rates war, aber ich hatte nie weiter darüber nachgedacht. Die Älteren sahen nicht gerade beeindruckend aus. Sie erinnerten mich an Ziegen in einem Streichelzoo – Schmerbäuche, verschlafener Gesichtsausdruck und glasige Augen, die nicht weiter sehen konnten als zur nächsten Handvoll Ziegenfutter. Ich wusste wirklich nicht, warum Grover so nervös aussah.
Silenus zog sein gelbes Polohemd über seinem Schmerbauch hinunter und setzte sich auf seinem Rosenstrauchthron zurecht. »Mein lieber Herr Underwood, wir hören jetzt seit sechs Monaten – sechs Monaten! – diese skandalöse Behauptung, Sie hätten den wilden Gott Pan sprechen hören.«
»Aber ich habe ihn wirklich gehört!«
»Unverschämtheit«, sagte der Ratsherr zur Linken.
»Aber Maron«, sagte Chiron. »Geduld.«
»Was heißt hier Geduld!«, rief Maron. »Ich habe diesen Unsinn bis zu den Hörnern satt. Als ob der wilde Gott ausgerechnet mit … mit dem da reden würde.«
Wacholder sah aus, als ob sie den alten Satyr am liebsten zusammengeschlagen hätte, aber Annabeth und Clarisse hielten sie zurück. »Falscher Moment«, murmelte Clarisse. »Warte.«
Ich weiß nicht, was mich mehr überraschte: die Tatsache, dass Clarisse jemanden von einer Prügelei zurückhielt, oder die Tatsache, dass sie und Annabeth, die sich gegenseitig verachteten, fast aussahen, als ob sie hier unter einer Decke steckten.
»Sechs Monate lang«, sagte jetzt Silenus, »haben wir Sie gewähren lassen, Herr Underwood. Wir haben Ihnen die Reise erlaubt. Wir haben Ihnen die Sucherzulassung nicht entzogen. Wir haben darauf gewartet, dass Sie einen Beweis für Ihre skandalöse Behauptung erbringen. Und was haben Sie in den sechs Monaten auf Reisen herausgefunden?«
»Ich brauche nur einfach mehr Zeit«, sagte Grover flehend.
»Nichts!«, meldete der Ratsherr in der Mitte sich zu Wort. »Sie haben nichts herausgefunden.«
»Aber Leneus …«
Silenus hob die Hand. Chiron beugte sich vor und sagte etwas zu den Satyrn. Sie sahen nicht gerade glücklich aus und murmelten und diskutierten untereinander, aber Chiron sagte wieder etwas und Silenus seufzte. Widerstrebend nickte er.
»Mein lieber Herr Underwood«, verkündete Silenus. »Wir geben Ihnen noch eine Chance.«
Grovers Miene erhellte sich. »Danke!«
»Noch eine Woche!«
»Was? Aber, Sir! Das ist unmöglich.«
»Noch eine Woche, Herr Underwood. Und wenn Sie Ihre Behauptung dann noch immer nicht beweisen können, müssen Sie sich einen anderen Beruf aussuchen. Etwas, das zu Ihrer dramatischen Begabung passt. Puppentheater vielleicht. Oder Stepptanzen.«
»Aber Sir, ich – ich darf meine Sucherzulassung nicht verlieren. Mein ganzes Leben …«
»Die Versammlung des Rates ist beendet«, sagte Silenus. »Und jetzt wollen wir unser Mittagsmahl genießen.«
Der alte Satyr klatschte in die Hände und eine Gruppe von Nymphen löste sich aus den Bäumen und brachte Tabletts voller Gemüse, Obst, Blechdosen und anderer Ziegenköstlichkeiten. Der Kreis der Satyrn löste sich auf und sie machten sich über das Essen her. Grover kam mit hängendem Kopf auf uns zu. Sein verwaschenes blaues T-Shirt war mit dem Bild eines Satyrs bedruckt. Darunter stand NUR ECHT MIT HUFEN!
»Hallo, Percy«, sagte er. Er war so deprimiert, dass er nicht einmal meine Hand schütteln wollte. »Das lief ja super, was?«
»Diese alten Böcke«, sagte Wacholder. »Ach, Grover, die haben doch keine Ahnung, was du dir für eine Mühe gegeben hast!«
»Es gibt noch eine Möglichkeit«, sagte Clarisse düster.
»Nein. Nein.« Wacholder schüttelte den Kopf. »Grover, das lasse ich nicht zu.«
Sein Gesicht war aschgrau. »Ich – ich muss darüber nachdenken. Aber wir wissen doch nicht mal, wo wir suchen sollen.«
»Worüber redet ihr eigentlich?«, fragte ich.
In der Ferne erscholl ein Muschelhorn.
Annabeth spitzte die Lippen. »Ich erkläre es dir später, Percy. Jetzt sollten wir machen, dass wir in unsere Hütten kommen. Die Inspektion geht los.«
Ich fand es nicht fair, dass ich zur Inspektion musste, wo ich doch gerade erst im Camp angekommen war, aber so war es nun einmal. An jedem Nachmittag ging einer von den Hüttenältesten mit einer Papyrusrolle herum, auf der lauter wichtige Ordnungskriterien aufgeführt waren. Die beste Hütte bekam die erste Duschstunde, was bedeutete, dass sie garantiert heißes Wasser hatte. Die schlechteste musste nach dem Abendessen Küchendienst schieben.
Mein Problem war: Normalerweise war ich der einzige Bewohner der Poseidon-Hütte, und ich bin nicht gerade ein Ordnungsmensch. Die Putzharpyien kamen nur am letzten Tag des Sommers, weshalb meine Hütte vermutlich so aussah, wie ich sie nach den Winterferien verlassen hatte: Meine Bonbonpapiere und Pommestüten lagen noch auf dem Bett und meine Rüstung für das Erobern der Flagge lag in ihre Bestandteile zerlegt überall in der Hütte herum.
Ich stürzte zu den zwölf Hütten – für jede olympische Gottheit eine –, die um die Wiese in der Mitte des Camps ein U bildeten. Die Demeter-Kids fegten ihre gerade aus und ließen in ihren Fensterkästen frische Blumen wachsen. Einfach durch ein Fingerschnippen konnten sie über ihrer Tür Klee und auf ihrem Dach Gänseblümchen blühen lassen, was total unfair war. Ich glaube nicht, dass sie bei einer Inspektion je auf dem letzten Platz gelandet waren. Die Typen aus der Hermes-Hütte wuselten voller Panik durcheinander, stopften schmutzige Wäsche unter ihre Betten und beschuldigten sich gegenseitig, alles Mögliche geklaut zu haben. Sie waren schlampig, aber sie waren noch immer deutlich besser als ich.
Silena Beauregard verließ gerade die gegenüber gelegene Hütte und kreuzte Punkte auf ihrer Inspektionsrolle an. Ich fluchte leise. Silena war nett, aber sie war der totale Ordnungsfreak, die schlimmste Inspektorin. Sie mochte es, wenn alles hübsch aussah. »Hübsch« war nicht mein Ding. Ich merkte geradezu, wie meine Arme schwer wurden, weil ich abends unendlich viel Geschirr würde spülen müssen.
Die Poseidon-Hütte stand am Ende der Reihe von Hütten männlicher Gottheiten auf der rechten Seite der Wiese. Sie bestand aus grauem, mit Muscheln bewachsenem Seefels und war lang und niedrig wie ein Bunker, aber sie hatte Fenster mit Blick auf das Meer und immer wurde sie von einer frischen Brise durchweht.
Ich stürzte hinein mit dem Gedanken, dass ich vielleicht schnell alles unters Bett schieben könnte, wie die Hermes-Typen, und entdeckte, dass mein Halbbruder Tyson gerade den Boden kehrte.
»Percy!«, brüllte er. Er ließ den Besen fallen und kam auf mich zugestürzt. Falls euch noch nie ein enthusiastischer Zyklop in einer geblümten Schürze und Gummihandschuhen um den Hals gefallen ist, kann ich euch sagen, davon wird man ganz schnell wach.
»He, Großer«, sagte ich. »Au, Vorsicht mit meinen Rippen. Meine Rippen!«
Ich schaffte es, seine Bärenumarmung zu überleben. Er stellte mich wieder hin und grinste dabei wie verrückt, sein einziges kalbsbraunes Auge glühte vor Erregung. Seine Zähne waren gelb und krumm wie immer, und sein Haar sah aus wie ein Rattennest. Unter der geblümten Schürze trug er zerfetzte Jeans Größe XXXL und ein zerlumptes Flanellhemd, aber für mich war er trotzdem der pure Augenschmaus. Ich hatte ihn vor fast einem Jahr zuletzt gesehen, danach war er untergetaucht, um in den Schmieden der Zyklopen zu arbeiten.
»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte er. »Nicht von Monstern gefressen?«
»Aber nicht im Geringsten.« Ich zeigte ihm, dass ich noch immer beide Arme und beide Beine hatte, und Tyson klatschte glücklich in die Hände.
»Klasse!«, sagte er. »Jetzt können wir Brote mit Erdnussbutter fressen und auf Fischponys reiten! Wir können gegen Monster kämpfen und Annabeth treffen und lauter Sachen BUMM machen lassen!«
Ich hoffte, dass er das nicht alles gleichzeitig machen wollte, aber ich sagte, klar doch, wir würden in diesem Sommer wahnsinnig viel Spaß haben. Ich musste einfach lächeln, weil er von allem so begeistert war.
»Aber zuerst«, sagte ich, »müssen wir uns um die Inspektion kümmern. Wir sollten …«
Ich schaute mich um und mir wurde klar, dass Tyson ganz schön was geschafft hatte. Der Boden war gefegt. Die Etagenbetten waren gemacht. Der Salzwasserbrunnen in der Ecke war frisch geschrubbt und die Korallen leuchteten. Auf die Fensterbänke hatte Tyson Vasen mit Seeanemonen und seltsamen glühenden Pflanzen vom Grund des Ozeans gestellt, die viel schöner waren als alle Blumensträuße, die die Demeter-Kids herbeischnippen konnten.
»Tyson, die Hütte sieht … umwerfend aus!«
Er strahlte. »Siehst du die Fischponys? Ich hab sie an die Decke gehängt.«
Eine Herde aus winzigen Bronzehippocampi hing an Drähten von der Decke und es sah aus, als schwämmen sie durch die Luft. Ich konnte es nicht fassen, dass Tyson mit seinen Pranken derart zierliche Gegenstände herstellen konnte. Dann schaute ich zu meinem Bett hinüber und sah meinen alten Schild an der Wand hängen.
»Du hast ihn repariert!«
Der Schild war im vergangenen Winter übel zugerichtet worden, als mich ein Mantikor angegriffen hatte, aber jetzt war er wieder unversehrt – ohne einen Kratzer! Alle Bronzebilder meiner Abenteuer mit Tyson und Annabeth im Meer der Monster waren poliert und leuchteten.
Ich sah Tyson an. Ich wusste nicht, wie ich ihm danken sollte.
Dann sagte hinter mir jemand: »Meine Güte!«
Silena Beauregard stand mit ihrer Inspektionsrolle in der Türöffnung. Sie betrat die Hütte, drehte sich einmal um die eigene Achse und sah mich dann mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Na, ich hatte meine Zweifel. Aber du kannst ja doch Ordnung halten, Percy. Das werde ich mir merken.«
Sie zwinkerte mir zu und war verschwunden.
Tyson und ich verbrachten den Nachmittag damit, dass wir einfach abhingen und uns gegenseitig erzählten, was wir in letzter Zeit erlebt hatten, und das war sehr erholsam nach einem Morgen, an dem ich von dämonischen Cheerleaderinnen angegriffen worden war.
Wir gingen zur Schmiede und halfen Beckendorf aus der Hephaistos-Hütte bei der Arbeit. Tyson zeigte uns, wie man magische Waffen herstellt. Er schmiedete so schnell eine flammende doppelseitige Streitaxt, dass sogar Beckendorf beeindruckt war.
Während wir arbeiteten, erzählte Tyson uns von seinem Jahr unten im Meer. Sein Auge leuchtete, als er die Schmieden der Zyklopen und den Palast des Poseidon beschrieb, aber er erzählte uns auch, wie angespannt die Lage war. Die alten Meeresgottheiten, die zu Zeiten der Titanen geherrscht hatten, griffen immer wieder unseren Vater an. Als Tyson aufgebrochen war, hatten im ganzen Atlantik Schlachten getobt. Als ich das hörte, wurde ich nervös; ich fragte mich, ob meine Hilfe gebraucht würde, aber Tyson versicherte, dass Dad uns beide im Camp wissen wollte.
»Gibt auch über dem Meer jede Menge Leute«, sagte Tyson. »Können wir alle BUMM machen lassen.«
Nach der Schmiedearbeit verbrachten wir einige Zeit mit Annabeth am See. Sie freute sich zwar wirklich über das Wiedersehen mit Tyson, aber ich konnte sehen, dass sie mit ihren Gedanken anderswo war. Sie schaute immer wieder zum Wald hinüber, als dächte sie über Grovers Probleme mit dem Rat nach. Ich konnte ihr da keine Vorwürfe machen. Grover war nirgendwo zu sehen, und er tat mir schrecklich leid. Sein Leben lang war es sein Ziel gewesen, den verschollenen Gott Pan zu finden. Sein Vater und sein Onkel waren beide verschwunden, während sie denselben Traum verfolgt hatten. Im vergangenen Winter hatte Grover in seinem Kopf eine Stimme gehört – ich warte auf dich –, eine Stimme, von der er sicher war, dass sie Pan gehörte, aber offenbar hatte seine Suche zu nichts geführt. Wenn der Rat ihm jetzt seine Sucherzulassung entzog, würde ihn das total fertigmachen.
»Was ist das für eine andere Möglichkeit?«, fragte ich Annabeth. »Die, die Clarisse erwähnt hat?«
Sie hob einen Stein auf und ließ ihn über den See hüpfen. »Etwas, das Clarisse ausfindig gemacht hat. Ich habe ihr im Frühling ein wenig dabei geholfen. Aber es wäre gefährlich. Vor allem für Grover.«
»Ziegenknabe macht mir Angst«, murmelte Tyson.
Ich starrte ihn an. Tyson hatte feuerspeienden Stieren und Seeungeheuern und menschenfressenden Riesen gegenübergestanden. »Warum macht Grover dir Angst?«
»Hufe und Hörner«, murmelte Tyson nervös. »Und Ziegenfell macht, dass die Nase juckt.«
Und damit war unser Gespräch über Grover beendet.
Vor dem Essen gingen Tyson und ich zur Schwertkampfarena. Quintus freute sich, als er Gesellschaft bekam. Er wollte mir noch immer nicht verraten, was in den Holzkästen steckte, aber er brachte mir ein paar Schwertkampftricks bei. Der Mann war wirklich gut. Er kämpfte, wie manche Leute Schach spielen – als ob er alle Züge im Voraus plante, und man erkannte das Muster erst, wenn er den letzten Hieb ausführte und einem die Klinge an die Kehle hielt.
»Schöner Versuch«, sagte er. »Aber du deckst zu tief unten.«
Er holte aus und ich blockte ab.
»Waren Sie immer schon Schwertkämpfer?«, fragte ich.
Er parierte meinen Hieb über seinem Kopf. »Ich war vieles.«
Er schlug zu und ich sprang zur Seite. Sein Schulterriemen rutschte nach unten und ich sah wieder dieses Mal an seinem Hals – den lila Fleck. Aber es war kein Fleck. Es hatte eine klar erkennbare Form – ein Vogel mit angelegten Flügeln, wie eine Wachtel oder so.
»Was haben Sie da am Hals?«, fragte ich, was vermutlich unhöflich war, aber ihr könnt es auf mein ADHD schieben. Ich platze immer einfach mit allem Möglichen heraus.
Quintus geriet aus dem Rhythmus. Ich traf seinen Schwertgriff und schlug ihm die Klinge aus der Hand.
Er rieb sich die Finger. Dann verschob er seine Rüstung, um den Fleck zu verbergen. Es war kein Tattoo. Es war ein altes Brandzeichen … als ob er gebrandmarkt worden sei.
»Eine Mahnung.« Er hob sein Schwert wieder auf und rang sich ein Lächeln ab. »Also, machen wir weiter?«
Er trieb mich in die Enge und ließ mir keine Zeit für weitere Fragen.
Während wir kämpften, spielte Tyson mit Mrs O’Leary, die er »süßes Hündchen« nannte. Sie amüsierten sich köstlich dabei, um den Bronzeschild zu kämpfen und Fang den Griechen zu spielen. Als die Sonne unterging, wirkte Quintus noch immer ausgeruht, was ich seltsam fand. Tyson und ich dagegen waren total verschwitzt, deshalb gingen wir duschen und machten uns fürs Abendessen fertig.