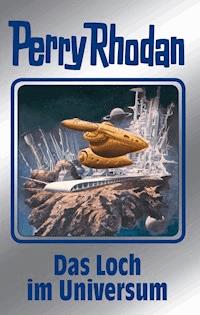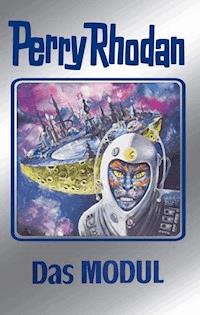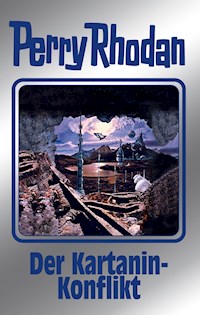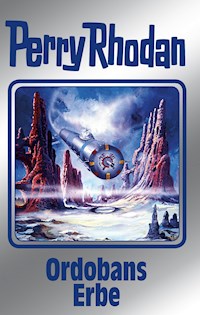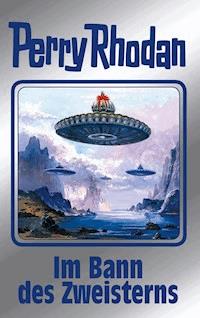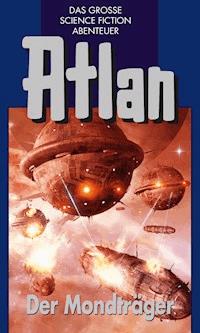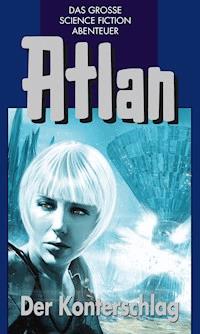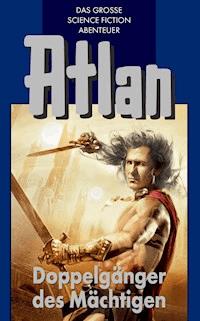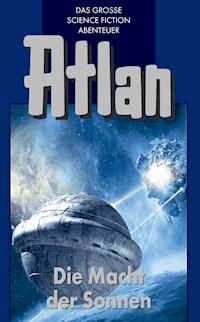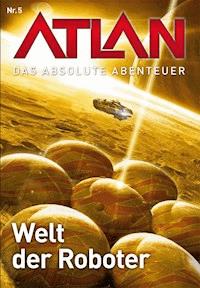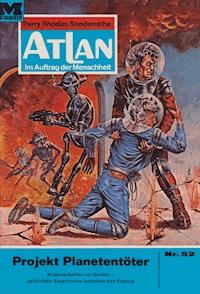Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Verkünder tritt auf - Menschen sprechen von einem strafenden Gott Die Situation zwischen den Sternen der Milchstraße ist im September 1331 Neuer Galaktischer Zeit äußerst angespannt. Während Hyperstürme die interstellare Raumfahrt zu einer höchst riskanten Angelegenheit machen, spitzt sich die politische Lage zu. Das Kristallimperium der Arkoniden und die Liga Freier Terraner stehen sich schwer bewaffnet gegenüber. Zum wiederholten Mal scheint ein interstellarer Krieg zu drohen. In dieser Zeit verschwindet Perry Rhodan zusammen mit Atlan, dem uralten Arkoniden, im geheimnisvollen Sternenozean von Jamondi. Seither sind die Männer verschollen. Auf der Erde und den anderen Planeten der bewohnten Milchstraße schlägt nun auch die Veränderung der so genannten Hyperimpedanz zu: Geräte, die auf der Verwendung fünfdimensionaler Energien beruhen, versagen komplett; es droht ein totales Chaos. In diesen dunkeln Stunden halten aber die Terraner zusammen, besinnen sich auf ihre Stärken. Für andere beginnt allerdings auch DER TRAUM VON GON-ORBHON...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 2213
Der Traum von Gon-Orbhon
Ein Verkünder tritt auf – Menschen sprechen von einem strafenden Gott
H. G. Francis
Die Situation zwischen den Sternen der Milchstraße ist im September 1331 Neuer Galaktischer Zeit äußerst angespannt. Während Hyperstürme die interstellare Raumfahrt zu einer höchst riskanten Angelegenheit machen, spitzt sich die politische Lage zu.
Das Kristallimperium der Arkoniden und die Liga Freier Terraner stehen sich schwer bewaffnet gegenüber. Zum wiederholten Mal scheint ein interstellarer Krieg zu drohen. In dieser Zeit verschwindet Perry Rhodan zusammen mit Atlan, dem uralten Arkoniden, im geheimnisvollen Sternenozean von Jamondi. Seither sind die Männer verschollen.
Auf der Erde und den anderen Planeten der bewohnten Milchstraße schlägt nun auch die Veränderung der so genannten Hyperimpedanz zu: Geräte, die auf der Verwendung fünfdimensionaler Energien beruhen, versagen komplett; es droht ein totales Chaos. In diesen dunklen Stunden halten aber die Terraner zusammen, besinnen sich auf ihre Stärken. Für andere beginnt allerdings auch DER TRAUM VON GON-ORBHON ...
Die Hauptpersonen des Romans
Mondra Diamond – Die Staatssekretärin z.b.V. interessiert sich für einen seltsamen Prediger.
Bré Tsinga – Die Kosmopsychologin sieht sich einem geänderten Weltbild gegenüber.
Homer G. Adams – Das Wirtschaftsgenie krempelt das Leben auf Terra um.
Carlosch Imberlock – Der Prediger folgt der Vision eines seltsamen Gottes.
Theorod Eysbir
1.
Er ahnte noch nicht einmal, was das leise, regelmäßige Ticken zu bedeuten hatte. Im September des Jahres 1331 NGZ kannte man keine tickenden Uhren. Syntronische Uhren hatten weder Unruh noch Zahnräder, sie besaßen keinerlei Mechanik. Ebenso wenig wie positronische Zeitmesser.
Die Uhren liefen schon seit Jahrhunderten lautlos.
Darum war es kein Wunder, dass er die Bedeutung des Tickens zunächst nicht begriff und selbst danach noch immer zu lange brauchte, um zu erkennen, was sich dahinter verbarg. Das Gefühl des Unbehagens, einer ungewissen Bedrohung war jedoch bereits früher da.
Schon als er die Halle betrat, stellte es sich ein. Nach den ersten Schritten war ihm klar, dass er besser draußen geblieben wäre. Eine innere Stimme riet ihm umzukehren. Doch er hörte nicht auf sie. Er ging weiter. Immer tiefer in die Halle hinein.
Hier findet sich nichts als Schrott! Niemand arbeitet mehr hier., machte er sich bewusst. Was soll schon passieren? Syntronikmaterial, wohin man schaut. Nichts davon mehr verwendbar. Alles Schrott, niemand sonst hat ein Interesse daran. Also beruhige dich. Kein Grund zur Panik.
Beim Anblick der achtlos an die Wände und in die Ecken geschobenen Syntronikchips, Projektoren und Interfeldgeneratoren verspürte Theorod Eysbir einen Stich im Herzen. Vor nicht allzu langer Zeit war dieses Material von erheblichem Wert gewesen und mit größter Vorsicht behandelt worden. Jetzt lag es im Dreck. Kaum zu glauben. Es war unter beträchtlichem Aufwand in vollkommen sterilen Räumlichkeiten hergestellt worden. Bei der Produktion hätte ein einziges Staubkorn genügt, um die Syntronik wertlos zu machen.
Man hatte die einzelnen Bauteile sorgfältig verpackt und in besonders gesicherten Kisten gelagert; jeder einzelne Baustein war dazu bestimmt gewesen, die Funktionsfähigkeit eines Syntrons zu gewährleisten – jener unglaublich leistungsstarken Computersysteme, die bis auf miniaturisierte Steuerchips und Projektoren sowie ein Gehäuse keinerlei Hardware mehr benötigten, weil jedes mechanische Element durch ein hyperenergetisches ersetzt worden war. Rund 800 Jahre war diese Technologie bereits alt, so fehlerunanfällig und wartungssicher wie nichts anderes.
Eysbir machte sich die Vergangenheit bewusst: Wie ein Wunder musste in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts NGZ der erste Syntron gewirkt haben, Positroniken und Inpotroniken hatten plötzlich gewirkt wie Papier und Tinte gegenüber einem einfachen Elektronengehirn. Der Aufschwung der Syntrontechnologie war beinahe kometenhaft erfolgt, sie wurde immer weiter ausgebaut, erweitert, perfektioniert, bis Syntroniken das führende Computerprinzip der Milchstraße verkörpert hatten. Ein Arbeitsplatz in der Syntronbranche war in all der Zeit im Grunde unglaublich sicher gewesen. Auch Gefahren wie spontan entstehende hyperenergetisch »Tote Zonen« oder wie der Korragische Syntronvirus waren statt als Menetekel eher noch als Ansporn begriffen worden. Jetzt war all das nur noch Geschichte, wie sein Arbeitsplatz und seine Zukunft.
Theorod seufzte. Zum ersten Mal hatte er Angst vor der Gegenwart. Seine Welt war überschaubar, deutlich, klar gewesen. Sicher. Und jetzt?
In der Decke der Halle klafften faustgroße Löcher. Durch sie lief Regenwasser herein. Es ergoss sich über das gelagerte Material und brachte Schmutz mit sich. Mit einem bitteren Lachen schüttelte Eysbir den Kopf. Kaum versagte die moderne Technik der Menschheit ihren Dienst, schon wurde sie von dem Schmutz zugeschüttet, der sich über ihr angesammelt hatte.
Mitten in der Halle blieb er stehen. Er spürte beinahe körperlich, dass etwas nicht in Ordnung war. Er meinte fühlen zu können, dass Blicke auf ihn gerichtet waren. Irgendjemand beobachtete ihn. Zu hören war nichts außer dem Trommeln des Regens auf dem Hallendach und dem Rauschen des auf dem Schrott aufprallenden Wassers.
Bis vor wenigen Tagen hatte Eysbir als hoch qualifizierter Techniker in der Syntronik-Produktion gearbeitet. Er war einer der wichtigsten Mitarbeiter des Unternehmens gewesen. Doch damit war es vorbei, seit Syntroniken überall versagten. Jetzt musste man wieder, sofern dies möglich war, zur Positronik übergehen. Doch von dieser Technik verstand er praktisch nichts, wusste bestenfalls, dass sie sich ebenfalls nur mit Material von höchster Reinheit erbauen ließ.
Er war bei der Syntron Limited & S.A. & Co. KG in der Reinraumüberwachung tätig gewesen. Wenige Wochen vor dem totalen Zusammenbruch der Syntronik war er aus Rationalisierungsgründen entlassen worden. Auf den ihm zustehenden vierjährigen Erholungs- und Ausgleichsurlaub, verbunden mit psychologischer Betreuung durch die Behörde für Zeitabschnitte vorübergehender Nichtbeschäftigung, hatte er verzichtet. Er würde ohne die Behörde schneller wieder eine Beschäftigung finden.
Aus einem Berg von Syntronprojektoren und Interfeldgeneratoren, gestapelten Kisten, Kästen und Teilen eines Antigravgleiters löste sich eine dunkle Gestalt. In dem dämmerigen Licht konnte er kaum mehr erkennen als einen Schatten, der sich schnell bewegte und durch eine sich öffnende Tür verschwand. Wasser und Dreck spritzten unter den Füßen des Flüchtenden auf.
»Stehen bleiben!«, rief Theorod Eysbir. Zu spät.
Die Gestalt hatte die Halle verlassen und tauchte nun irgendwo draußen zwischen den Lagerhallen und den vielen nutzlos gewordenen Antigravgleitern unter, die überall herumstanden. Er rannte einige Schritte hinter ihr her. Dann gab er auf und verharrte auf der Stelle.
Idiot! Was soll das bringen?
Er litt unter seiner Entlassung und war nicht bereit, diese Demütigung hinzunehmen. Seine Arbeit war sein Leben gewesen, die Basis seiner psychischen und physischen Existenz. Sie zu verlieren war gleichbedeutend mit dem Verlust eines wesentlichen Teils seiner Persönlichkeit.
Eysbir war nicht der Typ, der resignierte. Er wollte sich wehren. Er wollte sich behaupten. Er ergab sich nicht in sein Schicksal, und er schob niemandem die Schuld zu. Das Unternehmen hatte vermutlich gar keine andere Möglichkeit gehabt, als ihn auszusortieren. Wie hätte man ihn für eine Arbeit bezahlen sollen, die er nicht mehr erledigen konnte?
Er suchte nach einem Ausweg, und er glaubte ihn gefunden zu haben.
Die Halle war mit Schrott gefüllt. So konnte man es sehen. Man konnte es jedoch auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Was für die einen Schrott war, das war für die anderen ...
Das Ticken schien lauter geworden zu sein, und ihm war, als habe sich sein Herzschlag diesem Rhythmus angepasst. Plötzlich erinnerte er sich an einen schon lange zurückliegenden Besuch im Museum für altertümliche Technik. Er war mit seiner Tochter Sagha dort gewesen. Irgendwann hatten sie vor einer Vitrine gestanden, in der eine Uhr aus einer längst versunkenen Zeit ausgestellt wurde. Eine tickende Uhr, die als Zeitzünder diente und mit einer Sprengladung verbunden war.
Theorod Eysbir fuhr herum. Eine Bombe! Du Schwachkopf, es ist ...
Schatten schienen sich von allen Seiten auf ihn zu stürzen. Er setzte zu einem Spurt zur nächsten Tür an, kam jedoch nur wenige Schritte weit. Dann zuckte ein greller Blitz aus einem der Schrotthaufen auf. Feuer breitete sich rasend schnell in der Halle aus, um sich gierig fressend auf jedes Sauerstoffmolekül darin zu stürzen.
*
»Ein Scharlatan ist er. Nichts weiter als eine miese Type, die versucht, sich die Taschen zu füllen. Du wirst schon sehen. Wir sollten ihn einfach zum Teufel schicken.«
Die Worte riefen keine Reaktion hervor. Überrascht blickte sie die Freundin an.
»Was ist los, Bré?«, fragte Mondra Diamond. »Du bist so still. Irgendwie anders als sonst.«
»Wirklich?« Die blonde Frau schreckte aus ihren Gedanken auf. »Ich finde nicht.«
Mondra war enttäuscht. Sie kannte Bré schon eine ganze Weile. Die beiden Frauen vertrauten einander, konnten buchstäblich über alles miteinander reden. Geheimnisse gab es nicht. Umso mehr wunderte sie sich darüber, dass die Xenopsychologin einer offenen Antwort auswich.
Mondra war in besonderer Weise empfindsam gegenüber Bré. Sie spürte, dass es plötzlich etwas Trennendes zwischen ihnen gab, ein unsichtbares Hindernis, das sich allmählich aufrichtete und sie voneinander trennte. Umso weiter und tiefer gehend, je länger es dauerte. Sie dachte nicht daran, so lange zu warten, bis es unüberwindlich geworden war.
Irgendetwas war geschehen. Vielleicht hatte Bré eine Auseinandersetzung in der Solaren Residenz gehabt, die nun nicht mehr über Terrania schwebte, sondern zu Boden gesunken und in ihrem Futteral gelandet war. Möglicherweise aber war sie auch verstimmt, weil die Syntronik sie an diesem Morgen nicht geweckt, die Temperaturen in ihrem Appartement nicht geregelt, den Kaffee nicht gekocht, das Frühstück nicht angerichtet, das Wasser in der Dusche nicht erhitzt und die Farbtöne der Wände nicht der morgendlichen Stimmung angepasst hatte.
Oder hatte es gar daran gelegen, dass dieser seltsame Prediger sie bei einem seiner öffentlichen Auftritte direkt angesprochen hatte, als ob er sie erkannt hätte?
Um ihr Ziel möglichst schnell zu erreichen, hatten Bré Tsinga und Mondra Diamond die Rohrbahn genommen, die bis an den Stadtrand von Terrania führte.
An diesem kühlen, regnerischen Septembertag achtete niemand in der Rohrbahn auf die beiden Frauen. Das lag sicherlich mit daran, dass Mondra, um Aufsehen zu vermeiden, darauf verzichtet hatte, den Klonelefanten Norman mitzunehmen. Dessen Trompeten hätte im Normalfall für Aufmerksamkeit gesorgt. Zudem hatten die Bewohner von Terrania derzeit genügend mit sich selbst zu tun. Nach dem Ausfall der Syntron-Technologie lag praktisch jedes Wohnhaus still, waren nahezu hundert Prozent aller Haushaltsgeräte ausgefallen. Komfortable Einrichtungen wie etwa die Steuerung und Kontrolle des Haushalts waren für die Menschen so selbstverständlich geworden wie den Menschen früherer Zeiten die Glasscheiben in den Fenstern ihrer Häuser.
Jetzt funktionierten die Geräte nicht mehr, und jeder Bewohner der Stadt war davon betroffen. Es gab keine Ausnahmen. Sogar die Obdachlosen mussten mit einbezogen werden. Sie hatten sich ausnahmslos aus freien Stücken dafür entschieden, ohne Dach über dem Kopf in der Stadt zu leben. Sie gaben sich der Illusion hin, der absolute Verzicht auf alles, was sie als Zwänge der Zivilisation empfanden, bedeute Freiheit für sie. Tatsächlich trug jeder von ihnen einen syntronischen Chip, der ihn dazu berechtigte, einen gewissen Sozialbetrag an irgendeinem Bankautomaten abzuheben. Sie konnten ihn in kleinen Teilbeträgen abrufen oder in einer Summe.
Bis vor wenigen Tagen. Nun konnten sie es nicht mehr. Zyniker behaupteten, endlich hätten sie tatsächlich die Freiheit gewonnen, die sie erstrebten.
Die Rohrbahn erreichte ihr Ziel, und die beiden Frauen verließen im Strom der anderen Fahrgäste die Haltestelle. Die Luft vibrierte von der Musik, die mit Hilfe von mächtigen Lautsprechern abgestrahlt wurde. Positronisch geregelten Lautsprechern.
Bré Tsinga sagte etwas, doch Mondra verstand sie nicht. Es war zu laut. Sie sah nur die Lippenbewegungen der Psychologin. Sie stopfte sich Schaumstoffstöpsel in die Ohren, um sich vor dem Lärm zu schützen.
Sie glitten eine Schräge hinauf und erreichten mit wenigen Schritten einen weiten Platz, der sich über etwa dreihundert Meter hinweg in vier Stufen sanft anhob. So konnten sie über die Köpfe der versammelten Menge hinweg jenen Mann sehen, der die Menschen der Stadt zurzeit in seinen Bann schlug. Sie hatten die Fahrt mit der Rohrbahn auf sich genommen, um sich noch einmal ein Urteil über ihn bilden zu können. Sie wollten wissen, weshalb er einen so großen Einfluss auf die Massen hatte.
Carlosch Imberlock.
Er war der Erfolgreichste unter jenen, die Weltuntergangsstimmung verbreiteten und vor allem jene Menschen in Scharen anzogen, die zu schwach oder verunsichert waren, um die neue Situation ohne Hilfe bewältigen zu können. In ihrer Angst und Panik suchten sie ihr Heil ausgerechnet bei jenen, die ihnen ganz sicher nicht aus der Not helfen konnten.
Imberlock stand weit von Mondra und Bré entfernt auf dem höchsten Punkt des Platzes. Er hatte sich zudem auf ein Podest gestellt. Zwei Lautsprecherwände flankierten ihn. Aus weiteren Wänden an den Rändern des Platzes schallte die Musik auf die Menge herab.
Mondra kalibrierte die Sichtfelder vor ihren Augen; es handelte sich nicht um Sehhilfen im klassischen Sinne, sondern um Felder regulierter Luft, die sie befähigten, den Mann wie durch ein leistungsstarkes Fernglas zu sehen. Er war durchschnittlich groß. Sie schätzte, dass er knapp unter zwei Metern maß.
Hinter ihm erhob sich eine riesige Leinwand mit dem Symbol des Gottes Gon-Orbhon – ein Schwert vor einem flach liegenden Oval.
Mondra Diamond beobachtete den Mann. Ein dunkler Vollbart umrahmte sein Kinn. In sanften Wellen fielen die dunkelbraunen Haare bis auf die Schultern herab. Eine schmale Nase krümmte sich über dem Mund. Die Augen hatten eine intensiv dunkelblaue Farbe. Ihr war, als seien seine Blicke direkt auf sie gerichtet. Das seltsame Gefühl beschlich sie, die Massen hätten sich nicht versammelt, um den Verkünder des Gottes Gon-Orbhon zu hören, sondern bildeten nur eine Kulisse für ein stummes Zwiegespräch zwischen ihm und ihr.
Du kannst mich mal!, schoss es ihr durch den Kopf. Die anderen magst du ja verrückt machen. Aber mich kriegst du nicht. Niemals.
Obwohl der Mann in seiner dunkelblauen Kombination und mit den wadenhohen schwarzen Stiefeln eher schlicht wirkte, spürte Mondra Diamond doch auf einer anderen Wahrnehmungsebene die Faszination, die von ihm ausging. Sie wehrte sich vehement dagegen. Sie war nicht bereit, diesem Mann etwas Besonderes zuzubilligen.
Als der Lärm der Musik endlich endete und der Mann zu sprechen begann, hörte sie kaum zu, obwohl seine Worte ihr möglicherweise eine Antwort auf jene Frage hätten geben können, die sie am meisten beschäftigte.
»Ich bin das Medium meines Gottes Gon-Orbhon!«, dröhnte es aus den Lautsprechern.
Eine geradezu unerhörte Aussage! Und eine Provokation sondergleichen.
Er leugnete schlicht den Mehrheitsglauben der Terraner, dass es nur einen Gott gab. Neben dem Einen Gott, ob man ihn nun Allah, Jehova oder anders bezeichnete, präsentierte er einen weiteren Gott namens Gon-Orbhon und tat dabei so, als habe der eine Gott ausgedient, um durch einen anderen ersetzt zu werden. Damit griff er wesentliche Grundlagen der terranischen Zivilisation an.
Mondra Diamond sah sich um. Die meisten Menschen richteten ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Medium dieses Gottes, sie hingen mit ihren Blicken buchstäblich an seinen Lippen. Sie schienen wie gebannt, als sei ihr eigenes Urteilsvermögen ausgeschaltet. Einige wenige wandten sich kopfschüttelnd ab und gingen davon.
Gut so!
Sie wandte sich der Freundin zu. Gehörte sie auch zu jenen, die auf das Wort dieses Mediums hereinfielen? Ganz sicher nicht. Bré bemerkte ihre Blicke. Sie begegnete ihnen mit jenem kleinen Lächeln, das Mondra an ihr kannte und mochte. Bré mochte verstimmt sein, aber das hatte nichts mit Carlosch Imberlock zu tun. Er war allenfalls ein Studienobjekt für sie.
Mondra rief sich einiges von dem ins Gedächtnis, was sie von Imberlock wusste. Selbstverständlich hatte sie sich genauer über ihn informiert, bevor sie aufgebrochen war, um erneut eine seiner Predigten zu hören. Mittlerweile gab es Informationen des Terranischen Liga-Dienstes.
Er war geboren worden, während der Diener der Materie Ramihyn auf Terra seine Schneisen des Todes zog. Noch nicht einmal dreizehn Jahre alt, schloss er sich nach der Eroberung des Solsystems durch die von SEELENQUELL beeinflussten Arkoniden der von Roi Danton gegründeten Gruppe Sanfter Rebell an.
Die prägende Zeit hatte der Prediger vermutlich im MultiKonfessZentrum Neu-Londons verbracht, einer Begegnungsstätte vor allem für die Religionen terranischen Ursprungs. Aber auch die spirituellen Bedürfnisse vieler anderer galaktischer Völker stießen hier auf Verständnis und Gegenliebe. Der siebeneckige Platz vor dem Gebäude wurde von Plastiken – in Form von Symbolen aller vertretenen Religionen – beherrscht, die in Form der liegenden Acht angeordnet waren, des Zeichens für Unendlichkeit, einer Figur ohne Anfang und ohne Ende.
Später hatte Carlosch Imberlock die Erde verlassen, um ziellos durch die Galaxis zu ziehen. Dabei war er mit dem Passagierschiff IMPRESSION in einen Hypersturm geraten. Die meisten Passagiere an Bord waren getötet worden. Er hatte zu den wenigen Überlebenden gehört.
Mit seinen Predigten auf der Erde hatte er nach dem Hyperimpedanz-Schock am 11. September 1331 NGZ begonnen. Zunächst unbeachtet. Später mit wachsender Aufmerksamkeit.