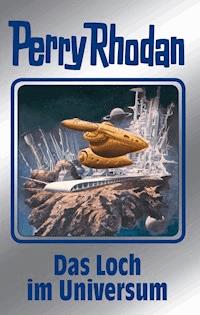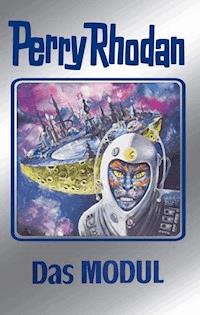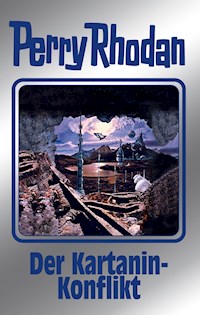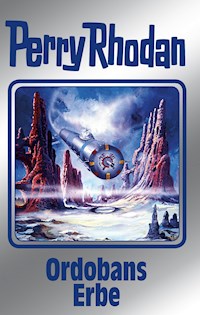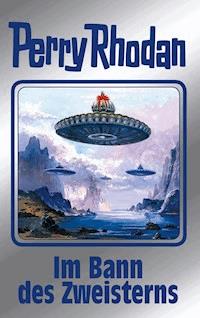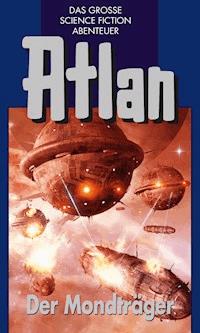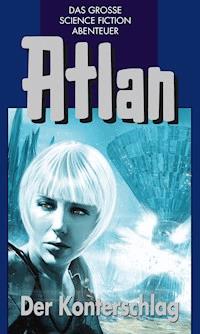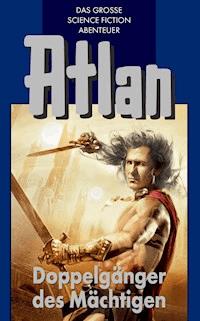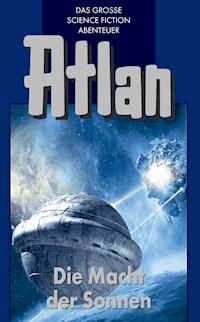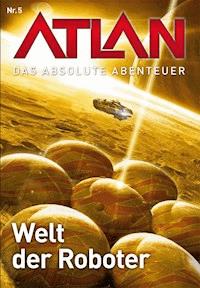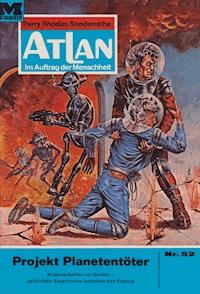Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Auf der Welt der Caiwanen - eine Volksbewegung entsteht Die Milchstraße wird derzeit von drei Machtblöcken beherrscht: dem monolithischen Imperium von Arkon, mit dem unsterblichen Imperator Bostich I. an seiner Spitze, der föderalistisch organisierten Liga Freier Terraner ( LFT ), zu der sich nahezu alle anderen Unsterblichen der Galaxis bekennen, und dem eher lockeren Interessenverbund des Forums Raglund, in dem die Blues den Ton angeben. Reisen zwischen den Sternen werden dabei durch fortschrittliche Technologien ermöglicht, die unabhängig von ihrem Qualitätsgrad eines gemeinsam haben: Um sie zu betreiben, bedarf es unter anderem der so genannten Hyperkristalle. Von daher gilt die eherne Regel: Wer die Förderung und Produktion von Hyperkristallen beherrscht, der kontrolliert die Galaxis. Jede zusätzliche Mine vergrößert die Macht jener, die sie besitzen. Das galaktische Recht bleibt dabei nicht selten auf der Strecke, und die Ausbeutung unterentwickelter Völker wird oft genug verbrämt. Ein Mittel dazu ist DER FINGER GOTTES...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 2236
Der Finger Gottes
Auf der Welt der Caiwanen – eine Volksbewegung entsteht
H. G. Francis
Die Milchstraße wird derzeit von drei Machtblöcken beherrscht: dem monolithischen Imperium von Arkon, mit dem unsterblichen Imperator Bostich I. an seiner Spitze, der föderalistisch organisierten Liga Freier Terraner (LFT), zu der sich nahezu alle anderen Unsterblichen der Galaxis bekennen, und dem eher lockeren Interessenverbund des Forums Raglund, in dem die Blues den Ton angeben.
Reisen zwischen den Sternen werden dabei durch fortschrittliche Technologien ermöglicht, die unabhängig von ihrem Qualitätsgrad eines gemeinsam haben: Um sie zu betreiben, bedarf es unter anderem der so genannten Hyperkristalle.
Von daher gilt die eherne Regel: Wer die Förderung und Produktion von Hyperkristallen beherrscht, der kontrolliert die Galaxis. Jede zusätzliche Mine vergrößert die Macht jener, die sie besitzen.
Das galaktische Recht bleibt dabei nicht selten auf der Strecke, und die Ausbeutung unterentwickelter Völker wird oft genug verbrämt. Ein Mittel dazu ist DER FINGER GOTTES ...
Die Hauptpersonen des Romans
Dando Gentury – Ein Caiwane lernt die Arkoniden noch besser kennen.
Owara Asa Tagakatha – Der caiwanische Priester predigt Wasser und trinkt Wein.
Otarie – Eine junge Frau wird zum Leitstern Caiwans.
Protana Aaqrass – Der arkonidische Tato nutzt die Religion für seine Zwecke.
Thorman da Vakalo
21.365 da Ark / 1236 NGZ
Der junge Arkonide ließ die Tischsyntronik mehrere Tabellen als Hologramme erstellen. Mit sparsamen, gezielten Bewegungen verschob er sie, fügte weitere Daten hinzu und blieb dann eine Weile stumm vor dem Ergebnis sitzen. Seine Miene verdüsterte sich. Die Leuchtplatte des Tischs strahlte ihn von unten an und verlieh seinem noch jungenhaften Gesicht einen Anflug von Strenge, der erahnen ließ, welcher harte Charakter unter den weichen Zügen lauerte.
»Komm mal her, Aktakul«, sagte er leise. Seine Stimme war deutlich zu verstehen; eine Stimme wie Samt über einer Stahlschneide.
Aktakul, ein Kolonialarkonide mit allen Anlagen dazu, einer der besten Wissenschaftler des Imperiums zu werden, eilte herbei. Es war nicht die hastige Gehweise eines Arkoniden zweiter Ordnung, sondern die selbstbewusste Art eines Mannes, der seinen Weg ging. Jedem, der die beiden beobachtet hätte, wäre sofort bewusst geworden, wie vertraut sie miteinander waren.
»Sieh dir das an«, sagte der junge Arkonide und schob Aktakul einen Stapel Folien zu, »und vergleiche es mit dieser Projektion.«
Der Wissenschaftler schnalzte anerkennend mit der Zunge, nachdem er einen ersten Blick auf die oberste Folie geworfen hatte. »Nicht übel«, kommentierte er. »Ein ergiebiges Hyperkristallvorkommen. Kenne ich den Planeten? Simyne vielleicht?«
»Nicht anzunehmen, dass ihn überhaupt jemand kennt: Caiwan. Die Imperatrice hat den Abbau dort untersagt.«
Aktakul erwiderte nichts, auf eine Art, die bei ihm ungefähr das Gleiche bedeutete wie ungläubiges Augenaufreißen bei anderen. Für einige Atemzüge war es still.
»Aber ... wieso?«
»Sag du es mir«, wurde er aufgefordert.
Wieder aufgeregte Stille, die nur von gelegentlichem Rascheln der Folien und leisem Räuspern unterbrochen wurde. Schließlich seufzte Aktakul.
»Wenn die Daten stimmen – und daran zweifle ich selbstverständlich nicht –, haben wir es mit einer Melange an Hyperkristalladern zu tun, die so ergiebig sind, dass die Kristalle sogar in ganzen Brocken abgebaut werden könnten. Der Nachteil dabei ist die Qualität; das meiste sind geringerwertige Sorten wie Skabol und Khalumvatt. Die schiere Menge würde das allerdings durchaus wettmachen. Wenn man sie benötigen würde.«
»Ganz genau. Das Imperium benötigt Hyperkristalle, um seine Flotten auszurüsten, um neue Flotten zu bauen, um dem imperialen Frieden ein Gesicht zu verleihen. Ich verstehe nicht, wieso sie das nicht begreift. Die Geschichte hat bewiesen, dass nur ein starkes Arkon auch Prosperität und Stabilität garantiert.«
»Warte«, warf Aktakul ein, »die Politik der Stärke ist nicht die Politik der Imperatrice.«
Er erntete einen Blick, der so kalt war wie das Eis einer Leerraumwelt.
»Es mag nicht die Politik der Imperatrice sein, aber es war oft genug Politik des Imperiums. Die Herrscher mögen wechseln, doch die Politik bleibt die gleiche, mit geringen Abweichungen. Doch das sind nur temporäre Schwankungen. Dir fehlt die Perspektive, mein Freund.«
»Mag sein. Aber hier hast du eine Reihe von Daten nicht in deine Darstellung aufgenommen. Hier, siehst du?« Aktakul verschob mit fließenden Bewegungen, die viel von seinem Geschick ahnen ließen, einige Hologrammzeilen, fügte neue ein und knüpfte die entsprechenden Verbindungen. Die Abbildung veränderte sich, nur ein wenig zwar, aber das genügte. »Du hast den Faktor der Ureinwohner ausgeklammert. Wie du hier sehen kannst, ist der starke Hyperkristallgehalt Caiwans nicht ohne Auswirkungen auf sie geblieben – und umgekehrt. Die Daten sind zwar nur bruchstückhaft, weil die Exploration offenkundig abgebrochen wurde ...«
»Auf Geheiß der Imperatrice«, erinnerte der andere.
»Die entscheidungsrelevanten Rückschlüsse sind aber bereits deutlich geworden«, ließ sich der Wissenschaftler nicht beirren. »Die Kristalle erzeugen eine Art Strahlungsfeld, das auch die Planetarier einschließt und beeinflusst. Ob der Begriff einer Symbiose angebracht ist, kann ich nicht verifizieren, doch es ist als Arbeitshypothese sicherlich keine schlechte Annahme. Wenn du nun diese Daten in Verbindung setzt mit ...«
»Komm zur Sache«, mahnte der Arkonide mit dem so täuschend harmlosen Gesicht.
»Wie du hier sehen kannst«, einige rasche Veränderungen an den Tabellen, einzelne Zahlenkolonnen glühten grün auf und wuchsen an, »haben die Kristalladern auf unsere Schürfkommandos immer reagiert, indem sie ab einer gewissen Mindestdistanz und in einem begrenzten Umkreis implodierten, zu Staub zerfielen und vollkommen nutzlos wurden. Testversuche, bei denen Eingeborene eingesetzt wurden, endeten hingegen positiv. Offensichtlich gibt es hier Zusammenhänge.«
»Und?«
»Um es auf den einfachsten Nenner zu bringen, ist die Wahrscheinlichkeit für folgendes Szenario sehr hoch: Wenn die Eingeborenen die Kristalle aus den Adern lösen, geschieht nichts, und man kann sie wie alle anderen Kristalle auch weiterverarbeiten. Ohne sie ... bumm.« Er machte eine vage Handbewegung. »Alles, was man zu tun braucht, ist, diese Caiwanen in Bergwerke zu schicken.«
Aktakuls Freund lächelte bitter. »Das genau ist das Problem: Wir brauchen die Kristalle nicht so dringend, dass die Imperatrice den Imageverlust Arkons akzeptieren würde, wenn Nachrichten davon die Öffentlichkeit erreichten. Entlohnte man die Wilden nach gängigen galaktischen Tarifen, würde ganz Arkon aufstöhnen. Zahlt man ihnen aber weniger, melden sich die Terraner mit ihrer Moral und stellen unser ganzes Volk an den Pranger. Keines der beiden Szenarien ist günstig für die derzeitige Politik. Und für Arkon.«
»Lass es sein. Wir beide werden daran nichts ändern können.«
»Nicht heute.«
»Ich weiß schon. Irgendwann wirst du das ändern. Und ich werde hoffentlich alt genug, um das auch zu erleben.« Aktakul lächelte und klopfte dem Freund kameradschaftlich auf die Schulter, etwas, das sonst kaum einer wagte oder wollte.
Gaumarol da Bostich war keiner, der schnell Freundschaften schloss und große Vertraulichkeiten zuließ. Nur Aktakul durfte sich so etwas herausnehmen. Er und vielleicht noch Sargor da Progeron an einem besonderen Tag.
»Keine Sorge. Du wirst es erleben, und Caiwan wird zu einem der größten Hyperkristall-Lieferanten des Imperiums.«
»Genau. Und du wirst vom Verwaltungsfachmann zum Imperator.«
Bostich lachte leise, und lachend ging Aktakul davon – beide wussten sehr genau, wie gering die Chancen standen, dass jemals ein da Bostich den Kristallthron bestieg.
Vier Arkonjahre später nahm Gaumarol da Bostich als Bostich I. die Reichsinsignien in Empfang: die konische Diamantkrone, das Arkonstahl-Szepter, die Kette aus dreifach gereihten Medaillons, den Umhang aus Kehoe-Tuch und ein kostbares Dagor-Schwert.
Und noch immer erinnerte er sich an Caiwan.
1.
Enko, der Kupfermond, war gerade hinter den matt schimmernden Wolken verschwunden, als die Nachricht wie ein Lauffeuer durch das Dorf Gentury ging: Menma sei zurückgekehrt.
Dando ließ den Holzstab liegen, mit dem er in einem Schlangenloch gestochert hatte, und rannte los. Auf keinen Fall wollte er den Mann verpassen, von dem er schon so viel gehört hatte, der von allen Bewohnern des Becktatals bewundert wurde und auch bei jenen der anderen Täler in hoher Achtung stand.
Menma war für ihn, den knapp vierzehnjährigen Jungen, wie ein Wesen aus einer anderen, höheren Welt. Vor Jahren hatte er das Tal verlassen, um in der Stadt Takijon zu arbeiten. Immer wieder hatte er Geld oder wertvolle Güter zum Wohle der Gemeinschaft nach Gentury geschickt. Er war ein wohlhabender Mann geworden, was er im Becktatal – nach übereinstimmender Meinung aller Jungen und Mädchen und wohl auch einiger Erwachsener – niemals erreicht hätte.
Geheimnisvolle Kristalle wurden bei Takijon aus den Bergen gewonnen. Die Weißen zahlten offenbar viele Chronners dafür. Vielleicht war Menma auf eine besonders ergiebige Mine gestoßen, oder ihm gehörte womöglich ein ganzes Bergwerk. Dando wusste es nicht, aber er hoffte, es in diesen Tagen zu erfahren. Sicherlich würde Menma erzählen, wie es ihm ergangen war.
Der Junge eilte einen gewundenen Feldweg hinunter ins Dorf, das malerisch an einem sanft geschwungenen Fluss lag und von großen Sischa-Bäumen beschattet wurde. Schon von weitem sah er, dass sich die Dorfbewohner am fließenden Wasser versammelt hatten. Er fand, dass sie merkwürdig still waren.
Unwillkürlich verzögerte er seine Schritte. Er hatte einen gewissen Trubel erwartet, wie er einem so wichtigen Mann wie Menma zustand. Doch die Männer, Frauen und Kinder des Dorfes waren still. Auffallend still. Sie bildeten einen Halbkreis um den Ala-Felsen herum, der direkt am Ufer lag und den Göttern des Wasserwandels gewidmet war. Das war nichts Ungewöhnliches. Jeder, der etwas Bedeutsames mitzuteilen hatte, durfte dies von dem Felsen aus tun. So konnte er sich der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer sicher sein.
Dando spürte eine unangenehme Kälte in seinem Rücken. Eine unsichtbare Hand schien ihn zurückzuhalten und seine Schritte zu hemmen. Schließlich ging er so langsam, dass er kaum eine Handbreit pro Schritt gewann.
Menma war ein großer, eindrucksvoller Mann, aber er sah anders aus, als Dando ihn sich vorgestellt hatte. Ganz anders. Er hatte einen strahlenden Mann erwartet, jemanden, dem der Erfolg anzusehen war, jemanden, den das Selbstbewusstsein und die in ihm wohnende Energie aus der Menge der anderen hervorhoben.
Menma war nicht so. Er sah aus, als ob er unter größter Pein zu leiden habe, als werde er von schier unerträglichen Schmerzen heimgesucht. Das zeigte sich schon daran, dass die meisten der bunten Federn an den Rückseiten seiner Arme abgefallen waren, obwohl es ansonsten keinerlei Anzeichen der Mauser gab. Seltsam wirkte das seidige Tuch, das den vorderen Teil seines Körpers bedeckte. Zahllose Stickereien darauf schilderten bedeutsame Szenen aus seinem Leben.
Dando blickte unwillkürlich an sich hinab. Auch er trug so ein Tuch, um seine Blößen zu bedecken. Allerdings fand sich nur eine winzige Stickerei darauf. Mit seinen vierzehn Jahre war er zu alt, um noch ein Kind zu sein, und zu jung, um schon als Erwachsener zu gelten. Von ihm gab es bislang nur zu berichten, dass er als Kleinkind von einem Raubtier angefallen und am Bein verletzt worden war. Von Leistungen für das Dorf und die Gemeinschaft konnte noch nicht die Rede sein.
Von weniger ehrbaren Spuren aber auch nicht.
Anders war es bei Menma. Die Vorderseite der Arme, der Beine, des Unterleibes und der Brust waren im Gegensatz zum Rücken vollkommen unbehaart. Hier war die Haut so zartrosa, wie es sein sollte – mit einer Ausnahme. Einer schrecklichen Ausnahme.
Die Brust, deren Haut makellos sein sollte, wurde von einer bläulichen Tätowierung verunziert, einer in die Haut eingeprägten Zeichnung eines Ungeheuers mit funkelnden Augen, einem weit aufgerissenen Rachen und acht Armen. Ihr Anblick verschlug nicht nur Dando die Sprache, sondern rief auch bei den erwachsenen Dorfbewohnern lähmendes Entsetzen hervor.
»Die Reinheit der Haut ist das höchste Gebot der Götter Cham und Phtatha«, stieß ein alter Mann hervor, der dicht am Stein stand. »Das weißt du so gut wie wir alle. Wie konntest du eine solche Schande über uns bringen?«
»Ich verstehe nicht, dass du es überhaupt wagst, zu uns zu kommen!«, rief ein anderer. »Mit einer solch blasphemischen Verstümmelung!«
»Ich bleibe nicht«, antwortete Menma mit brüchiger Stimme, die mehr als alle Worte verriet, wie es in ihm aussah. »Ich gehe in die Wüste. Zuvor aber wollte ich euch zeigen, was die Weißen mir – und uns allen – angetan haben. Ich habe nichts verbrochen, was ihren Zorn hätte hervorrufen können. Ein Missverständnis ließ mich in ihren Augen schuldig erscheinen. Das genügte, mich in dieser Weise zu verstümmeln und zu schänden.«
»Wir alle haben dich immer für einen ehrenwerten Mann gehalten«, entgegnete der Alte. »Doch deine Worte gefallen uns nicht. Du bist schuldig. Warum bekennst du dich nicht dazu? Die Weißen kommen im Auftrag der Götter. Daher können sie nicht irren. Sie hätten dich nicht in dieser Weise bestraft, wenn sie sich ihrer Sache nicht wirklich sicher gewesen wären. Die Götter hätten sie davon abgehalten.«
Menma senkte den Kopf. Der Wulst, der senkrecht von der Kopfmitte bis zu seiner Brust herabreichte, verlor seine hellblaue Farbe und wurde dunkel, fast schwarz, während die leuchtend hellen Streifen an der Seite eine dunkelrote Farbe annahmen, sodass die darin eingelagerten Augen kaum noch zu erkennen waren. Ohne ein weiteres Wort ging der Tätowierte durch die Menge, die sich vor ihm öffnete. Ganz dicht schritt er an Dando vorbei. Der Junge meinte fühlen zu können, wie sehr der Mann litt, der den Beinamen der Weise trug. Er konnte seinen Blick nicht von ihm lösen.
Er tat ihm Leid, obwohl die Worte des Alten recht überzeugend in seinen Ohren klangen. Der große Menma musste eine schwere Schuld auf sich geladen haben. Anders war seine Bestrafung nicht zu erklären. Aber was konnte er getan haben, dass die Weißen zu einer so extremen Maßnahme wie der Schändung der Haut gegriffen hatten?
Einige Schritte von dem Jungen entfernt blieb Menma stehen, drehte sich um, sank in die Hocke und öffnete die Ledertasche, die er in der Armbeuge trug. Er brachte bündelweise Chronners daraus zum Vorschein. Wortlos legte er das Geld auf den Boden. Es war so viel, dass alle Bewohner des Dorfes auf Jahre hinaus davon leben konnten. Er wollte es nicht mehr. Als die Tasche leer war, erhob er sich und ging davon, den Kopf gesenkt. Ein gebrochener Mann.
Dando zog sich bis an den Dorfrand zurück und folgte Menma mit seinen Blicken, bis der Ausgestoßene weit von ihm entfernt zwischen hoch aufragenden Felsblöcken in einer Schlucht verschwand. Der Junge wusste, dass sich die Schlucht in eine wasserlose Wüste öffnete, und er fragte sich, wie der bisher von ihm so verehrte Mann dort überleben wollte.
Als sein Freund Kae aus den Büschen hervortrat und sich zu ihm gesellte, sagte er: »Ich will Nennean suchen. Es wird einige Zeit dauern, bis ich zurückkomme.«
»Ist gut«, erwiderte der Freund. »Ich sag's deiner Mutter.«
Sie blickten einander kurz an, dann eilte Dando davon. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er verschwiegen hatte, was er tatsächlich beabsichtigte, tröstete sich jedoch mit dem Gedanken, dass ihm Kae letztlich dankbar sein würde, weil ihm endlos lange Erklärungen erspart geblieben waren.
Er lief schnell, und es dauerte nicht lange, bis er die Schlucht erreichte. Geschickt sprang er über die Felsen, überwand einen reißenden Bach, indem er über einen umgestürzten Baum balancierte, kroch durch einen vom Wasser gegrabenen Tunnel und sah Menma vor sich, wie er mit schleppenden Schritten in die Wüste hinauszog. Eine deutliche Spur blieb im weichen gelben Sand zurück.
Er wollte ihm folgen, um ihm einige Fragen zu stellen. Vor allem interessierte ihn, wie man in der Stadt so viel Geld verdienen konnte, dass man davon ein ganzes Dorf mit mehr als zweitausend Seelen versorgen konnte. An die Strafe, die Menma hatte hinnehmen müssen, dachte er nicht. Er war davon überzeugt, dass ihm ein derartiges Missgeschick niemals widerfahren würde. Auch dann nicht, wenn er in die Stadt ginge. Warum auch?
Die Weißen waren von den Göttern nach Caiwan geschickt worden, also hatten sich ihnen alle widerspruchslos unterzuordnen. Ihm war unverständlich, dass Menma es nicht getan hatte. War ihm denn nicht bewusst gewesen, dass er sich damit dem Willen der Götter widersetzt, den Zorn der Götter geradezu herausgefordert hatte?
Ein unangenehmer Geruch wehte ihm um den Hals und alarmierte ihn. Erschrocken zog er sich in den Schatten eines Felsens zurück, um dort bewegungslos auszuharren. Nur wenige Atemzüge später tauchte ein Zahnanther auf. Es war ein gewaltiges Männchen, das auf vier kräftigen Beinen lief: Seine Widerristhöhe überragte Dandos Größe mit Leichtigkeit.
Mit unglaublich geschmeidigen Bewegungen strich das Raubtier durch die Felsen, den Kopf tief nach unten gedrückt, die Lefzen gierig in die Höhe gezogen. Speichel tropfte zwischen den Zähnen herab, die wie vier handlange Dolche vorn aus seinem Kiefer hervorragten.
Dando wagte nicht, sich zu bewegen. Er atmete ganz flach. Vergeblich versuchte er, das trommelnde Herz in der Brust zu beruhigen. Er fürchtete, die Bestie könnte es hören oder mit ihren besonderen Sinnen seine Nähe erfassen. Zahnanther waren geheimnisvolle Tiere mit Fähigkeiten jenseits seiner Vorstellung. Oft hatte er den Worten der beiden Alten im Dorf gelauscht, wenn sie Geschichten von ihnen erzählten. Wenn richtig war, was sie berichteten, vermochten Zahnanther sich sogar in anderer Wesen Gedanken einzuschleichen und alles zu ergründen, was man lieber für sich behalten würde.
Lautlos verschwand das Tier zwischen den Felsen. Der Junge wartete noch ein wenig, dann hastete er davon, bemüht, so wenig Geräusche wie nur eben möglich zu machen. Als ein Spalt in den Felsen vor ihm auftauchte, schlüpfte er hindurch, warf sich auf den Boden und spähte hinaus. Der Spalt war schmal. Möglicherweise so eng, dass der Zahnanther nicht hindurchkriechen konnte.