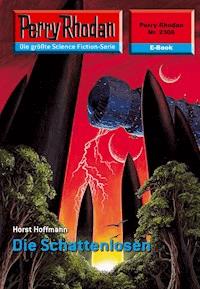
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
Sie sind zu neunt - und wirken wie Säulen der Ewigkeit Auf der Erde und den Planeten der Milchstraße schreibt man das Jahr 1344 Neuer Galaktischer Zeitrechnung - dies entspricht dem Jahr 4931 alter Zeitrechnung. Eine Epoche des Friedens und der Forschung scheint angebrochen zu sein, da werden diese Hoffnungen jäh zerstört. Erste Einheiten der Terminalen Kolonne TRAITOR treffen in der Milchstraße ein. Sie sind Abgesandte der Chaosmächte, die nach der Galaxis greifen und diese komplett ausbeuten wollen. Den Terranern gelingt es zwar, das für das Solsystem vorgesehene Kolonnen-Fort zu vernichten. Damit stellen sie jedoch die Ausnahme dar. Überall in der Milchstraße entstehen Kolonnen-Forts, agieren die Söldner des Chaos. In diesen Zeiten gilt als Gebot der Stunde: Ruhe bewahren und Lage sondieren. Die Liga Freier Terraner darf nicht auseinander brechen. Und so schickt Perry Rhodan den Verteidigungsminister auf eine "Goodwill-Tour" durch die neuesten Kolonien der Liga. Im Sektor Hayok, im Sternenozean von Jamondi, erwarten ihn DIE SCHATTENLOSEN...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 2308
Die Schattenlosen
Sie sind zu neunt – und wirken wie Säulen der Ewigkeit
Horst Hoffmann
Auf der Erde und den Planeten der Milchstraße schreibt man das Jahr 1344 Neuer Galaktischer Zeitrechnung – dies entspricht dem Jahr 4931 alter Zeitrechnung. Eine Epoche des Friedens und der Forschung scheint angebrochen zu sein, da werden diese Hoffnungen jäh zerstört.
Erste Einheiten der Terminalen Kolonne TRAITOR treffen in der Milchstraße ein. Sie sind Abgesandte der Chaosmächte, die nach der Galaxis greifen und diese komplett ausbeuten wollen.
Den Terranern gelingt es zwar, das für das Solsystem vorgesehene Kolonnen-Fort zu vernichten. Damit stellen sie jedoch die Ausnahme dar. Überall in der Milchstraße entstehen Kolonnen-Forts, agieren die Söldner des Chaos.
Die Hauptpersonen des Romans
Reginald Bull – Der Verteidigungsminister der LFT macht eine »dienstliche Hochzeitsreise« durch Jamondi.
Gucky – Der Mausbiber betritt eine neue Welt.
Ela – Eine Jäger-Fischerin begegnet dem Tod und verlässt ihre alte Welt.
Jan Shruyver
Prolog
Die Neun ragten in zeitloser Majestät in den von düsteren Gewitterwolken schwangeren, unruhigen Himmel. Nur ab und zu fand ein Sonnenstrahl zwischen den Türmen hindurch den Weg zu ihnen und tauchte ihre vom Regen nasse, schwarze Oberfläche in ein fahles, gespenstisches Licht.
Kein Laut war zu hören außer dem fernen, düsteren Grollen des heraufziehenden Unwetters. Die Neun standen schweigend, wie festgemauert in ihrem Kreis, still und geheimnisvoll wie seit Anbeginn der Zeit. Kein Vogel, kein Insekt, kein anderes Tier wagte es, ihre Ruhe zu stören – geschweige denn einer der Novanten. Selbst die Pflanzen des Planeten schienen ihre Nähe zu scheuen. In weitem Umkreis um die Neun wuchs nichts, nicht einmal Moose oder Flechten. Es war, als ob ein mächtiger Zauber sie umgäbe und alles fern hielte, was sie in ihrer Ruhe zu stören vermochte.
Doch diese Ruhe war nur scheinbar.
Kein auf Novatho geborenes Wesen besaß die Sinne, um das lautlose Wispern wahrzunehmen, das zwischen den Säulen stand. Es war unhörbar für eine Welt, deren Geschicke sie seit jenem Tag schweigend gelenkt hatten, an dem sie an diesen Ort gekommen waren, eine urzeitliche Umgebung, in der sich das Leben erst anschickte, die ersten Schritte aus den dunklen Wäldern heraus zu tun.
Niemand war da, um die Veränderung in dem psionischen Rauschen zu bemerken, das zwischen den Obelisken stand. Niemand registrierte den Aufruhr, der in dem mentalen Verbund tobte, seitdem sie den fernen Ruf vernahmen. Und niemand war da, um ihre Verzweiflung zu spüren, weil sie diesen Ruf weder richtig verstehen noch auf ihn antworten konnten.
Sie waren allein, solange sie denken konnten. Und es hatte den Anschein, als hätten sie in ihrer Isolation verlernt, mit anderen zu kommunizieren, die so waren wie sie. Sie hörten sie, über unendliche Entfernungen hinweg, doch sie konnten nicht reagieren.
Sie fühlten nur, dass der Ruf eine Warnung darstellte. Etwas geschah. Etwas kam auf sie zu. Etwas näherte sich aus Raum und Zeit, was ihnen galt – ihnen und der Welt, die ihnen anvertraut war.
Und sie wussten, es musste etwas Schreckliches sein.
Der Donner zerschlug das Schweigen des geheiligten Ortes. Die ersten Blitze zuckten aus den sich zusammenballenden Wolkentürmen herab auf die Ebene.
Die Neun ragten still und schweigend in die Dunkelheit wie riesige, einhundert Meter hohe Finger, die dem Wüten der entfesselten Elemente trotzten, wie sie es immer getan hatten. Sturm und Regengüsse konnten ihnen ebenso wenig anhaben wie Hitze und Frost. Sie hatten allem standgehalten, was im Lauf der Jahrmillionen auf sie eingedrungen war.
Doch das, die lange Zeit der Ruhe und Sicherheit, war bald vorbei. Sie spürten es. Sie wussten es.
1.
Ela
Eben noch hatte sie den Kopf in den Nacken gelegt und zum Himmel hinaufgesehen, diesem furchtbaren Himmel, der ihr solche Angst machte. Gerade hatte sie im ersten Blitz noch das Gesicht der Spürerin zu sehen geglaubt, deren weit offen stehende Augen, in denen kaum mehr Leben war, nur namenloses Entsetzen.
Jetzt registrierte sie mit Schrecken, dass ihr dieser kurze Augenblick der Unaufmerksamkeit beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Und die Gefahr war noch nicht vorbei.
Ela fing im letzten Augenblick den Ruck ab. Sie warf sich seitwärts in das Boot, das immer noch vom Kentern bedroht war, und krallte die Finger beider Hände in das Netz. Was immer sich darin verfangen hatte, was immer da gegen sie kämpfte, dass das wind- und regengepeitschte Wasser heftig aufschäumte, es hatte mindestens so viel Kraft wie sie.
Die Fischerin schrie laut um Hilfe, obwohl sie im Tosen des Sturms und Ächzen des wild schlingernden Boots wohl kaum jemand hören würde. Sie lag auf der Seite und zog am Netz – und wusste, dass die anderen mit ihr aufs Meer hinausgefahrenen Fischer sie in dieser aufgebrachten See niemals rechtzeitig erreichen konnten.
Dies war ganz allein ihr Kampf. Sie und das Meer. Sie und die Kreatur im Netz. Nur einer konnte gewinnen.
Ela hustete und spuckte das Wasser aus, das ihr in einem salzigen Schwall ins Gesicht gespritzt war. Sie spreizte die Beine und stemmte sie gegen die Planken, zwischen denen sie wie eingeklemmt lag. Es war ihr einziger Halt in einer aus den Fugen geratenen Welt. Ein Blitz zischte nur wenige Meter neben ihr in die Wellen. Ihr kleines Boot schaukelte wie eine Nussschale auf dem Wasser. Wenn es jetzt kippte, war alles vorbei.
Das Salz brannte in den Augen, machte die Lippen spröde und wund, und ihr wunderschönes, langes schwarzes Haar klebte ihr im Gesicht. Sie sah kaum noch etwas und konzentrierte sich nur auf das Netz in ihren Händen. Mit jedem Ruck des um sein Leben kämpfenden Fischs – dem Gewicht und der Kraft nach musste es ein Skay sein, kein anderes Tier vergleichbarer Größe kam in diesen Gewässern vor – glaubte sie, ihre Finger müssten brechen oder aufgerissen werden. Sie biss die Zähne so fest aufeinander, dass es schmerzte, und spannte die Muskeln.
Jeder Atemzug war eine Tortur und brannte im Rachen. Sie stemmte sich gegen die Planken und zog, wurde fast aus dem Boot gerissen, zog wieder, bis sie glaubte, dass es ihr die Arme aus den Schultern reißen würde. Der Himmel drehte sich mit dem Schaukeln des Boots über ihr, sie sah das Wasser vor sich aufsteigen und wieder sinken. Sie sah es schäumen und dann zwei mächtige Flossen, die in den Fluten schlugen.
Ela kämpfte tapfer, obgleich sie wusste: dieser Kampf war für sie nicht zu gewinnen. Nicht auf diese Weise. Ihre blutenden, gefühllosen Hände hielten fest, blieben in die Maschen des Netzes gekrallt. Die Fischerin begann Sterne zu sehen. Sie bekam keine Luft mehr. Ihr Körper schien nicht mehr ihr zu gehören. Sie schrie weiter, automatisch, ohne dahinter die Hoffnung auf Hilfe zu nähren, und verstummte erst, als das Boot sich drehte und sie ins kalte Wasser gerissen wurde, hinein in die Fluten, vor sich das Netz und die tobende, um ihr Leben kämpfende Kreatur.
Das dicke, schwere Fell zog sie hinunter, Luftblasengegurgel und -gewimmel begleitete sie. In ihren Ohren dröhnte und rauschte es, Echo des rasenden Herzschlags, der wie ein unheimlicher Rhythmus den Takt des Kampfes bestimmte, der nur einen Sieger sehen würde.
Ela löste eine Hand aus den Maschen und führte sie an ihre Hüfte, zu dem Messer, das in einer ledernen Scheide steckte. Sie musste gegen den Drang ankämpfen, den Mund zu öffnen und Luft zu holen. Sie war nicht dazu gekommen, als das Boot kippte, und hatte das Gefühl, ihre Lungen müssten zerplatzen. Die Fischerin zwang sich dazu, sich nur auf die Klinge aus Warwa-Gebein zu konzentrieren, auf ihre Hand, die von einem blutigen Schleier umspült war – auf das Netz vor ihr und den riesigen Fisch, der darin in wilder, kreatürlicher Raserei tobte.
Und nun griff er an.
Zuerst sah sie die Maschen aufreißen, dann war er auch schon heran: Ela entging dem zuschnappenden Maul nur um eine Handbreit und wich gerade noch rechtzeitig der heranpeitschenden, mächtigen Schwanzflosse aus, als der Skay an ihr vorüberschoss. Beim nächsten Angriff würde sie die Kraft dazu nicht mehr haben.
Sie zwang die Instinkte nieder, die ihr angesichts des an Luftmangel leidenden Körpers zuschrien: Auftauchen! Jede Bewegung, die den Skay ignorierte, würde sie zur leichten Beute machen. Wenn sie jetzt versuchte aufzutauchen, war das mit Sicherheit ihr Ende.
Dunkelheit begann ihren Geist zu umhüllen, da nahm sie abermals den mächtigen Schatten wahr, schnell und unaufhaltsam, und stieß in blinder Verzweiflung und mit letzter Kraft zu. Ihre Faust mit der Klinge darin fand ihr Ziel unter dem aufgerissenen Maul des Fischs. Plötzlich war die Schwärze rot, düster und bedrohlich und doch die wunderbarste Farbe, die sie je gesehen hatte. Sie riss das Messer zurück, während sie die Lippen aufeinander presste, holte aus und stieß wieder zu. Ihr Arm gehörte ihr nicht mehr. Sie spürte ihn gar nicht mehr. Ihre Klinge stach in das Fleisch ihres Gegners, wieder und wieder. Sie fühlte nichts mehr. In ihrem Kopf explodierte etwas, ein letzter, schrecklicher Blitz, der alles andere auslöschte.
Ela riss den Mund auf. Die angehaltene Luft platzte in einer großen Blase aus ihr heraus. Die Fischerin versank im Strudel aus Dunkelheit und Schmerz, der sich wie der Schlund des Todes vor ihr auftat.
*
Als sie erwachte, war ihre erste Wahrnehmung ein Prasseln und Knacken. Dann fühlte sie die Kälte in ihren Gliedern und eine unnatürliche Schwere. Als sie die Augen aufschlug, sah sie zuerst einen verschwommenen Schemen. Nur langsam klärte sich ihr Blick, und sie schaute direkt in das alte Gesicht von Joah, dem Heiler.
»Ona sei gepriesen«, wisperte der alte Mann. Ein schwaches Lächeln erschien auf seinem tief zerfurchten Gesicht. »Sie hat dich uns zurückgegeben.«
Ela blinzelte in das flackernde Licht und schloss die Lider. Sie atmete tief und wartete, bis der Schwindel verflogen war. Es roch nach Moder, nach der Kälte des Winters und verbrannten Kräutern und Ölen, nicht nach …
… nach Salz und nach Tod!
Sofort war die Erinnerung da. Die Fischerin stieß einen leisen Schrei aus und drehte sich vom Rücken auf die Seite. Als sie diesmal die Augen öffnete, starrte sie in das Feuer, das das Zelt erhellte und wärmte.
Nur ihr war es immer noch kalt. Sie rieb sich über die nackten Arme und erschrak, als sie merkte, dass ihre Hände verbunden waren.
Mit einem Ruck richtete sie sich auf einem Ellbogen auf und drehte den Kopf zu Joah zurück. Der alte Mann machte eine beschwichtigende Geste.
»Es wird heilen«, sagte er ruhig. »Es ist alles gut, Ela.«
Sie sah ihn verständnislos an. Was redete er da? Sie war doch – gestorben. Der Fisch und das Meer hatten gesiegt.
Aber Joah war wirklich und das prasselnde Feuer, die Gerüche, die Schmerzen in ihrer Brust …
»Was ist passiert?«, fragte sie mit einer Stimme, vor der sie erschrak. Es war fast nur ein Krächzen. »Ich war unter Wasser und …«
»Du hast tapfer gekämpft«, sagte der Heiler und reichte ihr eine Schale. Sie konnte sie nicht selbst nehmen. Er führte sie an ihren Mund, und sie trank in kleinen, vorsichtigen Zügen. »Bani und Sora haben dich aus dem Wasser gerettet und in Banis Boot zurückgebracht. Ich fürchte, du wirst dir ein neues zimmern müssen.«
»Und … der …?«, fragte sie. Der Trank tat bereits seine Wirkung. Sie hatte das Gefühl, einem zähen Sumpf zu entsteigen, zurück ins Licht, zurück in die Wärme. Ihr Frösteln ließ nach.
»Der Skay?« Joah lächelte vage, als verberge sich hinter der Freude eine unerkannte Bitternis. »Du hast tatsächlich einen Skay getötet. Sein Kopf wird als Trophäe dein Zelt schmücken. Das Fleisch aber wird den Stamm für Wochen ernähren. Du bist eine große Fischerin. Coralie ist stolz auf dich.«
Sie nahm einige tiefe Atemzüge, richtete sich weiter auf, bis sie aufrecht saß, und sah an sich hinab. Ihre zartblaue Haut war von vielen roten Schrammen bedeckt, mehr als ein Dutzend neue Narben. Doch sie war trocken und sauber. Die Frauen mussten ihr die Felle ausgezogen haben. Nur der lederne Schurz war um ihre Hüften geknotet.
»Was ist los?«, fragte sie Joah. »Der Skay ist tot, ich lebe noch – dank euch –, und dennoch freust du dich nicht. Was ist geschehen, Joah?«
Sie legte den Kopf zurück und sah hoch zum Rauchabzug in der Spitze des runden Zelts. Das Prasseln, das sie gehört hatte, stammte vom Feuer und nicht mehr vom Regen. Er schien aufgehört zu haben, aber immer noch war es draußen dunkel, und wenn sie sich anstrengte, konnte sie noch den fernen Donner über das Land rollen hören.
Joah schwieg, das Lächeln verblasste endgültig.
»Wie lange war ich in Onas Armen?«, wollte sie wissen.
»Fast vier Stunden«, sagte der Heiler.
»Dann müsste noch heller Tag sein.« Die Angst kam zurück und schlich sich in ihr Herz. Sie machte eine ungeduldige Bewegung. »Komm, Joah. Hilf mir aufzustehen.«
»Das solltest du noch nicht tun, Ela. Du bist …«
»Mir geht es gut«, unterbrach sie ihn und versuchte, in die Höhe zu kommen. Mit seiner Hilfe gelang es ihr, doch als sie stand, wurde sie fast wieder vom Schwindel übermannt.
»Es ist gleich vorbei«, sagte sie und strich sich das Haar zurück über die Schulter. »Ich muss es sehen.«
»Was, bei Ona?«
»Du weißt es genau. Den Himmel.«
»Besser nicht, Ela.«
Sie lachte rau. »Weshalb nicht? Hast du Angst, dass ich nicht stark genug dafür bin?«
»Oh, du bist jung und stark«, sagte er schnell. »Du bist eine unserer besten Frauen, aber das da draußen ist …«
»Was, Joah? Was ist es?«
Er antwortete nicht, sondern wich ihrem Blick aus.
»Lass mich los«, verlangte sie. Dann trat sie zum Ausgang. Die ersten Schritte fielen ihr schwer und taten in den Gelenken weh. Sie taumelte und hielt sich am Leder des Zelts fest. Als sich das Schwindelgefühl gab, schlug sie es zurück.
Für drei, vier lange Atemzüge stand die Fischerin im Eingang und starrte nach draußen.
Dann kam sie zurück, schweigend, mit gesenktem Kopf, und setzte sich auf eine von Joahs großen Holzkisten.
Lange starrte sie stumm vor sich hin. Der Heiler wagte es nicht, sie anzusprechen.
Als sie endlich den Kopf hob, schimmerten ihre großen dunklen Augen feucht.
»So schlimm ist es schon, Joah?«, fragte sie flüsternd. »Wie wird es denn weitergehen?«
»Das weiß nur Ona«, antwortete der alte Mann. »Und … vielleicht … die Schattenlosen.«
Die Schattenlosen!
Ela nickte.
»Und die Spürerin?«
Er setzte zu einer Antwort an, doch kein Laut kam über seine Lippen. Er drehte den Kopf zur Seite, um Ela nicht mehr ansehen zu müssen.
Es sagte ihr mehr als jedes Wort.
»Ona hat sie also zu sich geholt«, flüsterte die Fischerin. »Du hast ihr nicht helfen können. Was hat sie gesehen, Joah? Sag es, Heiler! Was?«
Was, dachte sie entsetzt, kann so schlimm sein, dass sie damit nicht mehr leben konnte?
2.
16. April 1344 NGZ
BUENOS AIRES
»Warum tust du dir das an?«, fragte Bré Tsinga.
»Ich habe meine Gründe«, antwortete Reginald Bull schroff, ohne sie anzusehen.
Die Kosmopsychologin seufzte. »Schon verstanden. Du willst, dass ich dich damit in Ruhe lasse. Nur eines noch, Bully: Charakteristisch an unseren Problemen ist unter anderem, dass wir sie uns selbst gegenüber nicht zugeben wollen. Wir legen sie sozusagen tiefer, ab damit in eine Schublade und ganz schnell wieder zu. Und du, mein Lieber, bist momentan ein ganz schönes Stück tiefer gelegt.«
»Unsinn«, knurrte Bull und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch seine roten Borsten. »Du solltest dich lieber selbst analysieren. Das Charakteristische an euch Psychologinskis ist nämlich, dass ihr ein ernstes Problem habt, wenn es keine Probleme gibt. Denn dann fehlt euch der Boden unter den Füßen.«
»So einfach ist das?«
»So einfach ist das«, schnaufte er. »Und jetzt wäre ich dir dankbar und verbunden, wenn du einen anderen mit deiner Fürsorge beglücken könntest. Gucky zum Beispiel. Er freut sich bestimmt, aber ich habe mich ganz nebenbei auf den Besuch auf Tan-Jamondi II vorzubereiten. Sonst könnte ich wirklich ein Problem kriegen, wenn du verstehst.«
»Wir sprechen uns noch«, drohte die Kosmopsychologin und zog sich lächelnd zurück.
Wir sprechen uns noch, äffte Bully sie in Gedanken nach und schnitt eine Grimasse. Such dir ein anderes Opfer. Es gibt genug Leute auf der BUENOS AIRES.
Natürlich wusste er, weshalb sie ihn nervte.
Der Liga-Verteidigungsminister wandte sich wieder den Holos zu, die ihm Teile des Weltraums zeigten, in den sie nach dem Ende der Überlichtetappe eintauchen würden. In anderen Feldern rollten die Informationen ab, die er noch brauchte, um optimal auf die Begegnung mit den Kolonisten vorbereitet zu sein. Viel Zeit blieb ihm bis dahin nicht mehr. In weniger als sieben Stunden würden sie auf der Insel Rogan landen.





























