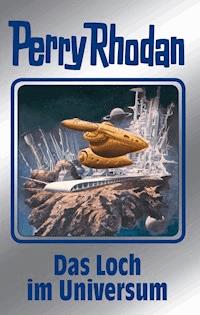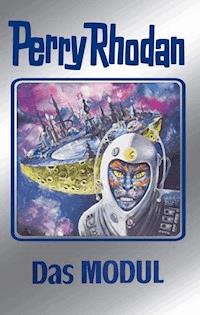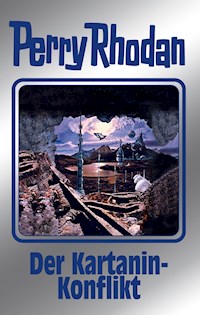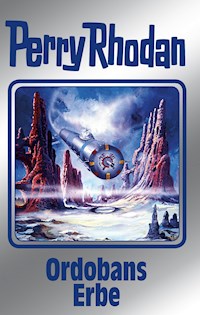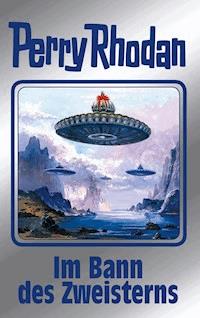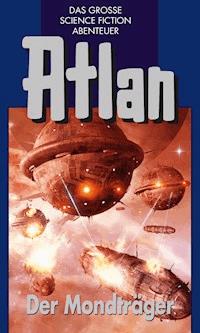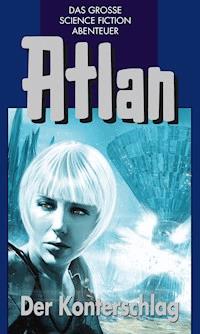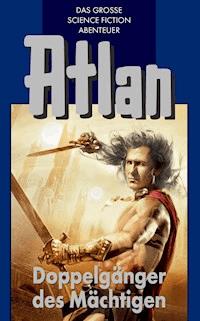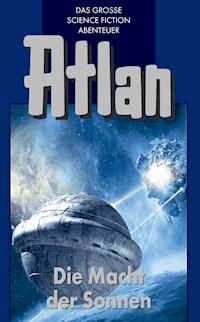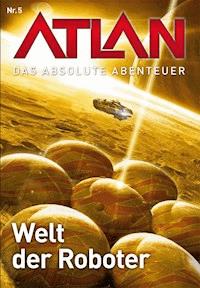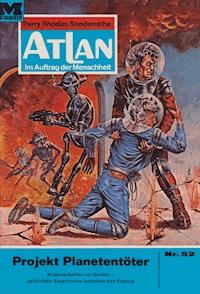Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Sie kommen als Befreier - und bringen das Inferno über die Welt Perry Rhodans SOL, das bisher größte Fernraumschiff der Menschheit, hat nach langem und gefahrvollem Flug im Spätsommer des Jahres 3583 endlich die verschwundene Erde erreicht, die ihre Position ein zweites Mal gewechselt hatte. Doch mit Erreichen des Zielorts beginnt für alle an Bord der SOL die Phase der bitteren Enttäuschung. Alle Messungen zeigen, dass der Heimatplanet der Menschheit ausgestorben ist. Es gibt keine Spuren der Zivilisation mehr. Die Klimakontrolle ist längst ausgefallen, und die Natur beginnt mit der Rückeroberung dessen, was Menschenhand ihr zuvor entrissen hatte. Die Frage, wo die 20 Milliarden einstmals im Bann der Aphilie befindlichen Bewohner der Erde geblieben sind, lässt sich nicht beantworten. Perry Rhodan ist jedoch der Annahme, dass die Superintelligenz BARDIOC für das Verschwinden der Terraner verantwortlich ist. Deshalb lässt er auch die Kleine Majestät auf der Erde vernichten. Deshalb auch macht er Jagd auf weitere planetarische Statthalter BARDIOCS - so auf einer von Terra etwa 4000 Lichtjahre entfernten Welt. Dabei bewirkt sein Eingreifen das CHAOS AUF LUSAMUNTRA ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 808
Chaos auf Lusamuntra
Sie kommen als Befreier – und bringen das Inferno über eine Welt
von H. G. FRANCIS
Perry Rhodans SOL, das bisher größte Fernraumschiff der Menschheit, hat nach langem und gefahrvollem Flug im Spätsommer des Jahres 3583 endlich die verschwundene Erde erreicht, die ihre Position ein zweites Mal gewechselt hatte.
Doch mit Erreichen des Zielorts beginnt für alle an Bord der SOL die Phase der bitteren Enttäuschung. Alle Messungen zeigen, dass der Heimatplanet der Menschheit ausgestorben ist. Es gibt keine Spuren der Zivilisation mehr. Die Klimakontrolle ist längst ausgefallen, und die Natur beginnt mit der Rückeroberung dessen, was Menschenhand ihr zuvor entrissen hatte.
Die Frage, wo die 20 Milliarden einstmals im Bann der Aphilie befindlichen Bewohner der Erde geblieben sind, lässt sich nicht beantworten.
Perry Rhodan ist jedoch der Annahme, dass die Superintelligenz BARDIOC für das Verschwinden der Terraner verantwortlich ist. Deshalb lässt er auch die Kleine Majestät auf der Erde vernichten.
Deshalb auch macht er Jagd auf weitere planetarische Statthalter BARDIOCS – so auf einer von Terra etwa 4000 Lichtjahre entfernten Welt.
Die Hauptpersonen des Romans
Perry Rhodan – Der Terraner will CLERMAC provozieren.
Quasutan – Eine Dorl kämpft für ihr Volk.
Cortwein Khan – Ein siganesischer Mutant.
Ras Tschubai – Der Teleporter hat Pech.
Puukar
1.
»Das ist zu gefährlich«, sagte er. »Es könnte dich das Leben kosten.«
Quasutan blickte auf das trübe Wasser hinab. Furcht stieg in ihr auf, wie sie sie schon lange nicht mehr gekannt hatte.
»Vergesst nicht, was es bedeutet«, entgegnete sie. Unschlüssig richtete sie sich auf und strich vorsichtig mit den Fingerspitzen über die filigranartigen Kiemenfilter zu beiden Seiten ihres Halses. Ein heißer und feuchter Wind wehte von Norden herab. Er trieb die Wellen gegen die Klippen, wo sie sich aufschäumend brachen.
»Wir werden arbeiten«, versprach Kara. »Tag und Nacht. Bis wir es geschafft haben.«
»Ihr könnt es gar nicht schaffen. Dafür würde andere Arbeit liegen bleiben.« Sie reckte die Arme und beugte sich nach vorn. »Sie werden mich nicht erwischen. Bestimmt nicht.«
»Sieh doch hin«, forderte Kuta sie ängstlich auf. »Du kannst sie da draußen sehen.«
Sie verengte die Augen und blickte auf die See hinaus. Ihre beiden Herzen schlugen heftig in ihrer Brust. Laut röhrend entleerte sie ihre Luftblase und befreite sich damit von einem Druck, der sie allzu sehr beengt hatte. Tatsächlich bemerkte sie die dunklen Flossen der Raubtiere. Sieben Pfeilfische jagten dicht unter der Oberfläche.
»Sie sind wild«, stellte Kara besorgt fest. »Der Druck der Götter macht sie rasend.«
Quasutan wusste, dass er recht hatte. Sie konnte sich diesem Argument nicht entziehen, denn sie selbst spürte den Einfluss der Götter. Er kam aus der Unendlichkeit, und ihr schien, als konzentriere sich die lautlose Stimme des Wolkengotts nur auf sie. Beunruhigt hob sie den Kopf und blickte zu den Wolken empor. Ihr schien, als könne sie den grauen Dunst mit den Händen greifen, so tief hingen die Wolken. Irgendwo dahinter verbargen sich die Götter mit ihren vielfältigen, unfassbaren Kräften. Quasutan wünschte, sie könnte sich ebenso leicht in die Wolken erheben, wie sie durch das Wasser gleiten konnte. »Tu es nicht«, bat Kara.
»Du glaubst, dass ich mich fürchte«, erwiderte sie.
»Ich glaube es nicht, ich weiß es«, erklärte er und warf den Kopf in den Nacken. »Warum willst du es leugnen?«
Das gab den Ausschlag. Quasutan ließ sich nach vorn fallen und stieß sich ab. Ihr schlanker Körper schnellte über das Wasser hinaus. Die Dorl hörte die beiden Männer erschreckt aufschreien, dann tauchte sie ein und schoss in die Tiefe. Das Wasser war angenehm kühl. Ihr wurde sofort wohler. Die Hitze der letzten Tage hatte ihren Organismus stark belastet. Das war für sie ein Zeichen dafür, dass die Tage der Eiablage gekommen waren.
Ihr Körper bog und streckte sich, während sie sich in die tieferen und noch kälteren Regionen vorarbeitete. Angestrengt beobachtete sie ihre Umgebung. Das Wasser war unten noch trüber als oben. Die Sicht reichte kaum eine Körperlänge weit. Allzu groß war daher die Gefahr, dass plötzlich ein Pfeilfisch vor ihr auftauchte.
In den Händen hielt sie ein engmaschiges Netz, das sie jedoch zusammengerollt hatte, damit es sie nicht behinderte. Jetzt wurde sie sich dessen bewusst, dass es nicht auf Geschwindigkeit ankam. Wichtig war nur, sich die Raubfische vom Hals zu halten.
Als sie etwa zweihundert Meter tief getaucht war, konnte sie nichts mehr sehen. Dennoch konnte sie sich orientieren. Sie gab zirpende Laute von sich und steigerte sie bis weit in den Ultraschallbereich hinein. Mit ihren ultraschallempfindlichen Sinnen fing sie das Echo auf, und ein Bild ihrer näheren Umgebung formte sich in ihr. Leider reichte diese Orientierungshilfe nur wenige Meter weit. Besser wäre es gewesen, wenn sie damit einen Raum mit einem Durchmesser von hundert Metern oder mehr hätte überwachen können. Dann hätten die Pfeilfische keine Gefahr für sie bedeutet. Quasutan hielt sich an einer Felszacke fest und drehte sich um sich selbst. Der schlanke Körper eines Raubfisches glitt lautlos an ihr vorbei. Das Tier war doppelt so groß wie sie. Das Auge auf der Schwanzflosse fluoreszierte. Es tanzte mit der Bewegung der Flosse hin und her und erschien ihr wie ein Signallicht für die anderen Pfeilfische.
Sie erschauerte.
Sie kannte keine gefährlicheren Feinde im Meer als diese Fische, deren Gefräßigkeit grenzenlos zu sein schien.
Plötzlich warf sich der Pfeilfisch herum und raste auf sie zu. Quasutan behielt die Nerven. Sie breitete das Netz zwischen ihren Händen aus und krümmte sich zusammen. Der Pfeilfisch schoss dicht über sie hinweg. Zwischen seinen Brustflossen löste sich ein Pfeil. Er flog auf sie zu, traf sie jedoch nicht, sondern verfing sich im Netz. Die Sehne, an deren Ende er saß, spannte sich, der Pfeilfisch wendete, als die Dorl das Netz mit aller Kraft hielt, und jagte wieder auf die Frau zu.
Quasutan hielt das Netz mit einer Hand. Sie duckte sich, als der Fisch sie erreichte. Die messerscharfen Zähne verfehlten ihren Kopf. Abermals glitt der Räuber an ihr vorbei, wobei er ihr die empfindliche Bauchseite bot. Dieses Mal stieß Quasutan ihm die Klinge eines Messers in den Leib. Der Pfeilfisch setzte instinktiv zur Flucht an, doch erreichte er damit nur, dass das Eisen ihn bis zur Schwanzflosse hin aufschlitzte.
Jetzt ließ Quasutan das Netz los. Sie konnte es nicht mehr halten. Sie flüchtete in die Tiefe, da sie den Geruch des ausströmenden Blutes nicht ertragen konnte. Zudem wusste sie, dass sie keinen Augenblick länger bleiben durfte, da die anderen Pfeilfische durch das Blut angelockt wurden.
Als sie über sich einen Schrei hörte, erreichte sie den Grund der Bucht. Erschrocken verharrte sie auf der Stelle.
Das war Kuta gewesen. Deutlich hatte sie ihn an der Stimme erkannt. Voller Entsetzen fragte sie sich, ob er ihr nachgeschwommen war, um sie zu schützen und um ihr zu helfen? Wenn er es getan hatte, dann befand er sich nun mitten in einem Rudel von Pfeilfischen, die im Blutrausch durch das Wasser rasten und nach allem schnappten, was in ihre Nähe kam.
Quasutan raffte die drei Steine und den Eisenwinkel, die sie auf dem Boden im Schlamm fand, zusammen, presste sie an ihren Leib und stieg langsam auf. Sie glitt mit dem Rücken an den Felsen hoch, so dass sie das freie Wasser ständig beobachten konnte.
Für einen kurzen Moment sah sie eine Hand vor sich auftauchen. Der Schock brachte sie fast um. Sie wusste, dass Kuta den Tod gefunden hatte. Angst und Entsetzen drohten, sie zu überwältigen und sie zu größerer Eile zu veranlassen. Doch sie beherrschte sich. Sie schaffte es, sich langsam und ruhig zu bewegen. Sie wusste, dass das die beste Sicherung gegen die unersättlichen Räuber der Meere war.
Hin und wieder sah sie den schlanken Körper eines Pfeilfisches an sich vorbeigleiten. Grüne Blitze zuckten durch das Wasser, wenn sich die Schwanzflossen so drehten, dass das fluoreszierende Auge auf sie gerichtet war. Doch kein Fisch griff sie an.
Schließlich durchbrach sie die Wasseroberfläche. Kara kauerte auf den Felsen und blickte sie mit geweiteten Augen an.
»Gib her. Schnell«, rief er.
Sie reichte ihm die drei Steine und den Eisenwinkel hoch. Er nahm sie vorsichtig entgegen, jedes Teil einzeln, damit es ihm nicht wieder ins Wasser fiel.
Er ist anders, dachte sie. Er ist nüchterner und handelt überlegter. Kuta hat alles andere vergessen und nur an mich gedacht. Das hat ihn das Leben gekostet. Er hätte niemals erst die Steine genommen, sondern erst mich aus dem Wasser geholt.
Kara wurde erst unruhig, als direkt neben Quasutan ein Pfeilfisch auftauchte. Die dunkle Schwanzflosse durchschnitt die Wellen, und das faustgroße Auge fixierte sie mit hypnotischer Kraft.
Die Frau schlug auf das Wasser, streckte den Arm aus und ließ sich von Kara auf die Felsen ziehen. Dann wandte sie sich um, nahm eine leere Muschel von den Felsen und schleuderte sie auf den Fisch. Sie verfehlte ihn nur knapp.
»Was für schöne Steine«, sagte Kara bewundernd. Dann hob er bedauernd die Hände und fuhr fort: »Ich konnte Kuta nicht zurückhalten. Er wollte dir helfen. Ich habe ihn gewarnt, aber er hat nicht auf mich gehört.«
»Er ist tot«, entgegnete die Frau verzweifelt. »Was soll nun werden?«
Kara antwortete nicht. Das erwartete sie auch nicht von ihm, denn ihre Sorgen berührten ihn als Mann nur wenig. Er wusste, dass er jederzeit eine Frau finden würde, die ihn sofort nehmen würde. Es gab genügend Frauen, denen ein Mann fehlte. Manche hatten überhaupt keinen.
Quasutan kauerte sich auf die Klippe und nahm einen Stein nach dem anderen auf. Sie waren exakt und mit großer Mühe geschliffen. Sie wiesen keinerlei Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten auf. Es waren wahre Meisterwerke.
»Wenn man davon mehr haben könnte«, sagte sie seufzend.
Kara schnatterte leise vor sich hin und wich ihren Blicken aus.
»Was ist los?«, fragte sie scharf.
»Nichts«, erwiderte er. »Ich bin traurig, weil Kuta tot ist. Das ist alles.«
Sie glaubte ihm nicht. Kaum ein Mann war traurig, wenn sein Partner den Weg zu den Strahlenden Göttern antrat. Sie wusste genau, wie es in ihm aussah. Wenn es ihr nicht gelang, bis zur Eiablage einen Begleiter für ihn zu finden, dann würde er sie verlassen.
»Du weißt, wo noch mehr solcher Steine sind«, behauptete sie.
»Wenn es so wäre, würde ich es dir sagen.«
»Du lügst«, rief sie empört. »Ich weiß genau, wie es in dir aussieht. Du glaubst, ich werde keinen zweiten Mann finden. Du hoffst, vielleicht schon morgen frei zu sein.«
»Unsinn«, entgegnete er schrill. »Wie kommst du darauf?«
»Du willst dir das Geheimnis für das neue Weib aufheben«, klagte sie ihn an.
»Also gut«, sagte er. »Du sollst es wissen.«
Er zeigte auf das Meer hinaus.
»Etwa zweihundert Körperlängen von hier und siebenhundert Körperlängen tief liegt ein ganzer Berg von solchen Steinen.«
Sie erschauerte.
»Du lügst. Du willst, dass ich hinunterschwimme, und du hoffst, dass mich die Pfeilfische holen. Du willst, dass es mir so ergeht wie Kuta.«
»Ich habe die Wahrheit gesagt. Du musst ja nicht tauchen. Du kannst hier bleiben. Mit den drei Steinen und dem Winkel bist du ohnehin reich.«
Nachdenklich blickte sie auf die Steine.
»Du hast recht«, erwiderte sie schließlich. »Ich will zufrieden sein.«
Sie zuckte zusammen und presste ihre Hände auf den Leib.
»Die Eier«, sagte sie stöhnend. »Sie kommen. Was tue ich nur? Hilf mir doch.«
»Ich kann nur eines nehmen«, antwortete er ablehnend. »Das zweite muss ein anderer Mann tragen. Das geht nicht anders.«
Sie hob den Eisenwinkel und einen Stein auf und schob ihm die beiden anderen zu. Wortlos eilte sie über die Felsen davon. Er folgte ihr und bemühte sich, nahe bei ihr zu bleiben, wie es seine Pflicht war. Sie kamen an einigen Dorls vorbei, die apathisch auf dem Boden kauerten.
Kara fühlte, wie sich in ihm etwas verkrampfte. Er wusste genau, dass etwas nicht stimmte. Es war nicht normal, dass die meisten Dorls nichts taten. Der Boden schwankte unter ihren Füßen. Deutlich spürte er, wie der Grund unter ihm erzitterte. Von fern kam das Donnergrollen eines speienden Vulkans.
Es begann zu regnen. So heftig ergossen sich die Wassermassen über das Land, dass es Kara erschien, als überschwemme das Meer die Dörfer und die sumpfigen Felder. Gleichzeitig wurde es dunkel. Hin und wieder zuckte ein Blitz aus den Wolken herab. Dann stöhnte Quasutan gequält auf. Die geheimnisvollen Kräfte, die aus den Wolken herabstürzten, pflanzten sich durch die Feuchtigkeit über den Boden fort und erreichten sie. Kara wusste, dass Quasutan besonders empfindlich dagegen war –, während er überhaupt nichts merkte.
Die Häuser des Dorfes tauchten aus der Dunkelheit auf. Kara folgte Quasutan in den Turm, den er und Kuta nach ihren Ideen gebaut hatten. Es war das prächtigste Bauwerk der ganzen Siedlung. Niemand hatte so schöne Steine wie Quasutan. Allerdings kam auch keiner außer ihr auf die Idee, sein Leben zu riskieren, nur um ein paar besonders sorgfältig geschliffene Mauersteine für das Fundament zu bekommen.
*
»Faszinierend«, sagte Gorlov Ovosoffsky. Er streckte seine Hände schwärmerisch aus und formte mit den Händen eine unsichtbare Kugel. »Darf ich den Kristall einmal anfassen?«
Perry Rhodan wich unwillkürlich vor ihm zurück. Er schüttelte den Kopf.
»Nein«, erwiderte er schroff. »Sie dürfen nicht.«
»Schade«, rief Ovosoffsky bedauernd. Er fuhr sich mit beiden Händen durch das volle Haar. »Können Sie sich nicht vorstellen, dass ich als Künstler angesichts einer solchen Schönheit geradezu betäubt bin vor Begeisterung?«
Perry Rhodan blieb ernst. Er blickte Fellmer Lloyd flüchtig an.
»Wie wäre es, wenn Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren würden?«, fragte er.
»Natürlich«, entgegnete Ovosoffsky. Er nahm einen Stahlstift auf, tänzelte um Rhodan herum, kniete neben ihm nieder und nahm mit dem Stift Maß, indem er ihn vor den Augen hin und her bewegte. Dann erhob er sich wieder, legte den Stift zur Seite und nahm einen winzigen Desintegratorstrahler auf. Mit diesem bearbeitete er einen Block Ynkelonium. Mit unendlicher Sorgfalt schnitt er einige Formen heraus.
Rhodan blieb ruhig. Er wusste, dass er Ovosoffsky Zeit lassen musste, wenn das Werk gelingen sollte. Der Künstler hatte seine Eigenarten, und die musste er akzeptieren.
»Ich habe gehört, dass Sie sich entschlossen haben, die Jagd auf die Kleinen Majestäten zu eröffnen?« Ovosoffsky ließ den Desintegrator sinken. »Ist das wahr?«
»Haben Sie Bedenken?« Nun konnte Rhodan ein Lächeln nicht mehr unterdrücken.
»Bedenken? Aber ich bitte Sie!« Der Bildhauer schüttelte lachend den Kopf. »Selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie Ihnen nicht eröffnen, weil ich mir dessen bewusst bin, dass Sie mir strategisch und taktisch wahrscheinlich überlegen sind.«
»Wahrscheinlich.«
»Oder meinen Sie nicht?« Ovosoffsky legte den Desintegrator zur Seite. »Sehen Sie, ich habe natürlich viel mehr Zeit als Sie, über dieses und jenes nachzudenken. Daher habe ich schon oft gedacht, ich sollte Ihnen ...«
»Sie sollten Ihre Arbeit fortsetzen, Meister«, bemerkte Fellmer Lloyd ruhig. Der Telepath erfasste die Gedanken des Künstlers und versuchte, den sich anbahnenden Vortrag rechtzeitig abzufangen. Es gelang ihm. Ovosoffsky biss sich auf die Lippen und setzte seine Arbeit am Ynkeloniumblock fort. Bisher war kaum zu erkennen, was er daraus formen wollte. Nur der Hinterkopf Rhodans zeichnete sich in groben Umrissen ab.
»Perry würde nie auf den Gedanken kommen, Ihnen Vorschläge für Ihre Arbeit zu machen«, sagte der Mutant nach einer Weile.
Ovosoffsky blickte auf. Seine Wangen röteten sich.
»Sie Schnüffler«, sagte er verächtlich. Er drehte sich um und machte Anstalten, den Raum zu verlassen.
»Bitte«, rief Perry Rhodan, als er die Tür erreicht hatte. »Fellmer wollte Sie nicht beleidigen.«
Ovosoffsky blieb stehen. »Bitte, entschuldigen Sie«, fügte Fellmer Lloyd hinzu. Nun endlich drehte der Künstler sich um und kehrte zum Ynkeloniumblock zurück. Er blickte den Mutanten mit verengten Augen an. Seine Lippen bebten, und auf seinen hohlen Wangen zeichneten sich noch immer hektische Flecken ab.
»Wenn es Sie interessiert, will ich Ihnen sagen, was wir vorhaben«, bemerkte Rhodan versöhnlich. »Sie wissen, wie wir die Erde vorgefunden haben.«
»Das war auch für uns Solaner ein Schock«, entgegnete Ovosoffsky.
»Dann können Sie sich sicherlich vorstellen, wie es in mir aussieht«, fuhr Rhodan fort, während der Bildhauer seine Arbeit wieder aufnahm.
»Was die Kleine Majestät auf der Erde getan hat, das haben andere Kleine Majestäten auch auf anderen Welten angerichtet.«
Er presste zornig die Lippen zusammen, bis ihm auffiel, dass der Künstler darauf wartete, dass sich sein Gesicht wieder entspannte.
»Deshalb werden wir mit der Jagd auf die Kleinen Majestäten beginnen. Wir werden sie vernichten, wo wir sie antreffen.«