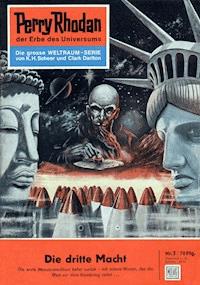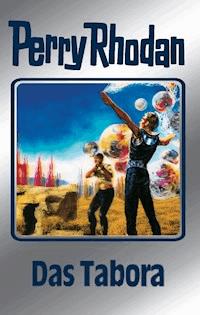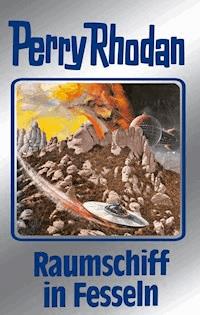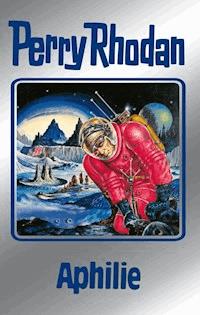
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Silberband
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 3540 steht die Bevölkerung der Erde im Bann der Aphilie. Reine Vernunft und Urinstinkte bestimmen das Verhalten der Terraner, Gefühle zählen nichts mehr. Auch Reginald Bull ist der Aphilie verfallen: Er entmachtet seinen Freund Perry Rhodan und treibt ihn mit mehr als tausend Begleitern in die Verbannung. An Bord des Fernraumschiffs SOL verlassen die Verurteilten ihre Heimat ohne Hoffnung auf eine Rückkehr, aber auch ohne Aussicht, die Milchstraße im Meer der Galaxien zu finden. Eine Odyssee durch Raum und Zeit nimmt ihren Anfang, geprägt vom unbeugsamen Willen der Verbannten, dem Schicksal zu trotzen. Auf der Erde greift die Aphilie indessen unaufhaltsam um sich. Als es Bull gelingt, die Fessel der Aphilie abzuschütteln, wird er ebenfalls zum Gejagten...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 699
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 81
Aphilie
Im Jahr 3540 steht die Bevölkerung der Erde im Bann der Aphilie. Reine Vernunft und Urinstinkte bestimmen das Verhalten der Terraner, Gefühle zählen nichts mehr. Auch Reginald Bull ist der Aphilie verfallen: Er entmachtet seinen Freund Perry Rhodan und treibt ihn mit mehr als tausend Begleitern in die Verbannung. An Bord des Fernraumschiffs SOL verlassen die Verurteilten ihre Heimat ohne Hoffnung auf eine Rückkehr, aber auch ohne Aussicht, die Milchstraße im Meer der Galaxien zu finden. Eine Odyssee durch Raum und Zeit nimmt ihren Anfang, geprägt vom unbeugsamen Willen der Verbannten, dem Schicksal zu trotzen. Auf der Erde greift die Aphilie indessen unaufhaltsam um sich. Als es Bull gelingt, die Fessel der Aphilie abzuschütteln, wird er ebenfalls zum Gejagten ...
Vorwort
PERRY RHODAN – das ist die Faszination ferner Welten, die Begegnung mit den unglaublichen Weiten der Schöpfung ebenso wie eine Reise in unser eigenes verborgenes Ich. Wir begleiten die geeinte Menschheit auf ihrem Weg in die Zukunft. Dass dieser Weg mitunter mühsam und steinig ist und aller Technik zum Trotz immer wieder der Mensch selbst gefordert wird, versteht sich von selbst.
Mit diesem Buch habe ich die Bearbeitung der Silberbände übernommen. Ich weiß noch, wie es war, als ich meinen ersten PERRY RHODAN-Roman in Händen hielt, und die Faszination, die ich damals verspürte, hat mich seither nicht wieder losgelassen. Der »sense of wonder« ist der Serie noch genauso zu Eigen wie an jenem Tag, als der Astronaut Perry Rhodan den Mond betrat.
Ich will dieses Buch mit einem Dank beginnen, dem herzlichen Dank an Horst Hoffmann, der in sicher nicht immer einfacher Arbeit (Herzblut, Schweiß und Tränen stecken in der Serie) insgesamt sechzig Bücher herausgegeben hat. Und ich danke Ihnen, den treuen Lesern und jenen, die vielleicht zum ersten Mal zu einem PERRY RHODAN-Buch gegriffen haben, für konstruktive Kritik und Mitarbeit. Auch ich nehme Ihre Anregungen gerne entgegen.
Die in diesem Buch enthaltenen Originalromane sind: Aphilie (700) von Kurt Mahr; Sprung in die Freiheit (701) von H. G. Ewers; Das Stummhaus (702) von Clark Darlton; Jagd der Outsider (703) von Hans Kneifel; Die Rebellen von Imperium-Alpha (704) von Ernst Vlcek sowie Flucht aus Imperium-Alpha (705) von William Voltz.
Zeittafel
1971/84 – Perry Rhodan erreicht mit der STARDUST den Mond und trifft auf die Arkoniden Thora und Crest. Mit Hilfe der arkonidischen Technik gelingen die Einigung der Menschheit und der Aufbruch in die Galaxis. Geistwesen ES gewährt Rhodan und seinen engsten Wegbegleitern die relative Unsterblichkeit. (HC 1–7)
2040 – Das Solare Imperium entsteht und stellt einen galaktischen Wirtschafts- und Machtfaktor ersten Ranges dar. In den nächsten Jahrhunderten folgen Bedrohungen durch die Posbis sowie galaktische Großmächte wie Akonen und Blues. (HC 7–20)
2400/06 – Entdeckung der Transmitterstraße nach Andromeda; Abwehr von Invasionsversuchen von dort und Befreiung der Völker vom Terrorregime der Meister der Insel. (HC 21–32)
2435/37 – Der Riesenroboter OLD MAN und die Zweitkonditionierten bedrohen die Galaxis. Nach Rhodans Odyssee durch M 87 gelingt der Sieg über die Erste Schwingungsmacht. (HC 33–44)
2909 – Während der Second-Genesis-Krise kommen fast alle Mutanten ums Leben. (HC 45)
3430/38 – Das Solare Imperium droht in einem Bruderkrieg vernichtet zu werden. Bei Zeitreisen lernt Perry Rhodan die Cappins kennen. Expedition zur Galaxis Gruelfin, um eine Pedo-Invasion der Milchstraße zu verhindern. (HC 45–54)
3441/43 – Die MARCO POLO kehrt in die Milchstraße zurück und findet die Intelligenzen der Galaxis verdummt vor. Der Schwarm dringt in die Galaxis ein. Gleichzeitig wird das heimliche Imperium der Cynos aktiv, die am Ende den Schwarm wieder übernehmen und mit ihm die Milchstraße verlassen. (HC 55–63)
3444 – Die bei der Second-Genesis-Krise gestorbenen Mutanten kehren als Bewusstseinsinhalte zurück. Im Planetoiden Wabe 1000 finden sie schließlich ein dauerhaftes Asyl. (HC 64–67)
3456 – Perry Rhodan gelangt im Zuge eines gescheiterten Experiments in ein paralleles Universum und muss gegen sein negatives Spiegelbild kämpfen. Nach seiner Rückkehr bricht in der Galaxis die PAD-Seuche aus. (HC 68–69)
3457/58 – Perry Rhodans Gehirn wird in die Galaxis Naupaum verschlagen. Auf der Suche nach der heimatlichen Galaxis gewinnt er neue Freunde. Schließlich gelingt ihm mit Hilfe der PTG-Anlagen auf dem Planeten Payntec die Rückkehr. (HC 70–73)
3458/60
Prolog
Wir schreiben den Juli des Jahres 3540.
Die Flucht der Erde und des Monds aus der von den Laren beherrschten Milchstraße ist gelungen – doch jetzt erst, achtzig Jahre später, zeigt sich, dass der Preis, den die Menschheit für ihr Entkommen zu zahlen hat, ein furchtbarer ist.
1.
Terra
Bangkok 3580 n. Chr.
»Den Nächsten, der dich anstarrt, schlage ich nieder«, knurrte Sergio Percellar.
»Pass auf deine Augen auf!«, sagte Sylvia warnend. »Dein Blick verrät dich.«
Sie trieben auf der langsamsten Sektion des Rollsteigs durch das Zentrum von Bangkok. Die Stadt hatte sich im Lauf der Jahrhunderte zum Zentrum Südostasiens entwickelt. Um Sergio und Sylvia Demmister herum brodelte dichter Verkehr. Auf dem breiten Laufband standen sie in Tuchfühlung mit Menschen in den lichtgrauen Standardmonturen – Menschen, die meist nur geradeaus schauten, ohne Regung in ihren Gesichtern. Nur hin und wieder blickte ein Mann auf, sobald eine Frau sein Interesse erregte. Für die wenigen Sekunden des Vorbeigleitens zeigte sich dann unverhüllte Begierde. Das war es, was Sergio Percellar störte: Sylvias Anblick weckte die Lust vieler Männer. Sie starrten von dem in entgegengesetzter Richtung laufenden Band herüber, und in ihren Blicken lag so viel obszöne Offenheit, dass Sergio seine Wut kaum noch zähmen konnte.
Sylvia spürte seinen Zorn. Verstohlen legte sie ihm die Hand auf den Arm, eine Geste, die sie sofort verraten hätte, wäre sie bemerkt worden. »Bleib ruhig!«, raunte sie. »Wir sind gleich da. Vergiss nicht, was wir uns vorgenommen haben.«
»Ich wusste nicht, dass es so schwer sein würde.« Sergio knirschte mit den Zähnen.
»Wiederhole unseren Vorsatz!«, forderte Sylvia.
»Jetzt? Hier?«, protestierte er.
»Du kannst so leise sprechen wie ich, und niemand außer mir wird dich hören. Also ...?«
Sobald Sylvia in diesem Ton zu ihm sprach, gab es kein Ausweichen. Sergio begann stockend: »Ich will fortan die Nächstenliebe als das höchste Gut betrachten, das dem Menschen je zuteil wird. Ich will nicht vergessen, dass eine Laune der Natur und nicht ihr eigenes Wollen den Menschen die Nächstenliebe genommen hat. Ich will meine Mitmenschen als Kranke betrachten, die Nachsicht verdienen. Ich will mich gegen ihre Nachstellungen wehren, soweit sie mir gefährlich werden können; aber ich will meine Mitmenschen für ihre Handlungen, die aus Mangel an Nächstenliebe geboren sind, nicht verantwortlich machen.«
Sylvia ließ die Hand von Sergios Arm gleiten. »Das hast du gut gesagt«, lobte sie ihn halblaut. Ihr Gesicht zeigte dabei den gleichen starren Ausdruck wie die Menschen, zwischen denen sie eingekeilt waren. »Und du fühlst dich jetzt schon viel weniger aufgeregt, nicht wahr?«, fügte sie hinzu.
»So ist es«, bestätigte Sergio Percellar und lachte leise. Als er den warnenden Blitz in Sylvias Augen sah, war es schon zu spät. Einer der Passanten fuhr herum und fragte mit drohender Stimme: »Wer hat gelacht?«
Ein kleines, altes Männchen neben Sergio deutete anklagend auf seine hochgewachsene, hagere Gestalt. Schrill rief der Alte: »Der da war es! Ich habe seinen Gefühlsausbruch deutlich gehört!«
Der andere, ein grobschlächtiger Kerl, drängte die Umstehenden beiseite und kam näher. »Du hast gelacht? Warum, Bruder?«
Percellars Miene wirkte wieder ernst und ausdruckslos. »Standardgesicht«, sagte Sylvia dazu; es war eine Notwendigkeit. Ohnehin kannte er die Regel: nicht auffallen und sich nicht von der Masse abheben. »Selbst wenn ich gelacht hätte«, antwortete er mit flacher Stimme, »ginge es dich nichts an, Bruder. Tatsächlich habe ich mich verschluckt und musste husten. Belästige mich nicht, Bruder!«
War es die korrekte Antwort, war es Sergios zwingender Blick – jedenfalls wandte sich der Bullige wortlos ab.
Eine halbe Minute später verließen auch Sergio Percellar und Sylvia Demmister das Band und verschwanden in der Menge, die sich abseits der Rollbandstraßen durch die Hochhausschluchten schob.
Die Straßen waren voll von Menschen, als triebe sie die Aphilie aus ihren Wohnungen. Obwohl sie sich nichts zu sagen hatten, wollten sie einander nahe sein. Ein buntes Völkergemisch umgab Sergio und Sylvia – Menschen aus allen Regionen der Erde, Marsgeborene ebenso wie Siedler von den Kolonialwelten des ehemaligen Solaren Imperiums. Alle starrten teilnahmslos vor sich hin. Sergio hasste den leeren Ausdruck der Gesichter, es kostete ihn Mühe, seine Abneigung nicht zu zeigen.
Eine zweite Gruppe gab es inmitten des Gedränges: gelbbraun Uniformierte, die sich durch die Menge schoben und ihre Augen überall hatten. Die Gelbbraunen waren Roboter, die Aufpasser der neuen Machthaber. Sie achteten darauf, dass das Gesetz eingehalten wurde. Andernfalls sorgten sie dafür, dass der Schuldige umgehend seine Strafe erhielt.
Die Menschen nannten sie nach ihrer Typenbezeichnung: K-2. Ka-zwo war ein gefürchtetes Wort, denn die Ka-zwos waren erbarmungslos. Jede Verfehlung wurde scharf geahndet, und es gab keine geringere Strafe als einen Schlag auf die Schulter, mit einer Energie von zwanzig Newtonmeter. Schon manches Schlüsselbein war dabei zerbrochen. Um Ka-zwos machten die Menschen einen Bogen.
Für Sergio Percellar aber – und ebenso für Sylvia Demmister – waren die Ka-zwos die Personifikation der Hässlichkeit dieser Welt. Sergio hasste die Roboter mit Inbrunst. Nicht umsonst hatte er bereits zweiundzwanzig von ihnen »beiseite geschafft«.
Er folgte Sylvia in eine schmale, von alten Fassaden begrenzte Seitenstraße. Sylvia liebte diesen Teil der Stadt, hier kannte sie ein kleines Esslokal, von dem sie Sergio schon lange vorgeschwärmt hatte. Es bestand aus einem einzigen Raum, in dem so viele Tische und Stühle wie möglich zusammengepfercht waren.
Das Restaurant war etwa zu drei Vierteln besetzt, als die beiden eintraten. An der rückwärtigen Wand standen Speise- und Getränkeautomaten. Eine Schlange hatte sich davor gebildet, und es ging nur langsam voran, weil die Automaten eine erstaunlich große Auswahl boten.
Über der Ausgabestelle hingen kleine Optiken, die alle Vorgänge im Restaurant aufzeichneten. Denn es war das hervorstechendste Merkmal der aphilischen Gesellschaft, dass sie ihre Mitglieder überall bewachte.
Überwacht, schoss es Sergio durch den Sinn. Kontrolliert ...
Sylvia und er stellten sich an. Sergio zog einige Münzen aus der Tasche und rechnete überschlägig. Ihr Geld musste noch bis Borneo reichen. Die Insel war ihr eigentliches Ziel, eines, das man besser nur hinter vorgehaltener Hand erwähnte.
Sie waren bis auf drei oder vier Personen, die noch vor ihnen standen, an den ersten Automaten herangekommen, als es geschah – plötzlich, unerwartet und ohne Anlass. An einer der weiter vorne stehenden Maschinen hatte sich einer der Kunden zu viel Zeit genommen. Jedenfalls nach Ansicht des hinter ihm stehenden Mannes. Der Ungeduldige, mittelgroß und grobknochig, drängte sich mit einem knurrenden Laut nach vorne, rammte dem Saumseligen den Ellenbogen in die Seite und begann, selbst seine Wahl zu treffen.
Unwillkürlich wurde es still in dem Raum. Instinktiv spannte Sergio die Muskeln. Er wusste, was geschehen würde, und die anderen, die den Zwischenfall beobachtet hatten, wussten es auch.
Eine schrille Pfeife plärrte los. Das Gesetz über den Umgang der Menschen miteinander war verletzt worden. Absatz drei: im Alltag, Paragraf vierzehn: bei Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen. Eines der Aufnahmegeräte hatte den Verstoß registriert und gemeldet.
Der Mann, der sich so rüde sein vermeintliches Recht genommen hatte, stutzte zuerst nur. Als er sich von den Ausgabeautomaten abwandte, konnte Sergio sein Gesicht sehen. Es war hager, mit ungesunder, gelblicher Haut und unangenehmen Zügen. Erst allmählich schien ihm die Bedeutung des Alarms bewusst zu werden. Seine Augen weiteten sich, als er in Richtung des Eingangs blickte. Ein Gurgeln kam über seine Lippen.
Dann, wild mit den Armen rudernd, trieb er die Umstehenden auseinander und hastete zum Ausgang. Draußen – das konnte Sergio durch die offene Tür sehen – blieb der Hagere so abrupt stehen, als wäre er gegen eine unsichtbare Wand geprallt.
Von rechts kamen zwei Ka-zwos ins Blickfeld. Der eine trug die reguläre gelbbraune Uniform, der andere zusätzlich eine rote Markierung am Revers, die ihn als übergeordneten Roboter auswies. Er musste zufällig in der Gegend gewesen sein, denn bei der Bestrafung von geringfügigen Vergehen, wie hier eines vorlag, war die Anwesenheit eines Aufsehers grundsätzlich nicht notwendig.
Beide Roboter führten den Mann ins Restaurant zurück. Eines der Prinzipien aphilischen Strafvollzugs war, dass die Strafe nach Möglichkeit am Tatort und in Anwesenheit der Zeugen des Vergehens vollzogen wurde. Der untergeordnete Roboter sprach den Straffälligen mit wohlmodulierter Stimme an: »Du hast das Gesetz über den Umgang der Menschen miteinander – Absatz drei: im Alltag, Paragraf vierzehn: bei Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen – gebrochen. Die Tat wurde aufgezeichnet, ich identifiziere dich zweifelsfrei. Hast du noch eine Frage?«
Der Gelbhäutige bewegte die Lippen zu einem lautlosen »Nein«. Dem Roboter schien die Antwort zu genügen, er hob den Arm. Zwanzig Newtonmeter – das war die kinetische Energie eines Kilogrammgewichtes, das aus etwa zwei Metern Höhe herabfiel. Ein wuchtiger Schlag, den manches Knochengerüst nicht aushielt. Der Gelbhäutige stand still, aber sein Blick war ängstlich nach oben gerichtet, wo die harte Faust des Ka-zwo über ihm hing.
»Jetzt!«, sagte der Roboter.
Die Faust sauste mit dumpfem Aufschlag auf die Schulter des Straffälligen herab. Der Mann schrie auf und brach in die Knie. Sekundenlang kauerte er mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Dann sprang er auf und stolperte davon. Die Roboter wandten sich ebenfalls ab, ihre Aufgabe war erledigt.
»Ich habe plötzlich keinen Hunger mehr«, sagte Sylvia halblaut.
Sergio erwachte aus tiefer Nachdenklichkeit. »Hunger?«, brummte er. »Wer hatte je Hunger?«
Sie verließen das Restaurant und mischten sich ziellos unter die Menge. Sie sprachen nicht miteinander. Jeder war auf seine Weise damit beschäftigt, das Erlebte zu verarbeiten.
Sergio Percellar beachtete kaum, was um ihn herum vorging. Er blickte erst auf, als er einen flüchtigen gelbbraunen Schimmer bemerkte. Mit einem Ruck hielt er inne. Vor ihm stand der Ka-zwo-Aufseher, der Roboter mit der roten Markierung am Revers, vermutlich derselbe, der vor wenigen Minuten der Bestrafung des Gesetzesbrechers beigewohnt hatte. Da alle Maschinenmenschen die gleichen ausdruckslosen Gesichter hatten, waren sie schwer voneinander zu unterscheiden. Es gab jedoch keinen Zweifel daran, dass dieser Roboter es auf Sergio und Sylvia abgesehen hatte. Er war vor ihnen aus der Menge aufgetaucht und hatte sich so postiert, dass er ihnen den Weg versperrte.
»Ihr seid ein eigenartiges Paar, Bruder und Schwester«, sagte er. »Ich habe euch im Restaurant beobachtet, und ich vermisse an euch die charakteristische Ausstrahlung des Personal-Identifizierungs-Kodegebers. Ihr wisst doch, Bruder und Schwester, was ein PIK ist – oder nicht?«
»Oh verdammt!«, entfuhr es Sergio. Im nächsten Moment hätte er sich am liebsten die Zunge abgebissen. Aber es war zu spät, den Fehler zu korrigieren.
»Du verwendest eine merkwürdige Sprache, Bruder«, bemerkte der Ka-zwo-Aufseher. »Solche Worte sind unter der Würde des befreiten Menschen.«
Sergio konnte nur noch retten, was zu retten war. »Du hast richtig beobachtet, Bruder«, gab er zu. »Wir beide haben noch keinen PIK.«
»Warum nicht?«
»Wir waren nie lange genug an einem Ort, um uns einen zu beschaffen. Außerdem ist die Frist noch nicht abgelaufen. Die Strafbefreiung endet erst in einigen Wochen.«
»Genau in vier Tagen, Bruder«, korrigierte der Roboter. »Du musst besser auf den Kalender achten.«
»Wir werden die nächste Gelegenheit wahrnehmen, uns einen PIK zu besorgen«, versprach Sergio.
»Das wollte ich dir eben nahe legen, Bruder. Begleitet mich! Beide!«
»Wie meinst du das?«
»Ich biete euch die Gelegenheit zur sofortigen Beschaffung eines Personal-Identifizierungs-Kodegebers. Folgt mir zum nächsten Büro der Aufsichtsbehörde.«
Der Vorschlag war Sergio alles andere als angenehm. Der PIK war ein heimtückisches Gerät, und Sylvia und ihm lag wenig daran, dass die Regierung ihren Weg durch den Dschungel von Borneo überwachen konnte.
»Wir haben eine dringende Verabredung«, versuchte er, den Roboter hinzuhalten. »Ich versichere jedoch ...«
»Das ist nicht vorgesehen«, unterbrach ihn der Ka-zwo-Aufseher. »Alle Personen, die innerhalb von zehn Tagen vor Ablauf der Beschaffungsfrist ohne Personal-Identifizierungs-Kodegeber angetroffen werden, sind zur nächsten Niederlassung der Aufsichtsbehörde zu geleiten und mit einem PIK auszustatten.«
Sergio zuckte hilflos mit den Schultern. Sylvias Blick wirkte kaum weniger ratlos.
Der Roboter bahnte ihnen einen Weg durch die Menge. Mehrmals suchte Sergio nach einer Fluchtmöglichkeit, aber nicht nur sein Verstand, sondern auch Sylvias warnendes Räuspern sagten ihm, dass es besser war, den Ka-zwo nicht zu provozieren. Die Maschinen verfügten über eine unglaubliche Reaktionsschnelligkeit.
Schweigend folgten sie dem Roboter und verständigten sich nur mit Blicken und knappen Gesten. Der Aufseher bemerkte vielleicht auch das, obwohl er ihnen den Rücken zuwandte. Aber die Sprache der Augen und der Hände konnte niemand entschlüsseln. Wenn man sich bei der Aufsichtsbehörde, wie der Roboter die Staatspolizei nannte, darauf beschränkte, ihnen einen PIK unter die Haut zu transplantieren, hatten sie noch eine Chance. Irgendwo auf hoher See würden sie sich des Geräts wieder entledigen können.
Aber falls der Roboter nur den geringsten Verdacht bezüglich ihrer Zuverlässigkeit hegte, würde die Staatsmaschinerie anlaufen. Und bis zum Hypnoseverhör durfte Sergio es nicht kommen lassen. Dann würde er alles ausplaudern, was er wusste – auch, dass er ein Buch war ... Und das wiederum bedeutete seinen und Sylvias Tod.
Bevor sie zu ihrer Reise nach Borneo aufgebrochen waren, hatten sie sich in mühevoller Arbeit einen Aktionsplan zurechtgelegt, der alle Gefahren und Eventualitäten berücksichtigte. Bislang waren sie weitgehend unbehelligt geblieben und standen nun vor der ersten ernsthaften Bedrohung. Sie wussten beide, dass ihr Leben an einem seidenen Faden hing.
Der Verwaltungstrakt der Aufsichtsbehörde war ein mehrstöckiges Gebäude im gesicherten Bereich. Eine flirrende Energiesperre riegelte es nach außen ab. Der Ka-zwo-Aufseher schaltete eine Strukturschleuse und forderte Sergio und Sylvia auf, unmittelbar hinter ihm zu bleiben. Sie kannten die tödliche Wirkung solcher Sperren.
Ist das unser Weg zur Hinrichtung?, fragte Sylvias Blick.
Unter der Energiebarriere parkten mehrere Dutzend Polizeigleiter. Gelbbraun uniformierte Roboter warteten auf ihren nächsten Einsatz.
Das Innere des Gebäudes bestand – das war Sergios erster Eindruck – nur aus kahlen, grell erleuchteten Gängen, fensterlos, mit endlosen Türreihen zu beiden Seiten. Der Roboter führte sie in einen kleinen Raum mit Sitzbänken, die sich an den Wänden entlangzogen. Eine zweite Tür führte in einen angrenzenden Raum. Durch sie verschwand der Aufseher.
Minuten vergingen. Sergio starrte dumpf zu Boden. Natürlich wurde der Raum überwacht, auch Sylvia wusste das. Ihr Schweigen wurde zur Qual, zumal scheinbar eine Ewigkeit verging. Sicherlich berichtete der Roboter über jede Phase ihrer Begegnung, und den Fluch, der Sergio entrutscht war, würde er nicht unerwähnt lassen. Falls der Vorfall verdächtig erschien, wurde ein Kampf unvermeidbar. Sergios Hand fuhr zur Hüfte hinab. Doch bevor die Finger seine Kleidung berührten, um nach der kleinen, beulenartigen Erhebung zu tasten, unter der sich seine einzige Waffe für den Ernstfall verbarg, erinnerte er sich der verborgenen Aufnahmegeräte und beschränkte sich auf ein kurzes Kratzen.
Nahezu gleichzeitig betrat ein älterer Mann den Raum. Er war von mittlerer Statur, trug das dunkle Haar kurz geschnitten und hatte ein nichts sagendes Gesicht. Eine Weile musterte er abwechselnd erst Sylvia und dann Sergio. Schließlich nickte er Percellar zu und sagte: »Mit dir will ich zuerst sprechen, Bruder. Folge mir!«
Merkwürdigerweise lag hinter der Tür kein weiterer Raum, sondern ein Gang, der schmaler und weniger hell erleuchtet war als die Korridore, durch die Sergio bis jetzt gekommen war. Auch gab es zu beiden Seiten keine Türen.
»Wohin führst du mich, Bruder?«, fragte Sergio den unscheinbaren Mann, der vor ihm herschritt.
»Zur Implantation deines PIKs, Bruder«, lautete die Antwort. Als die Beleuchtung flackerte, sah Sergio überrascht auf. Der Unscheinbare herrschte ihn an: »Nicht anhalten! Weitergehen!«
Leise Musik schien aus der Höhe zu kommen. Es war eine eigenartige Weise, wie Sergio sie nie zuvor gehört hatte, mit einem merkwürdigen Rhythmus, der sich mit dem Flackern der Beleuchtung verband und eine Wirkung erzeugte, die seinen Körper im gleichen Takt vibrieren ließ.
»Nicht anhalten! Weitergehen ...« Selbst die Stimme des Unscheinbaren wurde von dem geheimnisvollen Rhythmus eingefangen und schwang mit ihm auf und ab. Ungläubig starrte Sergio den schier endlosen Gang entlang, der mit einem Mal mit der Musik und dem Flackern zu pulsieren schien. Er war in eine Märchenwelt geraten, nichts war mehr wirklich. Nur der Befehl des Unscheinbaren hämmerte auf ihn ein: »Nicht anhalten ...!«
Jede Faser seines Körpers vibrierte. Erst im allerletzten Moment erkannte Sergio die Hypnofalle. Nur noch wenige Sekunden, und er wäre dem Bann der fremden Töne, dem psychedelischen Flackern und der beschwörenden Stimme hilflos ausgeliefert gewesen.
»Ich komme«, ächzte er, um den Unscheinbaren zu beruhigen.
Zugleich stach seine rechte Hand zur Beule am Oberschenkel hinab. Die tastenden Finger fanden die unscheinbare Naht im Stoff und rissen sie auf. Die Nägel gruben sich ins Fleisch, durchbrachen die Haut und fanden die verborgene winzige Kapsel. Aufstöhnend vor Schmerz, brachte Sergio das kleine Gebilde zum Vorschein. Der Sauerstoff aktivierte den Zünder. Von nun an hatte Sergio fünfzehn Sekunden Zeit.
»Warum kommst du nicht?«, fuhr der Unscheinbare ihn an.
Das Licht, die lähmende Melodie, die markante Stimme, das alles hatte plötzlich keinen Einfluss mehr auf Sergio. »Euch alle soll der Teufel holen, Bruder!«, stieß er zornig hervor. Dabei schnippte er die kleine Kapsel mit den Fingernägeln fort, warf sich herum und hetzte den Weg zurück, den er gekommen war.
Es dauerte viel länger als erwartet, bis er im immer noch flackernden Widerschein die Tür wieder vor sich sah. Fünf, vielleicht sechs Sprünge trennten ihn noch vom Durchgang, als die Kapsel explodierte. Ein greller Blitz durchzuckte den Gang, und die folgende Druckwelle schleuderte Sergio zu Boden.
Er blieb liegen, bis der Lärm und der Glutwind verebbt waren. Schweißgebadet taumelte er dann die letzten Schritte bis zum Ausgang. Er hatte erwartet, eine normale Tür zu finden, die sich selbsttätig öffnete. So selbstverständlich glaubte er, dass diese Tür sich wie alle anderen Türen verhalten würde, dass er mit dem Gesicht gegen das Hindernis prallte.
Er fuhr zurück. Ungläubig starrte er das Hindernis an. Dann begann er, die massive Platte mit den Fäusten und mit Fußtritten zu bearbeiten. Er hoffte, dass Sylvia ihn hörte und von ihrer Seite aus öffnete. Aber sein wütendes Hämmern erzeugte nichts weiter als ein schwaches Dröhnen.
Irgendwann hielt er inne. Seine Fäuste schmerzten, die Hitze raubte ihm den Atem, und der Schweiß brannte in den Augen. Er hatte geglaubt, die Aphiliker mit einer einzigen Mikrobombe ablenken und sich den Weg zurück in die Freiheit öffnen zu können, aber sie hatten ihn dennoch gefangen.
Staub- und Rauchschwaden wogten durch den Korridor. Keuchend bahnte Sergio sich durch den Mauerschutt einen Weg zurück zum Explosionsort. Nie zuvor hatte er mit solcher Inbrunst um das Leben eines Aphilikers gebangt wie in diesen Augenblicken. Es gab für ihn nur noch eine Hoffnung: Der Unscheinbare, der unter den Trümmern hoffentlich überlebt hatte, musste ihm helfen.
Sergio machte sich daran, den Schutt beiseite zu räumen. Falls es ihm nicht gelang, in kürzester Zeit zu entkommen, war seine letzte Chance dahin. Natürlich war die Erschütterung der Explosion in anderen Räumen wahrgenommen worden. Bald würden die ersten Räumroboter erscheinen.
Endlich hatte er Erfolg. Aus dem Trümmerberg erklang ein qualvolles Stöhnen. Sergio hing die Haut bereits in Fetzen von den Händen, als er die letzten Mauerbrocken über dem Unscheinbaren zur Seite wuchtete. Im schwachen Schein der einzigen noch intakten Leuchtplatte sah Percellar den ängstlichen Blick des Aphilikers auf sich gerichtet. Nach dem Verlust aller Emotionen hatten in den Bewusstseinen dieser Menschen neben dem streng logischen Denkprozess die reinen Instinkte die Oberhand gewonnen. Unfähig, Liebe oder Zorn, Zuneigung, Abneigung, Freude oder Trauer zu empfinden, waren die Aphiliker ihren Urtrieben in weitaus stärkerem Maß ausgeliefert als die Menschen früherer Generationen. Das armselige Häuflein, das sich vor ihm krümmte, wurde von der Todesangst bis in den hintersten Winkel seines Daseins beherrscht.
»Bist du verletzt, Bruder?«, fragte Sergio ruhig, bemüht, seiner Stimme einen unbeugsamen Klang zu geben.
»Ich ... ich weiß es nicht ...«, antwortete der Unscheinbare bebend.
»Wie heißt du?«
»Ich ... Mein Name ist Pakko.«
»Also gut, Pakko: Steh auf!«
Der Mann gehorchte. Aus einer Stirnwunde sickerte Blut, aber ernsthaft verletzt schien er nicht zu sein. Sergio erblickte eine Waffe an seinem Gürtel, einen kleinen Blaster. Sofort griff er zu, um dem anderen keine Möglichkeit für einen Angriff zu bieten.
»Hör zu, Pakko!«, sagte er zu dem Unscheinbaren, als der einigermaßen sicher auf den Beinen stand. »Am Ende dieses Gangs befindet sich eine Tür. Du wirst sie für mich öffnen. Wenn du nicht gehorchst, erschieße ich dich. Hast du verstanden?«
»Jj-ja ...«, würgte Pakko hervor. Sergio versetzte ihm einen kräftigen Stoß, der ihn taumeln ließ. Erst unmittelbar vor der Tür blieb der Mann stehen und murmelte einige Worte. Der Öffnungsmechanismus war demnach mit einem akustischen Servo ausgestattet und kodeabhängig.
Als der Ausgang aufglitt, stieß Sergio Pakko beiseite und stürmte hinaus. »Sylvia ...!«, rief er. Das Wort blieb ihm im Hals stecken. Mit wirrem Blick sah er sich um. Sylvia war nicht mehr da.
Als Sergio Percellar herumwirbelte und den Unscheinbaren anstarrte, stand in seinen dunklen Augen eine tödliche Entschlossenheit. Der Aphiliker sackte schier in sich zusammen.
»Wo ist meine Begleiterin?«, herrschte Sergio den anderen an.
»Die ... die Frau wurde zum Verhör geholt«, stieß Pakko hervor.
»Hast du eine wichtige Position in der Verwaltung?«
»Ja«, bekannte der Unscheinbare irritiert. Offensichtlich konnte er dem Gedankensprung nicht folgen.
»Schaff die Frau wieder herbei, egal wie!«, drängte Sergio. »Mach schon, oder ...«
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Die Tür zum Korridor hatte sich vor der unförmigen Gestalt eines Räumroboters geöffnet.
»Schick ihn zurück!«, befahl Sergio. »Sofort!«
Pakko trat auf das Maschinenwesen zu. »Du wirst hier nicht gebraucht«, sagte er mit zitternder Stimme. »Die Lage ist unter Kontrolle.«
Kommentarlos wandte sich der Roboter um. Sie folgten ihm mit wenigen Metern Abstand, wandten sich dann aber nach links, während die Reinigungsmaschine in die andere Richtung rollte. Sergio sicherte mit der Waffe nach beiden Seiten. Aber nur der Räumroboter war zu sehen.
Pakko ging an vier Türen vorbei. Vor der fünften blieb er stehen. »Die Frau ist in dem Raum«, brachte er ängstlich hervor.
»Ist sie allein?«
»Ein Beamter und ein Ka-zwo sind bei ihr.«
»Mach auf!«, befahl Sergio.
Wieder ein Kodewort. Die aufgleitende Tür gab den Blick frei in einen fensterlosen, von grell fluoreszierenden Lampen beleuchteten Raum. An den Wänden standen medotechnische Geräte. In der Mitte des Raumes lag Sylvia halb entkleidet und mit geschlossenen Augen auf einer Antigravliege. Sie schlief entweder oder war bewusstlos.
Ein Mann und ein Ka-zwo wandten sich jäh den Eindringlingen zu. Sergio rammte seiner Geisel die Abstrahlmündung der Waffe zwischen die Schulterblätter und stieß Pakko weiter.
»Sie sollen zur Seite treten! Na los!«
»Macht, was er verlangt«, ächzte Pakko. »Er kommt hier ohnehin nicht heraus.«
Der Roboter gehorchte. Ohne Zweifel übermittelte er die Szene bereits an seine Kommandostelle. Sergio stieß die Geisel von sich, riss den Strahler herum und feuerte. Ein greller Energiestrahl traf den Roboter im Brustbereich und hüllte ihn in Flammen. Mehrere Sekunden lang hielt Sergio den Auslöser gedrückt, bis eine schwache Explosion den Roboter erschütterte. Beide Aphiliker lagen da schon zitternd am Boden.
Ohne die Männer aus den Augen zu lassen, ging Sergio zur Liege. Sylvia atmete ruhig. Wahrscheinlich hatte man sie betäubt. Ihre Arme und Beine waren gefesselt. Sergio löste die Kunststoffbänder, dann wandte er sich an Pakko: »Wir müssen hier weg. Ihr beide führt uns durch den Energieschirm.«
Draußen heulten Alarmsirenen auf. Schrill verkündeten sie, dass die Polizei in ihrem Bangkoker Hauptquartier Probleme hatte.
Der zweite Aphiliker, ein stämmiger, gedrungener Bursche, trug die immer noch bewusstlose Sylvia auf der Schulter. Sergio trieb beide Männer mit der Waffe vor sich her. In einem Antigravschacht waren sie in die tief unter der Erde liegenden Geschosse gelangt. Der Gang führte nach Pakkos Aussage unter der Energiebarriere hindurch und mündete in das unterirdische Verkehrsnetz. Das Schrillen der Sirenen war längst verhallt, aber Sergio zweifelte nicht daran, dass es nur wenige Augenblicke dauern würde, bis die Staatspolizei seine Spur gefunden hatte.
Der Korridor beschrieb eine enge Biegung; eine Tür wurde sichtbar. Pakko hielt keuchend inne. »Dort ist der Ausgang«, stieß er hervor.
»Weiter!«, herrschte Sergio ihn an. Pakko eilte voraus und öffnete die Tür. Sie mündete auf einen leeren Bahnsteig der Röhrenbahn. Rechts lag das Ende der Plattform nur wenige Schritte entfernt. Einige Meter weiter glänzte das Schleusentor, das den druckregulierten Streckenabschnitt der Röhrenbahn von dem unter normalem atmosphärischen Druck stehenden Bahnsteig trennte.
Sergio hatte seine Flucht planlos begonnen. Beim Anblick der Schleuse wusste er endlich, was zu tun war. »Hinab auf die Fahrbahn!«, befahl er den beiden Aphilikern. Die Drohung mit der Waffe ließ sie gehorchen.
Der Mann, der Sylvia trug, stolperte beim Sprung, die Bewusstlose entglitt seinem Griff. Obwohl Sergio sofort hinzusprang, konnte er nicht verhindern, dass Sylvia hart aufschlug. Doch als er sich über sie beugte, um nach Verletzungen zu sehen, schlug sie die Augen auf.
»Ich bin in Ordnung«, sagte Sylvia Demmister leise. »Achte nicht auf mich, sondern auf diese Schurken. Sie sind zu allem fähig.«
Sylvia stand wieder erstaunlich sicher auf den Füßen. Mit flammendem Blick musterte sie den stämmigen Aphiliker, der sie bis vor wenigen Augenblicken auf der Schulter getragen hatte.
»Das ist der Hinterhältigste«, schimpfte sie. »Kaum warst du weg, kam er mich holen. Er sagte, er wollte mir einen PIK verschaffen. Stattdessen gab er mir eine Injektion, die mich von den Beinen riss ...«
Der Stämmige duckte sich unter ihrem wütenden Blick. Sergio wies auf das Schleusenschott. »Dort müssen wir durch«, stellte er fest. »Beeilt euch, damit uns der nächste Röhrenzug nicht einholt!«
Aus sicherer Entfernung richtete er den Strahler auf das Schott, zielte auf die positronische Verriegelung und drückte ab. Fauchend leckte der Energiestrahl über das Metall und schmolz es. Die Aphiliker wurden vorgeschickt, um die Schotthälften auseinander zu schieben. Die Schleuse war beleuchtet. Etwa einhundert Meter entfernt befand sich das zweite Schott. Dahinter begann der druckregulierte Streckenabschnitt.
Sergio näherte sich dem äußeren Schott bis auf etwa fünfzehn Schritte, dann feuerte er wieder. Auf der Strecke herrschte Unterdruck. Kaum schmolz die Thermosalve die Struktur des inneren Schotts, da fegte eine heulende Sturmbö über Sergio hinweg und riss ihn fast zu Boden. Er sah, wie der glühende Teil des Schotts nach außen gedrückt wurde. Mit ungeheurer Wucht rauschte die Luft aus dem Bahnsteigsektor in den fast luftleeren Streckenabschnitt. Es knackte in Sergios Ohren, und ein leichtes Schwindelgefühl ließ ihn schwanken.
»Weiter!«, schrie er gegen den Sturm.
Nur Sylvia hatte rechtzeitig reagiert und sich eng an die Schleusenwand gepresst; die Aphiliker waren jedoch von den Beinen gerissen worden. Sergio wartete, bis Pakko und der Stämmige an ihm vorbei durch das aufgebrochene Schott stiegen. Er folgte ihnen, und Sylvia blieb dicht neben ihm. Inzwischen mussten sie nicht mehr fürchten, von einem Rohrbahnzug überrollt zu werden. Das Überwachungssystem hatte den Schleusendefekt registriert und augenblicklich den Verkehr auf dieser Strecke lahm gelegt. Der Nachteil war, dass die Sicherheitsorgane informiert wurden.
Schweigend tappten sie durch die Düsternis. Der Sturm hatte sich inzwischen gelegt, der Druckausgleich war abgeschlossen. Sergio blieb stehen, als er im matten Schimmer einer der wenigen Leuchtplatten den flachen Stutzen eines Regulierventils in der Röhrenwand entdeckte. Wenige Schritte weiter, auf der anderen Seite und etwa in halber Mannshöhe, lag der Verschluss eines Überdruckventils. Selbsttätig trat es immer dann in Tätigkeit, sobald der Druck in der Röhre einen kritischen Wert überstieg. Das Regulierventil führte in einen der riesigen Drucktanks für die Regulierung der Streckenabschnitte. Der Wartungsschacht musste hingegen in nicht allzu großer Entfernung an der Oberfläche münden.
Mit Sergio waren auch die Aphiliker stehen geblieben. Pakko schrie auf, als die flirrende Abstrahlmündung der Waffe auf den Verschluss des Regulierventils zeigte.
»Nicht!«, wimmerte er. »Du wirst uns alle umbringen.«
»Hinlegen!«, knurrte Sergio. »Je dichter ihr euch an den Boden presst, desto weniger kann der Sog euch mitreißen.«
Pakko wollte weiter jammern, aber Sergio gab ihm einen kräftigen Stoß, dass er zu Boden ging. Sylvia und der andere Mann hatten seine Anweisung bereits befolgt. Sergio Percellar kniete sich, dem Regulierventil genau gegenüber, vor die linke Wand der Röhre, visierte das Ziel kurz an und schoss.
Die Wirkung war überwältigend. Dröhnend barst das Ventil. Der riesige Druckkörper dahinter entließ einen fauchenden Strom hochkomprimierter Luft in die Röhre. Sergio hatte sich ebenfalls zu Boden geworfen und machte sich so flach wie möglich, trotzdem fürchtete er, vom tosenden Sturm mitgerissen zu werden. Kaum mehr als dreißig Sekunden lang verkrampfte er sich, aber die Zeit erschien ihm wie eine halbe Ewigkeit. Dann ließ die Wucht des Sturmes allmählich nach. Vorsichtig hob Sergio den Oberkörper an und spähte nach beiden Seiten. Der Luftstrom trieb ihm Tränen in die Augen, aber er sah zur Linken die Aphiliker eng an den Boden gepresst und rechter Hand Sylvia in ähnlicher Haltung wie er selbst. Sie hatte seinen Plan instinktiv erkannt.
An der gegenüberliegenden Wand hatte die explosionsartig freigesetzte Luft aus dem Kessel ein mehr als mannshohes Wandstück herausgerissen. Ein Loch war entstanden, durch das ein normal gewachsener Mensch leicht ins Innere des Kessels eindringen konnte. Ein Blick zur Seite bewies Sergio, dass inzwischen das Überdruckventil arbeitete. Durch das Ausströmen der Pressluft hatte sich der Innendruck der Röhre unzulässig erhöht. Die Öffnung des Überdruckventils war zwar unbequemer als das Loch in der gegenüberliegenden Wand, aber dafür führte der Weg durch den Überdruckstollen geradewegs in die Freiheit.
Sergio machte eine Kopfbewegung, die Sylvia sofort verstand. Sie stemmten sich gegen den immer noch heftigen Sturm und krochen auf die Öffnung des Ventils zu. Sergio half der Frau in die Höhe. Es war nicht leicht für Sylvia, durch das enge Loch zu klettern, aber schließlich war sie in der Wand verschwunden. Sergio folgte ihr, nachdem er sich mit einem letzten Blick davon überzeugt hatte, dass die Aphiliker immer noch bäuchlings auf dem Boden lagen und ihre Gesichter auf den Beton pressten.
Seine breiten Schultern behinderten ihn, aber er schaffte es mit Sylvias Hilfe, die enge Öffnung zu überwinden. Ein finsterer, enger Stollen nahm ihn auf. Der Weg verlief zunächst horizontal und stieg später steil in die Höhe. Wo er nach oben abknickte, hielt Sergio erstmals an. Er brauchte eine Weile, um dem geschundenen Körper Ruhe zu gönnen. Von der Röhre her rauschte die immer noch aus dem Tank entweichende Luft durch den Stollen. Der Sturm hatte aber schon merklich an Wucht verloren. Bald würde sich der Druck im Innern der Röhre wieder normalisieren und das Ventil schließen.
2.
Das Buch
Die Luft war mild und vom Duft tropischer Blüten erfüllt. In den Blättern der Bäume raschelte ein sanfter Wind, und von weit her erklangen die Geräusche der Großstadt. Es war finster.
Die Erleichterung nach einer überstandenen Gefahr ist umso tief greifender, je größer die Gefahr war. Sergio, unter dem Geäst eines Busches ausgestreckt, fühlte sich zum ersten Mal seit langem wohlig entspannt. Er hatte die Arme unter dem Kopf verschränkt und blickte zu den Sternen hinauf. Sylvia lag neben ihm. Er spürte die Wärme ihres Körpers, und zeitweilig verloren sich seine Gedanken in Bahnen, die in der gegenwärtigen Lage absolut unangemessen waren. Immerhin war die Gefahr noch nicht wirklich überstanden. Der Stollen des Überdruckventils hatte sie im Hinterhof eines uralten Industriegebäudes an die Oberfläche geführt. Unbehelligt hatten sie sich bei der nächsten Gelegenheit des öffentlichen Verkehrssystems bedient und waren an den westlichen Stadtrand gefahren. Hier gab es weitläufige Erholungsflächen – Wälder und Parks in ursprünglichem Zustand. Sie hofften, dass ihnen der kommende Tag Gelegenheit zu neuen Unternehmungen bieten würde.
Die Polizei war auf der Suche nach ihnen, daran konnte es keinen Zweifel geben. Pakko musste sehr schnell erkannt haben, dass Sergio Percellar der Norm des neuen Menschen nur höchst unvollkommen entsprach. Mit anderen Worten: Percellar hatte die Umstellung vom emotional gebundenen »alten Menschen« zum rein logisch denkenden und agierenden »neuen Menschen« noch nicht vollzogen. Er war kein Aphiliker, und das allein reichte aus, um ihn zum Tod zu verurteilen.
Sylvia regte sich. Sergio blickte zur Seite und sah ihre Augen zu den Sternen hinaufgerichtet. Sie begann zu summen, ihre Lippen formten halblaute Worte. Er kannte die Melodie, und die Worte, die sie in eigenartigem Singsang von sich gab, erfüllten ihn mit einem Gefühl wohliger Wärme und gleichzeitig mit unstillbarer Sehnsucht nach vergangenen Zeiten.
»Nun aber hört«, sprach Sylvia. »Da waren einst Menschen, die einander liebten. Die Eltern liebten ihre Kinder und die Kinder ihre Eltern. Der Nachbar liebte seinen Nachbarn, und die Liebe war allgegenwärtig. Die Menschen lebten in Frieden miteinander, denn unter ihnen war Liebe.«
Sie schwieg. Sergio aber drängten sich die Worte förmlich auf die Zunge, die Worte, die er mit Sylvia gelernt hatte – Worte, die aus dem Buch stammten, das nur noch in einer Kopie existierte: in ihrer beider Gedächtnis.
Er setzte sich auf und sprach in dem gleichen Singsang, in dem Sylvias Worte erklungen waren: »Die Liebe hört niemals auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird.« Dann sank er wieder in seine vorherige Haltung zurück, und Sylvia fuhr fort: »Ihr aber, die ihr meint, die Liebe zu kennen – zu euch muss ich sagen: Ihr wisst nicht, was Liebe ist. Denn das, was ihr Liebe nennt, ist tierische Begierde. Eure Liebe ist die Brunst, die schnell aufflammt und ebenso schnell wieder verlischt, eure Liebe ist nicht die unsere – in der Tat, eure Liebe ist es nicht wert, Liebe genannt zu werden.«
Sergio hörte sie schwer atmen. Er selbst war bis ins tiefste Innere aufgewühlt. Niemand rezitierte das Buch, ohne dass er von diesen Worten ergriffen wurde, von den Worten einer alten Weisheit, die den Menschen dieser Tage völlig abhanden gekommen war.
»Uns aber ist die Liebe ein heiliges Gut«, fuhr Sylvia nach kurzer Pause fort, »ein wertvoller Besitz, der das Leben der Menschen miteinander überhaupt erst möglich macht. Die Liebe – das ist der Funke des Göttlichen, der in uns wohnt und uns Wärme und Licht in gleichem Maße spendet. Die Liebe – das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Die Liebe – das ist die Sehnsucht des Menschen nach der alten Heimat, nach den Tagen der Sonne, nach der Geborgenheit in der Hand der göttlichen Allmacht.«
An dieser Stelle erhob sich Sergio. Was er und Sylvia abwechselnd gesprochen hatten, war die Einleitung des Buches. Es blieb nur noch ein Satz, der die Einleitung vollendete, und die Reihe war an ihm, diesen Satz zu sprechen. Mit volltönender Stimme rief er in die Nacht hinaus: »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.«
Neben ihm erklang leise ein uraltes Wort. Es gehörte nicht zum Text des Buches. Sylvia setzte es aus eigenem Antrieb hinzu.
»Amen ...«, hörte Sergio sie sagen.
Rückblick
Vor fünfzig Jahren – im siebzigsten Jahr des Erdumlaufs um die fremde Sonne Medaillon – hatte es erste Anzeichen der nahenden Katastrophe gegeben. Sie waren mit Staunen, aber ohne Erkenntnis der drohenden Gefahr beobachtet worden. Eine bisher ungekannte Härte hatte sich in das Verhalten der Menschen eingeschlichen. Freundschaften waren zerbrochen, Kinder hatten aufgehört, ihre Eltern zu lieben, Höflichkeit und Freundlichkeit waren zu immer selteneren Tugenden geworden. Ein neuer Menschentyp war herangewachsen: der Aphiliker, ein jeglicher Emotion bares, nur nach logischen Gesichtspunkten und den Maßgaben der Urinstinkte handelndes Wesen.
Diejenigen, die vom Verlust der Emotionalität lange genug verschont geblieben waren und Zeit gehabt hatten, sich über die seltsame Veränderung Gedanken zu machen, nannten den Zustand, der den neuen Menschen charakterisierte, die Aphilie, den Mangel an Liebe, die Lieblosigkeit. Unter Liebe verstanden sie dabei nicht die körperliche Liebe, denn die blieb, als Ausfluss eines der Urinstinkte, auch dem Aphiliker erhalten. Liebe war vielmehr die Nächstenliebe, jenes undefinierbare Etwas in der Seele des Menschen, das ihn dazu veranlasste, Dinge zu tun, die seinem Nächsten nützten, ohne ihm selbst Nutzen zu bringen.
Auf der Erde machte sich das Chaos breit. Die Wissenschaftler ermittelten bald, dass es in der fünfdimensionalen Strahlung der Sonne Medaillon eine gefährliche Komponente gab, die jede Fähigkeit des Menschen zur Nächstenliebe allmählich zerstörte. Jene, die zunächst von der Aphilie verschont blieben, gaben sich alle Mühe, die Zusammenhänge zu erforschen und einen Weg zu finden, wie sie den verderblichen Einfluss unterbinden konnten. Aber die wohlmeinenden Forscher wurden gerade von jenen in ihrer Arbeit behindert, denen sie zu helfen versuchten. Denn die Aphiliker nannten die Wandlung, die sich an ihnen vollzogen hatte, den »Sieg der reinen Vernunft«. Sie sahen sich als eine neue Art, und die Biologen unter ihnen gaben der neuen Art den Namen »homo sapientior«, der »mehr wissende Mensch«.
Das Häuflein derer, die der Aphilie trotzten, schmolz im Lauf der Jahre dahin. Ein gewisser Rest aber blieb – Menschen, denen auf Grund ihrer psychischen Konstitution die Aphilie nichts anhaben konnte. Sie wurden zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft, manche im allerwörtlichsten Sinne, wie zum Beispiel die Aktivatorträger aus Perry Rhodans unmittelbarer Umgebung. Es hatte sich rasch herausgestellt, dass der Besitz eines Zellaktivators den Ausbruch der Aphilie verhinderte. Nur eine einzige Ausnahme gab es. Alle anderen Aktivatorträger, auch Perry Rhodan selbst, waren gegen die Lieblosigkeit immun geblieben. Dann hatten die Aphiliker die Macht übernommen und Perry Rhodan und seine Mitarbeiter verbannt. Das war vor vierzig Jahren geschehen, und seitdem wusste niemand, was aus Perry Rhodan, den die Menschheit einst den Erben des Universums genannt hatte, geworden war.
Es gab auch natürliche Immune. Sie wurden von den Aphilikern verfolgt und hatten Mühe, wenigstens das nackte Leben zu retten. Gerüchte kursierten, dass die Immunen im Herzen der nur dünn besiedelten Insel Borneo eine Kolonie gegründet hatten, in der jeder Zuflucht finden konnte. Aus den Reihen der Immunen kam das Buch, hinter dem die Regierung der Aphiliker her war wie der Teufel hinter der armen Seele. Das Buch war eine Sammlung von Texten aus Zeiten, in denen die Liebe noch unter den Menschen lebte.
Mit dem Buch hatte es eine eigenartige Bewandtnis. Die Worte der Texte waren so aneinander gereiht, dass beim Lesen, mehr noch beim lauten Vortrag, von ihnen eine suggestive, nahezu hypnotische Wirkung ausging. Aphiliker, die den Worten lauschten, empfanden vorübergehend wieder Liebe für den Mitmenschen. Freilich war die Wirkung nie von Dauer. Meist erlosch sie gleich nach dem Ende des Vortrags, aber die Erfahrung war doch so berauschend, dass das Buch quasi über Nacht zu dem begehrtesten Dokument geworden war, das die Menschheit jemals hervorgebracht hatte.
Kein Wunder, dass die aphilische Regierung das Buch sofort verboten hatte. Sein Besitz war ein todeswürdiges Verbrechen, ebenso seine Herstellung und Verbreitung. Aber selbst die Androhung des Todes schreckte die Menschen nicht, das Buch zu erwerben. Es entstand ein umfangreicher Schwarzmarkt, auf dem das Buch zu Fantasiepreisen gehandelt wurde. Bis schließlich die Regierung zu einem Trick griff: Sie erzeugte selbst ein Buch mit einem Text, der dem des Buches annähernd gleich war, ohne jedoch jene suggestive Wirkung zu besitzen, die das Original so begehrt gemacht hatte.
Die Wirkung blieb nicht aus. Menschen, welche die Regierungsversion unter Lebensgefahr und zu einem astronomischen Preis erstanden hatten, fühlten sich geprellt, als sie beim Lesen des Textes keine Wirkung empfanden. Die Käufer wurden misstrauisch, der Markt schrumpfte, und schließlich kam der Handel völlig zum Erliegen. Die Regierung hatte ihr Ziel erreicht. Es war ihr zwar nicht gelungen, die echten Kopien des Buches zu erfassen, aber zumindest dessen weiterer Verbreitung war Einhalt geboten.
Zu den wenigen, die das Buch besaßen, gehörten Sylvia Demmister und Sergio Percellar. Sie waren natürliche Immune und hatten sich bis zu dem Tag, an dem sie sich im Lehrsaal einer europäischen Universität zum ersten Mal begegneten, mehr schlecht als recht durchs Leben geschlagen, Teilnahmslosigkeit heuchelnd, den göttlichen Funken der Liebe unter ausdruckslosen Mienen verbergend. Sie hatten sofort Zuneigung zueinander gefasst. Auf gänzlich altmodische und unlogische Art und Weise hatten sie sich ineinander verliebt. Sylvia besaß eine Kopie des Buches. Nächtelang hatten sie beide den Text auswendig gelernt, weil sie befürchteten, dass eines Tages ein Agent der Regierung ihr Geheimnis entdecken und das Buch konfiszieren würde. Sie prägten sich die Texte des Buches in der ursprünglichen Wortfolge so nachhaltig ein, dass sie zum festen Bestandteil ihres Bewusstseins wurden.
Als die Regierung verkündete, dass im Laufe des kommenden Jahres der Personal-Identifizierungs-Kodegeber eingeführt werden sollte, wussten Sergio und Sylvia, dass ihre Stunde geschlagen hatte. Der PIK war ein winziges elektronisches Gerät, das jeder Mensch künftig im Körper tragen musste. Er strahlte in regelmäßigen Abständen ein für den Träger charakteristisches Signal aus, und dieses wurde von den Sensoren der rund um die Erde verteilten Positroniken des Personalüberwachungssystems, PIMOS, ausgewertet. PIMOS war der Ansatz und die Grundbedingung für ein System, das der Regierung die totale Überwachung ermöglichen sollte.
Aber genau dieser Gedanke war Sylvia Demmister und Sergio Percellar unerträglich. Sie hatten längst von dem Gerücht gehört, dass im Inneren Borneos eine Kolonie Immuner existierte. Also machten sie sich auf den Weg nach Südostasien. Vor zwei Tagen hatten sie Bangkok erreicht und vierundzwanzig Stunden damit verbracht, unauffällig nach einer See- oder Luftverbindung nach Borneo zu forschen. Jeder Reisende nach Borneo war automatisch verdächtig, deshalb mussten sie höchst vorsichtig vorgehen. Aber dann hatte sich der Zwischenfall ereignet, der beinahe alles zunichte gemacht hätte.
Sylvia und Sergio waren Borneo nicht einen Schritt näher gekommen. Nun lagen sie am Stadtrand von Bangkok in einem Park, lauschten dem Rauschen der Blätter und starrten hinauf zu den Sternen des Mahlstroms.
Medaillons erste fahle Lichtfinger, die im Laub des Gebüschs funkelten, weckten Sergio. Einige Augenblicke lang lag er wie erstarrt und lauschte den Geräuschen des erwachenden Tages. Neben ihm lag Sylvia. Sie schlief noch. Er betrachtete sie mit einem Gefühl inniger Zärtlichkeit. Sylvia war nicht schön im klassischen Sinne, aber sie war dennoch eine überaus anziehende, erregende Frau. Selbst die Farblosigkeit und Monotonie der aphilischen Kleidung konnten die vollendeten Formen ihres Körpers nicht verbergen. Sylvia hatte dunkle Augenbrauen und langes, rötliches Haar. Da Aphiliker keine langen, wehenden Haare kannten, hatte sie ihren Rotschopf unter einem Band gerafft, sodass ihre Frisur dem Standard-Bubikopf entsprach. Auch die Brauen hatten ihr schon manche Schwierigkeit verursacht. Der Kontrast zum Haar ließ die Brauen gefärbt erscheinen, und da die Aphilie in ihrer nur logischen Denkweise jede Kosmetik für wertlos und dekadent hielt, war Sylvia des Öfteren darauf angesprochen worden, sie solle das Färben der Augenbrauen unterlassen.
Sylvia rührte sich. Sie schlug die Augen auf, blickte Sergio an und lächelte. Sie richtete sich zu sitzender Stellung auf und sah sich um. Medaillon stieg über den Horizont empor und tauchte die Welt in ein rotgoldenes Licht.
Sylvia reckte sich und stand auf. »Was steht für heute auf dem Programm?«, wollte sie wissen.
»Ich habe darüber nachgedacht«, antwortete Sergio. »Wir haben keine große Auswahl.«
»Also ... Trailokanat? – Traust du dem Mann?«
»Wie kann ich ihm trauen oder misstrauen, wenn ich ihn noch nie gesehen habe? Der uns in Teheran seinen Namen nannte, hat ihn als einen Mann beschrieben, der geheime Reisen nach Borneo vermittelt. Das ist alles, was ich weiß.« Sergio erhob sich ebenfalls. Mit seiner Größe von knapp einem Meter neunzig überragte er seine Begleiterin um einen ganzen Kopf. Zudem war er ausgesprochen hager, von den breiten Schultern abgesehen, mit einem schmalen Schädel, hoher Stirn, ausgeprägter Nase und einem starken Adamsapfel, der bei jeder Erregung auf und ab hüpfte.
»Am besten machen wir uns gleich auf den Weg«, schlug Sylvia vor. »Wie viel Geld haben wir noch?«
»Einundzwanzig Solar, abgesehen von der eisernen Reserve.«
»Das langt gerade für ein halbwegs anständiges Frühstück«, entschied die Frau. »Ich habe einen Bärenhunger.«
Aus dem Frühstück wurde leider nichts. In Restaurants durften sich Sergio und Sylvia nicht mehr sehen lassen, denn in jeder Gaststätte hingen wenigstens zwei Aufnahmegeräte, die den Publikumsverkehr beobachteten. Zweifellos wurden alle Gesichter inzwischen auf eine Übereinstimmung mit den Physiognomien von Sergio Percellar und Sylvia Demmister hin überprüft.
Selbst die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erschien Sergio zu riskant. Sie legten ihren Weg also zu Fuß zurück und waren dabei zu erheblichen Umwegen gezwungen, weil sie möglichst frequentierte Bereiche suchten. Nur die Anonymität der Menge bot ihnen Schutz und verbarg sie vor Ka-zwo-Robotern. Sergio wollte kein Risiko mehr eingehen. Immerhin war denkbar, dass alle Wachen inzwischen ihr Bild kannten.
Knapp dreißig Kilometer und sieben Stunden nach dem Aufbruch erreichten sie die Gegend, in der Trailokanat sein Geschäft hatte. Es lag in der nördlichen Altstadt. Die Straßen waren breit und für den Fahrzeugverkehr zugelassen. Aber die Häuser zu beiden Seiten stammten noch aus der Zeit, als das Licht von Sol die Erde erhellt hatte und die Menschen noch den göttlichen Funken der Liebe in ihren Herzen getragen hatten.
Trailokanats Unternehmen beanspruchte die obersten drei Stockwerke eines achtzehngeschossigen Gebäudes. Er war Informationsmakler, nahm Nachrichten von privaten Zuträgern auf Kommissionsbasis entgegen und gab sie an die öffentlichen Nachrichtendienste weiter. Für die Vermittlung erhielt er eine Provision. Das Geschäft des Informationsmaklers war in Zeiten, als die Menschheit noch in Freiheit lebte, recht einträglich gewesen. Heutzutage, weil die Regierung das Recht für sich in Anspruch nahm, Nachrichten zu zensieren oder ganz zu verbieten, waren die Makler Kontrollen ausgesetzt, die ihre Arbeit stark behinderten und ihre Gewinne drastisch schrumpfen ließen.
Innerhalb des großen Gebäudes herrschte nur geringer Andrang. Die beiden Besucher gelangten ungehindert bis ins siebzehnte Stockwerk und an den Empfang. Ein stationärer Roboter nahm ihren Wunsch, Trailokanat zu sprechen, zur Kenntnis und bat sie, sich zu gedulden. Erst nach Minuten öffnete sich eine Tür in der rückwärtigen Wand, und ein kleines, fettes Männchen trat heraus. Aus winzigen Augen, die hinter dicken Speckfalten fast verschwanden, sezierte es die Fremden und fragte schließlich mit heller, quäkender Stimme: »Was verschafft mir die Ehre, Bruder und Schwester?«
»Wir wollen mit Bruder Trailokanat sprechen«, antwortete Sergio.
»Der bin ich, Bruder«, keifte das Männchen. »Also ...«
Sergio biss sich auf die Unterlippe. Der kleine Fette wirkte alles andere als vertrauenswürdig. Es fiel schwer, an die nächstenliebende Selbstlosigkeit dieses Mannes zu glauben.
»Borneo«, sagte Sergio schwer. Er war fest entschlossen, beim geringsten Zögern Trailokanats mit Sylvia das Büro zu verlassen und nie zurückzukehren. Es musste einen besseren Weg nach Borneo geben als über die Vermittlung des Dicken.
Jäh richtete sich der Thai auf, sodass er eine halbe Handbreit zu wachsen schien. Der selbstgefällige Ausdruck seines schwammigen Gesichts verschwand. »Hier ist nicht der Platz, um über Borneo zu reden«, stieß er hastig hervor. »Ihr kommt am besten mit mir.«
Er führte sie durch die Tür in einen Gang, in den weitere Zugänge mündeten. Das Ende des Korridors schien aus einer soliden Mauer zu bestehen. Erst als Trailokanat unverständliche Worte murmelte, stellte sich heraus, dass die Wand in Wirklichkeit eine verborgene Tür war. Der Gang setzte sich dahinter fort und mündete nach etwa acht Metern in einen quadratischen, behaglich ausgestatteten, aber fensterlosen Raum, der von altmodischen thailändischen Lampen angenehm erhellt wurde.
Trailokanat ließ seine Besucher Platz nehmen. Er offerierte Drinks, die Sylvia und Sergio jedoch ablehnten, weil sie immer noch nicht wussten, was sie von ihm zu halten hatten, und weil es leicht war, dem Getränk eine Droge beizumischen. Trailokanat nahm die Ablehnung lächelnd zur Kenntnis. Zwar galt unter Aphilikern jedes Lächeln als Ausdruck des Mangels an rationaler Selbständigkeit, aber es gab auch regionale Gewohnheiten. Unter Asiaten war das Lächeln daher nach wie vor ein zulässiger Gesichtsausdruck.
»Ihr wollt also nach Borneo?«, eröffnete Trailokanat mit seiner unnatürlich hohen Stimme die Unterhaltung. »Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich euch dabei helfen könnte?«
»Man hat uns in Teheran deinen Namen genannt, Bruder«, antwortete Sergio.
Der Thai nickte gewichtig. »Dort gibt es eine große Kolonie der Immunen.« Plötzlich sah er auf und musterte Sergio scharf. »Ihr seid Immune?«
»Nein«, log Percellar, ohne mit der Wimper zu zucken.
Trailokanat neigte den Kopf. »Ich verstehe, dass du dich nicht preisgeben darfst, Bruder. Aber wie kannst du mir beweisen, dass du kein Agent bist?«
»Die Polizei sucht nach uns«, gestand Sergio. »Wenn du Beziehungen hast, wirst du in Erfahrung bringen, dass wir gestern aus ihrem Hauptquartier ausgebrochen sind.«
Abermals nickte Trailokanat. »Ich glaube dir sogar. Und ich werde euch helfen, nach Borneo zu gelangen. Unter einer Bedingung.«
»Und die wäre?«
»Ihr rezitiert das Buch und erlaubt mir, den Text aufzuzeichnen.«
Sergio sprang auf. »Woher weißt du ...?«, stieß er beinahe keuchend hervor. Seine Rechte zuckte zum verborgenen Strahler.
Trailokanat machte eine beschwichtigende Geste. »Errege dich nicht!«, riet er milde. »Denn durch Erregung verrätst du, dass du kein Aphiliker bist. Im Übrigen lass dich informieren, dass ich gute Beziehungen nach Teheran besitze. Ihr wurdet mir avisiert, und ich weiß, dass ihr das Buch in euch tragt.«
Sergio wandte sich mit einem fragenden Blick an Sylvia.
»Ihr müsst euch nicht sofort entscheiden«, bot Trailokanat an. »Ihr seid meine Gäste. Dieser Raum steht zu eurer Verfügung. Ich gehe und komme erst in einer Stunde zurück. Dann lasst mich wissen, wie ihr euch entschlossen habt.«
»Und wenn wir auf dein Angebot nicht eingehen?«, fragte Sylvia hastig.
Trailokanat zuckte mit den Schultern. »Dann seid ihr frei und könnt gehen, wohin ihr wollt.«
Nach fünfundvierzig Minuten angestrengten Debattierens waren Sylvia und Sergio sich noch nicht darüber einig, ob sie Trailokanat vertrauen durften. Sergio sah in dem fettleibigen Thai einen habgierigen Geschäftemacher, der sie der Polizei überantworten würde, sobald er den Text des Buches aus ihnen herausgeholt hatte. Sylvia dagegen meinte, er sei ein verkappter Immuner. Das Buch war, wenn seine Echtheit sich garantieren ließ, trotz der Maßnahmen der Regierung Tausende Solar wert. Aber selbst abgesehen von dem Wert, den die Aufzeichnung darstellte, war Trailokanat nach Sylvias Ansicht als Immuner generell an der Verbreitung des Buches interessiert.
Schließlich einigten sie sich, auf Trailokanats Angebot einzugehen. Sie würden den Text rezitieren, hier, in diesem Raum. Sergio würde dabei den Strahler schussbereit halten und beim geringsten Anzeichen für Verrat den Thai erschießen.
Auf die Sekunde genau nach Ablauf der Stunde war draußen im Gang ein Geräusch zu hören. Schlurfende Schritte näherten sich, dann betrat Trailokanat den Raum.
»Wie habt ihr euch entschieden?«, fragte er.
Sergio übermittelte ihm den gemeinsamen Entschluss.
»Ich verstehe euer Misstrauen«, antwortete der Thai, »versichere euch jedoch, dass es unangebracht ist. Trotzdem gehe ich auf die Bedingungen ein.«
Er ließ sich in einen Sessel fallen, der Sergio und Sylvia gegenüberstand. »Wollt ihr gleich beginnen?«, fragte er.
»Gibt es hier ein Aufnahmegerät?«
»Sicherlich.« Trailokanat lächelte. »Es läuft, seit ich den Raum betrat. Ihr könnt jederzeit anfangen.«
Sergio nahm den Blaster in die Hand und warf Sylvia einen auffordernden Blick zu. Die Frau lehnte sich in die weichen Polster zurück und schloss die Augen. Sekunden vergingen, dann begann sie zu summen. Es war dieselbe Melodie, die sie in der Nacht unter den Bäumen gesungen hatte.
Endlich fing sie an zu sprechen. »Nun aber hört. Da waren einst Menschen, die einander liebten ...«
20. Juli 3540, alter Kalender, allgemeine Zeit.
Im Arbeitsraum des Großadministrators, Kernzone Imperium-Alpha, leuchtete ein Hologramm auf. Perry Rhodan las:
»An Exec-1 zur Kenntnisnahme: Aufgrund der lawinenartig überhand nehmenden Gesetzesübertretungen trivialer Art hat das Amt für innere Sicherheit von seinen Vollmachten Gebrauch gemacht und über alle Regionen mit einer Bevölkerungsdichte von mehr als fünfhundert Seelen pro Quadratkilometer das beschränkte Ausnahmerecht verhängt. Künftig sind Beamte der Ordnungstruppe berechtigt, verdächtige Bürger ohne Haftbefehl gefangen zu nehmen und dem Untersuchungsrichter zu überstellen, der innerhalb von vierundzwanzig Stunden darüber zu entscheiden hat, ob die Festnahme mit oder ohne Begründung geschah.
Nach Aufforderung des Amtes für innere Sicherheit tritt in wenigen Stunden der Justizausschuss des Senats zusammen, um über eine Vorlage zu entscheiden, nach der die gesetzlichen Mindeststrafen für Trivialvergehen drastisch erhöht werden sollen.
Das Amt für innere Sicherheit weist darauf hin, dass die Lage in der Bevölkerung überaus ernst ist. Einem weiteren Ansteigen der Zahl der Trivialvergehen muss so nachhaltig wie möglich Einhalt geboten werden, oder es ist für immer zu spät.
Gezeichnet Exec-4, Galbraith Deighton.«
Eine volle Minute lang starrte Rhodan auf den Text, bis die Schrift von selbst erlosch. Die Gedanken, die ihn jetzt bewegten, waren alles andere als freundlicher Natur. Es erschien ihm, als suche eine heimtückische Seuche ihre Opfer unter den Menschen. Plötzlich waren sie wie von einer Sucht besessen, ihren Nachbarn Schaden zuzufügen. Eine nie zuvor gekannte Gehässigkeit hatte sich ihrer bemächtigt. Die Ordnungsdienste waren überlastet und konnten kaum noch allen Beschwerden nachgehen, wenn jemand aus unerfindlichen Gründen eine Schlägerei begonnen, eine Ladeneinrichtung in sinnloser Wut zertrümmert oder Ware ohne Bezahlung bezogen hatte. Ein Ungeist war in die Menschen gefahren.
Angefangen hatte es vergleichsweise mild, und zunächst waren die Statistiker überzeugt gewesen, dass sie es nur mit einer kurzlebigen Erscheinung zu tun hatten. Aber die Zahl der Trivialvergehen, wie Galbraith Deighton die Vorfälle nannte, war unaufhörlich angewachsen.
Die Wissenschaftler waren ratlos. Zu Hunderten waren die Gesetzesbrecher von medizinischen und psychologischen Spezialisten untersucht worden. Ihnen fehlte nichts, sie waren durch und durch normale Menschen – nur dass ihnen ein gewisser Maßstab plötzlich abhanden gekommen war, die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Perry Rhodan aktivierte den Rundruf: »Exec-eins an alle Execs! Angesichts der bedrohlichen Lage berufe ich eine Sondersitzung des Exekutivrats ein. Wir treffen uns um achtzehn Uhr allgemeiner Zeit am üblichen Ort. Ich erwarte vollzähliges Erscheinen.«
Wenigstens einhundert Menschen sahen den Alten stürzen. Die Situation war nicht etwa gefährlich – er lag einfach da, und das Transportband trug ihn weiter mit sich fort. Wo es zu Ende war, würde es ihn mehr oder weniger sanft auf festem Boden absetzen.
So viel Geduld brachte der Alte aber nicht auf. Sei es, dass er überhaupt nicht bis ans Ende des Bandes wollte, sei es, dass ihm seine Lage unwürdig erschien. Jedenfalls versuchte er, sich aufzuraffen und wieder auf die Beine zu kommen.
Er mochte etwa einhundertundfünfzig Jahre alt sein, wirkte gebrechlich und würde es ohne zusätzlichen Halt nicht schaffen, sich aufzurichten. Jeder Passant konnte das sehen, und er selbst wusste es ohnehin. Er wandte sich flehend an die Umstehenden, aber sie sahen über ihn hinweg, als existiere er gar nicht.
»Wenigstens einer soll mir die Hand reichen«, jammerte er. »Ihr seht doch, dass ich es allein nicht mehr schaffe.«
Die Menschen reagierten auf erschreckende Weise. Einer stieg über den Alten hinweg, um ihn nicht mehr sehen zu müssen, ein anderer wies ihn zurecht: »In deinem Alter hättest du zu Hause bleiben sollen! Erkennst du nicht, dass du den Verkehr nur ins Stocken bringst?« Und ein Dritter stieß ihm den Fuß in die Seite und schob ihn bis zum Rand des Bandes, damit er niemandem mehr im Weg lag.
Ungläubiges Staunen und Furcht paarten sich im Blick des Alten. Er konnte nicht begreifen, was mit ihm geschah. Als er erkannte, dass er keineswegs nur träumte, wurde er zornig. »Ihr Nichtsnutze!«, keifte er. »Ich gebe euch noch achtzig, neunzig, vielleicht hundert Jahre, dann seid ihr genauso wie ich. Und ich hoffe bei Gott, dass es euch ebenso dreckig ergehen wird wie mir jetzt.«
»Du versündigst dich, Alter!«, rief ein junger Mann mit gehässigem Spott. »Du rufst Gott an und denkst an Vergeltung. Das ist nicht religiös.«
»Ah, bah, religiös«, zeterte der Alte. »Dich jungen Schnösel kann ich allemal belehren ...«
Der Junge stieg ihm mit dem rechten Fuß auf den Leib, dass der Alte vor Angst und Entsetzen aufschrie. Zugleich kam Bewegung in die Menge. Aus dem Hintergrund bahnte sich ein Mann in mittleren Jahren kraftvoll und mit wenig Rücksichtnahme einen Weg durch die Meute, die den Alten umstand.
Der junge Bursche, der soeben zugetreten hatte, fühlte sich am Kragen gepackt und in die Höhe gehoben. Eine unwiderstehliche Faust zog ihn herum. Unter dem Eindruck der ihn anfunkelnden Augen verließ ihn der Mut. Er stotterte, sein Gesicht färbte sich kreideweiß.