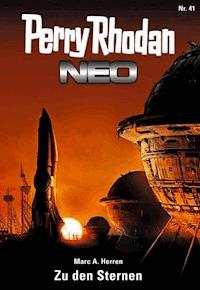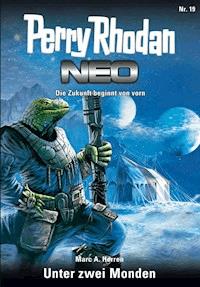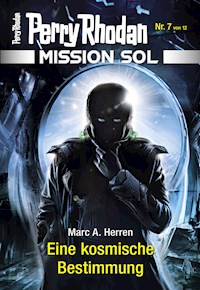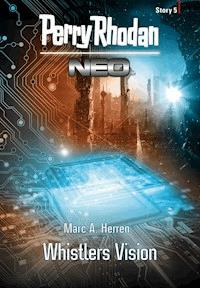Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Spätsommer 2036: Nachdem ihr Raumschiff von den Topsidern abgeschossen worden ist, stranden Perry Rhodan und seine Begleiter auf dem Planeten Ferrol. Dort werden sie getrennt. Ein Teil der Gruppe kommt in ein Gefangenenlager der Topsider; dort müssen die Menschen ums Überleben kämpfen. Auf der Erde spitzt sich die Lage mittlerweile zu. Die fremdartigen Fantan drangsalieren die Menschen - sie entführen und stehlen, was sie interessiert, und nehmen keine Rücksicht. Widerstand gegen ihre überlegene Technik scheint zwecklos. Reginald Bull, Perry Rhodans bester Freund, wird ebenfalls verschleppt. Sein erster Ausflug ins All endet in einer mysteriösen Raumstation - dort scheint die lebenslange Gefangenschaft auf ihn und seine Gefährten zu warten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Band 12
Tod unter fremder Sonne
von Marc A. Herren
Spätsommer 2036: Nachdem ihr Raumschiff von den Topsidern abgeschossen worden ist, stranden Perry Rhodan und seine Begleiter auf dem Planeten Ferrol. Dort werden sie getrennt. Ein Teil der Gruppe kommt in ein Gefangenenlager der Topsider; dort müssen die Menschen ums Überleben kämpfen.
Auf der Erde spitzt sich die Lage mittlerweile zu. Die fremdartigen Fantan drangsalieren die Menschen – sie entführen und stehlen, was sie interessiert, und nehmen keine Rücksicht. Widerstand gegen ihre überlegene Technik scheint zwecklos.
1.
Bernhard Frank
München, 9. Juli 2036
Er öffnete die Augen.
Unter ihm trieb die Erde wie ein wunderbarer blauer Edelstein in der Schwärze des Alls, das nur durch das beständige Glimmen ferner Sterne unterbrochen wurde.
Gerade schwebte er über Europa. Das Festland mit Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien mit dem charakteristischen Stiefel. Das Mittelmeer, an das sich Nordafrika anschloss, der nähere und fernere Osten, oben die britischen Inseln und Skandinavien.
Nur vereinzelt trieben Wolkenbänke über den Ländern, die er nur allzu gut kannte. Den Menschen dort unten stand ein strahlender Sommersonnentag bevor.
Bernhard Frank lächelte zufrieden.
Er besaß nicht nur in München eine Zweitwohnung, sondern auch in Hamburg, Göteborg, auf der schottischen Isle of Skye, in der Nähe von Reykjavik und in Irland. Dort nannte er ein kleines Häuschen in der Nähe der südirischen Stadt Youghal sein Eigen. Es war früher einmal von Walter Ernsting bewohnt gewesen, einem Schriftsteller, den er als Jugendlicher sehr geschätzt hatte – und es eigentlich immer noch tat.
Das am weitesten entfernte Domizil – ein stattliches Blockhaus in den Wäldern – befand sich in Kanada. Dorthin reiste er aber nur selten, da er sich am liebsten in Europa in der Nähe seiner Familie aufhielt.
Er seufzte glücklich.
Bernhard Frank hatte immer davon geträumt, die Erde als Ganzes zu sehen. Nun war auch dieser Traum in Erfüllung gegangen.
Die Erde ...
Wie viel Leben, Vielfalt, wie viel Reichtum sie doch barg.
Reichtum. Nicht das zur Neige gehende Rohöl, die seltenen Metalle und Mineralien, aus denen in erster Linie technische Spielzeuge gebaut wurden. Nein, Reichtum in Form seiner drei Töchter, die Beziehung mit seiner Frau Angelica oder einen einsamen Sonnenuntergang vor seinem Häuschen in Irland mit einem Glas Whisky.
Von hier oben konnte er fast vergessen, in welch traurigen Verhältnissen viele Menschen lebten. Wie manche aus Hass, Neid, Gier oder religiöser Verblendung alles taten, um ihre Ziele zu erreichen. Ohne Rücksicht auf andere Menschen oder die Natur. Sie raubten, zerstörten, unterwarfen – weil sie es konnten, weil sie die Macht besaßen, es zu tun.
Frank fühlte sich in erster Linie als konservativer Mensch, dem es in der Regel dann gut ging, wenn es seiner Familie und seinen Freunden an nichts fehlte. Wenn die Dinge blieben, wie sie waren – selbstverständlich einmal abgesehen von dem technischen Schnickschnack, den Reisen und den anderen Dingen, die ihm sein wunderbarer Reichtum beschert hatte.
Aber das Leid der Welt mit all den sozialen Ungerechtigkeiten, Umweltkatastrophen und sich ankündigenden Kriegen ließ ihn nicht unberührt.
Ob die Visionen eines Perry Rhodans daran etwas zu ändern vermochten?
Er vertrieb die dunklen Gedanken. Es war ein zu schöner Tag, um sich gleich nach dem Aufwachen mit schlechten Dingen zu beschäftigen.
Frank schloss die Augen. Ein paar Minuten Schlaf würde er sich noch gönnen.
In diesem Moment erklangen die ersten Takte von »Also sprach Zarathustra« von Richard Strauss. Über dem dunklen Tremolo von Kontrabässen, Fagott, Orgel und der großen Trommel erklang die Trompetenfanfare – und die Sonne ging auf. Je stärker die Musik anschwoll, desto kräftiger schien sie, schob sich hinter der Erde hervor, hinter der sie sich für das Auge des Betrachters bisher versteckt hatte.
»Guten Morgen, Brummbär!«, verkündete der Pudler.
Bernhard Frank blinzelte müde. »Wie spät ist es?«
»Sechs Uhr zwanzig«, verkündete die Stimme seines Pods vom Schreibtisch her, während die Lautstärke des Musikstücks zurückgefahren wurde.
»Du solltest mich doch erst um sieben Uhr wecken«, beschwerte sich Frank.
»Das ist mir bekannt«, antwortete der Pudler. »Aber in deinem Tagesplaner steht, dass du zusammen mit Angelica auf dem Bauernhof frühstücken willst.«
Frank gähnte. Mit beiden Händen rieb er sich über das Gesicht. Er hatte bis fast ein Uhr morgens ein Onlinegame gespielt, das auf einer deutschsprachigen Science-Fiction-Serie basierte, die er seit seiner Jugend las. Bisher hatte er es auf stolze 3908 wöchentliche Ausgaben gebracht.
Nur zu gerne hätte er ein wenig länger geschlafen.
»Ich habe dich früher geweckt, weil es auf der Schnellstraße einen Unfall gegeben hat und du über Land fahren musst, falls du den Chopper nehmen willst. Mit der Magnetschwebebahn wärst du zwar schneller, aber ich habe dafür eine geringere Wahrscheinlichkeit berechnet. Das Wetter ist ausgezeichnet heute, die Fahrt wird dir gefallen.«
»Danke!«, brummte Frank. »Das hast du gut gemacht. Aber du quasselst mir zu viel am frühen Morgen. Pass deine Einstellungen an.«
»Das werde ich machen«, versprach die Stimme des Pudlers. »Soll ich die Küchengeräte einschalten?«
»Nur die Kaffeemaschine, danke!«
Bernhard Frank überlegte kurz, ob er Angelica nicht kurz annetzen und fragen sollte, ob sie nicht anstelle des Frühstücks das Mittagessen zusammen einnehmen wollten.
Aber das war eine schlechte Idee.
Seit er nicht mehr arbeiten gehen musste und die Tage frei einteilen konnte, warf Angelica ihm mit unschöner Regelmäßigkeit vor, geschmiedete Pläne über den Haufen zu werfen, wenn es ihm gerade passte.
Es nervte ihn, aber er sah auch ein, dass sie recht hatte mit dem Vorwurf.
»Frühstück, ich komme.«
Er schwang die Beine aus dem Bett. Mit einer Handbewegung schaltete er den Samsung-Bildschirm aus, und der 3-D-Film von seinem Ausflug mit der Virgin-Space-Fähre verschwand.
Seufzend blieb er auf der Bettkante sitzen, streckte den Rücken durch und massierte sich den schmerzenden Nacken. Er sollte sich angewöhnen, beim Spielen in entspannter Haltung vor dem Kinetikpad zu sitzen. Mit seinen bald 65 Jahren war er einfach zu alt für Verspannungen und Schmerzen, für die er selbst verantwortlich war.
»Bernhard«, kam es vom Pudler. »Du solltest dich beeilen. Das Duschen und die restliche Morgentoilette dauern durchschnittlich achtzehneinhalb Minuten. Für das Ankleiden, Kaffeetrinken und das E-Paper-Lesen benötigst du bis zu zwanzig Minuten. Du musst spätestens um sieben Uhr aus dem Haus, um rechtzeitig bei deinem lieben Weib zu sein.«
Seufzend erhob er sich, packte den Pod und trottete ins Bad. »Wer hat dich bloß so katastrophal programmiert«, brummte er.
»Das warst du, wenn ich mich nicht irre«, sagte der Pod.
»Umso schlimmer.«
Er setzte den Pod in seine Wandhalterung.
»Darf es ein wenig Rockmusik sein?«
»Gerne«, antwortete Frank, während er aus seiner Unterhose schlüpfte.
»Nazareth, Guns N'Roses, Metallica?«
»Wunderbar. In dieser Reihenfolge, bitte.«
Er schob die Tür der Dusche beiseite, stieg ein und berührte die Sensoren für Wassertemperatur, Druck und Sprühbreite.
Während »Hair of the dog« durch das Badezimmer schallte, hüllte ihn eine warme Wasserwolke ein.
»Wünschst du belebende Oleate?«, fragte die Stimme des Pudlers durch den Lautsprecher des Duschrechners.
»Ja, bitte.«
Frank sagte immer »bitte«, wenn er mit dem Pudler sprach.
Seine Töchter nahmen ihn deswegen ab und zu hoch, aber das störte ihn nicht.
Den Luxus-Pod hatte ihm Mark geschenkt, als Andenken an ihr gemeinsames Abenteuer auf der Route 66. Der Pudler – eine Verschmelzung der Begriffe »Pod« und »Butler«, war eine exklusive App aus der Facebook-Schmiede, die Frank testen durfte. Sie war mit allen Nachrichtenkanälen und mit jedem einzelnen Gegenstand verknüpft, über den er verfügen durfte und der mit einem Chip versehen war.
Frank seifte sich ein, massierte das Gesicht, während Axel Roses' kräftiges Organ erklang, das den Regen im November besang.
Er grinste. Glücklicherweise fühlte sich seine Dusche mehr wie ein Sommer- denn wie ein Winterregen an.
»Es wird langsam Zeit.«
»Ja, ja, du Nervensäge«, brummte Bernhard Frank.
Er schaltete das Wasser aus und startete das Gebläse. Luftblätter strichen über seinen Körper, fuhren hoch und nieder. Zwanzig Sekunden später war er trocken.
Bernhard bürstete die Zähne, trennte sich von seinen Bartstoppeln und schlüpfte in die bereitgelegten Kleider. Er tastete die Hose ab und stellte fest, dass die Brieftasche fehlte.
»Pudler – wo habe ich meine Brieftasche liegen lassen?«
»Es tut mir leid, Bernhard«, kam die umgehende Antwort. »Aber du hast meine damalige Aufforderung missachtet und die neue Brieftasche nicht mit einem RFID-Chip ausgestattet.«
»Labertasche«, murrte Frank.
»Vielleicht befindet sie sich in deiner Hose, die du in die Reinigung gegeben hast? Soll ich dort mal nachfragen?«
»Ja, tu das«, sagte er ergeben. »Danke!«
Egal. An diesem Tag würde er seine Brieftasche nicht benötigen.
Bernhard ging mit dem Pod in die Küche, fügte ihn in die Tischplatte ein, nahm die Tasse mit dem dampfenden Kaffee aus der Maschine und griff sich das E-Paper.
»Guten Morgen, Schatz«, sagte Angelica, die am Tisch saß.
»Guten Morgen, Liebling«, gab er zurück. Frank ließ das E-Paper sinken. »Wolltest du überprüfen, ob ich rechtzeitig aufstehe?«
Sie lachte. »Ehrlich gesagt schon«, sagte sie. »Ich habe gehört, dass es einen Unfall auf der Schnellstraße gegeben hat. Da wollte ich dich kurz fragen, ob sich vielleicht deine Pläne kurzfristig geändert haben.«
Bernhard deutete auf die dampfende Tasse. »Nein, Schatz, ich genehmige mir nur einen Kaffee, dann fahre ich gleich los.«
»Dein Spielzeug hat dir in den Hintern getreten?«
Er grinste. »Der Pudler ist unschlagbar.«
»Du solltest dich von deinem Freund Mark als Werbestratege anstellen lassen.«
»Hat er mir tatsächlich schon angeboten«, sagte Frank mit breitem Grinsen. »Aber ich möchte nicht. Die Frühpensionierung finde ich nach wie vor klasse.«
Angelica nickte. »Ich gehe jetzt die Tiere füttern«, verkündete sie. »Fahr vorsichtig.«
»Mir kann nichts geschehen. Der Chopper ist frisch gewartet und mit dem Verkehrsleitsystem verbunden.«
»Ist gut. Bis gleich!«
Angelicas Hologramm verschwand.
Seit die Facebook-App Hologramm-Konferenzen erlaubte, könnten sie eigentlich jeden Morgen zusammen frühstücken – ob er nun in Deutschland, Irland, Schottland, Skandinavien oder Kanada weilte. Ab und zu taten sie dies auch, aber ein gemütliches Frühstück, bei dem man sich gegenseitig Butter und Konfitüre reichen konnte, ersetzte eine Holo-Konferenz einfach nicht.
Bernhard richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das E-Paper. Es fühlte sich an wie ein normales Stück Papier, barg aber eine ausgeklügelte Technik in seinem Innern.
Er strich über die obere Kante. Die Titelseite der deutschen Ausgabe der »Huffington Post« erschien. Es erstaunte Bernhard Frank nicht, dass sie in erster Linie über die Ereignisse in der Gobi und auf dem Mond berichtete. Der Amerikaner Perry Rhodan hatte etwas losgetreten, das eigentlich nur zwei mögliche Ausgänge nehmen konnte: das Zusammenstehen der Menschheit angesichts der Erkenntnis, nicht die Krone der Schöpfung zu sein – oder ihre Vernichtung.
Rund um die Stadt, die im Schutz von Rhodans Energieschirm entstand, versammelten sich Tausende von Anhängern, die Rhodans Vision einer neutralen Macht teilten.
»Bernhard?«
»Ja?«
»Du bekommst gleich Besuch.«
Er runzelte die Stirn. »An einem Freitag? Wer sollte das sein?«
»Deine Tochter Caroline«, sagte der Pudler. »Sie hat mich informiert, als sie ins Taxi eingestiegen ist.«
»Sie nimmt ein Taxi?«, fragte er verwundert. »Nicht den Dienstwagen? Sie arbeitet doch heute ...«
»Ich weiß es nicht, Bernhard«, sagte der Pudler. »Diese Informationen stehen mir nicht zur Verfügung.«
Bernhard Frank freute sich, seine älteste Tochter zu sehen. Gleichzeitig beunruhigte ihn dieser spontane Besuch ein wenig. Er wusste, dass sie an diesem Tag in den polizeilichen Dienstplan eingeteilt war.
Was mochte der Grund dafür sein, dass sie zu ihm kam?
Einen Moment lang gab er sich der Illusion hin, dass sie ihm verkünden würde, Mutter zu werden. Aber im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern war sie derzeit nicht in einer Partnerschaft.
Nein. Es musste einen anderen, einen ernsteren Grund geben für Carolines angekündigten Besuch.
Die Minuten zogen sich wie Kaugummi, bis endlich das erlösende Zeichen der Türklingel ertönte. Sofort riss er die Tür auf.
Caroline sah ihn einen Moment überrascht an, dann setzte sie ein breites Grinsen auf. »Hast du hinter der Tür gewartet, Paps?«
Frank nickte und umarmte seine älteste Tochter überschwänglich. Ihre fröhliche Miene hatte seine düsteren Gedanken hinweggewischt.
»He – nicht so stürmisch!«
»Verzeih, Caroline. Komm herein!«
Sie rauschte herein, schlüpfte aus ihrer Lederjacke und hängte sie an die Garderobe.
Caroline Frank, mittlerweile bereits 29 Jahre alt, war blond, schlank und sah beneidenswert gut aus. Ein wenig zu gut für Bernhards Geschmack, dem es gar nicht gefiel, dass sie sich der Bundespolizei angeschlossen hatte.
Sie hatte schon immer eine soziale Ader besessen. Bernhard hätte es lieber gesehen, wenn sie beispielsweise als Journalistin auf die Missstände der Welt aufmerksam gemacht hätte, als bei der Bupo nach vermissten Kindern und Erwachsenen zu suchen.
»Ich wollte gerade zu deiner Mutter fahren«, erzählte Bernhard. »Wir wollen zusammen frühstücken.«
»Ich weiß, Paps. Unsere Podkalender sind synchronisiert, erinnerst du dich?«
Er fuhr sich über die spärlichen Reste seiner Haare. »Ich freue mich ja, dass du hier bist – aber solltest du nicht am Arbeiten sein? Kommt die Bupo ohne dich überhaupt zurecht?«
Caroline legte den Kopf ein wenig schief, betrachtete ihn mit einem tadelnden Grinsen. »Komm, wir gehen in die Küche. Ich will dir etwas erzählen. Rieche ich da frisch gebrühten Kaffee?«
Da war es wieder, das ungute Gefühl in seiner Magengrube. »Frisch gebrüht«, bestätigte er. »Er sollte noch für zwei Tassen reichen.«
Sie gingen in die Küche. Caroline füllte seine Tasse auf und bereitete sich einen eigenen Kaffee mit Milch und Zucker.
»Die Milch läuft in zwei Tagen ab«, verkündete die Rechnereinheit des Kühlschranks. »Ich setze zwei Beutel auf die Einkaufsliste. Sie werden dir morgen Abend bis 17 Uhr zusammen mit den anderen Bestellungen geliefert.«
»Oho«, sagte Caroline. »Ein sprechender Kühlschrank. Sagt er dir auch, wenn du zu häufig naschst und der Käse Schimmel ansetzt?«
»Äh ... ja«, gab er nach kurzem Zögern zu. »Ach, Kruzifix! Was interessiert mich mein Kühlschrank? Erzähl schon, was los ist, Caro!«
»Du solltest dich vielleicht setzen.«
Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich auf einen der Stühle fallen. »Es geht doch nicht wieder um einen Auslandseinsatz der Interpol?«, fragte er. »Du weißt, dass ich kaum schlafen könnte, wenn du nun international nach Gaunern fahndest!«
Belustigt blickte sie ihn über den Rand der Tasse an. Ergeben wartete Frank, bis sie einen tiefen Schluck genommen und die Tasse abgestellt hatte.
»Du weißt, dass ich nicht in erster Linie nach Verbrechern fahnde, sondern nach vermissten Kindern und Jugendlichen«, erklärte sie mit sanfter Stimme. »Allerdings hast du nicht ganz unrecht, Paps. Es zieht mich tatsächlich ins Ausland. Aber nicht zur Interpol nach Lyon.«
Bernhard Frank kam ein furchtbarer Verdacht. Er wollte die Tasse zum Mund führen, aber seine Hand zitterte zu stark. Er setzte sie wieder ab. Ein wenig Kaffee schwappte über, lief heiß über seine Hand. Er beachtete es nicht.
»Lass deinen alten Vater nicht leiden, Caro. Erzähl mir, was los ist.«
Caroline umfasste ihre Tasse mit beiden Händen, als wolle sie sich daran erwärmen.
»Ich habe heute meinen Dienst quittiert«, sagte sie ernst. »Ich habe alle meine ausstehenden Ferientage und die Überstunden angerechnet erhalten, sodass ich bis zum Ende der Kündigungszeit nicht mehr arbeiten muss.«
Frank hielt die Luft an. Jetzt würde es gleich kommen. Ein Dolchstoß zwischen die Rippen, da war er sich sicher.
»Ich habe mich entschlossen, mich Perry Rhodan anzuschließen.«
Er ließ die angehaltene Luft entweichen. Ein seltsam hoher, klagender Laut entfuhr seinen Lippen.
Bernhard Frank hatte es geahnt. Vor seinem inneren Auge sah er die Menschen, die zwischen Rhodans Schutzschirm und den Kanonenrohren der chinesischen Volksarmee darauf warteten, in die neue Stadt eingelassen zu werden.
»Tu mir das nicht an«, sagte er. »Bitte nicht.«
Caroline beugte sich vor, ergriff seine zitternde Hand. Ihre Finger fühlten sich kühl an. Sie musste ebenso aufgeregt sein wie er, nur dass sie es viel besser verbergen konnte.
»Weshalb willst du das tun?«
»Ich denke, dass Rhodan und seine Leute jemanden wie mich gebrauchen könnten.«
»Jemanden wie dich? Wie meinst du das?«
Caroline betrachtete ihn eine Weile. »Kannst du dich an unsere ersten Ferien im Berner Oberland erinnern?«
»Zweitausendzwanzig?«, fragte er verblüfft. »Selbstverständlich. Wie sollte ich die vergessen können? Damals habe ich Elliot gefunden.«
Caroline atmete tief ein und sah ihn dabei mit diesem Gesichtsausdruck an, den sie immer dann aufsetzte, wenn sie ihn vor irgendwelche vollendete Tatsachen stellen wollte.
»Und kannst du dich erinnern, dass du immer zu mir kamst, wenn du etwas verloren hattest? Deine Schlüssel, die Fernbedienung, deinen signierten Sagan-Roman, den wir dir zu Weihnachten geschenkt hatten?«
Frank runzelte die Stirn. »Klar, weiß ich das noch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass du mir die Sachen stibitzt hast, damit du mir beim Suchen helfen konntest.«
Caroline ließ ihr glockenhelles Lachen erklingen. »Das hast du gedacht? Nun, so ist es nicht ganz gewesen. Du hast die Sachen immer selbst verloren, und ich wusste dann, wo sie waren.«
Er öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder, ohne dass er etwas gesagt hätte. Worauf wollte sie hinaus?
»Als damals Elliot Zuckerberg aus dem Internat im Berner Oberland verschwand, ging es mir wie bei deinen Schlüsseln und anderen verlorenen Gegenständen: Instinktiv wusste ich, wo er war. Das heißt, in welchem Versteck ihn die Entführer untergebracht hatten.«
Bernhard schluckte schwer. Er erinnerte sich gestochen scharf an jene Tage im Sommer 2020, die sein Leben für immer verändert hatten. Während eines Spaziergangs in den Bergen waren sie auf diese Hütte gestoßen. Caroline hatte unbedingt die Toilette aufsuchen wollen und sich standhaft geweigert, ihr Geschäft in freier Natur zu verrichten.
Die Männer in der Hütte waren ihm von Anfang an höchst verdächtig vorgekommen. Es waren Amerikaner gewesen, die ihn und Caroline mit rüden Worten weggeschickt hatten.
Eine dunkelblaue Kinderjacke hatte sein Misstrauen damals noch verstärkt. Bernhard hatte kurz entschlossen die Polizei angerufen und diese hatte – zu ihrer allseitigen Verwunderung – in der Hütte den verschwundenen Elliot Zuckerberg gefunden, den zehnjährigen Sohn des US-Milliardärs und Facebook-Gründers Mark Zuckerberg.
Das hatte ihn nicht nur über Nacht berühmt werden lassen, sondern ihn auch zu einem der reichsten Männer Deutschlands gemacht.
Ihn, Bernhard Frank, bis dahin unbescholtener Informatiker, der seinen Lohn als Technischer Redakteur verdient hatte.
Zuckerberg war so froh gewesen, seinen Sohn wiederzuhaben, dass er Frank mit einem unanständig großen Aktienpaket beschenkt und ihn in regelmäßigen Abständen zu sich nach Kalifornien eingeladen hatte.
Seither war er Milliardär, besaß Wohnungen und Häuser in all seinen Lieblingsdestinationen, hatte sich seinen Traum von der Reise auf der legendären Route 66 erfüllt – und wurde von Mark mit den neuesten technischen Gadgets versorgt.
Caroline sah ihn gespannt an.
Er sah sie verblüfft an. Dann endlich fiel er, der Groschen. Er konnte ... nein, er wollte es aber nicht glauben.
»Aber wie kann das sein?«, fragte er. »Dass wir Elliot gefunden haben, war ein riesiger Zufall! Unser Urlaub im Berner Oberland, unser Spaziergang ...«
Caroline setzte eine übertrieben unschuldige Miene auf. »... meine Verdauung, die sich genau dann beruhigt hatte, als wir bei der Hütte waren. Meine unschuldige Frage nach der blauen Kinderjacke ...«
Bernhard Frank entglitt ein leises Stöhnen. »Das warst alles du? Aber der Urlaub und dieser Spaziergang ...«
Seine Tochter lächelte. »Paps. Du solltest doch wissen, dass Töchter ihre Väter zu fast allem überreden können. Du hast schließlich drei von uns großgezogen!«
Frank sah sie an. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. »Du hast von Anfang an gewusst, dass Elliot in dieser Hütte festgehalten wird?«
»So, wie ich immer gewusst habe, wo du deine Schlüssel verloren hast«, sagte sie. »Und wie ich genau jetzt weißt, dass du deine Brieftasche suchst. Sie befindet sich übrigens im abschließbaren Fach deines Elektro-Choppers.«
Ihm klappte die Kinnlade herunter. »Aber ... aber weshalb hast du mir das nie gesagt? Weshalb hast du mich im Glauben gelassen, dass ich Elliot gefunden habe?«
»Ich war dreizehn Jahre alt. Meine Begabung machte mir damals große Angst. Ich wollte kein Freak sein, wie die Figuren aus deinen Science-Fiction-Heftchen.«
»Mutanten«, brachte er mit brüchiger Stimme heraus. »Es sind keine Freaks, sondern Mutanten.«
Caroline lächelte. »Wie auch immer. Ich benötigte einige Zeit, um mich mit meiner Gabe anzufreunden. Und mir hat es Spaß gemacht, dass du plötzlich in den Medien als Held dargestellt wurdest. Mich freute es, dass wir auf einmal so viel Geld hatten und du dir deine Träume erfüllen konntest.«
»Aber ...«
Sie ergriff seine Hände fester. Plötzlich fühlten sich ihre Finger warm und stark an. »Versteh mich nicht falsch, Paps. Für mich warst du schon immer ein Held. Und so freute ich mich, dass es die Welt ebenfalls wusste.«
Eine Träne stahl sich aus Bernhard Franks linkem Auge und kullerte über die Wange hinab. »Diese ... diese Gabe von dir ...«, begann er mit bebenden Lippen, bevor sich seine Kehle so eng verschnürte, dass er kaum noch Luft bekam.
»... ist nichts Schlimmes, Paps«, sagte Caroline. Sie erhob sich. »Ich setze sie ein, um vermisste Kinder und Jugendliche zu finden. Du glaubst nicht, wie viele Menschen ich dank meinem speziellen Sinn wieder zusammengeführt habe.«
»Und nun willst du sie für Perry Rhodan einsetzen?«, fragte Frank mit krächzender Stimme.
Caroline umrundete den Küchentisch und setzte sich auf seinen Schoß, wie sie es früher immer getan hatte.
»Vielleicht kann ich Perry Rhodan helfen, seine Vision von einer vereinten, friedlichen Erde wahr zu machen. Selbst wenn es nur ein winzig kleiner Beitrag ist. Denkst du nicht, dass ich es zumindest versuchen sollte?«
Bernhard umarmte seine Tochter, während die Tränen liefen. Sie hielt ihn fest, strich zärtlich über seinen Rücken.
2.
Reginald Bull
Schiff der Fantan
»Was ist mit ihm, Eric? Verdammt, schau nur, wie schräg sein Arm absteht. Er ist gebrochen!«
»Beruhige dich, Reg!«, gab Manoli zurück. »Lass mich arbeiten!«
»Wird er sterben?«
Manoli sah kurz auf. »Nein, Sue. Nicht, wenn ich ihn sofort und in Ruhe behandeln kann.«
Sue warf Bull einen Hilfe suchenden Blick zu. Bull legte ihr einen Arm auf die schmale Schulter. »Lass den Doc nur machen. Sid ist in den besten Händen.«
In seinem Innern fühlte Reginald Bull eine Melange aus Verärgerung, Trotz und Angst um das Leben des jungen Mannes.
Die Fantan-Krise hatte verhältnismäßig harmlos begonnen. Nachdem die Fantan keine Anzeichen gegeben hatten, als Aggressoren aufzutreten, hatten auch die irdischen Staaten den Finger wieder vom Abzug genommen. Die zylinderförmigen Außerirdischen hatten sich als kuriose Sammler von allerhand teils völlig unnützen Dingen herausgestellt.
Für die Konfrontation auf dem Schiff der Fantan war Bull davon ausgegangen, dass er die beiden Jugendlichen Sue und Sid keiner unverhältnismäßig großen Gefahr aussetzen würde.
Zumal Sid González dank seiner Teleportergabe die Funktion einer »Lebensversicherung« innehatte. Der einstmals fette Junge, den jeder Sprung Kraft und Substanz kostete, hätte sie innerhalb kürzester Zeit aus dem fremden Schiff, das den Eigennamen SREGAR-NAKUT trug, herausteleportieren können.
Dann war aber alles Schlag auf Schlag gegangen: Weil angeblich ein anderes, größeres Schiff der Fantan aufgekreuzt war, hatten die Fantan einen Notstart hingelegt. Ehe sie es sich versahen, flammte ein Energieschirm rund um die SREGAR-NAKUT auf.
Das hast du nun davon, halbe Kinder auf eine solche Mission mitnehmen zu wollen, du Esel, dachte er wütend. War ja klar, dass er früher oder später den Helden spielen würde. Jesus, Maria und Josef, macht, dass er nicht stirbt. Ich will ihn nicht auf dem Gewissen haben.
Sid »Spark« González hatte versucht, den Energieschirm mittels Teleportation zu überwinden. Bull hatte ihn zurückhalten wollen, aber wie zum Teufel stoppte man einen Teleporter, der nicht auf einen hören wollte?
Der Boden der Lagerhalle vibrierte leicht. Inmitten Hunderter unnützer Dinge, die von den Fantan als Besun bezeichnet wurden, schepperte es, als ob die Becken eines Schlagzeugs heruntergefallen wären. Irgendwo, tief im Raumschiff, dröhnten Maschinen. Riesige Energiegeneratoren, Antriebsblöcke, was auch immer.
Reginald Bull kümmerte es nicht. Egal, zu welchem Stern, in welches System die Fantan sie brachten, solange nur das Leben dieses Jungen gerettet würde.
Verdammt!
»Die Symptome sind dieselben wie bei einem starken Stromstoß«, berichtete Manoli, der neben dem Jungen kniete. Systematisch kontrollierte er Augen, Atmung und Genick. Dann riss er mit einer einzigen, entschlossenen Bewegung Sids Hemd auf. Knöpfe sprangen davon, klimperten zu Boden.
»Die Atmung hat ausgesetzt, kein wahrnehmbarer Puls«, fuhr er fort, während er mit zwei Fingern einen Punkt auf Sids Brustbein suchte, das unter einer dichten Schicht schwarzer Brusthaare verborgen war. Manolis Stimme klang kontrolliert. Keine Spur von Aufregung lag darin. »Durch das unkontrollierte Ausschlagen der Glieder hat er sich einen Arm gebrochen. Darum werde ich mich kümmern, wenn sein Herz wieder schlägt.«
Bull betrachtete Sids Brusthaare. Er hatte Sid González als halbes Kind kennen gelernt, aber der Junge war immerhin schon sechzehn Jahre alt.
Irgendwo zwischen Kind und Erwachsenem, dachte Bull erschüttert. Zwischen Mensch und Mutant, zwischen alter Welt und neuer. Und zwischen Leben und Tod.
Manoli legte beide Hände auf Sids Brustkorb, verschränkte die Finger ineinander und begann mit der Herzmassage. Gleich darauf hörte er wieder auf, tastete den Brustkorb ab. Setzte die Herzmassage fort.
Der Arzt sah auf. »Es ist ein Herzkammerflimmern, Reg«, sagte er ernst. Zu ernst.
»Was bedeutet das?«, fragte Sue.
Auf ihrem kalkweißen Gesicht schimmerte eine Schweißschicht. Unablässig fuhr sie sich mit ihrer Hand durch die Haare. Bull sah ihr an, dass sie gerne etwas getan hätte und fast verzweifelte, weil sie dazu keine Möglichkeit sah. Nicht viel anders ging es ihm.
»In Sids Herzkammern laufen ungeordnete Erregungen ab«, antwortete Manoli, ohne sein Tun zu unterbrechen. »Der Herzmuskel kann nicht mehr geordnet kontrahieren.«
»Das ist gefährlich, nicht wahr?«
Manoli stellte die Massage ein, überstreckte Sids Kopf, öffnete seinen Mund einen Fingerbreit, presste ihm die Nase zu und blies hinein. Sids Brustkorb hob sich leicht. Manoli wiederholte das Prozedere, dann führte er die Herzmassage fort.
Bull presste die Lippen aufeinander. Medizinische Soforthilfe hatte beim Astronautentraining nicht unbedingt zu seinen beliebtesten Ausbildungseinheiten gehört, aber ihre Wichtigkeit hatte er nie infrage gestellt.
Herzkammerflimmern entstand, wenn das Erregungsleitungssystem der Herzmuskelzellen aus dem Takt kam. Normalerweise gingen die Erregungen in regelmäßiger Folge vom Sinusknoten aus, von dem aus sie an die Vorhöfe und über das Erregungsleitungssystem an alle Anteile der Herzkammer weitergegeben werden. Auf diese Weise wurden alle Teile des Herzmuskels in einem sinnvollen Ablauf erregt, sie kontrahierten sich, und die Erregung bildete sich wieder zurück, sodass die Herzmuskelzellen für die neue Erregung bereit waren.
Der stromstoßartige Schock, den Sid bei seinem Sprung in den Schutzschirm erlitten hatte, hatte dazu geführt, dass die Erregungswellen unkontrolliert in verschiedene Richtungen liefen, sodass es zum namensgebenden »Flimmern« der Herzkammern kam.
Gegen Herzkammerflimmern blieb eine manuelle Herzmassage wirkungslos. Es gab nur eine Möglichkeit, wieder einen regelmäßigen Rhythmus herzustellen: durch einen erneuten Stromstoß.
»Wir müssen sofort defibrillieren!«, rief Bull.
»Wie erklären wir den Fantan, dass wir ein Gerät benötigen, das starke Stromstöße erzeugt?«, fragte Manoli.
»Wir ...« In diesem Augenblick fiel es ihm ein. Bull sah Manoli verblüfft an. Weshalb hatte er nicht schon früher daran gedacht? Er fuhr hoch. »Wir benötigen die Hilfe der verdammten Zylinder nicht. Ich weiß, wo ich einen Defibrillator finden kann. Wartet hier!«
»In Ordnung, Reg«, antwortete Manoli. »Beeil dich. Jede Minute, die wir verlieren, ist eine Minute zu viel.«
Bull rannte los.
Nun ging es um Leben und Tod. Manoli würde die Herz-Lungen-Wiederbelebung so lange fortsetzen, bis er wiederkam. Ohne Defibrillation, die den Herzmuskel zwang, sich ganzheitlich zusammenzuziehen, würde Sid dennoch sterben.
Auf so einfache Wahrheiten ließ sich das Leben manchmal reduzieren.
Während er den Korridor entlanglief, versuchte er sich genau daran zu erinnern, wo er den Wagen gesehen hatte. Der Eindruck war mehr als flüchtig gewesen. Zu viele wahllos zusammengewürfelte Dinge hatten die Fantan von der Erde mitgebracht.
Bull hatte es an ein Spiel erinnert, das sie als Kinder gespielt hatten und das das Gedächtnis hätte trainieren sollen. Ich packe in meinen Koffer, hatte es geheißen. Jemand packte einen imaginären Gegenstand in einen imaginären Koffer, der Nächste packte einen weiteren Gegenstand hinzu. Mit jedem Wechsel musste man sich an mehr Gegenstände erinnern. Und je länger das Spiel lief, desto abstruser wurden auch die Gegenstände, die in diesen Koffer gepackt wurden: Ich packe in meinen Koffer ein Hemd, eine Zahnbürste, einen Pod, einen Apfel, eine Thermoskanne ...
Und nun hieß es: Ich packe in mein Raumschiff einen Briefkasten, einen Altglascontainer, ein Fahrrad, einen Sonnenkollektor, ein Toilettenhäuschen, eine Ambulanz ...
Eine Ambulanz!
Bull hatte den weiß lackierten Kastenwagen mit den neonroten und -gelben Streifen nur kurz und undeutlich im Warenstrom gesehen. Aber er war ihm aufgefallen, und er hatte sich gefragt, ob der Krankenwagen während eines Einsatzes zu Besun geworden war und unten auf der Erde jemand deswegen in eine noch misslichere Lage gekommen war.
Skelir auf seinem fliegenden Gefährt, das an ein Motorrad ohne Räder erinnerte, kam ihm auf halbem Weg entgegen.
»Was tun Sie hier?«, rief er schon von Weitem.