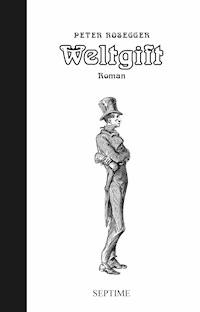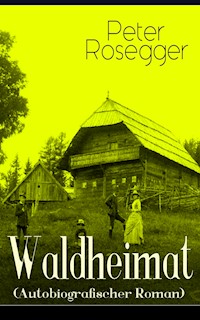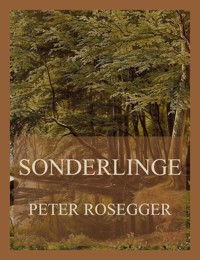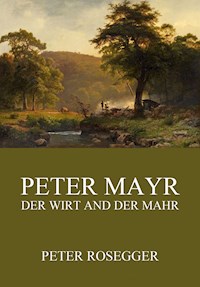
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Heldenerzählung um den Südtiroler Freiheitskämpfer Peter Mayr. Peter Rosegger war ein österreichischer Schriftsteller und Poet, der 1918 in Krieglach verstorben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Mayr, der Wirt an der Mahr
Peter Rosegger
Inhalt:
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Peter Mayr, der Wirt an der Mahr
Erster Teil
Herr, bleib bei uns!
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Napoleon Bonaparte!
Sei bereit zum Kampfe!
Wir Carl der fünffte von Gotes gnaden ...
Ihr geht zum Sandwirt!
Bei dem Faulenzen wird man verdammt müde!
Zu gratulieren ist und ich bekomme zwei Groschen!
Ich muß heim nach Tirol!
Wo ist der Hans?
Wer kauft Lämmer?
Heut' haben wir Schützentanz.
In Himmel kembts, Tiroler!
Pfaff, ich weiß was!
Mein Schwert hat ein Kreuz.
Still sei, Schurk', der du die Menschheit verläumdest!
Um Gotteswillen, Schwager, du bringst ihn doch mit!
Hanai, ein Geheimnis: du hast mich lieb!
Kein Weib wollten sie nehmen, das gelobten sie dem himmlischen Vater.
Mir brauchen enk nit!
Peter, du sollst kommen und uns regieren helfen!
Wo will das hinaus?
Die Neuigkeit wißt ihr nicht?!
Zweiter Teil.
Unrecht leiden ist sündig.
He da! Wir wirken auch Wunder!
Peter, du bist unser Vertrau! Verlaß uns nicht!
Nun liegt er zum Verschmachten auf einem kühlen Stein ...
Peter, ich hab' deinen Handschlag!
Mein' Freud' ist auf der grünen Alm!
Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit – ab!
An deiner Hausthür kannst es lesen ...
Foppen, foppen, Bayern foppen!
Mahrwirt, ich möcht' nit in deiner Haut stecken!
Was gibt's denn?
Das Kriegsgericht Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen
Ich gehe zum General!
O edle Frau, seid unsere Fürbitterin!
Franzosengeneral, gib uns unsern Vater!
Ich will nicht mein Leben durch eine Lüge erkaufen!
Peter Mayr, der Wirt an der Mahr, P. Rosegger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849653095
www.jazzybee-verlag.de
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Namhafter österr. Volksschriftsteller, geb. 31. Juli 1843 in Alpl bei Krieglach in Obersteiermark als Sohn armer Bauersleute, verstorben am 26. Juni 1918 in Krieglach. Erhielt nur den notdürftigsten Unterricht und kam, weil er für einen Alpenbauer zu schwach war, mit 17 Jahren zu einem Wanderschneider in die Lehre, mit dem er mehrere Jahre lang von Gehöft zu Gehöft zog. Dabei kaufte und las er, von Bildungsdrang getrieben, Bücher, namentlich den »Volkskalender« von A. Silberstein, dessen Dorfgeschichten ihn so lebhaft anregten, daß er selbst allerlei Gedichte und Geschichten zu schreiben anfing. Durch Vermittelung des Redakteurs der Grazer »Tagespost«, Svoboda, dem R. einige Proben seines Talents zusandte, ward ihm endlich 1865 der Besuch der Grazer Handelsakademie ermöglicht, an der er bis 1869 seiner Ausbildung oblag; später wurde ihm zu weitern Studien vom steirischen Landesausschuß ein Stipendium auf drei Jahre bewilligt. Er ließ sich dauernd in Graz nieder, wo er seit 1876 die Monatsschrift »Der Heimgarten« herausgibt, und wo der freundschaftliche Verkehr mit Hamerling, der auch seinen Erstling mit einem Vorwort in die Literatur einführte, auf seine Bildung bestimmend einwirkte. Seiner ersten Veröffentlichung: »Zither und Hackbrett«, Gedichte in obersteirischer Mundart (Graz 1869, 5. Aufl. 1907), folgten: »Tannenharz und Fichtennadeln«, Geschichten, Schwänke etc. in steirischer Mundart (das. 1870, 4. Aufl. 1907), dann fast jährlich gesammelte Schilderungen und Erzählungen, die vielfach aufgelegt wurden (meist Wien), nämlich: »Das Buch der Novellen« (1872–86, 3 Bde.); »Die Älpler« (1872); »Waldheimat«, Erinnerungen aus der Jugendzeit (1873, 2 Bde.); »Die Schriften des Waldschulmeisters« (1875); »Das Volksleben in Steiermark« (1875, 2 Bde.); »Sonderlinge aus dem Volk der Alpen« (1875, 3 Bde.); »Heidepeters Gabriel« (1875); »Feierabende« (1880, 2 Bde.); »Am Wanderstabe« (1882); »Sonntagsruhe« (1883); »Dorfsünden« (1883); »Meine Ferien« (1883); »Der Gottsucher« (1883); »Neue Waldgeschichten« (1884); »Das Geschichtenbuch des Wanderers« (1885, 2 Bde.); »Bergpredigten« (1885);»Höhenfeuer« (1887); »Allerhand Leute« (1888); »Jakob der Letzte« (1888); »Martin der Mann« (1889); »Der Schelm aus den Alpen« (1890); »Hoch vom Dachstein« (1892); »Allerlei Menschliches« (1893); »Peter Mayr, der Wirt an der Mahr«, (1893); »Spaziergänge in der Heimat« (1894); »Als ich jung noch war« (Leipz. 1895); »Der Waldvogel«, neue Geschichten aus Berg und Tal (das. 1896); »Das ewige Licht« (das. 1897); »Das ewig Weibliche. Die Königssucher« (Stuttg. 1898); »Mein Weltleben, oder wie es dem Waldbauernbuben bei den Stadtleuten erging« (Leipz. 1898); »Idyllen aus einer untergehenden Welt« (das. 1899); »Spaziergänge in der Heimat« (das. 1899); »Erdsegen. Vertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauernknechtes«, Kulturroman (das. 1900); »Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben« (das. 1901); »Sonnenschein« (das. 1901); »Weltgift« (das. 1903); »Das Sünderglöckel« (das. 1904); »J. N. R. J. Frohe Botschaft eines armen Sünders« (das. 1904; neu bearbeitete Volksausgabe 1906); »Wildlinge« (das. 1906). Diese Werke erschienen auch mehrmals gesammelt (zuletzt in Leipzig). In steirischer Mundart veröffentlichte R. noch: »Stoansteirisch«, Vorlesungen (Graz 1885, neue Folge 1889; 4. Aufl. 1907); ferner in hochdeutscher Sprache: »Gedichte« (Wien 1891), das Volksschauspiel: »Am Tage des Gerichts« (das. 1892), »Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling« (das. 1891) und »Gute Kameraden, Erinnerungen an Zeitgenossen« (das. 1893). Genaue Kenntnis des Dargestellten, Gemüt und Humor zeichnen die Erzählungen Roseggers aus; seine Stärke liegt in der kleinen Form der Skizze und kurzen Erzählung; in eine Reihe solcher hübschen kleinen Bilder zerfallen auch die besten seiner größern Romane, wie »Jakob der Letzte«, »Der Waldschulmeister«. Vgl. Svoboda, P. K. Rosegger (Bresl. 1886); Ad. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart (Dresd. 1895); O. Frommel, Neuere deutsche Dichter in ihrer religiösen Stellung (Berl. 1902); Hermine und Hugo Möbius, Peter R. (Leipz. 1903); Seillière, R. und die steirische Volksseele (deutsch von Semmig, das. 1903); Kappstein, Peter R., ein Charakterbild (Stuttg. 1904); Latzke, Zur Beurteilung Roseggers (Wien 1904).
Peter Mayr, der Wirt an der Mahr
Erster Teil
Herr, bleib bei uns!
Als in der ersten Zeit dieses Jahrhunderts unser deutsches Vaterland zerrissen und zertreten unter der Gewalt des Korsen lag, da wird wohl mancher Deutsche gegen Süden geblickt haben, wo in der Vorzeit die Helden gestanden und mit unvergänglichem Ruhme bekränzt gefallen sind. Vielleicht auch du, mein Leser, würdest als Sohn jener Tage einer von denen gewesen sein, welche ohnmächtigen Grimmes voll die geschändete Scholle der Heimat verlassen haben, flüchtend unter die heldenreifende Sonne Homers.
Und wenn du gewandert wärest gegen die sonnigen Lande, wo in ewiger Schöne die Rosen und die Palmen stehen, so hätte dich dein Weg vorher durch eine Gegend geführt, in welcher dein Herz entweder geschauert vor Grauen oder gebebt vor Wonne. Du wärest durch ein Gebirgsland gewandert, wie es herrlicher auf Erden nicht zu finden ist. Schattendämmernde Engschluchten, an den steilen Hängen Urwaldwüsten, dann stillheitere Hochthäler mit blühenden Dörfern, Pässe mit grünen blumigen Almen, ringsum im Hintergründe sich aufbauend eine Felsenwelt mit unerhörten Gebilden und leuchtenden Eisschildern, umbraut von Wolken, umkreist von Adlern. Aus der Eiswelt gehen senkrecht und silberweiß und schweigend die Wasser nieder, aber in den Schrunden ihnen nähergekommen sind sie grau wie Kalk und schreien seit unmeßbaren Zeiten ihr furchtbares Lied. Und auch weite, freundliche gesonnte Eilande gibt es und sanftere Berge mit fruchtbaren Triften, tauenden Wäldern und schimmernden Seen, in welchen sich oft an gleicher Stelle der Lorbeer und der Gletscher spiegelt. Wie schon gesagt, ringsum eingefriedet ist dieses Land, und wo aus der weiten Welt Straßen einziehen, da drohen die Lawinen, da rauschen die trotzigen Wasser hervor, als wollten sie die Brücken brechen, zurückstoßen und weit von sich schwemmen alles Fremde, das mit List oder Gewalt Eingang heischt.
Und in dieser gewaltigen Felsenburg lebt ein Volk von Bauern und Hirten, arm doch urkräftig, fromm und heiter, strenge und treu, tapfer und menschlich milde, in patriarchalischer Einfachheit und alter Sitte sich selbst genügend.
Tirol! Das schöne Land Tirol!
In jenen Tagen aber leuchteten die im Morgen- oder Abendgolde erglühenden Eisgipfel des Alpenrundes nieder auf ein geknechtetes Volk. Kühn wie seine Gemsen, seine Adler, stolz auf seine wildherrliche Heimat – und geknechtet!
Zu Innsbruck, im Herzen des Landes saß der Feind. Ein unnatürlicher Feind aus deutschem Bruderstamme, der Bayer. Diesem war im politischen Würfelspiele der Großen und durch den Machtspruch des Gewaltmenschen aus Korsika das Land Tirol zugefallen. Die Tiroler waren nicht befragt worden, ob es ihnen recht sei, so wollten sie unbefragt eine Antwort geben.
Du, der Wanderer, eilest unter Hindernissen dem Brenner zu, hinter welchem die Lüfte des Südens dich grüßen. Noch ein unheimlicher Weg dem schäumenden, rauschenden Eisack entlang durch endlose Schluchten. Allmählich aber bleiben die Schatten zurück, vor dir liegt im goldenen Sonnenschein ein breites Thal mit zahlreichen Menschenstätten, viele von diesen schon nach italienischer Bauart, dazwischen hin von grauen Steinwällen gartenartig eingefriedet die üppigen Rebengelände. Der Sohn des Nordens sieht das erste Mal den Aprikosenbaum, den schwellenden Pfirsich, im Haine den prangenden Sebenbaum. Auf den hohen, kahlen Bergen jedoch, welche in weiter Runde dieses Thales Hüter sind, liegt der Schnee – und es ist in den Tagen des August.
Mitten im Thale, vertrauend hingeschmiegt an den ungebändigten Fluß, ruht die alte Bischofsstadt Brixen mit ihren zahlreichen Klöstern und Türmen. Stattliche Bauernhöfe besäen die Gegend, auf den Hügeln stehen Schlösser und alte Burgen, in den Schluchten heimliche Klausen, an den Hängen, oft hoch an Bergesbrust, weisen der Wallfahrtskirchen spitze Türmchen himmelan. Von den Bergen eingeengt haben die Bewohner dieses Landes gelernt, an Kirchtürme sich rankend wie die Rebe an den Stab, ihren Blick aufwärts zu richten, und mit dem Blicke ihr Herz. Doch fest auf herbem Boden steht ihr Fuß und ob ihrer himmlischen Seelenheimat vergessen sie nicht dessen, was das Ihre ist auf Erden.
Wenn du von Brixen gegen Süden eine halbe Stunde lang dahin gewandert bist, so steht rechts an der Straße ein Wirtshaus. Knapp hinter demselben steigt eine rostbraune, schründige Felswand auf, die stellenweise berankt ist mit Immergrün. Ueber der breit sich hinziehenden Wand beginnt der steile Bergwald, der hoch hinansteigt bis zu den Almen des Hilm. Dem Hause gegenüber, links an der Heeresstraße, sind die buschig bewachsenen Ufer des Eisack. Hinter dem Wasser liegt das breite, wiesenreiche Thal und jenseits desselben sich gewaltig erhebend der Gebirgszug des Plossach. Vor dir, wenige Schritte vom Hause entfernt, kommt rechter Hand ein Wässerlein behendig hüpfend herab, und weiterhin auf der Anhöhe steht das Kirchlein des heiligen Jakobus. Das Haus an der Straße mit den danebenstehenden Wirtschaftsgebäuden ist im Stile südtirolischer Bauernhäuser gebaut, aus rohen Steinen gemauert, einen Stock hoch, mit einer stattlichen Fensterreihe und Erkern; das halbflache Schindeldach ist mit Steinen beschwert. An der Straßenseite sind zwischen den Fenstern auf der Mauer von unbehilflicher Hand und mit kindlichem Sinne zwei Bilder gemalt; das eine stellt die Mutter Gottes dar, wie sie, die Hände gefaltet auf der Weltkugel stehend, der Schlange den Kopf zertritt; das andere den heiligen Martinus, der auf einem Pferde reitend mit dem Schwert seinen Mantel entzweischneidet, um das losgetrennte Stück einem vor ihm knieenden halbnackten Bettelmann zu schenken. Zur Eingangsthür führen ein paar steinerne Stufen hinan, über dem Eingange in dieses Haus steht der evangelische Spruch: »Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden.«
Die Ortschaft heißt An der Mahr.
Warum ich diese Stätte so genau beschreibe? Weil ich glaube, mein Leser, daß du – nach dem Süden wandernd, um Helden zu suchen – hier Halt machen wirst auf längere Zeit. Ist doch schon die Sonne hinter das Gebirge gesunken, so daß sie dort drüben in der Stadt nur noch die goldenen Turmknäufe des Bischofsdomes bestrahlt.
In diesem Lande, in diesem Thale und endlich mit diesem Hause an der Mahr hat sich einst ein Drama abgespielt, wie es ähnlich selten sich ereignen wird auf Erden. Die Historiker haben es gewissenhaft aufgezeichnet in seinen Ursachen, in seinen Wirkungen und in seinen Einzelheiten. Tirol war ein österreichisches Land und hielt treu zum Kaiser. Da kam Napoleon der Eroberer und riß das Land von Oesterreich los, um es unter das ihm botmäßige Bayern zu stellen. Des Bergvolkes alte Sitten und Rechte wollte man brechen, seine Eigenart ihm zerstören. Dagegen haben die Tiroler sich empört. Der Heldenkampf war beispiellos und noch größer als ihr Siegen war ihr Fallen.
Diese Historie hat auch der Dichter gelesen und die Botschaft ist seither in ihm nie mehr verklungen, sie drängte fort und fort nach Ausdruck in einem Liede von dem Heldenkampf der Tiroler. Denn es war nicht ein fluchwürdiger Kampf des Angriffes und der Eroberung, es war ein heiliger Kampf der Verteidigung des Vaterlandes. Und die Helden desselben besiegten nicht bloß den äußern Feind, sie besiegten auch den innern – sie waren stark und gerecht. Germanischer Reckenhaftigkeit und Treue sind sie ein herrliches Bild, ein Vorbild für alle Zeiten. – Doch siehe, als die Dichtung sich entfalten wollte, stand die Historie ihr im Wege. Die Historie ragte so gewaltig und gebieterisch auf und dabei in ihrem politischen Geiste, in ihrer realen Gliederung so ungefüg, daß der Poet rathlos vor ihr stand. Endlich kam er mit sich dahin ins reine, daß der Dichter – wie bei allen geschichtlichen Stoffen – die profane Historie vergessen müsse, daß er warten müsse, bis die Geschichte zur Sage geworden, dann sei die Zeit gekommen, sie wieder zur Geschichte zu machen.
Ich erzähle die meine schon heute. Es soll manchmal vorkommen, daß der Dichter bei dem revolutionären Stoff selbst revolutionär wird, Berge versetzt, Zeiten verschiebt, Personen und Ereignisse umstellt. Sollte das – was ich aber schon wegen der Poetenunfehlbarkeit bestreiten müßte – irgendwo auch hier der Fall sein, so bedenke man, daß zu jedem Spiele, also wohl auch zu einem Trauerspiele, die Karten gemischt zu werden pflegen.
Unter den Tirolerhelden hat der Erzähler sich einen ganz besonderen ausgewählt und um denselben andre und andres einfach und einfältig gruppiert, vor allem eingedenk der allgemein menschlichen, der poetischen Wahrheit.
Die Erzählung beginnt zur Zeit, da Tirol zum erstenmal an das Königreich Bayern abgetreten und von diesem besetzt worden war.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Napoleon Bonaparte!
Im Wirtshause an der Mahr um einen großen Tisch sind mehrere Männer versammelt. Auf dem Tische liegt ein wuchtiger Laib Brot mit dem dazugehörigen Schnittmesser, daneben steht ein großer Zinnkrug. Jedoch die Männer gehaben sich nicht, als wären sie zusammengekommen zum Essen und Trinken. Lauter markige Bauerngestalten sind es in der malerischen Tracht: kurze braune Joppe mit roten oder grauen Aufschlägen, Knielederhosen, weiße Strümpfe, niedrige Bundschuhe. Ueber dem roten Brustfleck der grüne oder braunlederne Hosenträger und um die Mitte ein breiter Ledergurt. Mehrere haben ihre hohen Spitzhüte mit Schnur und Hahnenfeder auf. Die Gesichter sonngebräunt, knochig, bebartet, die Züge derb, die Augen feurig. Die einen sitzen bekümmert gebeugt, die andern trotzig aufrecht. Ein paar haben kurze Tabakspfeifen in der Hand, vergessen aber, sie zum Munde zu heben, denn lebhaft führen sie ein leises Gespräch, und wer mit dem Munde schweigt, der spricht mit den Augen, mit dem Neigen des Hauptes, mit dem Zucken der Hände; ganz und gar ist jeder bei der Sache, die wohl eine sehr wichtige sein muß. Während die übrigen saßen, stand einer aufrecht und stützte seine Faust an die Ecke des Tisches. Das war ein schlank, stark und schön gebauter Mensch von etwa vierzig Jahren. Sein Gesicht wies starke Wangenknochen und eine breite Stirn. Ueber dieser hingen quer ein paar rötlichblonde Haarlocken herein bis zu den runden, ziemlich tiefliegenden Augen. In diesen braunen Augen glühte ein sanftes, freundliches Feuer, das aber manchmal plötzlich aufzuckte in greller grünlicher Blitzglut. Die Nase sprang aus dem Stirnwinkel kühn hervor und ging dann in gerader Linie nieder bis zur etwas stumpfen Spitze über dem weichen, nach beiden Seiten hinaus gestrichenen Schnurrbart. Wenn er schwieg, war der Mund fest zusammengekniffen, wenn er sprach, so sah man die obere Reihe weißer Zähne. Kinn und Wangen waren glatt rasiert, nur unter den Ohren hatte er zwei Bartflöckchen. Die Züge des sonnengebräunten Gesichtes waren so, daß man immer wieder darauf hinblicken mußte. Sein Anzug unterschied sich jetzt von dem der Andern dadurch, daß er keine Joppe anhatte, sondern in bloßen weiten, aber an den Knöcheln enggebundenen Hemdärmeln war. – Vor uns steht Peter Mayr, genannt der Wirt an der Mahr.
»Verschmäht mir Brot und Wein nicht!« sagte nun dieser Mann mit etwas gedämpfter Stimme zu den andern. »Auf Körperkraft müssen wir auch denken, die werden wir wohl zu brauchen haben.«
Auf solches Wort faßte der älteste unter den Männern den Brotlaib und das Messer, machte mit der Spitze des Werkzeugs das Zeichen des Kreuzes auf das Brot und feierlich, als begehe er eine heilige Handlung, schnitt er ein Stück ab.
In demselben Augenblicke ging die Thür auf, und als sie sahen, wer da eintrat, war ihr Erstaunen groß. – Was soll das bedeuten? Ist jetzt eine Zeit für Fastnachtsscherze? Und von einem solchen Mann?
Der am Tische Aufrechtstehende that langsam ein paar große Schritte gegen den Eintretenden und fragte: »Herr Pfarrer, wie ist das zu verstehen?«
Der Angesprochene war ein Mann mit rundem Gesichte, klugen Augen, glatten Händen und trug am Leibe die Gewandung eines Hirten. An einem Fuße hatte er grobe, durchlöcherte Beschuhung, am andern war er barfuß; auf dem Rücken schleppte er einen Korb mit Kräutern, daraus ragte der rostige Stiel einer Pfanne hervor, wie solche Hirten zur Bereitung ihrer Kräutersuppe mit sich zu tragen pflegen. In der Hand hatte er einen langen Gebirgsstock.
Der hastig Eingetretene fragte den Wirt leise: »Ist es bei euch sicher, Peter? Gut, dann schließt die Thür ab.«
»Das darf ich ja nicht thun,« antwortete der Wirt. »Die Kirche kannst du freilich verschließen, Pfarrer, aber das Wirtshaus muß offen bleiben. Ist was auszumachen, so wollen wir in die obere Stube hinaufgehen. Kommt nur mit, Männer.«
Da schritten sie hinaus und stiegen die Holzstufen hinan in das obere Gelaß, wo sich einer um den andern hinsetzte auf die Bank.
»Wie sollen wir das deuten?« fragten sie den Pfarrer.
»So weit ist es gekommen,« sagte der Ankömmling und legte geräuschlos seine Sachen ab, »so weit unter dieser welisch-bayrischen Herrschaft, daß euer von Papst und Kaiser aufgestellter Pfarrer vermummt wie ein Schelm muß umherschleichen in seiner Gemeinde. Schaut nur einmal, seit heute morgen bin ich vom Freimaurerpapst zu München meines Amtes entkleidet und soll gehen, um mich vor dem Kreisrichter, diesem saubern Herrn, zu verantworten.«
»Gehst du?« fragte einer.
»Fällt mir nicht ein. Der Bayer ist nicht mein Herr.«
»Verantworten sagst du? Wofür, Pfarrer?«
»Fürs erste, daß wir in unsrer Kirche am fünfundzwanzigsten Juli das Fest des Apostels Jakobus gefeiert haben.«
»Wir sollen unsern Pfarrpatron nicht mehr verehren?« brausten mehrere auf.
»Die Feiertage sind gesetzlich abgeschafft,« fuhr der Pfarrer fort, »auch der Kirchenbesuch an den Werktagen ist abgeschafft. Höret mich nur an. Gerade vor einer Stunde ist der Klausen-Oswald nach Brixen getrieben worden, weil ihm die fremden Büttel begegnet sind, wie er im Sonntagsgewand auf dem Kirchweg ist. Heute ist, ihr wisset es, der Tag des heiligen Oswald, da hat er zu Ehren seines Namensheiligen in der Kirche ein paar Vaterunser beten wollen. Dafür sitzt er jetzt im Kotter.«
»Steht es so?« sagte einer der Männer; er flüsterte es fast und erhob sich von seiner Bank.
»Es ist wohl noch mehr,« fuhr der Priester fort. »Männer von der Mahr und von Sankt Jakob und von Schalders, ich sage es euch: Wenn wieder Winter kommt und die Weihnachtszeit, wird uns Tirolern kein Christ mehr geboren werden.«
»Wie ist das zu verstehen, Pfarrer?« fragte der Wirt an der Mahr.
Da antwortete der Pfarrer: »Es darf keine Rorate mehr abgehalten werden im Advente, kein Mitternachtsgottesdienst mehr in der Christnacht. Wegen der nächtlichen Ruhe und Ordnung, heißt es. Aber ich denke, es ist was andres, die Heiden fürchten sich vor christlichen Versammlungen. Aller Glockenklang ist verboten, aller Orgelton und aller Freudensang. Totenstill muß es werden, nur der bayrische Adler will kreischen auf den Türmen und die Freimaurer werden den Antichrist predigen und der Bonaparte wird das Jesukind aus der Krippe reißen und töten lassen, das ist der neue Herodes. Denn der Napoleon will alleiniger König sein im Himmel und auf Erden. Nur, der fünfzehnte August soll der einzige große Festtag sein, an welchem alle Völker des Erdkreises auf ihren Knieen und auf ihren Bäuchen liegen müssen.«
»Am fünfzehnten August,« sagte einer der Bauern nach. »So hält er wenigstens noch etwas auf Unsre Liebe Frau.«
»O mein Rampesbauer!« rief der erregte Pfarrer dem Manne zu, »du glaubst, weil am selben Tage das Fest Maria-Himmelfahrt ist! Das ist vorbei, mein Lieber!«
»Der Herr Bonaparte wird doch nicht mir zu Ehren den fünfzehnten August feiern lassen,« versetzte jetzt der Mahrwirt mit einiger Schalkheit. »Ich meine halt, weil das gerade mein Geburtstag ist.«
»Am Ende seid ihr Zwillingsbrüder, du und der Napoleon!« lachte der Pfarrer überlaut.
»Dafür bin ich fürs erste um ganze zwei Jahre zu alt,« sagte der Mahrwirt.
»Und fürs zweite?«
»Hätte der schon im Mutterleib seinen Bruder umgebracht,« setzte der Rampesbauer ein.
Der Pfarrer fuhr fort: »Man kann sich's überhaupt nicht vorstellen, wie dieser Tyrann vom Weibe stammen soll. So gar nichts Mildes und nichts Menschliches ist an ihm. Aber geboren wurde er doch. Leider wurde er geboren, und zwar gerade am Himmelfahrtstage. O freuet euch nur auf den nächsten Himmelfahrtstag, da werden die Glocken läuten im ganzen Land. Die fremden Söldner werden uns in die Kirchen geleiten mit aufgesteckten Bajonetten, auf dem Opfertische wird man katholische Christen ausplündern und die fromme Gemeinde wird vor seinem Bildnisse singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Napoleon Bonaparte!«
Während der Pfarrer im glühenden Zorne also gesprochen hatte, waren nach und nach alle aufgestanden und unruhig geworden. Nur Peter, der Mahrwirt, hatte seinen Gleichmut bewahrt.
»Das ist übertrieben,« sagte er, »geredet wird gar viel. Bis so etwas geschieht in Tirol, rinnt noch gar viel Wasser hinab den Eisack. Das neumodische Evangeli wird auch noch seinen Herrn finden. Wollen erst einmal hören, was die Bischöfe sagen.«
»Die Bischöfe?« fragte ihn der Pfarrer, »welche Bischöfe? – Glaubt ihr denn wirklich, ich treibe mich aus Uebermut umher wie ein Schalksnarr? Oder es wäre mir Hirn und Herz in die Stiefel gefallen, daß ich gar nicht mehr wüßte, was zu thun ist, wo ich Beschwerde führen und Zuflucht finden könnte? Wisset doch: die Bischöfe sind abgesetzt, verfolgt. Auch der unsere zu Brixen hat sich gestern ins Gebirge geflüchtet. Werden sie erwischt, so geht's ihnen wie dem heiligen Vater, den man in den Kerker geworfen hat.«
»Den Papst?«
»'s ist ihnen keiner zu hoch und keiner zu gering. Was Priester ist, wird vogelfrei.«
»Was thun sie denn, daß man sie verfolgt?« rief der Rampesbauer.
»Nicht weil sie thun, was sie thun, sondern weil sie sind, was sie sind. Darum werden sie gefangen, wenn nicht gar hingerichtet. Der Bonaparte thut Märtyrer machen, ich sage es euch!«
»Was ist das für eine Zeit!« rief der Rampesbauer und schlug die Hände ineinander, »was haben wir angestellt, daß uns Gott so verlassen kann?«
»'s ist nicht Gott allein, der uns verlassen hat!« rief einer.
»Gott und der Kaiser ist ja doch unser Erstes und Letztes!«
»Haus Oesterreich allein ist unser Schutz und Schirm,« sagte der Pfarrer, »so wie Tirol Oesterreichs Herz und Schild ist. Das gehört zusammen, solange die Berge stehen ...« Hier zuckte er mit der Stimme ab; erwartungsvoll schauten die Männer auf ihn. Der Pfarrer sagte ganz leise, aber mit einer heftigen Handbewegung: »Auf! Auf müssen wir!«
Der Wirt, der ihm stramm gegenüberstand, entgegnete gelassen: »Das meine ich auch.«
Nun schwiegen sie und standen finster da. Der Stauker aus Sarns kauerte auf der Bank, stützte seine Ellbogen auf den Tisch und über der Stirn faltete er die Hände. »Haben wir ein solches Unglück verdient?« murmelte er dann. »In Fried' und Arbeitsamkeit haben wir gelebt zwischen unseren Bergen, den Reisenden Gastrecht gewährt, den Fremden geachtet, verträgliche Nachbarschaft gehalten mit den Bayern, mit den Welschen. Und jetzt so schreckbar niedergeworfen!«
Jäh brauste nun der Wirt auf: »Dieser gottverdammte Preßburger Frieden! Es ist nicht wahr! Es gilt nicht! Denn die Bayern halten's nicht, was sie versprochen, sie halten's nicht! Männer, sie halten's nicht. – Ihr kennt die Schrift. Was steht geschrieben? Tirol soll alle Titel und Rechte haben wie bisher, und nicht anders. Den Tirolern wird Glauben und Sitte gewahrt wie bisher, ihre alten Freiheiten bleiben ihnen zu eigen wie bisher, und nicht anders. Die Tiroler marschieren nicht in fremdes Land, sie sollen sein zum Schutze ihres eigenen Landes, und nicht anders. Das, ihr Männer, steht drin, das steht in der Schrift! Erlogen ist es, und erlogen, und dreimal erlogen, was sie haben zugesagt ...«
Plötzlich brach er ab, sein Auge sprühte fast grünliche Funken, aber sein Antlitz war blaß geworden wie Lehm.
»Wir wissen es wohl,« sagte nun ein alter Bauer, »sie wollen uns hündisch machen. Schweifwedeln sollen wir vor ihnen und den österreichischen Bruder in die Waden beißen. Ja, wenn wir dumm genug wären!«
»Und schlecht genug!« setzte der Rampesbauer bei. »Das feige Luder möcht' ich kennen!«
»Unsre Freiheiten und Rechte!« lachte der alte Bauer, nicht einmal unseren Namen haben sie uns gelassen. Wir heißen Südbayern. Es gibt kein Tirol mehr!«
Hierauf sagte der Mahrwirt auf einmal wieder ganz ruhig, fast lässig: »Das wollen wir erst sehen, ob's kein Tirol mehr gibt.«
»Und für eine so schandvolle Falschheit verlangen sie von uns Treue!« versetzte der Rampesbauer. »Dieser Frieden gilt nicht. Wir sind kaiserlich.«
»Und das bleiben wir!« stimmten die andern bei. Nur der Mahrwirt schwieg, schaute finster auf die Diele nieder, und nach einer Weile murmelte er's noch einmal: »Das wollen wir sehen, ob's kein Tirol mehr gibt.«
Da war es gerade in demselben Augenblicke, daß draußen auf der Straße eine dünne schreiende Stimme daherkam.
»Wer kauft, wer kauft?« rief sie. »Schöne Kruzifixelein und Kelche! Neu und sakermentiert! Der Gnadenchristus aus der Josephikapelle um sechsunddreißig Kreuzer! Um dreißig Kreuzer schlechtes Geld! Christen, wer kauft? Und eine Monstranze, drei güldene Pfunde wiegt sie. Für fünfzig Gulden das Santissimum! Für fünfundvierzig Gulden schlechtes Geld! So viel als geschenkt! Mehr als geschenkt. Um diesen Preis – Gott wie bin ich leichtsinnig! – nur die braven Südbayern, vormals Tiroler, sollen es haben um diesen Preis. Die Bayern nicht! Frankreich und Kompanie auch nicht! Kaufet, Christen, kaufet! Was heute nicht weggeht, kommt morgen in den Schmelztiegel! Sünd' und Schade drum! Und sakermentiert! Wer kauft?«
Ein Jüdlein war's, das des Weges herangehuscht kam, im Arm das dunkelgrüne Bündel, aus welchem zwischen Tuchrändern die Hand eines Kruzifixes, die Zackenspitze einer gothischen Monstranze hervorstanden.
Die Bauern in der Stube schauten zu den Fenstern hinaus und einer von ihnen, der Stauker aus Sarns, ein hagerer, gebückter Mann, dem Haupt und Arme vor Aufregung zitterten, packte den Wirt am Gurte und sprach: »Peter, leih mir einen Stutzen! Diesen Wichtling muß ich niederlegen.«
»Den Juden?« fragte der Wirt. »Der thut ja nur, was seines Amtes ist. Was haben ihm Kruzifix und Monstranz für Bedeutung? Aber die Bayern mußt niederlegen, Stauker von Sarns. Die Bayern haben Tauf' und Chrisam in der Haut und rauben doch die Kirchen aus; nennen sich katholische Christen und verkaufen das Kreuz an den Juden. Die Bayern mußt du niederlegen, Stauker von Sarns!«
Sie gingen hinaus und schickten sich an, dem Jüdlein die Sachen abzunehmen. Dieses erhob ein klägliches Geschrei und lief die Straße zurück gegen Sankt Jakob, von woher eine Truppe Soldaten kam.
Der Rampesbauer nickte mit dem Kopf: »Sie sind schon wieder da. Hätte mich wohl gewundert, daß der Jud' in solchem Handelsgeschäft sich so weit vorwagen wollt', aber es ist halt endlich sein Messias gekommen, der Bonaparte, und der schickt ihm zu rechter Zeit die braunhoseten Schutzengel!«
»Saubere Schutzengel, die anstatt Flügeln lange Messer haben hinter den Schultern!«
»Schockel-Franz, solche Red' über heilige Sach' ziemt sich nicht!« verwies ein alter Bauer den, der das obige Wort gesagt.
»Die Bayern sind mir keine heilige Sach' und der Jud' auch nicht,« entgegnete der Schockel.
»Aber der Schutzengel soll dir's sein, wenn du nicht etwa auch schon ein Neugläubischer bist.«
Das Jüdlein hatte sich mittlerweile hinter die Soldaten verschanzt, welche mit ihm allerlei Gespötte trieben.
Die Bauern zogen sich wieder in das Haus zurück, denn es sollten an diesem Tage noch wichtige Sachen beraten und ein Beschluß gefaßt werden. Jetzt aber kam bei der hinteren Thür der Meßner von Sankt Jakob hereingeschlichen. Er hatte gehört, es sei der Herr Pfarrer im Hause. Nach dem Herrn Pfarrer sei Nachfrage.
»Ich glaub's, daß die Bayern ihm nachfragen,« sagte der Schockel-Franz.
»Nicht die Bayern!« begehrte der Meßner auf, »da möchte ich wohl nicht so dumm sein und ihn suchen helfen. Daß ich's sage: Wallfahrer sind gekommen. Ihrer etliche Frauenzimmer, vom Pusterthal her, glaube ich. Bessere Leute müssen es sein nach dem Aussehen. Heute zu Mittag sind sie angekommen. Habe sie in die Kirche gelassen, beten fleißig; haben auch schon was geopfert, glaube ich. Jetzt wollen sie halt ihre Sünden ausleeren und morgen, ehe sie wieder fortmachen, die heilige Messe hören und darauf nachher abgespeist werden. Und ist kein Pfarrer da, wo sie so weit herkommen. Davor müßt ihr euch bei den Bayern bedanken, habe ich gesagt, daß kein Pfarrer da ist, habe ich gesagt. Diese gottverfluchten Bayern! haben sie zurückgegeben und die Bayern verfluchen, das wäre keine Sünde nicht.«
»Das Fluchen hilft nichts,« sprach der Wirt.
»Aber das Beten hilft halt auch nichts, sonst müßt's schon anders sein,« versetzte der Rampesbauer. »Was hilft denn nachher?«
»Das Zuschlagen,« sagte der Wirt.
»Wenn ich ihnen den Herrn Pfarrer könnt' verschaffen,« fuhr der Meßner fort, »so wollten sie schon erkenntlich sein, haben sie gesagt. Ist recht, sage ich, will ihn suchen gehen, vielleicht finde ich ihn. Die Gegend um unsre Kirche herum ist heute frei von Unfrut, glaub' ich.«
»Ich wollt' nicht trauen!« gab der Stauker zu bedenken, »just vorhin ist ein Schwarm Bayern vorübergezogen.«
Der Pfarrer ging hervor und erklärte sich bereit, hinaufzusteigen zur Kirche. »Wo christgläubige Seelen die heiligen Gnadenmitteln verlangen, da wird der Priester nicht erst fragen, ob's den Fremden recht ist,« sagte er, »allsogleich gehe ich hinauf.«
»Und sind sie drinnen, er und die Beichtkinder, dann sperre ich ab,« beruhigte der Meßner. »Solange ich vorhanden bin, wird unserm geweihten Herrn nichts geschehen.«
»Für alle Fälle,« sagte der Wirt, »ist oben auf der Mahralm in der hintern Heuhütte Brot und Speck zu finden; auch zwei Stutzen und ein Horn Pulver.«
»Vergelt's Gott!« antwortete der Pfarrer. »Ein wenig Gottvertraun und viel Pulver, nachher wird alles recht werden.« Hierauf ging er in seiner abenteuerlichen Tracht mit dem Meßner davon.
Die übrigen Männer blieben noch beisammen im oberen Gelasse des Mahrwirtshauses und durch ihre Berathungen ging der Grundzug: Gottvertrauen und Pulver.
Sei bereit zum Kampfe!
Als die beiden Männer gegen ihren Pfarrort kamen, schlichen sie von hinterwärts durch den Schachen zur Kirche hin und in die Sakristei, wo der Pfarrer sein Hirtengewand gegen die kirchliche Kleidung vertauschen konnte. Der Meßner spähte ringsum in die Gegend aus und da er nichts Verdächtiges bemerkte, ging er in die Taberne, wo bei Brot und Wein die Wallfahrer harrten, und zeigte ihnen an, daß der Pfarrer bereit wäre, die Beichte abzuhören.
Ein alter Mann und drei stattliche Matronen waren es, die, fern aus dem Pusterthale hergekommen, um frommen Sinnes die Wallfahrt zu verrichten bei dem Bildnisse des heiligen Apostels Jakobus. Sie waren in würdiger dunkler Gewandung mit Bündeln und Pilgerstäben und um ihre knochigen, sonnenverbrannten Hände hatten sie den Rosenkranz gewunden. Zwei der Frauen hatten über das Gesicht lange Schleier, wie Klösterinnen. Der alte Mann hatte bei seiner Ankunft die bestaubten Stiefel zusammengebunden über der Achsel getragen, um in barfußem Wandern Sünden abzubüßen. Sie mußten an Seelenlast schwer aufgepackt haben, denn sie waren gar wortkarg und zerknirscht, und als jetzt die Nachricht kam, der Pfarrer sei schon bereit, schlürften sie noch rasch den Rest ihres Trunkes aus und eilten in die Kirche.
Der Priester saß, immer noch ohne ordentliche Fußbedeckung, mit Chorhemd und Stola am Leibe, im Beichtstuhl, dessen offene Vorderseite durch einen blauen Vorhang verhüllt war, und an dessen beiden Nebenseiten die mit gekreuzten Holzflechten vergitterten Fensterchen waren, durch welche das Beichtkind knieend mit dem Gesalbten, der da drinnen anstatt Gottes saß, verkehren konnte. Der Beichtstuhl war mit mancher Zierat versehen und über demselben, an der Kirchenwand, hing das Bild des heiligen Johannes, der einst von der Prager Brücke gestürzt worden war, weil er das Beichtgeheimnis nicht verraten wollte. Die Kirche atmete ihren kühlenden Weihrauchduft und es dämmerte schon, so daß man die Altäre und die zahlreichen Bildnisse nur in dunkeln Umrissen sah. Die rote Ampel vor dem Hochaltar flackerte ein wenig, weil draußen sich ein Wind erhoben hatte, der vom Etschlande kam und manchmal jetzt durch eine Fensterfuge winselnd hereinpfiff.
Die vier Wallfahrer gingen, vor lauter Demut fast schleichend, in der Kirche zwischen den Sitzstuhlreihen hin bis an den Beichtstuhl; der alte Mann ließ den Frauen den Vortritt. Während die eine Wallfahrerin schon vor dem Gitterfensterchen kniete, flüsterten die übrigen miteinander, als machten sie ihre Bemerkungen über die reiche und kunstvolle Ausstattung der Kirche, über die Darstellungen aus der heiligen Geschichte, die, wenn auch nicht mehr deutlich gesehen, doch immerhin die Bewunderung der Wallfahrer erregen mochten.
Das erste der Beichtkinder war ohne weiteres absolviert worden; es ging mit langsamen Schritten hinweg und kniete nieder vor dem Hochaltare, um im Stande der Gnade nun andächtig zu beten. Beim zweiten Beichtkinde wurde der Beichtvater laut; seine Worte waren weiterhin zu verstehen. – »Ich kann dich nur absolvieren, wenn du als Tiroler den heiligen Glauben hältst, wie es unsre Vorfahren immer gethan haben im Lande Tirol!« Die Beichtende gab das Versprechen, erhielt den Segen und kniete dann ebenfalls hin vor den Altar.
Ungewöhnlicher ging es beim dritten Beichtkinde her. Da sagte der Pfarrer ein- um das andremal: »Du mußt lauter sprechen, ich verstehe dich nicht.«
Hierauf sprach die Beichtende freilich so laut, daß es auch die andern hören konnten: »Aber mein Gewissen, Hochwürden! Wie soll ich mich denn zurechtfinden? Die Oesterreicher haben Frieden gemacht und das Tirolerland an Bayern abgetreten und der König von Bayern ist jetzt unsre von Gott eingesetzte Obrigkeit. Und in Tirol heißt's, wir sollen gegen die Bayern aufstehen und sie aus dem Lande vertreiben. Und jetzt sagt mir mein Gewissen: das ist Empörung, der von Gottes und Gesetzes wegen aufgestellten Obrigkeit sollst du unterthan sein. Jetzt, Euer Hochwürden, wie soll ich das halten?«
Darauf antwortete der Priester dann auch so verständlich: »Als die Pharisäer den Herrn versuchten, fragend, ob sie dem Kaiser die Steuer zu zahlen hätten oder nicht, antwortete er: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Ist da von einem Könige die Rede? Nein, nur von Kaiser und Gott. Auch in unserem Falle ist die Sache so sonnenklar, daß ein Zweifel dran schon an Gottlosigkeit grenzt. Der von Gotteswegen aufgestellten Obrigkeit sollst du unterthan sein. Ganz recht, wer aber ist die von Gott über uns katholische Christen aufgestellte Obrigkeit? Ist es der durch den gottlosen Empörer Bonaparte abtrünnig gewordene Bayernkönig? Nein, es ist Seine apostolische Majestät, des heiligen römischen Reiches Kaiser. Oder wem hast du den Eid geschworen? Dem Bayernkönig? Nein, dem hast du nicht geschworen. Und hättest du es thun müssen, so wäre es ein erzwungener Eid gewesen, und ein solcher gilt nicht vor Gott und gilt nicht vor dem irdischen Gesetz. Den Eid hingegen hast du geschworen bei der heiligen Taufe der katholischen Kirche, die nun von den Bayern verfolgt wird, den Eid hast du wie deine Vorfahren geschworen deinem rechtmäßigen Landesherrn, dem Kaiser Franz. Was uns Tiroler jetzt von ihm trennt, ist nicht die freie Entschließung, sondern die Gewalt Wenn der Räuber dir die Herde aus dem Stalle führt, gehört sie deshalb schon ihm? Nimmermehr, sie gehört dein und deine Sache ist es, sie mit Gewalt wieder zurückzunehmen. Ich sage dir: sei bereit zum Kampfe!«
Darauf entgegnete das Beichtkind völlig verzagt: »Ich verstehe es wohl, ich verstehe es, aber wir sind ganz ohnmächtig. Das kleine arme Tirol kann den allmächtigen Franzosen und allen andern großen Völkern, die mit ihm vereinigt sind, nicht widerstehen. Es ist ja lächerlich, wir werden zertreten wie ein Wurm.«
»O kleingläubiger Christ!« rief der Beichtvater. »Also kleinmüthig sind auch die Jünger gewesen auf dem Schifflein Petri, als der Sturm war; aber der Herr hat dem Meere geboten. Nur dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen. Hilf dir selbst, so hilft dir auch Gott!«
»Es ist alles recht, Hochwürden, aber wie angreifen?«
»Weib, du bist eins und redest auch wie ein solches,« sagte der Pfarrer und setzte leise bei: »Es wird schon vorbereitet und wir sind nicht allein. Ich sag's euch zum Troste, Oesterreich ist mit uns. Der Kaiser Franz hat uns sagen lassen, wir wären seine lieben Tiroler und würden es bleiben. Kommt's zum Kampf, so wird er da sein. Der Erzherzog Johann ist schon im Anzug mit einer großen Armee; es ist alles verabredet, sobald das Zeichen gegeben wird, geht's los. Da wird jeder Tiroler zum Stutzen greifen und zum Messer. Gott selbst hat uns das Bergland Tirol gebaut als eine unüberwindliche Feste, und wer in diesem heiligen Kampf für Gott, Kaiser und Vaterland fällt, der kommt vom Mund auf in den Himmel. Weib, wenn du einen Gatten hast, oder Kinder, oder andre, mit denen du schaffen kannst, schicke sie in den Kampf, der Herr wird mit ihnen sein. Geh selber mit, trage ihnen Erfrischung zu, lade die Gewehre, rolle Steine nieder von den Bergen auf die Heeresstraße, wo der Feind marschirt. Keiner und keine bleibe daheim, dieser Streit ist verdienstlicher als alle Wallfahrt und alle Buße. Wer in diesem Streite steht, der hat keine Sünde mehr. Weib, du kniest jetzt als arme Sünderin vor dem Priester und der spricht zu dir im Namen Gottes: Keine andre Buße und Genugthuung als die: sei bereit zum heiligen Kampfe!«
Als der Beichtvater so gesprochen, stand das Beichtkind rasch auf und gleichzeitig erhoben« sich auch jene am Altar, kamen herbei und sagten: »Wir haben es gehört. Selbst der Beichtstuhl wird benützt zur Volksaufwiegelung. Was soll es weiter, wir führen den Befehl aus.«
Der Pfarrer war nicht wenig überrascht, als er anstatt der Matronen drei wohlgerüstete feindliche Häscher, vor sich stehen sah, welche die Vermummung von sich geworfen hatten und nun den Priester aus dem Beichtstuhl rissen.
»Pfaffe, du bist uns in die Falle gegangen!« lachten sie und banden seine Hände, »du sollst es wohl natürlich finden, wenn man dich und deinesgleichen erschießen wird!«
»Ich finde es ganz natürlich,« gab der Pfarrer ruhig zur Anwort. »Und ihr müßtet es wohl natürlich finden, wenn wir katholische Priester gegen eine Gewaltherrschaft protestieren, die das christliche Gewissen so grob beleidigt, der nichts und gar nichts mehr heilig ist, die ihre Spione frevlerisch in Kirche und Beichtstuhl schickt, um die Diener des Herrn zu belauern. Erschießet mich nur. Ihr ohnmächtigen Kriegsknechte, die ihr nur den Leib töten könnt, der Geist wird euch doch besiegen, ich sage es euch.«
»Wir werden dich vor den Richter bringen,« sagte nun das alte Männlein, »dort wirst du uns alles erzählen, was du von den Vorbereitungen zum Aufstande, von den Oesterreichern und dem Erzherzog Johann weißt.«
Auf solches Wort hatte der Pfarrer nichts als ein mitleidiges Lächeln.
»Du wirst scharf befragt werden, Schwarzer!« sagte einer der Häscher.
»Ich kann mir's denken,« gab der Priester gleichmütig zur Antwort.
»Lasset das,« versetzte nun wieder der Greis. »Der Mann that, was seines Amtes war. In der Kirche, im Beichtstuhl darf er nicht anders sprechen, die fanatischen Tiroler selbst würden ihn steinigen. Außerhalb seines Amtes ist es anders, da ist er Mensch und Staatsbürger, der auch seinen und seines Landes greifbaren Vorteil nicht unterschätzen wird. Unser Herr ist nicht bloß mächtig, er ist auch gütig und großmütig. Der geplante Hochverrat muß aufgedeckt werden. Und der Seelsorger kann seiner Gemeinde keinen christlicheren Dienst erweisen, als wenn er ein Verbrechen vereitelt, das sie im Begriffe ist zu begehen.«
Nun hob der Pfarrer erregt die gebundenen Arme gegen den Sprecher und schrie: »Beschimpfe mich nicht! Ich bin ein Tiroler und ihr sollet noch erfahren, was das heißt.«
Auf dem Turme schlug die Glocke an in heftigen, unregelmäßigen Schlägen. Der Meßner hatte die Gefahr bemerkt und läutete Sturm. Als die Häscher mit ihrem Fang zur Kirche hinaus wollten, war das Thor verschlossen. Draußen tobte der Lärm nahender Bauern, denen der Meßner vom Turme herab mittheilte, daß der Pfarrer von Spionen gefangen sei und daß mitsammt dem Pfarrer auch diese in der Kirche glücklich gefangen seien.
Drang ein wildbärtiger Bursche vor und führte mit seinem Knüttel einen Schlag gegen das Kirchenthor. Der Schlag wurde von innen heftig erwidert. Das Thor gab keiner Seite nach und nun entspann sich folgende Verhandlung.
»Macht auf, im Namen des Königs!« schrieen sie drinnen.
»Aufmachen? Das werden wir schon gewiß nicht thun,« sagten sie draußen.
»Wenn ihr nicht öffnet, so machen wir euern Pfarrer auf der Stelle kalt,« schrieen sie drinnen.
»Dann werdet ihr die warme Sonne nimmer sehen,« sagten sie draußen. »Wohlfeil geben wir unsern Pfarrer nicht.«
Als die Häscher merkten, es wären ihrer draußen viele und die Gefahr nicht gering, riefen sie: »Wenn ihr das Thor öffnet und ruhig eures Weges geht, so soll der Pfarrer wieder euer sein.«
Und von draußen: »Wir glauben euch nichts. Wer vermaschkeriert wie ein Komödiant in Häuser und Kirchen einschleicht und in Altweiberkittel kriecht, um ehrliche Leut' zu überlisten, das ist ein Schelm und dem glaubt man nichts.«
Hierauf von drinnen: »Das wäre auch was Neues, daß der Tiroler keinen Spaß verstünd'! Machet nur auf, wir gehen als gute Freunde auseinander.«
Und nun rief von innen der Pfarrer: »Machet nicht auf, Leute, sie haben Waffen und würden euch niedermachen. Mir kommt bei dieser Zeit das Sterben nicht sauer an und meine Haut ist jetzt vier Feinde wert.«
»Wir werden ihm das Sterben schon sauer machen,« setzte drinnen einer der Häscher bei.
»Thut es nur,« rief einer von draußen, »wie ihr ihm, so wir euch!«
Mittlerweile hatte der Meßner vom Turmfenster den Schlüssel herabgeworfen. Während einer der Bauern den Schlüssel ins Loch steckte, stellten sich die andern sechs oder sieben mit ihren Knitteln und Hacken hart an die Thür, um sofort einzudringen, die Feinde niederzumachen und den Pfarrer zu befreien. In demselben Augenblick knallte ein Schuß und der bärtige Bauernbursche sank lautlos nieder an der Kirchenwand.
Vom Thale herauf rückten Truppen, da meinten die Bauern, sie wollten sich auf etwas Besseres sparen, als hier niedergepfeffert zu werden, und der Pfarrer hätte doch nichts davon. Sie eilten hinterwärts der Kirche den Berg hinan, nachdem einer noch den Kirchenschlüssel aus dem Schloß gerissen und zu sich gesteckt hatte. Die anrückenden Soldaten schleuderten den Toten beiseite, brachen das Thor auf unter dem Jubel der »frommen Wallfahrer« drinnen, und der würdige Pfarrer, zu halb noch im Hirtenkleide und zu halb im kirchlichen Gewand, wurde davongeschleppt und entgegengeführt dem Gerichte. Der Meßner blickte vom Turmfenster aus dem Zuge nach, dann. Hub er an zu läuten, als ob es ein Leichenzug wäre ...
Wir Carl der fünffte von Gotes gnaden ...
Im Wirtshause an der Mahr war Sonntagsruhe. Peter war nicht mit den andern hinaufgestiegen in das Gebirge, wo in einer versteckten Felsschlucht auf Scheiben geschossen wurde. Jung und alt wollte sich im Schießen üben, allein das war schwer verboten, die Bayern hatten alle Schießstände aufgehoben im Eisackthale und weiter um, hatten alle Schießgewehre weggenommen, die sie an den tirolischen Jägern und in den Häusern gefunden. Was sich aber in den schwer zugänglichen Gebirgswinkeln barg und vorbereitete, das sahen, hörten und ahnten sie nicht.
Peter, der Mahrwirt, brauchte sich im Schießen nicht erst zu üben. Also war er nach dem Nachmittagsgottesdienste heimgegangen in sein Haus und hatte sich dort auf die Familienstube zurückgezogen im ersten Stock. Das Wirtszimmer konnte wohl eine Kellnerin besorgen; der gewöhnliche Straßenverkehr hatte abgenommen, seit es wieder so unruhig ward im Lande.
Draußen sauste ein Gewitterregen nieder, Peter hatte ein viereckiges Kistchen hervorgeholt, stellte es auf den Tisch, setzte sich davor in seinen ledernen Lehnstuhl und sagte mit einem Tone des Behagens: »Endlich kann man wieder einmal daheim sein. In solchen Zeiten gehört der Mann kaum mehr der Familie, noch weniger sich selber.«
»Ich merke es wohl,« antwortete sein Weib, das nicht weit von ihm saß und ein Knäblein auf dem Schoß hatte. Es war ein schönes, blondes, noch jugendliches Weib; ihr rundes Gesicht neigte sie nieder auf den Kleinen, ein Menschenknösplein, das gerade im Einschlummern war. Um ihr Haupt hatte sie einen geflochtenen Haarkranz schlicht geschlungen. Das einfache Hausgewand, welches sie anhatte, gewann Licht und Blüte durch ein Busentuch aus roter Wolle, welches sie nur an Sonntagen zu tragen pflegte. Zu Füßen der Mutter saß ein kleines Mädchen, aus dessen Blauäuglein lautet Träumerei und Sanftmut schaute. Es saß ruhig da und betrachtete ein Sträußlein von blauen Blumen, die es im Händchen hatte und über welches ein braunes Käferlein lief. Weiterhin auf den weißgescheuerten Dielen hockte ein größerer Knabe, eben beschäftigt, mit Holzstücken und Schulbüchern eine Festung zu bauen. Dieser blickte auf den Vater hin, und als er sah, daß derselbe sich ein wenig in seinen Sessel zurückgelehnt, fragte er: »Willst du schlafen, Vater, so werde ich hinausgehen?«
»Bleib, Hans, und baue weiter an deiner Zwingburg,« versetzte Peter, denn er war froh, endlich wieder einmal alle beisammen zu haben. Wer weiß, wie bald es anders wird. Er lehnte sich mit geschlossenen Augen ein wenig zurück, weil sein Weib mit ihren Fingern sanft sein Haar streichelte, als wollte sie den Alten einschläfern, wie sie es dem Jungen gethan hatte.
Peter hob aber ein bißchen sein Augenlid und sagte zu seinem Weibe: »Nun, Notburga, wie denkst du über einen solchen Mann? Sollte Kugeln gießen und läßt sich das Haar strählen wie ein Frauenzimmer.«
»Gönne dir das bisset Ruhe, Peter,« antwortete sie, ohne weiter auf den Scherz einzugehen, »es ist ja ohnehin so selten, daß wir dich haben.«
»Von Samson steht zu lesen, daß seine Schwäche im Haar gelegen ist,« sagte er und richtete sich auf. Dem Knaben schaute er nun zu bei seinem Festungsbau. Als Hans damit fertig war und die Bücher und Holze als Mauern zwei- und dreifach dastanden, umgeben von Schanzen und Türmen, stellte er auf die Mauern eine Reihe grauer Steinchen, das waren die Knappen; hinter diesen auf höhern Zinnen eine Reihe weißer Kiesel, das waren die Ritter. In eine Ecke der Festung that er ein glänzendes Stück Küchenruß, das vom Rauchfang herabgefallen war, solches stellte den Burgkaplan dar. Und mitten in die Burg legte der Erbauer eine Pflaume hinein.
»Was soll denn die vorstellen?« fragte der Vater.
»Das ist die Katharina,« antwortete der Knabe.
»Wohl vom Herzen kindisch ist er noch,« lachte die Mutter.
»Gottlob!« sagte Peter. »Wer lange Kind bleibt, bleibt auch lange Mann. – Nur möchte ich wissen,« wandte er sich an den Knaben, »was die Katharina in der Festung, zu thun hat.«
»Die Katharina Maultasche hat ja in der Burg Tirol gewohnt,« antwortete Hans. »Und unser Lehrer hat erzählt, die Bayern hätten sich dazumal Tirol von Oesterreich mit Geld abkaufen lassen. Nachher hat sie's aber gereut und haben das Land wieder zurückhaben wollen. Aber die Katharina hat gesagt: Wer uns für Geld verkauft, der soll die Schläge umsonst haben. Dann hat sie dreingeschlagen und ist österreichisch geblieben.«
»Siehst du,« sagte Peter leise zu seinem Weibe, »im Spiel ist Wahrheit.«
»Nur wird das alte Schloß Tirol nicht mit Schulbüchern erbaut worden sein,« meinte Frau Notburga, »Ich denke, Hans, du wirst die Mauern wieder abtragen und aus den Bausteinen deine Schulaufgaben lernen.«
Der Knabe machte ein mißmutiges Gesicht. Das Auswendiglernen des Katechismus war so wenig nach seinem Sinn, wie das Sitzen in der Schulbank. Mit hilfesuchenden Augen schaute er auf den Vater hin.
»Ja, ich kann dir aber auch nicht helfen,« sagte Peter, »der Mensch ist ein Soldat und der Soldat muß exerzieren. Nicht allein mit Säbel und Gewehr, auch mit Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Bayern und Franzosen waren uns vielleicht nie hereingekommen ins Land, wenn sie nicht besser lesen, schreiben und rechnen konnten, als wir Tiroler. »Es stimmt gar nicht so schlecht, wenn man sagt, die Festungen müssen wir mit Schulbüchern aufführen.«
Der Knabe nahm eines der Bücher und ging ans Fenster, wo er sich anschickte, seine Aufgabe zu machen. Peter öffnete sein Kästchen. Das war klein, aber aus braunem Holze fest gefügt, hatte ein Stahlschloß und war an den Ecken zierlich mit Messing beschlagen. Es waren Schriften drin, in welchen der Mahrwirt nun anhub zu kramen. Ein vergilbtes Blatt nahm er zuerst hervor, entfaltete es und begann bei sich Halblaut zu sagen: »Unter freiem Himmel ein freies Haus. Nicht Feste und doch Burg: die Dachtraufe des Hofes Wall und Graben, den kein Fremder bewaffnet überschreiten darf. ...«
»Was liest du dort, Peter?« fragte Frau Notburga.
»Das ist der Ehehaft-Taidling-Brief von meinem Heimatshause, dem Kohlhof auf dem Ritten,« antwortete Peter. »Mein liebes Weib, in Tirol war einmal eine andre Zeit, als heute.« Er nahm einen zweiten Bogen hervor: »Hier ist der Adelsbrief derer von Mayr. Er wurde uns ausgestellt von Kaiser Karl dem Fünften, im Jahre 1555, Hans, komm einmal her, kleiner Bauerngraf du! Hier ist unser Wappen: Ein Löwe mit der Hellebarde.« Und in der That war dem Kleinen diese Sache von größerem Interesse als sein Schulbuch, er begann den Adelsbrief zu lesen: »Wir Carl der fünffte von Gotes gnaden Römischer Kayser, zu allen Zeiten merer des Reichs, Kinig zu Germanien, zu Hispanien, baider Sicilien, Jerusalem, Hungern etc. – Bekhennen öffentlich mit diesem Brief vnd thuen khund allermeniglich: Wiewol wir aller und jeglicher unserer und des heiligen Reichs Undterthanen und getreuen Ehre, nuz und bestes, zu betrachten vnd zu fürdern genaigt, So sein wir doch mer bewegt zu denen, die sich gegen uns und dem heiligen Reiche in getreuem, willigern gehorsam hatten und beweisen, sy mit Unseren Kayserlichen gnaden zu begaben und zu fürsehen; wenn wir nun goettlich angesehen und betracht, sollich Erbarkhait, Redlichkheit, guet Sitten, tugend und vernunfft, damit unsere und des Reichs lieben getreuen Hanns, Melchior und Caspar die Mayr Gebrüder, vor unserer Kayserlichen Majestät berüembt werden, .... darumb so haben wir mit wohlbedachtem Muet, guetem Rath und rechtem wissen den ... Mayrn Ihren Eelichen Leibs Erben vnd derselben Erbens Erben, für und für ewige Zeiten dies Wappen Clainot verliehen ...«
Die Augen des kleinen Hans leuchteten, als er solches verständig las, aber auch die des Mahrwirts schauten nicht schläfrig, als er seine Hand nun auf die Achsel des Sohnes legte.
»Jetzt will ich's doch gleich in der Schule dem Lehrer sagen, daß wir von Adel sind!« rief der Kleine.
»Nein, Hans,« lachte Peter, »das brauchst du nicht zu sagen – bloß zu beweisen. Und jetzt kannst du wieder zu deinem Buche gehen.«
Der Knabe nahm sein Buch und ging hinaus.
Der Mahrwirt hob ein weiteres Blatt aus dem Kästlein. »Notburga,« sagte er, selbes seinem Weibe hinhaltend, »kennst du das? – Das ist die schwere Kette, unter der wir zwei gar so hart keuchen,« setzte er schalkhaft hinzu, denn es war der Eheschein des Peter Mahr, dazumal Besitzers des Wirtshauses zum weißen Kreuz bei Klausen, und der Notburga Fuchs, eheleiblichen Tochter des kunstreichen Herrn Franz Fuchs, Orgelmachers und Organisten zu Gries.
Als Peter das Blatt umwendete, sagte er: »Mein Gut ist dein Gut.«
»Das brauche ich ja nicht alles zu wissen,« entgegnete Frau Notburga.
»Du sollst es nicht vergessen,« versetzte Peter, weitere Papiere aus dem Kästlein hebend. »Dahier ist der Kaufbrief von unserm Mahrwirtshause. Es ist bis auf den letzten Heller bezahlt. Dahier ist eine Schuld von sechsundzwanzig Gulden an den Pferdehändler Kilian. Er ist in Welschland verstorben, seine Erben weiß ich nicht, aber wenn sie vorkommen, so gebührt ihnen das Geld. Es ist der Rest für ein gekauftes Pferd, welches den Dampf gehabt hat. Wenn der Dampf in Jahresfrist gut wird, habe ich sechsundzwanzig Gulden nachzuzahlen versprochen. Sonst ist keine Schuld.«
»Warum kommst denn auf solche Sachen, Peter?« fragte ihn Frau Notburga.
»Weil es gut ist, Weib, wenn du von allem weißt. Die Zeiten sind unsicher. Und da mußt du auch noch herschauen.« Er nahm ein flaches Ledertäschchen, schlug es auf, und da drin lag eine Tausendguldennote. »Das ist der Notpfennig. Ich will das Täschlein unter einer Dachschindel verstecken und du sollst dabei sein. Das Kästel mit den Papieren werden wir draußen an der Felswand vermauern.«
»Um Gotteswillen, Mann, steht es denn so schlimm?« fragte erschrocken Frau Notburga.
Peter legte seinen Finger an den Mund und sagte leise: »Vor dem Eheweib machen wir kein Geheimnis mehr. Wir sind bereit, warten nur noch auf einige Botschaften.«
Sie schwieg. Draußen im Bodengelasse war plötzlich ein greller, kurzgebrochener Schrei. Frau Notburga legte das schlummernde Kind in das Bett und ging hinaus. Hanai die Magd stand da und lachte. »Wie ich aber jetzt erschrocken bin!« rief sie lachend und wies mit beiden Zeigefingern gegen den dunklen Wandwinkel hin. Dort stand, auf einen langen Feuerhaken gestützt, starr und stramm eine Gestalt, welche von den scharfen Augen der Frau Notburga bald erkannt war als der Knabe.
»Was bedeutet das, Hans?« fragte sie scharf.
Hans gab zur Antwort: »Der Löwe mit der Hellebarde.«
Ihr geht zum Sandwirt!
In denselben Tagen war es, daß eines Abends vor dem Wirtshause an der Mahr neben der Holzplanke, wo die Pferde angehängt zu werden pflegten, ein fremder junger Mensch saß. Er hatte graue, staubige Kleider an und über der Schulter ein Ledertäschchen hängen; die Stiefel machten bei den Zehen ihre Schnäbel auf, wie zwei hungrige Krokodile. Das Gesicht war blaß und eingefallen, den üppigen braunen Haaren und dem Schnurrbärtchen sah man an, daß sie gepflegt wurden. Der Fremde saß zusammengekauert auf einem Stein an der Mauer und schien sehr erschöpft zu sein.
Die Kellnerin kam heraus und fragte ihn, was er schaffe.
Der junge Mensch schüttelte müde sein Haupt – er schaffe nichts.
Als später der Wirt das Hausthor schloß, saß der Fremde noch immer da. Also ging Peter mit der Laterne zu ihm und fragte: »Was ist's denn mit Euch? Da könnt Ihr doch nicht sitzen bleiben über Nacht.«
Der Fremde war bei dieser Anrede aus dem Halbschlummer aufgefahren und schaute betroffen auf den Mann, der ihn von dieser Ruhestätte verscheuchen wollte.
»Seid Ihr krank?« fragte ihn der Wirt.
Der Fremde schüttelte das Haupt.
»Warum geht Ihr nicht ins Haus? Wir haben ja Betten. Und solltet auch was essen.«
»Ich danke,« antwortete der junge Mensch. »Ich kann wohl auch im Freien schlafen.«
»Im Freien? Es ist jetzt nicht gesund im Freien, und Ihr scheint mir nicht der Stärksten einer zu sein. Geht nur mit ins Haus.«
Nach einigem Zögern gestand der Fremde, er hätte nicht viel Geld bei sich. Da lachte der Wirt, nahm ihn am Arm und führte ihn in die Stube. Dort ließ er ihm etwas zu essen und zu trinken vorsetzen; der Gast genoß nur wenige Bissen und dabei fielen ihm schier die Augen zu. Peter brachte ihn in eine kühle Dachkammer, wo ein reines, hochgeschichtetes Bett stand, stellte dort die Kerze auf den Tisch und sagte: »Ruhet Euch nur aus. Gute Nacht.«
Am nächsten Morgen, als der Fremde gefragt wurde, was er zum Frühstück wünsche, begehrte er allein mit dem Wirte sprechen zu können. Er sah heute viel frischer aus als gestern und sagte, als er vor dem Mahrwirte stand: »Geruht hätte ich sehr gut und möchte mich nun wieder auf die Wander machen, aber in einer Verlegenheit bin ich. Bezahlen kann ich jetzt nicht.«
Peter hielt seine Arme über die Brust gekreuzt, wie er gerne that, schaute fast ernsthaft auf den jungen Mann und sagte hernach: »Was glaubt Ihr denn eigentlich von mir? – Um Gottes willen, ist denn das ein Spottwort? Wenn heute der Herr Jesus bei mir einkehrt, daß er sich in der Pilgerfahrt auf Erden ein wenig labe und ausruhe in meinem Haus: wird er beim Fortgehen in seinen Hosensack greifen, den Geldbeutel herausziehen und fragen: Wirt, was bin ich schuldig? Und werde ich mir fünf bayrische Groschen vorzählen lassen? – Seid nicht kindisch.«
Antwortete der Fremde nicht ohne Schalkheit: »Ich bin halt nicht der Herr Jesus und Ihr seid ein Wirt an der Straßen, wo man gewöhnlich alles eher bekommen kann, als eine geschenkte Zeche.«
»Woher und wohin denn die Reise, wenn man fragen darf?«
Der junge Reisende zuckte die Achseln: »Mir geht's halt auch nicht viel besser wie vielen andern.«
»Setzt Euch nur noch einmal nieder und erzählt mir Euer Anliegen. Ich glaube nicht, daß Ihr auf einer Vergnügungsreise seid.«
»Das wahrlich nicht. Mein Name ist Joseph Dürninger, bin ein Student aus Innsbruck. Mein Vater, ein Bürger dort, hat mit den Franzosen Händel gehabt; darauf hat der General Dittfurt unser Vermögen eingezogen, so daß ich meine Studien nicht mehr fortsetzen kann. Meinen Vater wollten sie hängen, aber fast vom Stricke weg hat ihn der Bauer Speckbacher entführt. Jetzt sind sie alle, auch eine Mutter habe ich noch und drei Geschwister, ins hintere Pitzthal geflohen. Ich will ihnen nach.«
»Das ist aber nicht der Weg in das hintere Pitzthal,« bemerkte der Wirt.
»Ich will jetzt nach Bozen.«
»Was wollt Ihr denn in Bozen?«
Nun zögerte der junge Mann mit der Antwort. »Ihr wollt mit der Sprache nicht heraus,« sagte Peter, »da kann ich mir's schon denken. Ihr geht zum Sandwirt!« Dörninger langte schweigend nach des Wirtes Hand; dieser reichte die Rechte hin und achtete auf die Lage des Mittelfingers. Die beiden Tiroler schauten sich fest ins Auge und verstanden sich.
»Der Sandwirt ist jetzt in Bozen, das hat mir Freund Eisenstecker geschrieben,« sagte der Mahrwirt. »In Bereitschaft wäre alles, aber die Stunde ist noch nicht gekommen. Bleib ein paar Tage bei mir, daß du dich stärkest. Dann sollst, du von hier Botschaften mitnehmen für den Hofer. Und nun wollen wir miteinander frühstücken.«
Und Joseph Dörninger, der versprengte Student, blieb etliche Tage im Wirtshause an der Mahr. Die beiden Männer waren, wenn auch unauffälligerweise, viel beisammen, und es war bald, als hätten sie sich lieb gewonnen. Manche Stunde auch saßen sie hinter verschlossener Thür und beredeten vieles. Dörninger hatte sich von seiner beschwerlichen Flucht über das Pfitschergebirge bald ganz erholt und nun zeigte es sich, daß er ein hübscher Junge war. Eines Morgens rief er die Magd Hanai und fragte, wo seine Stiefel wären.
»Der Schuster verklenkt ihnen die Mäuler,« antwortete die Magd, »und ich habe Auftrag, daß ich an Euren Strümpfen dasselbe thu'. Und die Frau hat gesagt, Ihr sollet dem Wirt sein Gewand anlegen, daß man Eures derweil wieder festmachen kann.« Damit raffte sie die Kleider zusammen, soweit sie nicht schon an seinem Leibe hingen, ging damit davon und in wenigen Stunden war alles heil.
Gerne that der junge Mann mit seines Gastherrn Kindern um, besonders mit dem klugen, unternehmungslustigen Hans. »Wie alt bist du?« fragte er diesen einmal.
»Zwanzig!« antwortete der Knabe. Das war um die Hälfte zu hoch gegriffen und vor dem Vater hatte er darob ein herbes Verhör zu bestehen.
»Hans, warum hast du's gesagt?«
»Weil ich kein Kind will sein, weil ich gegen die Fremden will.«
»Ich will dir ein Merkzeichen geben!«
»Es war ja nur im Scherz!« wollte Dörninger beschwichtigen.
»Mit der Wahrheit gibt's keinen Scherz.« wies der Wirt zurück. »Daß ich dir's nur sage, Dörninger, du bist auch nicht redlich gewesen. Du wärest auf deinem wichtigen Wege lieber verhungert, als von einem Tiroler Nahrung zu begehren. Das mußt du dir abgewöhnen, Kamerad! Wer fürs Vaterland was thut, der ist in jedes Tirolers Haus daheim. Da hat keiner was für sich allein, da ist alles gemeinsam – verstehst?«