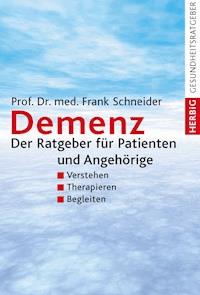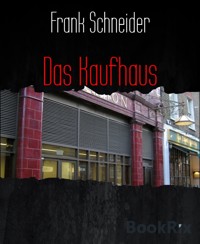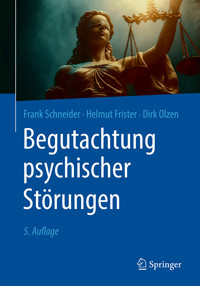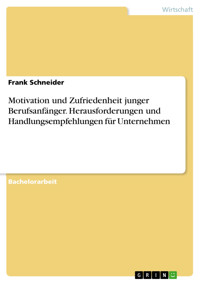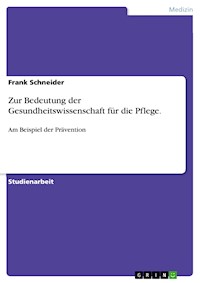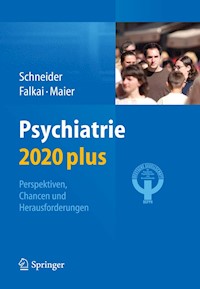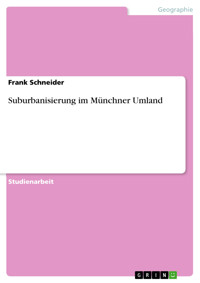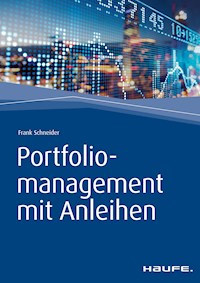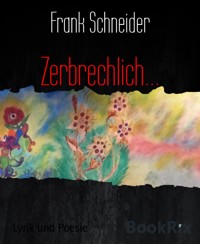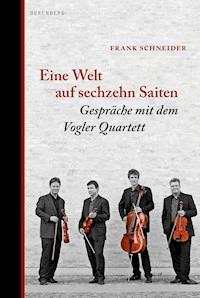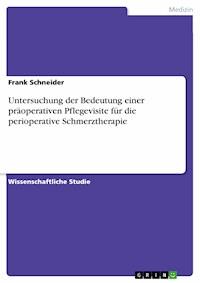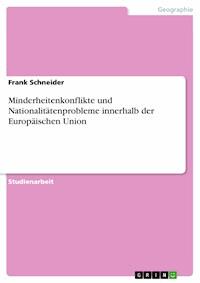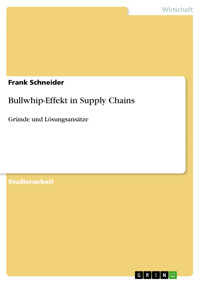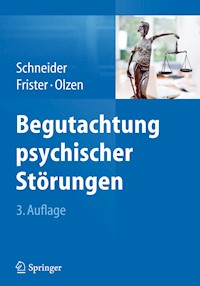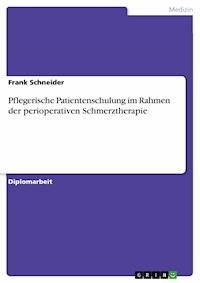
Pflegerische Patientenschulung im Rahmen der perioperativen Schmerztherapie E-Book
Frank Schneider
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Pflegewissenschaft - Sonstiges, Note: 1,1, Hamburger Fern-Hochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Chirurgie haben Schmerzen eine zentrale Bedeutung. Zum einen gelten sie als einer der Hauptauslöser für den Patienten, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Zum anderen können Schmerzen die Diagnostik, Therapie und den Heilungsprozess erschweren oder sogar verhindern. Schmerzprävention und -therapie stellen daher, neben anderen Parametern, eine der Voraussetzungen für eine effiziente und erfolgreiche chirurgische Krankenbehandlung dar. Die Komplexität und Individualität des Schmerzerlebens machen einen übergreifenden Ansatz notwendig, der nicht nur die medizinische Diagnose fokussiert, sondern auch die Bedürfnisse des Patienten integriert. Insbesondere in der postoperativen Phase spielt die Mitarbeit des Patienten eine bedeutende Rolle. Zum einen bestimmen seine Schmerzäußerungen Art und Inhalt der Behandlung; zum anderen kann er durch sein eigenes Verhalten einen Beitrag zur Schmerzreduktion leisten. Damit der Patient in der Lage ist, dies zu erfüllen, benötigt er verständliche Informationen, Beratung und Schulung. Ziel soll ein mündiger Patient sein, der seine persönlichen Ressourcen zum Gelingen der Behandlung zur Verfügung stellen kann. Hierfür bieten sich präoperative Schulungen und Beratungen an, durch die der Patient spezifische Informationen erhält und Verhaltensmaßnahmen einüben kann. Durch den ständigen Kontakt des Patienten zum Pflegepersonal und die damit verbundenen Austauschbeziehung, sind hier die Pflegefachkräfte besonders gefordert. In der vorliegenden Studie sollen deshalb die Auswirkungen einer präoperativen Patientenschulung auf die perioperative Schmerzsituation des Patienten und dessen Zufriedenheit untersucht werden. Dabei werden zwei Schulungsformen in Betracht gezogen. Zum einen die individuelle Schulung im Rahmen eines pflegerischen Beratungsgesprächs und zum anderen die allgemeine Informationsvermittlung in Form einer pflegerischen Aufklärungsbroschüre. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der beiden Schulungsformen und deren Effekte auf den Behandlungsverlauf darzustellen, um abschließend eine Empfehlung für die praktische Umsetzung von schmerztherapeutischen Patientenschulungen auf chirurgischen Bettenstationen begründen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Danksagung:
In erster Linie gilt mein aufrichtiger Dank meinem Vater für seine Unterstützung während meines Studiums.
Weiterhin danke ich Frau Dr. med., dipl. theol. Maria Lempa. Sie stand mir jederzeit mit großer Geduld und profunder Sachkenntnis zur Verfügung.
Ohne die Hilfe der Kolleginnen und Kollegen des Kreiskrankenhaus Grevenbroich wäre der praktische Teil der Arbeit nicht durchführbar gewesen. Vielen Dank dafür.
Im Andenken an meine Mutter.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorbemerkungen
1 Forschungsidee
2 Patientenschulung und –beratung
2.1 Definition
2.2 Ziel und Zweck der Patientenedukation
2.2.1 Erhöhung der Selbstpflegefähigkeit
2.2.2 Erhöhung der Partizipationsfähigkeit
2.2.3 Kritische Auseinandersetzung
2.3 Schulungs- und Beratungsmethoden
2.4 Patientenschulung als Aufgabe der Pflegefachkräfte
2.4.1 Pflegerische Praxis
2.4.2 Aspekte aus dem Krankenpflegegesetz
2.4.3 Standpunkte nationaler und internationaler Verbände
2.4.4 Auffassungen in der Pflegewissenschaft
3 Schmerz
3.1 Definition
3.2 Schmerzarten und -formen
3.3 Das Schmerzerlebnis
3.3.1 Schmerzbeeinflussende Faktoren
3.3.2 Schmerzwahrnehmung
3.4 Diagnostik
3.4.1 Anamnese
3.4.2 Schmerzbeschreibung
3.4.3 Schmerzmessung
4. Schmerztherapie
4.1 Bedeutung in der perioperativen Phase
4.2 Medikamentöse Methoden
4.2.1 Therapie chronischer Schmerzen
4.2.2 Therapie akuter Schmerzen
4.3 Nicht medikamentöse Methoden
4.4 Kreislauf der Schmerztherapie
4.4.1 Diagnose
4.4.2 Therapie
4.4.3 Symptomkontrolle
4.4.4 Anpassung von Diagnose und Therapie
5 Mögliche Effekte präoperativer Informationen
5.1 Einfluss auf die Angst
5.2 Erhöhung der Partizipationsfähigkeit
5.3 Erhöhung der Selbstpflegekompetenz
5.4 Psychologische Effekte
6 Zentrale Fragestellung und Forschungsziel
7 Studiendesign
7.1 Rahmenbedingungen
7.1.1 Untersuchungsumfeld
7.1.2 Schmerzerfassung und -therapie im Feld
7.2 Empirische Methode
7.2.1 Aufteilung in Vergleichsgruppen
7.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien
7.2.3 Methoden und Datenerhebungsverfahren
8 Ethische Überlegungen
8.1 Unterstützung durch das direkte Untersuchungsumfeld
8.2 Einverständnis der Befragten
8.3 Anonymität der Datenerhebung
8.4 Aufwand für die Teilnehmer
8.5 Sinnhaftigkeit der Untersuchung
9 Gütekriterien
9.1 Reliabilität
9.2 Validität
9.3 Objektivität
10 Planung der Patientenschulungen
10.1 Standardisierung des Aufklärungsgespräches
10.2 Erstellung der Broschüre
11 Pretests
11.1 Fragebogen
11.2 Aufklärungsgespräch
11.3 Broschüre
12 Datenerfassung und Aufbereitung
12.1 Auswertungsgesamtheit
12.2 Datenverarbeitungstechnik
12.3 Datenauswertung
13 Ergebnisse
13.1 Zusammensetzung der Vergleichsgruppen
13.2 Fragenkomplex A
13.3 Fragenkomplex B
13.4 Fragenkomplex C
14 Dateninterpretationen
14.1 Auswirkungen der Schulungen auf das Befinden
14.2 Auswirkungen der Schulungen auf die Schmerzintensität
14.3 Auswirkungen auf die Bewertung des therapeutischen Teams
14.4 Auswirkungen auf die Beurteilung der Partizipationsmöglichkeiten
14.5 Auswirkungen auf die Selbstpflegekompetenz
15 Empfehlung für die pflegerische Praxis
16 Persönliche Betrachtungen und Ausblicke
Literaturverzeichnis
Broschürenverzeichnis
Anhang
Anhang 1: Schmerzskala des Kreiskrankenhaus Grevenbroich
Anhang 2: Kurvenblatt des Kreiskrankenhaus Grevenbroich
Anhang 3: Patientenfragebogen
Anhang 4: Formular „Patientenanamnese“
Anhang 5: Verhaltensregeln für die Pflegekraft beim Aufklärungsgespräch
Anhang 6: Checkliste des pflegerischen Aufklärungsgesprächs
Anhang 7: Patientenbroschüre
Anhang 8: Detaillierte Datenaufbereitung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Gleichgewicht als Ziel der Pflege
Abb. 2: Gate-Control-Theorie
Abb. 3: WHO-Stufenschema
Abb. 4: Kreislauf des Schmerzprozesses
Abb. 5: Gleichgewicht durch Therapie und Beratung
Abb. 6: Aufteilung der Studiengruppen
Abb. 7: Ein- und Ausschlussverfahren
Abb. 8a: Testhalbierungsreliabilität in der Kontrollgruppe
Abb. 8b: Testhalbierungsreliabilität in der Visitengruppe
Abb. 8c: Testhalbierungsreliabilität in der Broschürengruppe
Abb. 9: Bildung der Auswertungsgesamtheit
Abb. 10: Bildung der Auswertungsgesamtheit (prozentuale Verteilung)
Abb. 11: Zusammensetzung der drei Patientengruppen
Abb. 12: Durchschnittliche Verteilung von Alter, Geschlecht und BMI
Abb. 13: Verteilung des OP-Risikos nach ASA-Kriterien
Abb. 14: Verteilung der Operationsgruppen nach Häufigkeit
Abb. 15: Präoperative Emotionen (Frage 1)
Abb. 16: Ursachen präoperativer Ängste (Frage 2)
Abb. 17: Beantwortung präoperativer Fragen (Frage 3)
Abb. 18: Wirkung der Aufklärungen (Frage 4)
Abb. 19: Bevorzugte Informationsquellen (Frage 5a und 5b)
Abb. 20: Verlauf der Schmerzintensitäten (Frage 6)
Abb. 21: Verständlichkeit der Schmerztherapie (Frage 7a)
Abb. 22: Spezifisches Fachwissen des Personals (Frage 7c)
Abb. 23: Behandlungssouveränität des Pflegepersonals (Frage 7d)
Abb. 24: Beachtung geäußerter Schmerzen (Frage 7e)
Abb. 25: Beachtung der Individualität (Frage 7f)
Abb. 26: Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Therapie (Frage 7g)
Abb. 27: Große Bedeutung der Mitarbeit in der Therapie (Frage 8a)
Abb. 28: Wurden notwendige Kompetenzen vermittelt (Frage 8b)
Abb. 29: Auswirkungen auf zukünftige Schmerzsituationen (Frage 8d)
Abb. 30: Schmerzlinderung durch Mitarbeit des Patienten (Frage 8c)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Kriterien des Expertenstandard Schmerzmanagement
Tab. 2: Schmerzformen (vgl.: Kress 2004, Kap. 1.2.1, S. 2-3)
Tab. 3: 15 Adjektive zur Schmerzbeschreibung
Tab. 4: Nichtmedikamentöse Methoden (vgl. Zens 1993, S. 197ff)
Tab. 5: Zusammenfassung der Operationen in sieben Obergruppen
Tab. 6: Ergebnisse der Lesbarkeitstests
Tab. 7: Verteilung von Alter, Geschlecht und BMI
Vorbemerkungen
Im Folgenden wird die klinische Studie zur pflegerischen Patientenschulung im Rahmen der perioperativen Schmerztherapie dargestellt, sowie die Ergebnisse und Schlussfolgerungen entsprechend veranschaulicht.
Die Begriffe Visite bzw. Pflegevisite werden mehrmals verwendet. Hierzu findet man in der Literatur die unterschiedlichsten Definitionen. Die von Heering 1995 veröffentlichte Beschreibung deckt sich mit dem Verständnis des Autors: „Die präoperative Pflegevisite ist der Kontakt zwischen einer Pflegeperson und dem Patienten am Vortag einer geplanten Operation.“ (Heering 1995, S.302) Die in der Untersuchung durchgeführten Pflegevisite umfasste jedoch nicht den gesamten Pflegeprozess, sondern konzentriert sich im wesentlichen auf den Bereich der Schmerzbehandlung. Die genaue Art, Inhalt und Durchführung dieser Visiten werden im Text eingehend beschrieben und erläutert.
Zur besseren Lesbarkeit werden synonym auch die Bezeichnungen „pflegerisches Aufklärungsgespräch“ oder „Pflegegespräch“ verwendet.
1 Forschungsidee
Eine chirurgische Behandlung wird oft automatisch mit Schmerzen in Verbindung gebracht.
Oft ist es gerade das Symptom Schmerz, welches den Betroffenen auf eine Erkrankung aufmerksam macht und ihn schließlich zum Arzt gehen lässt. Hoppe (1990) führt hierzu aus, dass nahezu jede stationäre Einweisung auch aufgrund eines individuellen Schmerzgeschehens erfolgt. Typische Beispiele für chirurgische Einweisungsdiagnosen sind Knochenbrüche, Gallensteinkoliken und Entzündungen des Darmes. All diese Erkrankungen sind mit spezifischen Schmerzen verbunden und machen häufig eine operative Behandlung notwendig.
Aber auch die operative Behandlung selber, ob ambulant oder stationär, ist regelmäßig mit Schmerzen verbunden. Bereits in der Vorbereitung zur Operation wird der Patient mit unangenehmen Voruntersuchungen wie Blutabnahmen oder endoskopischen Diagnoseverfahren konfrontiert. Im weiteren Verlauf stellen die Operationswunden eine schmerzhafte Verletzung des Körpers dar. Folge ist, dass der Patient nach Abklingen der Narkose, mehr oder minder ausgeprägte operationsbedingte Schmerzen hat. Diese wiederum können die postoperative Rehabilitation erschweren. So wird z.B. die Mobilisation oft durch den Wundschmerz beeinträchtigt.
In der chirurgischen Behandlung haben Schmerzen also eine zentrale Bedeutung. Zum einen gelten sie als einer der Hauptauslöser, um sich in eine chirurgische Behandlung zu begeben. Zum anderen können Schmerzen die Diagnostik, Therapie und den Heilungsprozess erschweren oder sogar verhindern.
Schmerzprävention und -therapie stellen daher, neben anderen Parametern, eine der Voraussetzungen für eine effiziente und erfolgreiche chirurgische Krankenbehandlung dar.
„Schmerzen beeinflussen das physische, psychische und soziale Befinden und somit die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Darüber hinaus entstehen dem Gesundheitswesen durch schmerzbedingte Komplikationen und einer daraus oft erforderlichen Verweildauerverlängerung im Krankenhaus sowie durch die Chronifizierung von Schmerzen beträchtliche Kosten, die durch ein frühzeitiges Schmerzmanagement in den meisten Fällen erheblich verringert werden könnten.“ (DNQP 2005, S. 13)
Die Komplexität und Individualität des Schmerzerlebens machen einen übergreifenden Ansatz notwendig, der nicht nur die medizinische Diagnose fokussiert, sondern auch die Bedürfnisse des Patienten integriert.
Insbesondere in der postoperativen Phase spielt die Mitarbeit des Patienten eine bedeutende Rolle. Zum einen bestimmen seine Schmerzäußerungen Art und Inhalt der Behandlung; zum anderen kann er durch sein eigenes Verhalten einen Beitrag zur Schmerzreduktion leisten. Damit der Patient in der Lage ist, dies zu erfüllen, benötigt er verständliche Informationen, Beratung und Schulung. Ziel soll ein mündiger Patient sein, der seine persönlichen Ressourcen zum Gelingen der Behandlung zur Verfügung stellen kann. Hierfür bieten sich präoperative Schulungen und Beratungen an, durch die der Patient spezifische Informationen erhält und Verhaltensmaßnahmen einüben kann. Durch den ständigen Kontakt des Patienten zum Pflegepersonal und die damit verbundenen Austauschbeziehung, sind hier die Pflegefachkräfte besonders gefordert.
In der vorliegenden Studie sollen deshalb die Auswirkungen einer präoperativen Patientenschulung auf die perioperative Schmerzsituation des Patienten und dessen Zufriedenheit untersucht werden. Dabei werden zwei Schulungsformen in Betracht gezogen. Zum einen die individuelle Schulung im Rahmen eines pflegerischen Beratungsgesprächs und zum anderen die allgemeine Informationsvermittlung in Form einer pflegerischen Aufklärungsbroschüre.
2 Patientenschulung und –beratung
2.1 Definition
Der Begriff „Schulung“ wird im Brockhaus Lexikon unter anderem als „Ausbildung in einer Fertigkeit“ (Brockhaus AG, 2002) definiert. Das heißt, durch die Schulung wird einer Person eine bestimmte Fähigkeit vermittelt, mit dem Ziel diese zukünftig selbständig auszuführen bzw. zu nutzen.
Passend dazu wird der Begriff Beratung folgendermaßen beschrieben: „Beratung, eine Hilfeleistung, bei der (im Gegensatz zu den meist verhältnismäßig einfachen gelegentlichen Ratschlägen im Alltag) der umfassende Versuch gemacht wird, einem oder mehreren Menschen (etwa einer ganzen Familie) bei der Bewältigung von gesundheitlichen, erzieherischen, seelischen oder schulischen Problemen zu helfen...“. (Brockhaus AG, 2002)
Fasst man diese beiden Definitionen zusammen, so kann man unter Schulung und Beratung eine Dienstleistung für eine Person verstehen, die es ihr ermöglichen soll, bestimmte Anforderungen selber bewältigen zu können. Beispiele für solche Anforderungen im Bereich der Betreuung von kranken Menschen sind z.B. das Einhalten eines Diätplanes, das selbständige Durchführen krankengymnastischer Übungen oder der Umgang mit emotional belastenden Diagnosen. Ziel ist demnach die Befähigung zur selbständigen Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit. „Die Patientenschulung und -beratung (Patientenedukation) dient dazu, Patienten zur Selbstpflege zu befähigen und ihnen Autonomie, Würde und Selbstkontrolle im Alltag zurück zu geben;...“ (Menche 2001, S. 282)
2.2 Ziel und Zweck der Patientenedukation
Den in Kapitel 2.1 angeführten Definitionen ist zu entnehmen, das die Patientenedukation das Ziel der Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen verfolgt. Im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflege kann dies mit dem Begriff der Selbstpflegefähigkeit beschrieben werden.
2.2.1 Erhöhung der Selbstpflegefähigkeit
Dieser Begriff entstammt dem Selbstpflege-Defizit-Modell nach Dorothea Orem. Diesem Modell folgend kann der Mensch zwei Formen der Fürsorge wahrnehmen: self care (Selbstpflege) und dependent care (Abhängigenpflege). Unter Selbstpflege fasst Orem sowohl das Bedürfnis nach Existenzerhaltung als auch darauf ausgerichtete Maßnahmen. Unter Abhängigenpflege versteht sie die erlernten, zielgerichteten Aktivitäten zur Regulierung von Faktoren die das Wohlbefinden von abhängigen Personen beeinträchtigen.