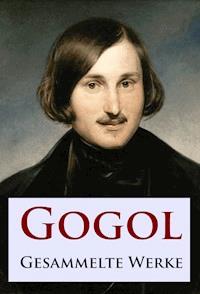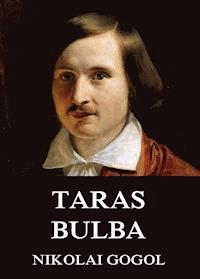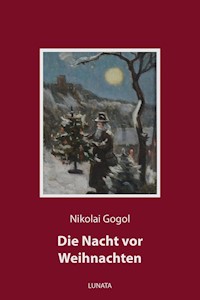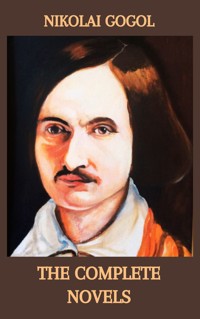Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nikolai Gogols 'Phantastische Geschichten' ist eine Sammlung von Erzählungen, die von übernatürlichen Elementen und grotesken Figuren durchdrungen sind. Mit seinem einzigartigen literarischen Stil, der Realismus und Fantasie geschickt verbindet, schafft Gogol eine fesselnde Welt, die den Leser in ihren Bann zieht. Die Geschichten spiegeln die verstörenden und mysteriösen Seiten der menschlichen Natur wider, während sie gleichzeitig humorvolle und ironische Elemente enthalten. Gogols brillanter Einsatz von Symbolik und Allegorie macht diese Sammlung zu einem Meisterwerk der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Phantastische Geschichten
Books
Inhaltsverzeichnis
Die Weihnacht
Deutsch von Ludwig Rubiner und Frieda Ichak
Der letzte Tag vor dem Weihnachtsfeste war verstrichen. Klar brach die Winternacht an, die Steine schauten hervor, der Mond stieg majestätisch am Himmel empor, um allen guten Leuten und der ganzen Welt zu leuchten, auf daß allen fröhlich ums Herz sei, wenn nach dem Weihnachtsbrauch unter den Fenstern Christi Lob und Preis gesungen würde.Dieses Singen unter den Fenstern am Weihnachtsabend nennt man bei uns »Koljadowatj«, und die Lieder heißen »Koljadki«. Dem, der da singt, wirft der Hausherr oder die Hausfrau, oder wer sonst zu Hause bleibt, stets eine Wurst, ein Brot, einen Kupfergroschen oder was er gerade besitzt, in den Sack. Man sagt, es habe einmal einen Narren namens »Koljada« gegeben, den man für einen Gott gehalten habe, und der Name Koljadki für die Lieder rührte daher. Wer will das wissen. Es ist nicht Sache von uns einfachen Leuten, uns hierüber auszusprechen. Voriges Jahr wollte der Vater Ossip es verbieten, in den einzelnen Weilern die »Koljadki« zu singen, da, wie er behauptete, dies ein Tribut sei, den das Volk dem Satan bringe. Allein, um die Wahrheit zu sagen, in den »Koljadki« findet sich auch nicht ein Wort über den »Koljada« Man singt oft von der Geburt Christi und wünscht zum Schluß dem Hausherrn, der Hausfrau, den Kindern und dem ganzen Hause eine gute Gesundheit. Der Frost war noch schneidender als am Morgen; aber dafür war es so still, daß man das Knirschen des Schnees unter den Stiefeln eine halbe Werst weit hören konnte. Noch war unter keinem Fenster eine Schar von Burschen zu sehen; allein der Mond blickte verstohlen durch die Scheiben, als wollte er den sich putzenden Mädchen zuwinken, sie sollten schneller hinauslaufen in den knisternden Schnee. Da wälzten sich plötzlich dichte Ballen von Qualm aus dem Schornstein einer Hütte und stiegen wie eine Wolke zum Himmel auf, und zugleich mit dem Rauch ritt eine Hexe auf einem Besenstiel in die Höhe.
Wenn in diesem Augenblick der Herr Assessor aus Ssorotschintzy in einem mit Gutspferden bespannten Dreispänner vorbeigefahren wäre, die Mütze mit der Hammelfellborde, wie sie die Ulanen tragen, auf dem Kopf, in seinem blauen, mit schwarzem Lammfell gefütterten Pelz, und mit dem Teufelsding, seiner geflochtenen Peitsche, mit der er gewöhnlich seinen Kutscher anfeuerte, so hätte er sie bestimmt gesehen; denn dem Assessor von Ssorotschintzy kann keine Hexe entgehen. Er kann sich’s nämlich von jedem Frauenzimmer an den Fingern abzählen, wieviel Ferkelchen ihre Sau wirft, wieviel Leinwand in ihrem Kasten liegt, und er weiß aufs Tüpfelchen, was ein wackerer Mann an einem Sonntag in der Schenke an Kleidern und Wirtschaftssachen versetzt. Aber der Assessor von Ssorotschintzy kam nicht vorbeigefahren, und dann kümmerte er sich auch nicht um fremde Leute – er hatte ja seinen eigenen Bezirk. Unterdessen aber stieg die Hexe so hoch empor, daß sie da oben nur noch wie ein schwarzes Pünktchen aussah. Aber wo dies Pünktchen sich zeigte, dort verschwand ein Stern nach dem andern vom Himmel. Bald hatte die Hexe einen ganzen Ärmel voll von ihnen heruntergeholt. Nur noch drei oder vier blinkten so herum. Auf einmal jedoch tauchte an der entgegengesetzten Seite ein anderes Pünktchen auf, wurde immer größer, dehnte sich in die Breite, und bald war es kein Pünktchen mehr. Ein Kurzsichtiger hätte sogar statt einer Brille die Räder vom Wagen des Kommissärs auf die Nase setzen können, aber auch dann hätte er nicht genau erkennen können, was das für ein Ding war. Von vorne sah es sich ganz an wie ein Welscher:Einen Welschen nennt man bei uns einen jeden, der aus einem fremden Lande stammt, möge er nun ein Franzose, ein Römer, ein Schwede oder sonstwer sein, er heißt immer ein Welscher. Das spitzige Mäulchen, das sich fortwährend bewegte und alles und alle beschnüffelte, lief in ein rundes Fünfkopekenstück aus wie bei unseren Schweinen; die Beine waren so dünn, daß sie auch dem Jareskower Amtmann, wenn er nämlich ebenso schmächtige gehabt hätte, schon beim ersten Sprung im Kosakentanz gebrochen wären. Dafür aber war’s von hinten ein waschechter Gouvernementsprokurator in Uniform, denn ihm baumelte ein Schwanz herunter, der so lang war und so spitz zulief wie die Schöße an den neumodischen Uniformen; höchstens aus dem Bocksbart unterm Maul, aus den kleinen Hörnerchen auf dem Kopfe und daraus, daß er nicht viel weißer war als ein Schornsteinfeger, konnte man erraten, daß das weder ein Kerl aus dem Auslande noch ein Gouvernementsprokurator war, sondern ganz einfach der Teufel in eigener Person, für den die letzte Nacht gekommen war, wo er sich in Gottes weiter Welt umhertreiben und die guten Menschen zu allerlei Sünden verführen durfte. Denn morgen schon sollte er beim ersten Glockenschlage der Frühmesse mit eingezogenem Schwanz zur Hölle fahren.
Indessen aber schlich sich der Teufel leise an den Mond heran und streckte die Hand aus, um nach ihm zu greifen; plötzlich jedoch riß er seine Hand zurück, als wenn er sich verbrannt hätte, sog an den Fingerspitzen, schlenkerte mächtig mit dem einen Bein und schlüpfte dann auf die andere Seite; aber da prallte er wiederum zurück und zog schleunigst die Hand weg. Trotz dieser Mißerfolge ließ jedoch der listige Teufel nicht von seinen bösen Streichen. Mit einem Anlauf rannte er heran und packte den Mond mit beiden Händen; er krümmte sich hin und her, blies aus vollen Backen auf ihn und warf ihn aus einer Hand in die andere wie ein Bauer, der sich mit bloßen Händen Feuer für seine Pfeife holt; endlich steckte er ihn rasch in seine Tasche und sauste weiter, als ob ganz und gar nichts geschehen wäre.
In Dikanka hatte niemand gemerkt, daß der Teufel den Mond gestohlen hatte. Freilich, als der Gemeindeschreiber, übrigens auf allen Vieren, die Schenke verließ, sah er, daß der Mond plötzlich am Himmel umhertanzte, und er beschwor das bei allen Heiligen vor dem ganzen Dorfe; aber die Leute im Dorfe schüttelten nur die Köpfe und lachten ihn einfach aus. Doch was hatte den Teufel eigentlich zu einer so schändlichen Tat veranlaßt? Der Grund war folgender: Er wußte, daß der reiche Kosak Tschub vom Küster zum Weihnachtsschmaus eingeladen war, und daß außerdem noch der Amtmann, ein Anverwandter des Vorsängers von der Bischöflichen Sängerkapelle, ein Mann im blauen Rock, der die tiefsten Baßtöne mühelos hervorbrachte, ferner der Kosak Swerbygus und noch dieser und jener da sein würden. Da würde es außer dem Weihnachtskuchen noch süßen Branntwein, Safranschnaps und noch allerhand Gutes zum Essen und Trinken geben. Unterdessen würde aber sein Töchterchen, die erste Schöne im ganzen Dorf, allein zu Hause bleiben; und dann würde sicher der Schmied zu dem Mädel kommen, ein handfester, kräftiger Bursch, ein Mordskerl, der dem Teufel noch widerwärtiger war als die Predigten des Vaters Kondrat. In seinen Mußestunden pflegte der Dorfschmied sich nämlich mit der Malerei zu beschäftigen, und er galt als der beste Maler in der ganzen Umgegend. Der Kosakenhauptmann L…ko, der damals noch lebte, hatte ihn sogar eigens dazu nach Poltawa kommen lassen, um den Bretterzaun vor seinem Haus zu tünchen. Alle Schüsseln, aus denen die Kosaken von Dikanka ihren Borschtsch schlürften, waren von ihm bemalt. Der Schmied war ein gottesfürchtiger Mann, malte oft Heiligenbilder, und man kann jetzt noch in der Kirche zu T…… einen Evangelisten Lukas von seiner Hand sehen. Aber der Triumph seiner Kunst war ein Bild, das er an die Wand der rechten Kirchenvorhalle gemalt hatte; da hatte er den heiligen Petrus dargestellt mit Schüsseln in der Hand, wie er am Jüngsten Tage den bösen Geist aus der Hölle vertreibt: Der erschrockene Teufel rennt, seinen Untergang vorausahnend, hin und her, und die Sünder, die einst in die Hölle gesperrt waren, prügeln mit Knuten, Holzscheiten und allem, was ihnen unter die Hände kommt, auf ihn los. Zur Zeit, als der Maler an diesem Bilde arbeitete – er malte es auf ein großes Brett – hatte sich der Teufel aus aller Kraft bemüht, ihn dabei zu stören: er puffte ihn unsichtbar am Arm, holte Asche aus der Schmiede-Esse und streute sie auf das Bild; aber trotz alledem wurde das Werk zu Ende geführt, das Brett wurde in die Kirche gebracht, an der Wand der Vorhalle angenagelt, und seitdem hatte der Teufel dem Schmied Rache geschworen.
Nur noch eine Nacht war ihm nun geblieben, durch die Welt zu ziehen; in dieser Nacht aber wollte er seine ganze Wut an dem Schmied auslassen, und darum beschloß er, den Mond zu stehlen; er hatte es sich nämlich folgendermaßen ausgedacht: Der alte Tschub ist träge und schwer auf die Beine zu kriegen, und dann ist es auch von seinem Hause bis zum Küster nicht sehr nahe. Der Weg zu ihm führte hinterm Dorfe an Windmühlen, am Friedhof und an einem Abgrund vorüber, und dann konnten bei hellen Mondnächten auch noch der süße Branntwein und der Safranschnaps den Tschub locken; aber bei dieser Finsternis konnte es wohl kaum jemand gelingen, ihn von seinem Plätzchen hinterm Ofen hervor und auf die Straße hinaus zu lotsen. Und da würde der Schmied, der schon lange nicht im besten Einvernehmen mit ihm lebte, es sicher nicht wagen, seine Tochter aufzusuchen, und wenn er noch so kräftig war.
Und so kam es, daß der Teufel kaum den Mond in die Tasche gesteckt hatte, als es plötzlich in der ganzen Welt so stockfinster wurde, daß manch einer den Weg ins Wirtshaus nicht gefunden hätte, geschweige denn den in des Küsters Haus. Die Hexe fand sich auf einmal im Dunkeln und stieß einen Schrei aus. Da scharwenzelte der Teufel auf sie zu, faßte sie flink unterm Arm und begann ihr allerhand schöne Dinge ins Ohr zu flüstern, wie man sie den Weibern gewöhnlich zuzuraunen pflegt. Es geht doch recht wunderlich zu in unserer Welt! Alles was in ihr leibt und lebt, alles ist bemüht, einander was abzugucken und andere Leute nachzuäffen. Früher gab’s einmal eine Zeit, da trugen in ganz Mirgorod nur der Richter und der Bürgermeister im Winter Pelze, die mit Tuch überzogen waren, während die übrigen Unterbeamten gewöhnlich die Pelze mit dem Fell nach außen trugen; jetzt dagegen haben sich der Assessor und der Unterrendant neue Pelze aus feinem Lammfell mit Tuchbezügen zugelegt. Vor zwei Jahren kauften der Kanzlist und der Gemeindeschreiber Nanking zu sechzig Kopeken die Elle, und der Kirchendiener hat sich zum Sommer gar eine Pluderhose aus Nanking und sogar eine Weste aus Kammgarn machen lassen. Kurz, alles will zur seinen Welt gehören! Wann werden die Menschen endlich einmal von ihrer Eitelkeit ablassen! Nun könnte man wetten, manchem kommt der Gedanke sonderbar vor, daß der Teufel sich ebenso benimmt. Am ärgerlichsten ist’s aber, daß er sich am Ende gar noch auf seine Schönheit was zugute tut, und dabei hat er doch eine Fratze, daß es eine wahre Schande ist. Geradezu eine Fresse, wie Foma Grigorjewitsch zu sagen pflegt, das Garstigste vom Garstigen, und so einer geht auch noch auf Liebschaften aus! Aber am Himmel war es so stockfinster geworden, daß man durchaus nichts mehr von dem sehen konnte, was sich weiter zwischen dem Pärchen abspielte.
»Also, Gevatter, du bist noch nicht beim Küster in der neuen Hütte gewesen?« sprach der Kosak Tschub, trat aus der Tür seines Hauses und ging auf einen hageren, baumlangen Bauer in kurzem Schafspelz, mit einem dichten Bart zu, der davon Zeugnis ablegen konnte, daß dies Kinn schon über vierzehn Tage lang nicht mehr von dem Sensenstück berührt worden war, mit dem sich die Bauern in Ermanglung eines Rasiermessers ihren Bart schaben. »Dort wird es jetzt ein schönes Gelage geben!« fuhr Tschub, übers ganze Gesicht schmunzelnd, fort. »Daß wir nur nicht zu spät kommen!«
Dabei rückte Tschub seinen Gurt zurecht, der seinen Pelz fest zusammenzog, schob die Mütze tief in die Augen und nahm die Knute – den Schrecken und die Angst aller lästigen Hunde – fester in die Hand. Als er jedoch nach oben blickte, hielt er inne…
»Teufel noch einmal! Schau! Schau nur, Panas!…«
»Was denn?« sprach der Gevatter und hob ebenfalls seinen Kopf.
»Was? Der Mond ist fort!«
»Verflucht! Wahrhaftig, der Mond ist fort!«
»Das ist es ja eben«, rief Tschub, einigermaßen ärgerlich über die unerschütterliche Teilnahmlosigkeit des Gevatters. »Du scherst dich wohl wenig drum!«
»Ja, was soll ich denn dabei machen?«
»Mußte sich da grad so ein Teufel,« fuhr Tschub fort und wischte sich mit dem Ärmel den Schnurrbart, »grad so ein Teufel hineinmischen! So ein Hundsfott! Daß er morgens doch nie wieder sein Glas Schnaps zu trinken kriegte! … Wahrhaftig! Es ist zum Lachen… Als ich in der Stube saß, da sah ich zu meinem Vergnügen zum Fenster hinaus: Die Nacht war ein reines Wunder! Es war ganz hell, der Schnee leuchtete im Mondlichte, und alles war so klar zu sehen wie am lichten Tag; kaum aber trete ich aus der Tür, – da herrscht eine Dunkelheit, daß man die Hand vor den Augen nicht sieht! Mag er sich doch alle Zähne an hartem Buchweizenbrot ausbrechen!«
Lange noch brummte und schimpfte Tschub, zugleich aber überlegte er, wozu er sich entschließen solle. Für sein Leben gern hätte er beim Küster über dies und jenes schwatzen mögen; denn sicher saßen dort schon der Amtmann, der zugereiste Baß und der Teersieder Mikita, der alle vierzehn Tage zum Markt nach Poltawa zu fahren pflegte und solche Possen trieb, daß die Leute aus dem Dorf sich den Bauch vor Lachen hielten. Schon sah Tschub in Gedanken den süßen Branntwein auf dem Tisch stehn. Freilich, all das war verlockend, aber die Dunkelheit der Nacht lockte wieder zu jenem Faulenzerleben, das jedem Kosaken so lieb ist. Wie gut wäre es jetzt, mit untergeschlagenen Beinen auf der Ofenbank zu sitzen, seine Pfeife zu rauchen und in süß umnebelndem Schlummer den lustigen Burschen und Mädeln zuzuhören, die in Scharen vor den Fenstern ihre Lieder singen und die Weihnacht preisen! Ohne Zweifel hätte er sich auch für das letztere entschieden, wenn er allein gewesen wäre; aber zu zweit war es nicht mehr so langweilig und so gruselig, mitten durch die Nacht zu gehen, auch wollte er vor dem andern nicht faul und feige erscheinen. Als er mit dem Schimpfen fertig war, wandte er sich an den Gevatter.
»Der Mond ist also weg, Gevatter?«
»Ja, er ist weg!«
»Wirklich sonderbar! Gib mir mal eine Prise! Du hast einen vortrefflichen Tabak, Gevatter! Wo hast du ihn her?«
»Vortrefflich? Ei, da soll mich doch der und jener –« antwortete der Gevatter, indem er seine Dose aus Baumrinde mit den eingeritzten Mustern zuklappte. »Nicht einmal ein altes Huhn würde bei diesem Tabak niesen!«
»Ich erinnere mich,« fuhr Tschub in demselben Tone fort, »der verstorbene Schankwirt Susulja hatte mir einmal etwas Tabak aus Njáschin mitgebracht. Oh, war das ein Tabak! Also, Gevatter, was machen wir nun? Es ist ja mächtig dunkel.«
»So bleiben wir meinetwegen zu Hause!« rief der Gevatter und griff schon nach der Türklinke.
Hätte der Gevatter das nicht gesagt, so hätte Tschub sich wohl entschlossen, zu Hause zu bleiben; jetzt aber schien ihn gerade etwas zum Widerspruch zu reizen. »Nein, Gevatter, wir wollen gehen! Unmöglich! Wir müssen gehen!«
Kaum hatte er das gesagt, so ärgerte er sich schon über seine eigenen Worte. Es war ihm höchst unangenehm, sich in solcher Nacht umhertreiben zu müssen, aber der Gedanke tröstete ihn, daß er es selbst so gewollt und daß er wider den Ratschlag eines anderen gehandelt hatte.
Der Gevatter ließ auch nicht die leiseste Regung von Verdrießlichkeit in seinem Gesichte erkennen. Er war ein Mann, dem es durchaus gleich war, ob er zu Hause saß, oder ob er sich draußen umhertrieb. Er sah sich nur noch einmal um, kratzte sich mit dem Stiel der Knute die Achseln – und die beiden Gevattern machten sich auf den Weg.
Doch sehen wir nun zu, was seine schöne Tochter trieb, die allein zu Hause geblieben war. Oxana war noch nicht ganz siebzehn Jahre alt, als man schon beinah in der ganzen Welt, sowohl diesseits wie jenseits von Dikanka, von nichts anderem sprach als von ihr. Die Burschen erklärten einstimmig, ein herrlicheres Mädchen gäbe es im ganzen Dorfe nicht, habe es noch nie gegeben und werde es auch niemals geben. Oxana hörte und wußte alles, was über sie geredet wurde, und sie war so eingebildet, wie ein schönes Mädchen es eben ist. Hätte sie nicht ein Kopftuch und die Jacke einer Bäuerin getragen, sondern ein Stadtkleid, so hätte sie sicher alle Mädchen in den Schatten gestellt. Die Burschen liefen ihr scharenweise nach; aber sie verloren allmählich die Geduld, verließen nach und nach die eigensinnige Schöne und wendeten sich anderen, weniger verwöhnten Weibern zu. Nur der Schmied blieb hartnäckig und hörte nicht auf, sie zu umwerben, obwohl er keineswegs besser behandelt wurde als die anderen. Sobald nun der Vater fortgegangen war, putzte und schmückte sich Oxana noch lange vor dem kleinen Spiegel im Bleirahmen. Sie konnte sich nicht satt sehen an ihrer Schönheit.
»Was fällt den Leuten nur ein, mich zu rühmen, ich sei schön?« sprach sie mit zerstreuter Miene, nur um einen Vorwand zu haben, mit sich selbst zu plaudern. »Die Leute lügen, ich bin gar nicht schön!«
Aber das frische, lebhafte, kindlich jugendliche Gesicht im Spiegel, mit den strahlenden schwarzen Augen und dem unsagbar anmutigen Lächeln, das die Seele erglühen machte, bewies das Gegenteil.
»Sind denn meine schwarzen Brauen und meine Augen in der Tat so schön?« fuhr sie fort, ohne den Spiegel aus der Hand zu legen, »daß sie nicht ihresgleichen in der Welt haben? Was ist nur Schönes an dieser Stumpfnase? An meinen Wangen? An meinen Lippen? Meine schwarzen Zöpfe sollen schön sein? O jeh, am Abend können sie einem Menschen einen ordentlichen Schreck einjagen: wie lange Schlangen winden und schlingen sie sich um meinen Kopf. Ich sehe jetzt, daß ich gar nicht schön bin!« Und sie rückte den Spiegel etwas von sich fort und rief: »Nein, ich bin doch schön! Ach, wie ich schön bin! Wundervoll! Welch eine Freude werde ich einst dem bereiten, dessen Frau ich sein werde. Wie wird mein Gemahl entzückt von mir sein! Er wird außer sich sein vor Freude. Er wird mich zu Tode küssen!«
»Wunderbares Mädchen!« flüsterte der Schmied, der leise eingetreten war. »Aber sie ist nicht wenig eitel! Schon eine Stunde lang steht sie da, besieht sich im Spiegel und kann sich nicht satt sehen an sich selbst, und dazu lobt sie sich noch ganz laut!«
»Ja, ihr Burschen, ich bin nicht euersgleichen, seht mich an«, fuhr die reizende Kokette fort. »Wie ist mein Gang so geschmeidig. Mein Hemd ist mit roter Seide genäht. Und was für Bänder ich auf dem Kopf habe! Euer Lebtag werdet ihr nicht mehr solche Goldborden sehen! All das hat mir mein Vater gekauft, damit mich der schönste Bursch der Welt zur Frau nimmt.« Sie lächelte, wandte sich um und erblickte den Schmied …
Sie schrie auf und blieb mit strenger Miene vor ihm stehen.
Der Schmied ließ die Hände herabsinken.
Es wäre schwer zu sagen, was das braune Gesicht des wundervollen Mädchens ausdrückte: Ein strenger Ausdruck spiegelte sich in ihm, und durch die Strenge hindurch blickte ein gewisser Hohn über den verblüfften Schmied und eine kaum merkliche Röte, die ihr der Ärger ins Gesicht getrieben hatte; all das zusammen war so unbeschreiblich schön, daß das Beste, was man hier hätte tun können, dies gewesen wäre: – sie eine Million mal abzuküssen.
»Wie bist du hierhergekommen?« begann Oxana. »Willst du denn, daß ich dich mit der Schippe davonjage? Ihr versteht euch meisterhaft darauf, euch an uns heranzumachen. Im Nu schnüffelt ihr aus, wann die Väter aus dem Hause sind. Oh, ich kenne euch schon! Nun, ist meine Truhe fertig?«
»Sie ist bald fertig, mein Herzchen; nach den Feiertagen wird sie fertig. Wenn du wüßtest, wieviel Mühe ich mir gegeben habe: zwei Nächte lang habe ich die Schmiede nicht verlassen. Dafür soll aber auch keine Popentochter so eine Truhe haben. Ich habe Eisenbeschläge darauf getan, wie ich sie nicht einmal für den Wagen des Hauptmanns nahm, als ich noch in Poltawa auf Arbeit war. Aber wie wird sie erst bemalt sein! Und wenn du die ganze Umgegend mit deinen weißen Füßchen abläufst, du findest solch eine Truhe nicht mehr! Über den ganzen Grund werden rote und blaue Blumen verstreut sein, und es wird so leuchten wie Feuer. Zürne mir nicht! Erlaube mir wenigstens, zu dir zu reden und dich nur anzuschauen!«
»Wer verbietet dir das? Rede und schau!«
Und sie nahm Platz auf der Bank, blickte wieder in den Spiegel und begann ihre Flechten auf dem Kopfe zu ordnen. Sie blickte auf ihren Hals, auf das neue seidenbestickte Hemd, und ein leises Gefühl der Selbstzufriedenheit spiegelte sich auf ihren Lippen und auf ihren frischen Wangen und leuchtete aus ihren Augen.
»Erlaube mir, daß ich neben dir Platz nehme!« sagte der Schmied.
»Setze dich«, sprach Oxana immer noch mit demselben selbstzufriedenen Ausdruck auf den Lippen und in den Augen.
»Wundervolle, herzallerliebste Oxana, erlaube mir nur, daß ich dir einen Kuß gebe!« sagte der Schmied ermutigt und preßte sie an sich, in der Hoffnung, ein Küßchen von ihr zu erwischen. Doch Oxana wandte ihre Wangen ab, die sich schon in erreichbarer Nähe von den Lippen des Schmiedes befanden, und stieß ihn von sich. »Was du nicht alles möchtest! Kaum hat er den Honig, so braucht er gleich auch noch einen Löffel dazu! Geh doch, deine Hände sind noch härter als Eisen. Auch riechst du nach Rauch. Ich glaube gar, du hast mich ganz mit deinem Ruß beschmiert.«
Sie nahm den Spiegel und begann sich von neuem zu putzen.
»Sie liebt mich nicht!« dachte der Schmied bei sich und ließ den Kopf hängen. »Für sie ist alles nur Spielerei; und ich stehe vor ihr da wie ein Narr und kann meine Augen nicht von ihr wenden. Ja, ich möchte immer so vor ihr stehen und meine Augen nicht von ihr wenden. Welch herrliches Mädchen! Was würde ich alles darum geben zu erfahren, was in ihrem Herzen vorgeht und wen sie eigentlich liebt. Aber nein, sie kümmert sich um niemand. Sie freut sich nur ihrer Schönheit, quält mich Armen, und ich bin so traurig, daß mir alles trüb und dunkel erscheint. Und dabei liebe ich sie doch so, wie kein Mensch in der Welt sie je geliebt hat oder lieben wird.«
»Ist es wahr, daß deine Mutter eine Hexe ist?« fragte Oxana und brach in lautes Lachen aus; auch der Schmied fühlte, wie alles in seinem Innern auflachte. Dieses Lachen schien plötzlich in seinem Herzen und in den leise erschauernden Adern widerzuhallen, aber gleich darauf erwachte ein Ärger in seiner Seele, weil er nicht die Macht hatte, dieses so anmutig lachende Antlitz zu küssen.
»Was geht mich meine Mutter an? Du bist mir Mutter und Vater und alles, was es auf der Welt an Teuerem für mich gibt! Wenn mich der Zar zu sich rufen ließe und zu mir sagte: »Wakula, du darfst mich um alles bitten, was es Schönes in meinem Reiche gibt, ich will dir alles geben. Ich will dir eine Schmiede aus purem Golde bauen lassen, und du sollst silberne Hämmer zum Schmieden bekommen,« – dann würde ich zu dem Zaren sagen: »Ich will weder kostbare Edelsteine, noch eine goldene Schmiede, noch dein ganzes Reich. Gib mir lieber meine Oxana!«
»Schau, schau, so einer bist du also! Aber mein Vater ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Paß auf, er heiratet noch deine Mutter!« sagte sie und lächelte listig. »Aber, wo bleiben nur die Mädchen? … Was soll das bedeuten? Es ist schon höchste Zeit, daß man vor den Fenstern zu singen beginnt. Ich fange an, mich zu langweilen.«
»Mögen sie nur bleiben, wo sie sind, du meine Holde!«
»Warum nicht gar! Mit den Mädchen werden auch wohl die Burschen mitkommen. Da wird’s was geben. Ich stell’ mir vor, was für putzige Sachen sie da erzählen werden!«
»Du sehnst dich also wohl nach ihrer Gesellschaft?«
»Sicherlich mehr als nach dir. Ah! Jemand hat geklopft. Das sind wohl die Mädchen und Burschen.«
»Worauf soll ich noch länger warten?« sprach der Schmied zu sich selbst. »Sie macht sich über mich lustig. Ich bin ihr ebensoviel wert wie ein verrostetes Hufeisen. Wenn das aber wirklich so ist, dann soll wenigstens kein anderer über mich lachen. Sobald ich merke, daß ein anderer ihr besser gefällt als ich, dem will ich doch gleich …«
Hier wurden seine Gedanken durch ein Pochen an die Tür unterbrochen, und eine Stimme, die bei dem kalten Frost ziemlich scharf klang, rief: »Mach’ auf!« »Warte, ich mache schon selbst auf«, sagte der Schmied und trat in den Flur hinaus mit dem Vorsatz, dem ersten, der hereinkäme, aus Ärger die Rippen einzuschlagen.
Der Frost nahm zu, und oben in der Höhe wurde es so kalt, daß der Teufel von einem Huf auf den andern hüpfte und sich in die Fäuste blies, um nur einigermaßen seine frierenden Hände zu erwärmen. Es war auch kein Wunder, wenn’s einen fror, der sich Tag für Tag in der Hölle herumdrückte. Dort ist’s bekanntlich längst nicht so kalt wie bei uns im Winter, er aber steht da unten vor dem Feuer, mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf, akkurat wie ein wirklicher Küchenmeister, und brät die Sünder mit solchem Vergnügen, wie wohl die Weiber zu Weihnachten Wurst braten.
Selbst die Hexe litt unter der Kälte, trotzdem sie recht warm angezogen war; daher hob sie die Arme in die Höhe, schob ein Bein vor, gab ihrem Körper die Haltung eines Schlittschuhläufers und sauste, ohne ein Glied zu rühren, durch die Luft, wie wenn’s einen steilen Eisberg hinabginge, geradeswegs in den Schornstein hinunter.
Der Teufel folgte ihr auf dieselbe Art. Da dieses Vieh aber viel gewandter ist als so mancher Geck in Seidenstrümpfen, so ist’s kein Wunder, daß er grad am Eingang zum Schornstein seiner Geliebten auf den Hals flog, und schnell sahen sich die beiden in dem geräumigen Ofen mitten unter den Töpfen.
Die Besenreiterin schob leise das Ofentürchen auf, um zu sehen, ob ihr Sohn Wakula sich nicht die Stube voller Gäste geladen hatte; als sie aber sah, daß niemand da war außer etwa ein paar Säcken, die in der Stube umherlagen, so kroch sie aus dem Ofen, warf den warmen Pelz ab, ordnete ihre Kleidung, und niemand hätte ihr mehr ansehen können, daß sie noch vor einer Minute auf einem Besenstiel geritten war.
Die Mutter des Schmieds Wakula war nicht mehr als vierzig Jahre alt und war weder schön noch häßlich. Es ist ja auch ziemlich schwer, in diesen Jahren schön zu sein. Sie verstand es aber, selbst die gesetztesten und würdigsten Kosaken an sich zu fesseln (denen es, nebenbei bemerkt, auch wenig um die Schönheit zu tun war), so daß sie ebensowohl der Amtmann wie der Küster Ossip Nikiforowitsch (natürlich, wenn die Frau Küsterin nicht zu Hause war), der Kosak Kornij Tschub und der Kosak Kassjan Swerbygus aufzusuchen pflegten. Zu ihrer Ehre muß übrigens gesagt werden, daß sie es vorzüglich verstand, mit ihnen umzugehen: keinem einzigen von ihnen kam es auch nur von ferne in den Sinn, er könne einen Nebenbuhler haben. Ging ein frommer Bauer oder ein »Edelmann«, wie die Kosaken sich selbst zu nennen pflegen, am Sonntag in seinem Mantel mit der Kapuze zur Kirche, oder – wenn das Wetter schlecht war – ins Wirtshaus, so ließ er sich’s nicht nehmen, bei der Ssolocha vorzusprechen, um ein paar fette Käsekrapfen mit Rahm zu essen und ein Weilchen mit der gesprächigen und gefälligen Hausfrau in der warmen Stube zu schwatzen. Der Edelmann machte eigens zu diesem Zweck einen großen Umweg, bevor er im Wirtshaus anlangte – und nannte das »unterwegs mal vorsprechen«. Oder ging die Ssolocha einmal an einem Festtag, in ihrem grellen Kopftuch und ihrem Nankingkittel und dem blauen Rock darüber, der hinten mit goldenen Bändern benäht war, zur Kirche, und stellte sie sich gerade neben dem rechten Chor auf, so fing der Küster sicherlich an zu hüsteln und blinzelte unwillkürlich nach jener Seite hinüber; der Amtmann aber strich sich den Schnurrbart, wickelte sich seine Kosakenlocke ums Ohr und sprach zu dem neben ihm stehenden Nachbarn: »Ei, ei, das ist mir ein Weibsbild! Ein ganz verteufeltes Weib!« Die Ssolocha pflegte denn auch jeden Menschen zu grüßen, und jeder glaubte, sie grüße ihn allein.
Aber wer es liebte, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen, der konnte sofort merken, daß die Ssolocha am freundlichsten gegen den Kosaken Tschub war. Tschub war Witwer. Vor seinem Hause standen stets acht Schober Getreide, zwei Paar mächtige Ochsen streckten beständig ihre Köpfe durch das Geflecht des Schuppens auf die Straße hinaus und brüllten jedesmal, wenn sie eine Muhme oder einen Ohm, das heißt eine Kuh oder einen dicken Bullen kommen sahen. Ein bärtiger Bock kletterte hoch auf das Dach hinauf und meckerte mit einer gerade so schrillen Stimme von dort herab wie der Bürgermeister, um die auf dem Hofe umher stolzierenden Truthähne zu reizen, oder er kehrte seinen Hintern hervor, wenn er seine Feinde, die Dorfjungen, erblickte, die sich über seinen Bart lustig zu machen pflegten. In Tschubs Truhen lagen viele Ellen Leinwand, teure Schupans und altertümliche Röcke mit Goldborden: seine verstorbene Frau war nämlich sehr putzsüchtig gewesen. In seinem Gemüsegarten gab es außer Mohn, Kohl und Sonnenblumen auch noch zwei Beete mit Tabak. Von all dem, meinte die Ssolocha, wäre es ganz nett, wenn es ihrer eigenen Wirtschaft einverleibt würde; sie rechnete schon im voraus damit, welche Ordnung sie einführen wollte, wenn all das in ihre Hände gelangen würde, und daher verdoppelte sie ihr Wohlwollen gegen den alten Tschub. Damit aber ihr Sohn Wakula sich nicht an seine Tochter heranmachte, alles Hab und Gut selbst einheimste und ihr dann am Ende nicht mehr erlaubte, sich in irgend etwas einzumischen, so griff sie nach dem üblichen Mittel aller vierzigjährigen Weiber, das heißt, sie säte möglichst viel Fehde zwischen Tschub und dem Schmied. Vielleicht waren gerade diese Ränke und Listen der Grund davon, daß die alten Weiber, besonders wenn sie in fröhlicher Gesellschaft zusammen saßen und etwas über den Durst getrunken hatten, davon munkelten, die Ssolocha sei wirklich eine Hexe: der Bursche Kisjakolupenko habe hinten bei ihr einen Schwanz gesehen, der ungefähr so lang gewesen sei wie eine Weiberspindel; am verflossenen Donnerstag erst sei sie in Gestalt einer schwarzen Katze über die Straße gelaufen; auch sei einmal eine Sau zur Popenfrau gerannt gekommen, habe wie ein Hahn gekräht, dann sich die Mütze des Vaters Kondrat aufgesetzt und sich darauf wieder davongemacht…